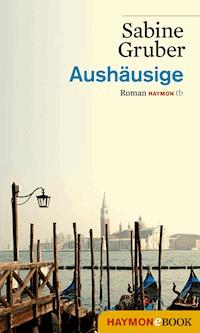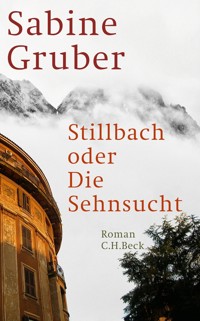17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag C.H. Beck oHG - LSW Publikumsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Die Übersetzerin Renata verliert jäh ihren Lebensgefährten und wird mit gänzlich unerwarteten Konflikten konfrontiert. Sie muss sich außerdem selbst ins Leben zurückkämpfen und die Frage beantworten, ob Konrad, ihr Partner, Geheimnisse vor ihr hatte? Sabine Grubers Roman Die Dauer der Liebe ist ein ergreifendes, gelegentlich zorniges und manchmal auch komisches Buch. Ein morgendliches Klopfen an der Tür zu ihrer Wiener Wohnung, die Übersetzerin Renata Spaziani öffnet, und die Nachricht, die ihr ein Polizist überbringt, ändert alles: Konrad Grasmann, mit dem sie die letzten fünfundzwanzig Jahre zusammengelebt hat, die Liebe ihres Lebens, ist, erst Anfang sechzig, schon am vorigen Tag auf einem Parkplatz gestorben. Seine Herkunftsfamilie war verständigt worden, Renata aber nicht. Und während sie den Schock des jähen Endes ihrer innigen Partnerschaft verkraften muss, Konrad am liebsten nachsterben will und sich doch ins Leben zurückkämpft, muss sie aushalten, dass Konrads Familie diese Partnerschaft nicht respektiert. Renata und Konrad waren nicht verheiratet, ihr Gefährte hat kein rechtsgültiges Testament hinterlassen. Renata wird doppelt beraubt ... Bei den Erinnerungen an Konrad, einem Architekten und Fotokünstler, bei den Aufräumarbeiten und Auseinandersetzungen mit seiner Familie stößt Renata auf Ungereimtheiten in seinem Leben. Hat er ihr etwas verschwiegen? Ihren Erlebnissen mit Konrad und seinen ästhetischen Vorlieben nachspürend und gestützt von ihren Freunden, fasst Renata allmählich wieder Fuß in einem Dasein, das sie nun neu, anders entwerfen muss. Wer soll dazu gehören? Ergreifend, poetisch und klug, gelegentlich zornig und auch komisch erzählt Sabine Gruber in «Die Dauer der Liebe» davon, wie es ist, ohne den anderen weiterleben zu müssen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Sabine Gruber
Die Dauer der Liebe
Roman
C.H.Beck
Zum Buch
Ein morgendliches Klopfen an der Tür zu ihrer Wiener Wohnung, die Übersetzerin Renata Spaziani öffnet, und die Nachricht, die ihr ein Polizist überbringt, ändert alles: Konrad Grasmann, mit dem sie die letzten fünfundzwanzig Jahre zusammengelebt hat, die Liebe ihres Lebens, ist, erst Anfang sechzig, am Tag zuvor auf einem Parkplatz gestorben. Seine Herkunftsfamilie war verständigt worden, Renata aber nicht. Und während sie den Schock des jähen Endes ihrer innigen Partnerschaft verkraften muss, Konrad am liebsten nachsterben will und sich doch ins Leben zurückkämpft, muss sie aushalten, dass Konrads Familie diese Partnerschaft nicht respektiert. Renata und Konrad waren nicht verheiratet, ihr Gefährte hat kein rechtsgültiges Testament hinterlassen. Renata wird doppelt beraubt …
Bei den Erinnerungen an Konrad, einem Architekten und Fotokünstler, bei den Aufräumarbeiten und Auseinandersetzungen mit seiner Familie stößt Renata auf Ungereimtheiten in seinem Leben. Hat er ihr etwas verschwiegen? Ihren Erlebnissen mit Konrad und seinen ästhetischen Vorlieben nachspürend und gestützt von ihren Freunden, fasst Renata allmählich wieder Fuß in einem Dasein, das sie nun neu, anders entwerfen muss. Wer soll dazu gehören? Ergreifend, poetisch und klug, gelegentlich zornig und auch komisch erzählt Sabine Gruber in «Die Dauer der Liebe» davon, wie es ist, ohne den anderen weiterleben zu müssen.
Über die Autorin
Sabine Gruber lebt als freie Schriftstellerin in Wien. Von 1988–1992 war sie Universitätslektorin in Venedig. Für ihr Werk, Erzählungen, Gedichte, Hörspiele und Theaterstücke sowie ihre Romane «Aushäusige», «Die Zumutung» (C.H.Beck, 2003), «Über Nacht» (C.H.Beck, 2007), «Stillbach oder Die Sehnsucht» (C.H.Beck, 2011) und «Daldossi oder Das Leben des Augenblicks» (C.H.Beck, 2016) erhielt sie zahlreiche Preise und Stipendien, u.a. den Priessnitz-Preis 1998, den Förderungspreis zum österreichischen Staatspreis 2000, das Elias-Canetti-Stipendium der Stadt Wien 2004, den Anton Wildgans-Preis 2007 und das Robert Musil-Stipendium 2009, den Veza Canetti-Preis der Stadt Wien 2015, den Österreichischen Kunstpreis für Literatur 2016 und den Preis der Stadt Wien für Literatur 2019. Sabine Gruber war mit «Über Nacht» für den Deutschen und mit «Daldossi oder Das Leben des Augenblicks» für den Österreichischen Buchpreis nominiert.
Für Wolfgang Fetz (1958–2022)
Penso che forse a forza di pensarti potrò dimenticarti, amore mio.
Patrizia Cavalli
Es klopft, Renata sitzt am offenen Fenster, die Platanenblätter versperren den Blick zum Kanal. Um diese Zeit erwartet sie niemanden, sie steht nicht auf, geht nicht zur Tür. In einem großen Haus mit vielen Wohnungen wird ständig renoviert und umgebaut.
Sie hört das Rauschen des Verkehrs. Wenn die Ampel auf Grün schaltet, sind manche Motoren lauter als andere; Renata hat sich an das Aufheulen gewöhnt, wenn die Fahrer aufs Gas treten, kurz beschleunigen, um dann – keine hundert Meter später – wieder abzubremsen, weil der nächste Fußgängerübergang wartet.
Stimmen von Passanten dringen an ihr Ohr, sie hört ein Kind weinen, die Schreie der beiden Krähen, die wieder zwei Junge durch den Frühling und Frühsommer gebracht haben, hört die Hunde der Pensionisten bellen, deren Herrchen sich jeden Morgen vor dem Haus treffen.
Obwohl der Tag erst angebrochen ist, hat der Himmel schon eine blaue Farbe. Es ist ein Spätsommerblau, das in der Stadt selten so kräftig und so klar ist wie auf dem Land.
Renata liebt es, während der Arbeit mit ihrem Blick in die Himmelsöffnung zwischen den Häusern am Platz zu tauchen. Jeden Tag, selbst bei gleichbleibendem Wetter, zeigt sie eine andere Farbnuance. Himmelschwimmen nennt sie dieses Abschweifen, das gleichzeitig Sammlung bedeutet.
Doch jetzt steht sie auf, schließt das Fenster, zieht die Rollos herunter, um die Sonne auszusperren, obwohl sie weiß, daß sich die Nachtkühle nicht lange halten wird.
Im Bett nebenan schläft ihre Nichte Pauline. Wie jedes Jahr verbringt sie einen Teil ihrer Ferien in der Großstadt, sie liebt die Wiener Bäder und die italienischen Eissalons.
Renata hat schon die Wäsche sortiert, die Handtücher ausgetauscht, das Waschbecken gereinigt und die Rasierschaumdose, die seit zwei Tagen am Beckenrand steht, im Allibert verstaut.
Sie setzt sich an den Schreibtisch, nur mit einem dünnen, ärmellosen T-Shirt bekleidet. Direkt vor ihr hängt ein Bild, das sie vor vielen Jahren von Konrad geschenkt bekommen hat. Ein Blick in Das Innere von Genua, eine Photozeichnung, beherrscht von realen und mit Stiften eingefügten Straßen, Zufahrtsrampen, Wendeltreppen, die aus dem ausgehöhlten Stadtberg ins Nirgendwo oder nach oben in die Altstadt zu führen scheinen. Die Serie hat Konrad, kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten, bei der Expo 1992, den Celebrazioni Colombiane, ausgestellt.
Es klopft wieder. Noch immer bleibt Renata sitzen, starrt auf das Bild, ohne es zu sehen. Sie könnte es auswendig nachzeichnen, so oft hat sie es angeschaut. Der Berg schafft in seinem Inneren den Platz, den das Land nicht hergeben kann: übereinander angelegte Garagen, Tunnelöffnungen, Schächte für Lichteinfälle und den Personentransport.
Das Sternparkett ist alt und knarrt unter den Füßen. Renata will Paulines Schlaf nicht stören.
Sie beantwortet Mails, liest die Nachrichten, öffnet ihre Arbeitsdatei. Noch zwei Kapitel, dann ist sie mit der Rohfassung durch und kann sich nach den Schriften von Teodoro Pontoni über Architektur wieder der Übersetzung von Gedichten widmen, bis der nächste Auftrag hereinkommt.
Wenn Konrad aus Innsbruck zurückkehrt, wird sie ihm die neu übersetzten Passagen vorlesen. Obwohl er wenig schreibt und liest, hat er ein feines Gehör für Wörter und ihre Bedeutung. Manchmal ist ihm das Deutsche geläufiger als Renata, deren Muttersprache zwar Deutsch, deren Vatersprache aber Italienisch ist. Zu Hause hatten sie, war der Vater da, Italienisch gesprochen. Seine Familie stammt mehrheitlich aus Rom und dem Latium, ihm und seinen in Bozen lebenden Verwandten fällt es schwerer, deutsch zu reden als dem deutschen Teil der Familie italienisch.
Auf der Straße vor dem Haus ist das Piepen eines zurücksetzenden Lastwagens zu hören.
Dann schlägt jemand, dieses Mal mit Kraft, gegen die Wohnungstür.
Renata streift sich das blickdichte, kurzärmelige Kleid über, das im Badezimmer auf der Waschmaschine liegt, und öffnet.
Sind Sie Frau Spaziani?
Konrads Moto Guzzi, denkt Renata, jemand hat sie umgeworfen oder ist dagegengefahren. Das war schon einmal passiert.
Kennen Sie mich nicht? fragt der Polizist. Hier im Bezirk kennt man mich. Und ohne Renatas Antwort abzuwarten, fragt der Uniformierte: Sagt Ihnen der Name Konrad Grasmann etwas?
Das ist mein Lebensgefährte.
Darf ich hereinkommen? Es ist etwas Schlimmes passiert.
Warum sollte ich diesen Polizisten kennen, denkt Renata. Und gleichzeitig fragt sie sich: Was hat Konrad angestellt? Und warum Konrad? Undenkbar, daß er jemandem Schaden zugefügt hat. Plötzlich fällt ihr ein, daß man Konrad umgebracht haben könnte. Aber warum sollte ihn jemand umgebracht haben, aus welchem Grund. Er ist bestimmt nur verletzt.
Herr Grasmann ist gestern gestorben, hört Renata den Mann sagen. Es tut mir leid, Ihnen das mitteilen zu müssen. Seltsam, daß Sie mich nicht kennen, sagt der Polizist nach einer kurzen Pause. Sie wohnen doch schon lange da. Alle kennen mich.
Der Mann steht mit beiden Füßen in der Wohnung und ist doch nicht hier, denn die Tür ist noch offen, und er ist nur einen Schritt vom Stiegenhaus entfernt.
Renata löscht das Gehörte in ihrem Kopf, aber während sie es löscht, hört sie es wieder. Sie sieht den Mann an. Er steht noch immer da.
Was hat der Mann gesagt, denkt Renata.
Sie vergißt, gleichmäßig zu atmen. Herr Grasmann ist gestern gestorben.
Warum sollte Renata diesen Mann kennen.
Ich war schon gestern Abend hier, hört sie den Polizisten sagen, Sie haben aber nicht geöffnet.
Gestern Abend, wiederholt Renata. Sie weicht ein paar Schritte zurück, läßt den Mann nicht aus den Augen, hält sich am Schuhkasten fest.
Was ist mit Konrad, fragt sie leise. Zwei Zimmer weiter schläft Pauline, Renata will nicht, daß sie aufwacht.
Ich war mit meiner Nichte Eis essen.
Herr Konrad Grasmann ist auf einem Parkplatz zusammengebrochen.
Renata bleibt an der Tür stehen, nachdem der Polizist gegangen ist. Sie blickt auf ihre Hand. Die Hand hat die Wohnungstür geschlossen. Die Hand liegt auf der Klinke. Die Hand klammert sich fest, dann löst sie sich, bedeckt zusammen mit der anderen Hand ihr Gesicht.
Hinter den Fingern ist es hautdunkel, aber nicht dunkel genug. Renata möchte einen Schrei ausstoßen, aber sie ist still, um Pauline nicht zu erschrecken. Sie schiebt die Laute in den Kehlkopf zurück, preßt die Lippen aufeinander.
In Renatas Gedanken ist der Autobahn-Parkplatz schlecht beleuchtet, es riecht nach Pisse. Die Müllbehälter sind voll mit Plastikflaschen. Im Gras liegen zusammengeknüllte Zigarettenschachteln. Eine Frau zieht einem kleinen Mädchen die Unterhose runter, hält sein Kleid in die Höhe.
Geh in die Hocke. Nicht auf meine Füße!
Auf Renatas Parkplatz stehen Autos, Wohnmobile, Kleinlastwägen. Der Löwenzahn blüht auf der Wiese. Ein Mädchen schlägt ein Rad und kippt nach vorne ins Gras.
Auf Renatas Parkplatz ist niemand. Ein Wagen hält an. Ein Mann öffnet die Tür, um Luft zu schnappen. Der Mann schafft es nicht mehr, aus dem Auto zu steigen.
Auf dem Parkplatz steht nur ein roter Mini. Ein zweites, silbergraues Auto fährt vor, stellt sich dazu. Der Fahrer öffnet die Tür, steigt aus. Es ist Konrad, er lehnt sich mit dem Bauch gegen den Saab, hebt die Arme in die Höhe, als stünde ein Bewaffneter hinter ihm und befähle ihm, die Hände hochzuhalten; er legt die Unterarme aufs Autodach, drückt den Kopf gegen das Blech.
Der Besitzer des Minis kommt von der Toilette zurück, sieht, wie Konrad langsam in die Knie geht, entlang der Fahrertür des silbergrauen Saab auf den Boden sackt.
Auf Renatas Parkplatz steht Konrad und raucht eine Zigarette. Er ruft Renata an. Guten Morgen, tesoro mio. Hast du gut geschlafen? Was macht die Kleine?
Das Mobiltelephon ist schwarz. Es liegt auf dem Schuhkasten. Es sieht aus wie eine glänzende Miniaturmarmorplatte.
Warum war Konrad auf diesem Parkplatz? Wo ist er jetzt?
Ruf mich an. Konrad!
Du bist stärker als ich, hatte Konrad einmal zu Renata gesagt. Deshalb muß ich vor dir sterben. Ich könnte es nicht aushalten, dich zu verlieren. Ich bin nicht stärker, denkt Renata.
Warum erfahre ich erst heute, daß Konrad gestern gestorben ist? Sie haben nicht geöffnet, hat der Polizist gesagt. Ich bin zweimal da gewesen.
Aber jemand hätte mich doch anrufen können.
Renata wählt Gundas Nummer. Das Mobiltelephon von Konrads Schwester ist ausgeschaltet. Auch Konrads Mutter hebt nicht ab. Marcel, der jüngere Bruder, besitzt zwar ein Mobiltelephon, hat es aber selten an.
Auf dem handgeschriebenen Zettel, den der Polizist auf dem Schuhkasten abgelegt hat, steht die Telephonnummer der Bezirkshauptmannschaft Schwaz, Land Tirol. Für Details, hat der Mann gesagt. Ob er sie jetzt allein lassen könne?
Renata ist nicht allein.
Zwei Stunden später fährt sie mit Pauline nach Innsbruck, wo das Kind von Renatas Schwester am Bahnsteig abgeholt wird, damit Renata unverzüglich nach Schwaz weiterreisen kann, um Konrad zu sehen, bevor man ihn zur Bestattung nach Wien überstellen würde.
Um Konrads Geschwister Gunda und Marcel in Innsbruck zu treffen.
Um seine Mutter zu sprechen.
Um den Besitzer des roten Minis ausfindig zu machen – Konrads letzten Lebenszeugen.
Pauline schaut die Fahrt über mit unbeweglichem Gesicht aus dem Zugfenster. Sie weint nicht, spricht nicht.
Mein tapferes Mädchen, denkt Renata und streicht ihr übers Haar. Vielleicht schiebt auch Pauline die Wörter in den Kehlkopf zurück, beißt ihnen die Köpfe ab.
*
Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt, fragt Marianne beim Essen.
Bruno, sagt Konrad, hat mich zum Abendessen eingeladen und von einer Freundin erzählt, die auch kommen würde. Ich bin viel zu spät gewesen, habe Brunos Wohnung betreten, Renata gesehen und sofort gewußt: Ich will, daß sie meine Frau wird.
Das kann man doch nicht wissen, sagt Marianne, man kann es sich höchstens einreden.
Meine Gefühle wissen das, sagt Konrad.
Wir lieben, was wir zu lieben denken, sagt Marianne. Alles ist schon in den Büchern ausgedacht, vorformuliert. Sie lacht. Erst ist es Ars, dann Farce amandi. Oder etwa nicht? Bruno, was sagst du dazu?
Mich fragst du das? Er steht auf und sammelt die schmutzigen Teller ein. Hilfst du mir mal, sagt er zu Marianne und macht eine Kopfbewegung Richtung Küche.
Konrad faßt nach Renatas Hand, führt sie zu seinem Mund. Er zupft mit den Schneidezähnen an ihrer Handrückenhaut, nähert sich Renatas Ohr: Ich hätte jetzt Lust, dich zu vögeln, sagt er so leise, daß Marianne und Bruno es nicht hören können.
*
Renata und Konrad sind zu Besuch bei Henriette, Konrads Mutter. Sie dürfen das Haus nicht verlassen.
Konrads Elternhaus steht am Stadtrand, es ist ein Ein-Familien-Häuschen, das aussieht, als sei es erst vor kurzem gebaut worden, dabei ist es fast fünfundsechzig Jahre alt. Der Putz ist makellos, die Jalousien glänzen. In Sichtweite stehen die letzten Bauernhäuser, die noch nicht dem städtischen Wohnbau weichen mußten. Manfred, Konrads Vater, hatte das Haus innen und außen selbst verputzt, auch alle Malerarbeiten nach und nach allein erledigt. Die ersten zwei Jahre lebten die Grasmanns im Parterre, für die Fassade und den Ausbau des oberen Stockwerks fehlte das Geld.
Seit den frühen Morgenstunden bereitet Henriette in der Küche das Mittagessen zu.
Wenn Konrad nach Hause fährt, werden ihm unsichtbare Fußfesseln angelegt. Der ansonsten so freie Mann steht dann in ständigem Kontakt mit der Basisstation Mama. Geht er doch einmal aus dem Haus, weiß Henriette alles: wen er trifft, was er tut, wann er wiederkommt. Wenn er sich längere Zeit außerhalb ihrer Reichweite befindet, ruft sie ihn an und bittet ihn, einen Liter Milch oder irgendein anderes Lebensmittel zu besorgen, das gerade fehlt. Fehlt nichts, erfindet Henriette etwas.
Kommt Konrad fünf Minuten zu spät zum Mittagessen, rechtfertigt er sich. Seine Mutter füllt schweigend die Teller. Seit Konrads Vater nicht mehr ist, immer Konrads zuerst. Konrad kriegt das größte Stück Fleisch. Sind alle Geschwister da, bekommt das zweitgrößte Stück Marcel. Gunda muß schauen, was übrigbleibt.
Henriette hat als Kind erst den Löffel in die Muspfanne stecken dürfen, nachdem der Vater von dem Mus gegessen hatte. Sie hatte vier Geschwister, die inzwischen alle gestorben sind, keines traute sich auch nur, nach dem Löffel zu greifen, bevor der Vater zu essen angefangen hatte.
Er aß einen Löffel Mus, dann wartete er, bis die auf dem Mus zerlassene Butter in die Kuhle geronnen war. Manchmal half er nach, indem er die Pfanne schräg hielt.
War eines der Kinder dennoch einmal vorschnell, schlug der Vater ihm mit seinem Löffel auf den Handrücken oder den Kopf.
Jedesmal, wenn Henriette im Haus Geräusche hört, hofft sie, Konrad würde nun endlich beim Frühstück erscheinen. Jedesmal erhitzt sie die Milch von neuem.
Sie versucht, die Milchhaut mit dem Schneebesen aufzulösen, aber in der Tasse treiben kleine Fetzen.
Renata trinkt den Kaffee schwarz. Schon um neun Uhr morgens riecht es in der Küche nach angerösteten Zwiebeln.
Um keinen Streit mit Konrad zu provozieren, hat Renata gelernt zu schweigen. Wenn sie spricht, gerät Konrad zwischen die Fronten. Renata macht den Mund auch dann nicht auf, wenn Konrads Mutter zu beten beginnt.
Segne, Vater, dieses Morgenmahl, segne, Vater, unser Brot.
Konrads Mutter vergißt, daß sie betet, sie hat nur Renata im Blick. Sie leiert die Sätze herunter: Laß uns jene nicht vergessen, die da hungernd sind in Not. Amen.
Du glaubst einen Scheißdreck, sagt sie nach dem Frühstück zu Renata, während sie den Abwasch macht. Sie legt die Kaffeetassen in heißes Wasser und reibt die kleinen Teller ab, bevor sie alles in die Spülmaschine räumt.
Konrad schiebt Renata aus der Küche.
In den Augen von Konrads Mutter ist Renatas T-Shirt zu weit ausgeschnitten, ein anderes Mal regt sie sich über ihr kurzes Kleid auf. Sie bemerkt den Nagellack auf Renatas Zehen, ihre rasierten Beine und das Make-up; sie sieht sofort, wenn Renata keinen BH trägt. Dieses Mal fordert sie Renata auf, ihr langes Haar hochzustecken oder zusammenzubinden.
Wie Maria Magdalena, flüstert Konrads Mutter zu Blanka, der Zugehfrau, gewandt, aber so, daß Renata es hört.
Das Unsittliche lauert überall, es findet sich vor allem an Renata, aber stärker noch haftet es Konrads Verflossenen an, die Henriette vor Konrad und Renata allesamt als Schlampen bezeichnet. Hannah, Konrads Freundin in der Studienzeit, hatte sie sogar einmal als Drecksschlampe bezeichnet.
Die Freundinnen haben mit ihrem unehelichen Geschlechtstrieb ihren Konrad verdorben, und diese Verderbnis setzt Renata nun fort.
Wann immer sie kann, verläßt Renata das Grasmann-Haus, spaziert Richtung Zentrum. Sie geht an der Haltestelle Großer Gott vorbei, biegt in die Schneeburggasse ein, dann in den Speckweg. Nach der Kehre, auf der Sonnenstraße endlich, hat sie freien Blick auf die Stadt, auf den Patscherkofel und die Serles. Die Sonnenstraße ist Renatas Erleichterungsstraße, an dieser Stelle läßt das Gefühl der Beklemmung nach, sind Henriettes Worte nur noch tonlose Bewegungen ihrer Lippen. An dieser Stelle verstummt deren aufgesetzte sorgenvolle Stimme, erreichen sie Henriettes Blicke nicht einmal mehr in der Erinnerung.
Manchmal macht Renata einen Abstecher in den Botanischen Garten, in dem neben den Pflanzen die Schilder aus dem Boden wachsen. Auch in der Altstadt gibt es keinen Brunnen und kein Gebäude mehr, die nicht mit einer Tafel versehen sind.
*
Riech einmal, sagt Renata zu Konrad. Sie hält ihm ein Stück Seife unter die Nase. Woran erinnert dich dieser Duft?
Keine Ahnung, sagt Konrad, ich rieche nichts. Er nimmt Renata die Seife aus der Hand, schnuppert daran.
Doch – sehr dezent; ich weiß nicht, was es ist, sagt Konrad. Woher hast du die?
Von Marianne, es ist eine Schafmilchseife, ihr Dermatologe hat sie selbst entwickelt. Sie erinnert mich an dich.
An mich?
Moschus-, sagt Renata, und etwas Kastanienblütenduft. Wie dein Sperma.
Darauf wäre ich nicht gekommen, sagt Konrad. Wenn wir einmal knapp bei Kasse sind, könnte ich also meine Samenflüssigkeit an die Kosmetikindustrie verkaufen?
*
Renata ist bei Konrads Innsbrucker Freunden angekommen. Leonhard arbeitet als Chirurg an der Universitätsklinik. In der Saggener Gründerzeitvilla, die Konrad 2012 behutsam renoviert und umgebaut hat, hängen mehrere frühe Photographien und Zeichnungen von ihm, auch Photozeichnungen aus der Genueser und Pontinischen Serie.
Leonhards Frau Elsbeth ist Scheidungsanwältin. Sie nimmt Renata in die Arme. Ich sitze morgen leider in einer Verhandlung. Ich kann mich nicht um dich kümmern.
Das brauchst du nicht, sagt Renata.
Ihr wart nicht verheiratet? Keine eingetragene Partnerschaft? fragt Elsbeth.
Das weißt du doch.
Testament?
Ja. Hat Konrad schon vor Jahren aufgesetzt. Du weißt doch, wie sehr er an seinen Photozeichnungen hing.
Hast du es dabei?
Nein, ich habe noch nicht nachgesehen. Er hat es sicher abgespeichert.
Elsbeth schiebt ihre Lesebrille in das Etui, schüttelt den Kopf.
Nicht dein Ernst, sagt sie. Ihr lebt nicht auf dieser Welt, oder?
Elsbeth legt das Lederetui neben die Teetasse. Sie tritt ans Fenster.
Siehst du die Frau da draußen auf dem Zufahrtsweg?
Renata stellt sich neben Elsbeth. Woher soll ich die kennen. Was ist mit der?
Elsbeth sieht Renata an. Genauso viele Rechte hast du.
Aber wir waren doch fünfundzwanzig Jahre zusammen. Und es gibt einen unterschriebenen Ausdruck des Testaments. Zählt der etwa nicht?
Elsbeth kehrt Renata jetzt den Rücken zu, geht zum Glastisch und nimmt eine welk gewordene Rose aus der Vase.
Es wäre besser gewesen, ihr hättet geheiratet, sagt Elsbeth.
Er wollte mich immer heiraten, aber die Ehe ist doch unmöglich für eine Frau, die selbständig ist. Renata schiebt eine Haarsträhne hinters Ohr. Hätten wir ein Kind bekommen, ich wäre einverstanden gewesen. Um des Kindes willen.
Schade, daß es nicht geklappt hat, sagt Elsbeth. Ich erinnere mich, wie traurig Konrad über sein katastrophales Spermiogramm gewesen war. – Er hätte das Testament bei einem Notar hinterlegen oder es zumindest mit der Hand schreiben müssen.
Es ist, wie es ist. Es läßt sich nicht mehr ändern, sagt Renata und starrt die Rosen an. Es ist was es ist/sagt die Liebe.
Es war leichtsinnig, sagt Elsbeth.
Renata lacht auf. Es ist Unglück/sagt die Berechnung.
Wie meinst du das? Elsbeth wischt mit dem Geschirrtuch die Wasserflecken weg, die der tropfende Rosenstengel hinterlassen hat.
Es ist nichts als Schmerz/sagt die Angst/ Es ist aussichtslos/sagt die Einsicht/Es ist was es ist/sagt die Liebe.
Ach so. Du meinst dieses Gedicht, sagt Elsbeth.
Renata schließt die Augen, ihre Lider flattern, und Elsbeth drückt sie an sich.
Pauline ist wach im Bett gelegen, erzählt Renata. Sie muß etwas gehört haben, sie rührte sich nicht. Normalerweise springt sie gleich aus den Federn. Ich habe mich sofort um sie gekümmert, habe sie festgehalten.
Wie sagt man es einem Kind, fragt Elsbeth.
Ich weiß nicht, wie man es einem Kind sagt, ich weiß nicht einmal, wie ich es mir selbst sagen soll. – Ob ich stark genug sei, hat mich der Polizist gefragt. Er hat mir seine Visitenkarte in die Hand gedrückt und ist dann gegangen.
Du hast es von einem Polizisten erfahren?
Erst heut in der Früh, sagt Renata.
Elsbeth geht in die Küche und wirft die Rose weg. Warum hat dich seine Schwester nicht angerufen? Gunda hat uns noch gestern Abend mitgeteilt, daß Konrad –
Daß er gestorben ist, sagt Renata. Mir hat sie es nicht gesagt.
Wir haben dich auch nicht angerufen, aber es war schon so spät, als wir es erfuhren, sagt Elsbeth.
Eine Stunde später bringt Leonhard Renata zu Konrads Mutter nach Sadrach. Blanka umarmt sie, Konrads Mutter dreht sich weg.
Du hast dich nicht genug um ihn gekümmert, sagt Henriette.
Renata steht in der Küchentür. Es riecht nach scharfem Putzmittel.
Hör nicht hin, sie ist eine alte Frau, sagt Gunda im Vorbeigehen.
Leonhard fährt zurück in sein Saggener Haus, er ist müde von der langen Schicht am OP-Tisch, muß sich hinlegen.
Gunda bittet Renata, Kerzen für die Aufbahrung zu besorgen. Sie kann den Saab benützen, er steht vor dem Haus.
Doch nachdem Renata die Fahrertür aufgesperrt hat, wird ihr schwindelig. Sie weiß, sie kann ihren Sinnen nicht mehr trauen. Die Bäume im Garten sehen nicht mehr wie gewöhnliche Bäume aus, die Lampen am Hauseingang und über dem verschlossenen Scheunentor nicht mehr wie Beleuchtungskörper. Daß sie noch immer da sind, wohingegen Konrad nicht mehr existiert, macht aus ihnen etwas Lebendiges, nahezu Feindliches. Renata empfindet Wut über deren Fortbestand.
Dieses Wachsen, die Windbewegungen in den Ästen, das Lichtversprechen – als wäre nichts geschehen.
Als sich Renata endlich auf dem Fahrersitz niederläßt, zuckt sie zusammen.
Sie klappt die Armlehne hoch, tastet das Innere des Türfachs ab. Dann erst versteht sie: Hier ist nichts mehr. Keine einzige CD. Renata greift ins Handschuhfach, alles weg: Konrads Sonnenbrille, das Klappmesser, mit dem sie auf Reisen die Brote auseinandergeschnitten haben; sogar der Pyrit, Konrads Glücksbringer, den er in einer aufgelassenen Eisenmine auf Elba gefunden hatte, ist verschwunden. Nur der Werbekugelschreiber, mit dem sie beide die letzten Monate die Parkzettel ausgefüllt haben, liegt noch in der Kuhle vor dem Schalthebel.
Renata findet keine Spuren, die auf einen Einbruch deuten. Sie schaltet die Musikanlage ein. Auch der CD-Schlitz ist leer. Jetzt weiß sie nicht, welche Musik Konrad bei seiner letzten Fahrt gehört hat.
Al Green. Aretha Franklin. Ray Charles. Johnny Cash.
Renata fallen Reisen ein, die sie mit Konrad unternommen hat.
Tricky. Portishead. Prodigy. Brahem. Beethoven. Zuletzt wieder öfter Schostakowitsch, nachdem sie beide Julian Barnes’ Der Lärm der Zeit gelesen hatten.
Sie muß an den regimetreuen Komponisten Tichon Chrennikow denken, der bis zum Schluß behauptet hatte, Schostakowitsch habe von den Stalin-Kommunisten nichts zu befürchten gehabt.
Der Wolf kann nicht von der Angst der Schafe reden, hatte ein anderer russischer Komponist Chrennikows Aussage kommentiert.
Vor Renatas Augen ziehen Landschaften vorüber.
Mit offenen Fenstern und laut aufgedrehter Musik fährt sie mit Konrad noch einmal die Küstenstraße auf der Westseite Elbas entlang, vorbei an Seccheto, Fetovaia, Pomonte. Sie sitzt am Steuer und Konrad filmt sie. Er hat das gleißende Licht auf dem Wasser im Fokus seiner Kamera, dann schwenkt er auf ihre Oberschenkel. Sie hört ihn lachen. Isola bella. Isola d’Elba. Mia donna.
Als Renata den Saab starten will, verfehlt sie mit dem Autoschlüssel das Zündschloß. Sie hält kurz inne, trommelt mit der Faust auf das Cockpit, steigt wieder aus.
In Konrads Elternhaus ist es still. Niemand antwortet auf Renatas Rufen. Sie entdeckt Konrads jüngeren Bruder in der Stube, er sieht sich eine Serie am Laptop an, nimmt die Kopfhörer ab.
Wo sind die CDs, fragt Renata Marcel. Man hört entfernten Amselgesang, das Ticken der Kuckucksuhr.
Wo ist unsere Musik?
Marcel sagt eine Weile nichts, dann blickt er zu seiner Sporttasche.
Die habe ich.
*
Es ist nichts zu hören, nicht einmal Vogelgezwitscher. Renata wirft die Bettdecke zurück, setzt sich auf. Sie muß ständig schlucken.
Vielleicht habe ich mir im Schlaf auf die Zunge gebissen oder von scharfem Essen geträumt. Sie steigt aus dem Bett. Die Speicheldrüsen hören nicht auf, ihren Mund zu überschwemmen, es sammelt sich so viel Flüssigkeit, daß Renata mit dem Schlucken kaum nachkommt. Sie geht zum Fenster, sieht in den Garten hinunter, ohne ihn wahrzunehmen. An den lichten Stellen der Hecken schimmert das Blau des Pools durch.
Wie geht Leben?
Elsbeth hat ihr geraten, einen Psychologen aufzusuchen.
Aber ich halte mich doch gut, hat Renata geantwortet.
Sie schluckt und schluckt.
Erschrickt.
Gleich trinke ich mich selbst aus.
Renata fährt ins Zentrum, um den Mini-Fahrer zu treffen. Der Mann ist jung und weiß noch wenig vom Tod; er kondoliert nicht einmal, streckt Renata nur den Arm hin, schüttelt mit Kraft ihre Hand.
Während sie am Herzog-Siegmund-Ufer stehen, im Rücken die Markthalle, dreht er sich mehrmals nach vorbeigehenden Freunden und Bekannten um, ruft ihnen Halbsätze im Tiroler Dialekt hinterher. Sein Körper ist durchtrainiert, über den Nacken bis zu den Ohren zieht sich ein abstraktes Tattoo. Er duzt Renata, sieht ihr nicht in die Augen, wenn er mit ihr spricht.
Dann bin ich aus der Toilette gekommen und hab gesehen, daß er das Auto umarmt.
Ich habe zuerst gedacht, den haben sie grad angeschossen. Wirklich. Ich habe mich umgedreht, um zu schauen, ob da einer mit der Knarre steht. Mafia. Gibt es schließlich überall.
Der ist auf den Boden geglitten wie in einem Krimi.
Nichts. Gar nichts hat er gesagt. Ich bin gleich zu ihm hin. Er hat geschnarcht, aber gesagt hat er kein Wort.
Soll das ein schlechter Witz sein, habe ich ihn noch gefragt. Wegen des Schnarchens. Aber es war gleich still, und er hat sich nicht mehr bewegt.
*
Renata liegt ausgestreckt auf dem Ledersofa und blickt zum Fenster. Wenn sie ihren Gedanken nachhängt, kommt Konrad manchmal auf die Idee, sie dächte an etwas oder sähe etwas vor sich, dem er nicht gewachsen sei.
Du bist nicht hier, sagt er.
Ich bin hier, liege vor dir.
Das ist nur dein Körper, sagt Konrad.
Was heißt nur?
Eine Weile sagt Konrad nichts, dann erzählt er den Traum der vergangenen Nacht.
Überall auf der Schulter und an den Armen habe er Bißwunden entdeckt.
Von Hunden, fragt Renata.
Konrad schüttelt den Kopf.
Wanzen? Wie damals in Neapel, weißt du noch?
Nicht hinter den Schränken oder den Leisten, nein, mitten durch das erste Hotelzimmer, das man ihnen zugewiesen hatte, war eine Ameisenstraße verlaufen. Konrad war sofort zur Rezeption gegangen, vorbei an Nitsch-Bildern, an alten Neapel-Stichen und Art-déco-Möbeln, und hatte ein anderes, sauberes Zimmer verlangt.
Die nachtaktiven, rotbraunen Mitbewohner des zweiten Zimmers hatten sich während der Besichtigung nicht gezeigt. Erst in Wien, zwei Tage später, in einer gut ausgeleuchteten Umkleidekabine eines Unterwäschegeschäfts, hatte Renata an den kleinen roten Flecken am Bauch und an den Oberschenkeln die Wanzenbisse entdeckt.
Mama hat mich gebissen, sagt Konrad.
*
Von draußen sind harte, klappernde Laute zu hören. Renata, die sich mit Konrad das Sofa teilt, hebt den Kopf und blickt Richtung Fenster.
Die Schnatterpecks? fragt Konrad.
Seit Konrad den Flügelaltar von Hans Schnatterpeck in Südtirol wiedergesehen hat, nennt er die Gänse der Nachbarin, aber auch die Enten des Wiener Stadtparks, die regelmäßig durch die Wiener Wollzeile spazieren, Schnatterpecks.
Eigentlich ein schöner Name für einen Bildschnitzer, sagt Renata, obwohl Schnatterpeck sich doch eigentlich als Maler gesehen hat. Meine Mutter sagte übrigens immer Halt die Schnatter statt Halt den Schnabel!
Die Schnatter solltest du öfter halten, sagt Konrad und küßt Renata auf den Mund.
Wieviele Monate haben sie noch, die Schnatterpecks?
Vier, sagt Renata.
Gänse sind ein Leben lang monogam. Wußtest du das?
Die da draußen haben nicht viel Gelegenheit dazu, sagt Renata. Noch bevor sie sich aneinander gewöhnen, werden sie geschlachtet.
Sie würde Konrad gerne fragen, ob er in seiner Beziehung zu ihr auch monogam sei. Keiner fragt den anderen, sie gehen beide davon aus, daß jeder weiß, was er tut. Ob Konrad das auch noch weiß?
Ich habe irgendwo gelesen, die Seele sei nichts weiter als ein Geschnatter von Nervenzellen. Renata streichelt Konrads Kopf, riecht an seinem Hals. Glaubst du an die Seele?
Ein Mensch, der eine Seele hat, spürt doch nur sein Herz, sagt Konrad.
Renata legt ihren Kopf auf Konrads Brust.
Deine Seele rast.
*
Am späten Nachmittag bringt Renata die Aufbahrungskerzen in Konrads Elternhaus. Gunda hat darauf bestanden. Wahrscheinlich befürchtet sie, Renata könnte die Kerzen bei Leonhard und Elsbeth vergessen. Daß sie bei den Freunden im Saggen schläft und nicht in Konrads Elternhaus, findet Gunda eine unnötige Provokation.
Die Haustür ist nicht abgesperrt, Marcel nicht mehr bei seiner Mutter.