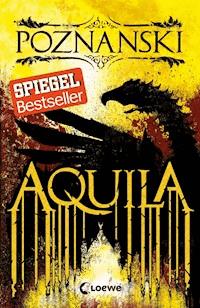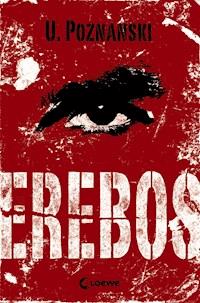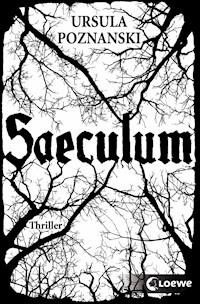19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Loewe
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Alle Bände der dystopischen Trilogie von Spiegel-Bestsellerautorin Ursula Poznanski, auch bekannt durch ihre Romane "Erebos" und "Saeculum", in einem E-Book! Ein packender Jugend-Thriller, der Leser in einen Strudel von Verschwörung und Verrat zieht. Sie ist beliebt, privilegiert und talentiert. Sie ist Teil eines Systems, das sie schützt und versorgt. Und sie hat eine glänzende Zukunft vor sich - Rias Leben könnte nicht besser sein. Doch dann wendet sich das Blatt: Mit einem Mal sieht sich Ria einer ihr feindlich gesinnten Welt gegenüber und muss ums Überleben kämpfen. Es beginnt ein Versteckspiel und eine atemlose Flucht durch eine karge, verwaiste Landschaft. Verzweifelt sucht Ria nach einer Erklärung, warum ihre Existenz plötzlich in Trümmern liegt. Doch sie kann niemandem mehr vertrauen, sie ist ganz auf sich allein gestellt. Die drei Einzelbände der Trilogie heißen "Die Verratenen", "Die Verschworenen" und "Die Vernichteten".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1721
Veröffentlichungsjahr: 2015
Sammlungen
Ähnliche
1
Ich weiß, dass etwas Furchtbares passiert sein muss, als Tomma den Raum betritt. Sie weint nicht, sie schreit nicht, doch ich sehe es an ihrem Blick, der mich findet und sofort wieder von mir wegschnellt wie ein scharf geworfener Ball von einer Wand. Ich sehe es an ihren blassen Lippen, an der dunklen Haarsträhne, die ihr achtlos ins Gesicht hängt, vor allem aber an ihren Händen, die so fest verschränkt sind, dass die Fingerknöchel weiß hervortreten.
Ich unterbreche meine Rede, sie war ohnehin nicht gut, und Grauko, mein einziger Zuhörer, schenkt mir keine Beachtung mehr. Er hat sich zur Tür gewandt. Sollte er aus Tommas Verhalten das Gleiche lesen wie ich, lässt er es sich nicht anmerken. Sein Ton ist gelassen wie immer.
»Ja?«
»Es gab … es war …«
Ich beobachte Tomma, wie sie nach Worten ringt, und fühle, dass meine Kehle sich verengt. Ist eine Kuppel eingestürzt? Gab es wieder Angriffe auf die Außenwachen?
»Die Expedition …«, stößt Tomma endlich hervor. »Sie sind tot. Alle drei.«
In mir wird auf einen Schlag alles kalt. Ich gehe in die Knie, bevor mir schwindelig werden kann. Mein Herzschlag dröhnt in meinen Ohren ebenso laut wie Tommas Worte.
Ihre Lippen zittern, in ihren Augen sammeln sich Tränen, und als sie weiterspricht, entgleitet ihr auch die Stimme. »Raman, Curvelli und Luria. Ein Überfall, gleich nachdem sie … ausgestiegen sind. Die Prims müssen es gewusst haben, sie haben auf der Lauer gelegen –«
»Tomma!« Grauko ist blass geworden und seine Ermahnung wegen des verpönten Ausdrucks Prims fällt weniger scharf aus als gewöhnlich. Er hat Curvelli und Lu unterrichtet, es muss ihn genauso treffen wie mich.
Tomma korrigiert sich nicht, wie sie, wie wir alle es normalerweise machen würden. Sie weint und ich möchte das Gleiche tun. Mein Atem geht zittrig und ich kann kaum schlucken.
Lu, denke ich und sehe ihr Gesicht vor mir, so lebendig wie vor drei Tagen, als wir gemeinsam die Pilze in den Zuchtgewölben untersucht haben. Sie hielt ihre Stablampe mit den Zähnen, während sie Proben nahm und in Glasröhrchen füllte. »Du wirst sehen«, sagte sie, als wir fertig waren, »von draußen bringe ich mehr davon mit. Sie sagen, es gibt wieder neue Spezies, weiter im Süden.«
Die Expedition sollte den Höhepunkt ihres letzten Ausbildungsjahres bedeuten. Nicht ihren Tod.
Tomma geht, die Konturen ihrer Silhouette verschwimmen, obwohl ich mit aller Kraft versuche, meine Tränen zu unterdrücken. Lu. Innerhalb eines Monats hatte sie sich in der Reihung drei Plätze vorgearbeitet und jetzt …
Ich weigere mich, es zu glauben. Es wäre nicht die erste Falschmeldung; vielleicht stellt die Nachricht sich schon heute Abend als Irrtum heraus.
»Ria? Ist alles in Ordnung?«
Ich reiße mich zusammen. Nur eine Träne findet den Weg bis zu meinem Kinn und ich wische sie fort, bevor sie zu Boden fallen kann. Grauko sieht mich mit schief gelegtem Kopf an, er schreibt innerlich mit, wie immer. Speichert jede meiner Reaktionen gedanklich ab.
»Es geht wieder.« Ich nicke ihm zu und will Tomma folgen, vielleicht weiß man in der Zentralkuppel schon mehr.
»Bleib bitte da, wir sind noch nicht fertig. Ich möchte, dass du eine weitere Rede hältst. Die, bei der du vorhin unterbrochen wurdest, war nicht besonders gut.« Er streicht über seinen kurzen dunklen Kinnbart. »Noch einmal von vorne.«
Ich starre ihn an. Meint er das ernst? Jetzt? »Ich bin nicht in der richtigen Verfassung. Es sind Freunde von mir –«
»Deine Verfassung kannst du dir nicht aussuchen. Du musst in jeder Lage fähig sein, dich zu sammeln und die Menschen zu überzeugen.« Sein Lächeln ist voller Verständnis und Schmerz. »Niemand hat gesagt, dass es leicht ist. Und weißt du was? Ich mache es jetzt noch schwerer für dich, ich gebe dir ein neues Thema. Es lautet: Den Clans und Stämmen zu helfen ist unsere Pflicht. Wer die Außenbewohner diskriminiert, hat den Sinn der Sphären nicht begriffen.«
Grauko ist mein Lieblingsmentor. Von niemandem lerne ich so viel, vor niemandem habe ich so viel Respekt. Doch im Moment würde ich ihn gern anbrüllen: Den Clans zu helfen ist unsere Pflicht? Sie töten unsere Forscher, zerstören unsere Arbeit, überfallen unsere Transporte, brechen den Frieden immer und immer wieder. Und wir? Schicken Hilfspakete.
Der Gedanke muss aus meinem Kopf, sonst kann ich Graukos Aufgabe nicht erfüllen. Lu muss aus meinem Kopf und das Bedürfnis, denen da draußen mit einem Stein den Schädel einzuschlagen, jedem Einzelnen. So, wie sie es wahrscheinlich bei Lu getan haben.
»Stell dir vor, du wärst in Sphäre Neu-Berlin 3. Dort ist es mit den Attacken wirklich schlimm, kein Vergleich zu hier, es gibt regelmäßig Tote auf beiden Seiten. Du sollst den Bewohnern klarmachen, dass Gewalt als Antwort nicht infrage kommt. Du vertrittst die Position des Sphärenbundes.«
Die Trauer um Lu nistet sich in meinem Körper ein, sie gräbt Höhlen in meinen Magen und in meine Brust. Ich bin sicher, sie zeichnet ihre Spuren auch in mein Gesicht, obwohl dort nicht mehr zu sehen sein darf als verständnisvolle Bekümmertheit. Würde.
Ich denke an eine weiße Wand. Atme durch.
»Wir sind privilegiert«, beginne ich. Meine Schultern sind gerade, meine Stimme fest. Ich erlaube einem kaum merkbaren Lächeln, sich auf meine Lippen zu stehlen. Jetzt müsste ich zuversichtlich wirken. »Unsere Ernten waren gut in diesem Jahr und es ist uns gelungen, zwei neue Sphären zu errichten und zu besiedeln. Wir sind gegen Sturm, Kälte und Tiere geschützt, wir verfügen über Medikamente, moderne Technik und sauberes Wasser. Mit jedem Tag, der vergeht, macht die Wissenschaft unser Leben leichter.« Ich lasse meinen Blick von links nach rechts schweifen, als wäre der Raum voller Menschen. »Ich weiß, dass die meisten von uns der Ansicht sind, all das verdient zu haben. Damit habt ihr recht, zumindest zum Teil. Unsere Vorfahren haben die Sphären aufgebaut. Sie haben an das geglaubt, was Melchart vorhergesagt hat, und auf diese Weise sich selbst und uns gerettet. Sie haben das Wissen der damaligen Zeit bewahrt und weiterentwickelt, um der Zivilisation eine Chance zu geben. Wir sind privilegiert, aber es muss uns auch klar sein, wie viel Glück wir hatten.«
»Dafür schuften wir aber auch Tag und Nacht!«, fällt Grauko mir ins Wort und imitiert dabei die Sprachfärbung der Sphäre Neu-Berlin 3.
»Ja, wir arbeiten hart«, stimme ich ihm zu. »Du, ich, jeder Einzelne von uns. Die Erde hat den Ausbruch noch nicht verkraftet und es wird viel Zeit vergehen, bis es so weit ist. Aber sieh dich an. Sieh an dir hinunter. Findest du Frostbeulen? Hungerödeme? Hat ein Wolf dir ein Bein abgerissen? Nein. Doch für die Menschen außerhalb der Sphären ist das Normalität und an ihrer Stelle würdest du auch alles tun, um dein Leben erträglicher zu machen.« Kein Vorwurf in der Stimme, das ist das Schwierigste dabei. Keine Selbstgerechtigkeit, sonst verliert man die Zustimmung. Ich habe den richtigen Ton gefunden, wie mir Graukos leichtes Nicken bestätigt.
»Wir arbeiten so hart«, fahre ich fort, »damit wir die, die ohne die Sphären überlebt haben, irgendwann bei uns aufnehmen können. Im Moment wäre das verhängnisvoll für uns alle – zu wenige Lebensmittel, zu wenig Platz. Aber wir nähern uns diesem Ziel jeden Tag ein Stück weiter an. Dass die Clans nicht warten wollen, ist verständlich. Mir ginge es an ihrer Stelle ebenso.«
»Nicht warten wollen und uns töten sind aber zwei verschiedene Dinge«, brummt Grauko, nach wie vor in der Rolle eines Neu-Berliners.
Wieder habe ich Lu vor Augen. Sie war so sehr auf der Seite der Clans, ihr Verständnis und ihre Nachsicht für die Raubzüge und Überfälle waren echt. Als ich weiterspreche, habe ich das Gefühl, dass es ihre Worte sind, die über meine Lippen gleiten.
»Sie wissen es nicht besser. Wir in den Sphären haben uns die Art der Zivilisation bewahrt, wie man sie vor dem Ausbruch kannte. Die Menschen außerhalb haben neben allem anderen auch das verloren. Ihr nennt sie Prims, aber sie sind nicht primitiv, sondern der Welt in ihrer ganzen Härte ausgeliefert. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, auch wenn es schwerfällt. Denn wir sind es, die sie auf Abstand halten. Nicht für alle Zeit, aber doch so lange, bis wir einen Weg gefunden haben, sie zu uns zu holen, ohne dabei unterzugehen.« Eine kurze Pause, wieder ein Blick quer durch den Raum. Mitgefühl in die Stimme legen. »In der Zeit, die wir dafür brauchen, sterben draußen bei jedem Sturm, jeder Welle, jedem Beben Hunderte Menschen. Dafür geben die Clans uns die Schuld, und auch wenn das falsch ist, sollten wir dafür Verständnis aufbringen. Es ist nicht leicht, fair zu sein, wenn man verhungert oder erfriert. Wir haben es nicht mit Wilden zu tun, sondern mit Not leidenden Menschen, denen wir helfen müssen, so gut wir können. Wenn wir ihnen ihre Lage erträglicher machen, werden die Überfälle weniger werden. Das steht außer Frage.«
Beinahe habe ich mich selbst überzeugt und Graukos Miene entnehme ich, dass er ebenfalls zufrieden ist.
»Du kannst gehen«, sagt er. »Das war viel besser als dein erster Versuch. Nicht deine beste Rede, nicht gut genug für Punkte. Aber ausreichend für eine Ansprache vor Minenarbeitern.«
Er hat recht. Ich nicke.
»Was du bewiesen hast, ist, dass du deine Fähigkeiten auch in extremen Situationen einsetzen kannst. Das freut mich ganz persönlich.«
Ein Lob aus Graukos Mund ist selten und kostbar, das Beste, was ich im Moment erwarten kann. Wenn man in der Reihung so weit vorn steht wie ich, gibt es Punkte nur noch für Übermenschliches.
Er entlässt mich mit einer beiläufigen Handbewegung.
Ich trete auf den Gang, beginne zu rennen. Jetzt kann, darf ich weinen, aber es kommen keine Tränen, nur ein Wimmern, das auch von meiner Atemlosigkeit herrühren kann.
Ich laufe aus dem Akademieblock hinaus, an der Bibliothek, an den inneren Quartieren und am Medcenter vorbei.
Lu ist tot, denke ich bei jedem Schritt. Lu. Ist. Tot. Lu. Ist. Tot.
Die beiden anderen habe ich kaum gekannt. Raman hing immer nur mit den Physikern herum und Curvelli war lediglich einmal im gleichen Selbstanalyseseminar wie ich und fiel dort nur durch beharrliches Schweigen auf, jedes Mal wenn die Sprache auf seine Wünsche und Ziele kam. Er war wortkarg und sehr von sich überzeugt. Meistens zwischen 20 und 25 gereiht. Jemand, auf den die Mentoren ein Auge hatten, ein potenzieller künftiger Leiter des Physikalischen Forschungszentrums. Tot jetzt.
Es heißt, in extremen Kälteperioden fressen die Prims auch Menschenfleisch.
Laufen. Links, rechts, schneller. Ein Sonnenstrahl bricht sich über mir an der Hermetoplastkuppel und mischt sein Licht mit dem der Leuchten zu beiden Seiten des Verbindungsstegs. Es ist nicht mehr weit, nur noch quer durch Kuppel 9a, doch mein Salvator beginnt schon zu piepsen, als ich den ersten Schritt hinein mache. Puls 182, anaerober Bereich, zeigt das Display an.
Ich bremse ab und merke erst jetzt, wie hektisch mein Atem geht. Eine Arbeiterin aus der Großwäscherei lächelt mir grüßend zu, während sie an mir vorbeieilt, die Arme voll beladen mit weißem, gestärktem Stoff. Kenne ich sie? Ich bin mir nicht sicher und das ist ein übles Zeichen.
Den Rest des Weges gehe ich in normalem Tempo und lege mir meine Worte zurecht. Ich werde es den anderen sagen müssen, aber auch darin bin ich geübt. Schlechte Nachrichten zu überbringen war eine der ersten Lektionen, die ich von Grauko erhalten habe.
2
Die Studenten sitzen um die Plexiglastische im Café Agora und unterhalten sich leise. Ich umrunde das Denkmal unseres Sphärengründers Melchart, genau in der Mitte der Zentralkuppel. Gleich daneben, nur geringfügig kleiner, ragt die Säule auf, die Richard Borwin gewidmet ist, dem Konstrukteur der Sphären. Nach ihm ist unsere Akademie benannt.
Aureljo sitzt mit dem Rücken zu mir, sein Haar hat die Farbe von Löwenfell, und ich kann nicht anders, ich muss es jedes Mal berühren, wenn ich ihn sehe. Glatt und fest.
Er dreht sich zu mir um und ich weiß, dass ich nichts mehr sagen muss. Man hat ihn informiert – ich hätte es mir denken können. Seit Monaten führt er die Reihung an; wenn einer von uns auf dem Laufenden gehalten wird, dann er.
»Ria.« Er zieht mich auf seinen Schoß und ich schlinge meine Arme um seinen Hals. Als Aureljo scharf einatmet, lockere ich erschrocken meinen Griff.
»Tut mir leid.« Er muss noch Schmerzen haben, wieso habe ich daran nicht gedacht? Weil ich mich so schnell an sein neues Gesicht gewöhnt habe, wahrscheinlich. Nein, nicht neu. Natürlich nicht.
Wähle deine Worte sorgfältig, höre ich Grauko in meinem Kopf.
Sein verändertes Gesicht also. Die Blutergüsse sind kaum mehr zu erahnen und die Narben sowieso nicht. Die Chirurgen des Medcenters wissen genau, wie sie die Spuren ihrer Arbeit unsichtbar machen und dabei gleichzeitig die gewünschte Wirkung erzielen. In Aureljos Fall bedeutete das: die Nase eine Winzigkeit verkürzen, die Augenbrauen heben, ebenso wie die Mundwinkel, die Wangenknochen verstärken, das kleine runde Muttermal neben dem linken Auge entfernen.
Vor dem Eingriff war es ein gutes Gesicht voller Freundlichkeit, jetzt ist es bezwingend. Man sieht Aureljo an und vertraut ihm, möchte ihm nahe sein, möchte ihm zuhören. So ist es gedacht. Noch bevor er ein Wort sagt, werden die Menschen ihm recht geben wollen.
Ich lege vorsichtig meine Stirn gegen seine Schulter. »Du hast es auch schon gehört?«
Er nickt. »Es ist entsetzlich.«
»Und ist es offiziell bestätigt?«
»Ja. Sie bringen die Leichen heute Abend zurück. Nur zwei allerdings. Curvellis Körper war nicht aufzufinden, den dürften die Täter mitgenommen haben.«
Das Warum, das mir auf der Zunge liegt, schiebe ich schnell beiseite.
Aureljo streicht mir übers Haar. »Es tut mir sehr leid wegen Lu«, flüstert er.
Tränen, endlich. Der mittelblaue Stoff von Aureljos Hemd färbt sich an der Schulter dunkelblau.
»Wir sollten kurzen Prozess mit ihnen machen.« Tudor, der schräg gegenüber sitzt, hat unser Gespräch mit angehört, was nicht verwunderlich ist, denn die anderen Gespräche am Tisch sind mittlerweile verstummt. Nun beugt Tudor sich vor und nimmt Aureljo ins Visier. »Die Prims müssen weg, jedenfalls aus der unmittelbaren Umgebung der Sphären und der Magnetbahnen. Wir haben uns ihre Angriffe lange genug gefallen lassen.«
Obwohl ich Tudor nicht leiden kann, würde ich ihm gerne zustimmen. Wenn wir uns nicht beizeiten wehren, werden sie eines Tages einen Weg in die Sphären finden und uns im Schlaf die Kehlen durchschneiden. Manchmal bedeutet sich wehren auch, zuerst zuzuschlagen. Solange noch Zeit ist.
Falsch, sagt Grauko in meinem Kopf. Unzivilisiert. Unmenschlich.
»Um auf eine solche Idee zu kommen, müsstest du nicht die Akademie absolvieren«, erwidert Aureljo. Seine Hand streicht über meinen Arm, immer und immer wieder, aber er ist nicht bei der Sache. Seine ganze Aufmerksamkeit richtet sich auf Tudor. »Das Problem beseitigen, indem man einfach draufhaut – so haben es schon die Höhlenmenschen gemacht. Schlechter Stil, der seit Jahrtausenden nur Katastrophen zur Folge hat.«
Es wird eine lange Diskussion werden, wie jedes Mal, wenn Aureljo und Tudor sich in ein Thema verbeißen. Normalerweise würde ich mich einmischen, aber mir fehlt die Kraft. Ausreichend für Minenarbeiter, hat Grauko meine Rede genannt. Um unseren Tisch sitzen aber lauter Akademiestudenten, die mir jedes schwache Argument gnadenlos um die Ohren schlagen würden.
Mein Blick wandert ganz automatisch zu Tafel 1, wie jedes Mal, wenn ich hier bin. Meine Augen brennen, aber die riesigen Zahlen und Buchstaben, die fast die gesamte gegenüberliegende Wand einnehmen, erkenne ich trotzdem. Ich entdecke meinen Namen sofort. Immer noch auf Platz 7. Gut. Aureljo führt die Reihung an, so wie wir es alle gewohnt sind, doch es scheint, als habe Tudor es geschafft, den Abstand zu verringern. Im vergangenen Jahr war er drei Wochen lang die Nummer 1 und niemand, der dabei gewesen ist, wird je seinen Wutanfall vergessen, als er erfuhr, dass er wieder auf die 2 zurückgefallen war.
Auf Tafel 4 finde ich Lu, was mich einen Moment lang denken lässt, dass doch alles nur ein Irrtum ist. Nummer 78. Hinter ihr liegt Brit. Ich frage mich, ob sie sich freut, einen Platz aufzusteigen.
In der Sekunde, als ich mich wieder umwenden will, treten drei Sentinel durch den Kuppeleingang. Einen davon kenne ich, er trägt die grüne Uniform der Quartierwachen und patrouilliert gelegentlich auf den Gängen zwischen den verschiedenen Wohnsektoren. Sein schütteres rotes Haar klebt an seinem Kopf, als wäre er verschwitzt. Der zweite Sentinel ist ein blauer, also ein Wissenschaftswächter, aber beim dritten suche ich vergeblich nach der farblichen Kennzeichnung an Kragen- und Ärmelaufschlägen. Alles an ihm ist grau: Hose, Hemd, Jacke. Kann es sein, dass er neu ist und noch keiner Einheit zugeordnet wurde? Nein. Dafür ist er zu alt, außerdem wirkt es, als würden die beiden anderen ihm folgen, nicht umgekehrt.
Sie gehen an der Außenwand der Kuppel entlang und der Farblose zeigt nach oben, auf Tafel 1. Er spricht mit dem Sentinel der Quartierwache, dann geht er weiter zu Tafel 3, deutet wieder nach oben.
Es geht bestimmt um die Toten. Erst um Curvelli, gereiht auf Platz 24, jetzt um Raman mit der 70. Haben sie es so eilig, die Namen entfernen zu lassen?
»… stellt unser ganzes System infrage«, sagt Aureljo gerade. »Wir haben Gesetze.«
Mit einer leichten Berührung lenke ich seine Aufmerksamkeit auf mich. »Siehst du den Sentinel unterhalb von Tafel 3?«
»Ja. Warum?«
»Zu welcher Staffel gehören die ohne Farbe? Kommando? Ich dachte immer, deren Kragen wären golden.«
»Sind sie auch.« Sein Blick bleibt an den drei Männern hängen. »Du hast recht. Das ist ungewöhnlich. Er muss ein Gast aus einer anderen Sphäre sein. Vielleicht aus dem Ausland.«
»Gilt dort denn eine andere Farbregelung?«
»Eigentlich nicht. Vielleicht ist er erst kürzlich hierher umgesiedelt worden und wird erst noch zugeteilt? Ich habe ihn noch nie gesehen.«
Das ist möglich, obwohl das gebieterische Gebaren des fremden Sentinel für mich etwas anderes aussagt. Er verhält sich wie ein Beamter des Sphärenbundes, doch die tragen keine Uniformen.
Auch Tudor lässt den Mann nicht aus den Augen und sein Atem geht etwas schneller. Interessant.
»Ich vermute, dass Ria richtigliegt«, sagt er. »Kommando. Möglicherweise hat er seine Farben abgelegt, um zu verhindern, dass Gerüchte die Runde machen.«
Mein Puls beschleunigt sich und ich atme betont ruhig, damit mein Salvator nicht anspringt. Tudor hat recht. Die Sentinel vom Kommando lassen sich hier nur dann blicken, wenn Gefahr droht. Wie damals, als die Prims die Außenhülle von Kuppel 17a gesprengt hatten. Oder zwei Jahre davor, nach den Überfällen auf die Lebensmitteltransporte aus Sphäre Genua 4. Gelegentlich begleiten sie auch wichtige Persönlichkeiten, wenn diese von Sphäre zu Sphäre reisen.
Schweigend beobachten wir, wie der Fremde weitergeht, zur nächsten Tafel. Wieder zeigt er hinauf und ich bin mir sicher, er deutet auf Lus Namen. Jetzt, da er näher bei uns steht, schwindet mein letzter Zweifel an Tudors Worten.
Seine Haltung, seine Miene, die Selbstverständlichkeit seiner knappen Bewegungen. Der Mann ist es gewohnt zu befehlen.
Sie schicken jemanden vom Kommando wegen drei toter Studenten, denke ich und mir wird warm, weil es eine verdiente Würdigung für Lu, Raman und Curvelli ist. Doch dann fällt mein Blick auf Tudor. Er muss sich unbeobachtet fühlen und hat für wenige Augenblicke seine Emotionskontrolle vernachlässigt. Hinter seinem ironischen Lächeln und den lässig gehobenen Augenbrauen sehe ich plötzlich nackte, blanke Angst.
3
»Ich bin darauf trainiert, so etwas zu erkennen«, protestiere ich.
Aureljo läuft zwei Schritte vor mir, und obwohl ich nur seinen Hinterkopf sehe, weiß ich, dass er nachsichtig lächelt.
»Wir sind doch alle beunruhigt.« Er bleibt stehen, dreht sich um und nimmt mich in den Arm. »Tudor war mit Raman befreundet, wusstest du das? Er trauert, auch wenn er es nicht zeigt.«
»Er hat Angst.« Wie soll ich Aureljo den Unterschied klarmachen? Es ist, als wollte man jemandem, der keine Noten beherrscht, erklären, wie er eine Partitur lesen muss. Die Gefühlsäußerungen eines Menschen, offen oder unterdrückt, sind wie Orchestermusik, es passiert unglaublich viel gleichzeitig. Wenn man nur auf die Augen, die Hände oder die Stimme achtet, wird man leicht getäuscht.
»Er war wütend und traurig, das stimmt. Aber dann …« Ich suche nach den richtigen Worten. »Als Tudor diesen Sentinel gesehen hat, ist er innerlich zurückgewichen. Sein Kiefer hat sich angespannt, seine linke Hand hat die rechte umfasst. Er hat häufiger geblinzelt.« Ich seufze und zucke mit den Schultern. »Er ist erschrocken und hatte Angst. Glaub es oder lass es.«
Aureljo beugt sich zu mir und legt seine Stirn gegen meine. »Ich glaube dir, ich weiß, wie gut dein Auge für Menschen ist. Aber kannst du dir erklären, woher seine Angst kommen sollte? Das Kommando ist doch dazu da, uns in Krisensituationen zu beschützen.«
Darauf habe ich keine Antwort. Müsste ich eine Einschätzung abgeben, würde ich sagen, dass sich Tudors Angst auf diesen Sentinel, seine Person, bezog, nicht auf einen drohenden Überfall. Natürlich könnte ich ihn direkt fragen, doch meine Lust auf höhnisches Lachen und grobe Bemerkungen hält sich in Grenzen.
»Vielleicht weiß er etwas, das wir nicht wissen.« Erst nachdem ich es ausgesprochen habe, wird mir klar, dass das wahrscheinlich die Wahrheit ist.
Wir trennen uns vor dem Eingang zu den äußeren Quartieren. Aureljo biegt nach links ab, ich nach rechts. Die Sentinel der Quartierwache nicken mir grüßend zu und ziehen ihre Scanner über den Identifikationscode, der seitlich an meinem Salvator angebracht ist. Der Anwesenheitszähler springt auf 145, jedenfalls vermute ich das, denn die mittlere der Leuchtziffern flackert und erlischt immer wieder. Ersatzteile fehlen, der letzte Transport wurde überfallen. Ich frage mich, was die Prims wohl mit Leuchtdioden anfangen.
Dass sich um diese Zeit schon so viele Studenten in ihren Quartieren befinden, muss an der schlechten Nachricht liegen. Niemand geht unvorbereitet auf eine Trauerfeier, denn theoretisch kann jeder dazu aufgefordert werden, das Wort zu ergreifen.
Meine Wohneinheit liegt in der zweiten Etage, ich schließe die Tür hinter mir, ziehe die Schuhe aus und lasse mich auf das Sofa fallen.
Seit ich unter die ersten zehn gereiht bin, verfüge ich über zwei Zimmer, ganz für mich allein. Es gibt Tageslicht und sogar ein Fenster, durch das man nach draußen sehen kann. Richtig hinaus, nicht nur in den Himmel oder auf einen der Höfe zwischen den Kuppeln. Hier in der Sphäre Hoffnung sind solche Räume selten – meistens hat man das Gefühl, man befände sich in den verschlungenen, blasenförmigen Organen eines transparenten Tieres. Aber in meinem Quartier ist es anders. Von meinem Sofa aus kann ich die schwarzen Umrisse der Sentinel beim Patrouillieren beobachten, sie heben sich gegen den Schnee ab wie aus Dunkelheit geformte Schatten. Hinter der Mauer, die die Sphäre umgibt, weit, weit entfernt, liegt ein Hügel, der sanft ansteigt und wieder absinkt. Wenn ich nicht schlafen kann, sitze ich oft am Fenster, ziehe mit Blicken seine geschwungene Form nach und suche am nächtlichen Himmel nach dem Mond. Perfekte Schönheit, nicht von Menschenhand gemacht, anders als alles, was mich sonst umgibt.
Bis zur Trauerfeier habe ich noch vierzig Minuten, informiert mich die Nachrichtentafel an der Wand. Ich schäle mich aus meinen Sachen und dusche mir den Tag von der Haut, bevor ich in die Robe für offizielle Anlässe steige. Rot wie Feuer und grau wie Asche. Die Farben des Sphärenbundes.
Aus dem Spiegel sieht mir mein blasses Gesicht entgegen, das Haar ist noch feucht und klebt mir an Kopf und Schultern. Kastanienbraun, so hat Lu die Farbe immer genannt. Einer dieser altmodischen Begriffe, die sie so liebte, weil sie geheimnisvoll klingen. Wie Kastanien ausgesehen haben, wusste sie aber auch nur von alten Abbildungen.
Ich schließe die Augen und stelle mir vor, mein Haar wäre nass vom Regen. Ob ein Regenguss sich wie eine Dusche anfühlt? Ich habe Beschreibungen gelesen, die alten Romane sind voll von Regen, doch selbst erlebt habe ich ihn erst zwei- oder dreimal. Er war laut, knallte auf die Oberfläche der Kuppeln und verschleierte sie mit Wasser. Ganz anders als der stumme, sanfte Schnee, der fast täglich fällt.
Keine Zeit für Träumereien. Ich binde das Haar zu einem Knoten, während ich fast automatisch vor dem Spiegel meine Übungen mache. Undurchdringliche Miene, dann ein wenig Mitgefühl hineinlegen. Missbilligung. Verständnis. Versteckte Ablehnung. Offene Ablehnung. Vertrauen. Wertschätzung.
Duldsamkeit fällt mir schwer, wie immer, und ich breche mitten in der Übung ab. Fixiere meinen Blick im Spiegel und frage mich, ob sich die Akademieleitung überlegt hat, auch an meinem Gesicht etwas zu ändern. Bisher habe ich keinen Bescheid erhalten und ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Vermutlich wissen sie noch nicht, wo ich eingesetzt werde – vor oder hinter den Kulissen. Oder sie wollen nicht riskieren, dass ich mit einem veränderten Gesicht alle Regungen neu einstudieren muss.
Meine Stirn könnte höher, mein Kinn spitzer, meine Nase schmäler sein. Die Augenfarbe ist gut, sagt Grauko oft, Hellbraun wirkt vertrauenerweckend. Ich nicke mir zu und lege Vertrauenswürdigkeit in meine Züge.
Wenn du so aussiehst, würde ich dir meine tiefsten Geheimnisse verraten, hat Lu letztens zu mir gesagt. Der Gedanke an sie drückt mich mit einem Mal fast zu Boden. Lu, die zu allen freundlich war und von denjenigen ermordet wurde, denen sie helfen wollte. Ich drehe mich vom Spiegel weg, lege meine Hände übers Gesicht und tue, was ich schon die ganze Zeit tun möchte: weinen, bis keine Tränen mehr kommen.
Ich bin eine der Letzten, die in der Festhalle eintreffen. Es ist ruhig, Gespräche werden nur im Flüsterton geführt, als wolle man die, die in den Särgen auf dem Podium liegen, nicht stören. Drei metallene Kisten, eine davon leer. Ich frage mich, welche es ist. Ihr Anblick macht mich schwindelig, besonders die Tatsache, dass sie geschlossen sind.
Üblicherweise dürfen die Trauernden einen letzten Blick auf die Gesichter der Toten werfen, bevor sie verbrannt werden. Will man diesmal darüber hinwegtäuschen, dass nur in zwei Särgen Körper liegen? Oder sind die Gründe andere?
Ich suche nach Aureljo und entdecke ihn ganz vorne. Er starrt den Boden an und sieht erst auf, als ich dicht neben ihm stehen bleibe.
»Setz dich zu mir«, flüstert er und nimmt meine Hand.
»Warum sind die Särge geschlossen?« Die Frage lässt mich nicht los.
Aureljo schüttelt den Kopf. »Ich weiß es nicht.« Doch auch er vermutet etwas, möchte es mir aber nicht mitteilen, lächelt meine Hand in seiner an, weil er mir nicht in die Augen sehen will.
Das, was niemand ausspricht, wird plötzlich zu Bildern in meinem Kopf. Eingeschlagene Gesichter. Zerbrochene Schädeldecken. Entstellungen, Verstümmelungen. Will man uns schonen? Damit die Angst vor Außenmissionen nicht übermächtig wird?
Ich schmiege mich an Aureljo und vergrabe mein Gesicht an seiner Brust. Der Hass gegen die Prims ist mit einem Mal wieder da, er schnürt mir die Luft ab. Was Grauko nie deutlich sagt, was ich aber oft aus seinen Worten heraushöre, scheint mir plötzlich unmöglich: dass es meine Aufgabe werden könnte, zwischen den Menschen innerhalb und außerhalb der Sphären zu vermitteln.
Um uns herum verstummt das Geflüster, Aureljos Rücken strafft sich und auch ich richte mich auf. Gorgias, der Rektor unserer Akademie, ist zwischen zwei der Särge getreten und streicht sich über seinen haarlosen Kopf, bevor er zu sprechen beginnt. Ich höre nur die Hälfte von dem, was er sagt, ich kann meinen Blick nicht von dem Sarg losreißen, in dem sich – so habe ich es für mich beschlossen – Lu befindet. Aufmerksam werde ich erst, als Gorgias den Tod der drei Studenten als Unglücksfall bezeichnet und nicht als barbarischen Mord, wie es richtig wäre. Am liebsten möchte ich aufstehen und aus dem Saal rennen.
»Wir trauern um Raman, benannt nach dem indischen Nobelpreisträger, in dessen Fußstapfen er hätte treten können. Wir trauern um Luria, benannt nach dem bahnbrechenden Mikrobiologen, in dessen Sinn sie geforscht hat. Und wir trauern um Curvelli. Seine Begabungen waren vielfältig, er hätte sie als Forscher ebenso wie als Staatsmann einsetzen können. Indem sein Benenner die Namen Curie und Machiavelli miteinander verschmolz, wurde beiden Möglichkeiten Rechnung getragen. Nun sind diese Möglichkeiten einer bitteren Realität gewichen. Doch unsere Ziele bleiben die gleichen. Wir werden nicht von Rachegedanken geleitet, sondern von Vernunft.«
Aureljo drückt meine Hand, Gorgias spricht ihm aus der Seele. Ich lasse ihn nicht aus den Augen, unseren Rektor, warte auf den einen Lidschlag zu viel, den einen falschen Ton, der verrät, dass er nicht meint, was er sagt. Aber entweder ist er hervorragend trainiert oder einfach ehrlich.
Nach ihm hält der stellvertretende Vorstand unserer Sphäre seine Ansprache und meine Aufmerksamkeit lässt erneut nach. Er ist ein kleiner Mann mit einer leisen Stimme, dessen Stärken in der Klimaforschung liegen, nicht darin, seine Zuhörer zu fesseln.
An der Wand hinter den drei Särgen stehen fünf Sentinel aufgereiht, den Blick starr geradeaus gerichtet. Unwillkürlich suche ich nach dem Sentinel von heute Nachmittag, dem, der Tudor so beunruhigt hat. Doch er ist nirgendwo zu sehen.
Wir bleiben, bis die Särge in die Feuerhalle gebracht werden. Niemand hat erwähnt, dass einer davon leer ist, kein Wort wurde über den Verbleib von Curvellis Leiche verloren.
Curie und Machiavelli. Ein Physiker und ein machtbesessener Politiker. Ich frage mich, ob diese Kombination Curvelli gerecht geworden ist, und gleichzeitig, wie schon unzählige Male zuvor, welche Aufgabe mein eigener Name mir auferlegen wird.
Aus Eleonore von Aquitanien und Ariadne, Tochter des kretischen Königs Minos, haben meine Namensgeber Eleria gemacht. Eleonore war eine der mächtigsten Frauen des Mittelalters; Ariadne diejenige, die die Idee mit dem roten Faden hatte, der einem den Weg zurück durchs Labyrinth zeigt. Soll ich später einmal an der Spitze einer Sphäre stehen? Oder im Hintergrund bleiben und die Fäden in der Hand halten?
Auf dem Weg zurück zu unseren Quartieren lasse ich Aureljos Hand nicht los. Für ihn ist es einfach, sein Name ist eindeutig. Ein Anführer, weise und gütig wie der römische Kaiser Marc Aurel. Die Nummer 1 in der Reihung, wahrscheinlich wird das sein ganzes Leben lang so bleiben.
Kurz bevor wir die Sentinel vor dem Quartiereingang erreichen, bleibt er stehen. Neue Schneeflocken haben ihren stummen Tanz über den Kuppeln begonnen.
»Wollen wir noch spazieren gehen?« Aureljo deutet in Richtung des Atriums, der kleinen, dreieckigen Fläche, wo die Kuppeln 6a, 6b und 6c zusammenstoßen. Die Tür wird von zwei Sentinel bewacht, die jeden registrieren, der nach draußen geht.
Sie lassen uns durch, grüßend und lächelnd. Aureljo ist überall beliebt und sein verändertes Gesicht lässt die Menschen noch freundlicher auf ihn reagieren.
Wir treten hinaus und augenblicklich schneidet mir die eisige Luft in die Haut. Mein Atem formt Wolken, auf meiner Stirn landen kalte, feuchte Flocken. Am liebsten würde ich sofort zurückkehren, in die gereinigte, gewärmte Luft der Sphäre, aber Aureljo schlingt seine Arme um mich und drückt mich an sich, so fest, dass ich seinen Herzschlag spüren kann.
»Halte es aus«, sagt er leise in mein Ohr. »Nur fünf Minuten. Oder vier.«
Ich presse mich an ihn und vergrabe mein Gesicht in seiner Halsgrube. Von außen müssen wir wirken wie zwei Menschen, die nicht voneinander lassen können und einen einsamen Moment unter freiem Himmel suchen, um das Universum in seiner ganzen Unendlichkeit zu spüren.
Zum Teil stimmt das sicher. Doch vor allem will Aureljo, dass ich mir der Kälte bewusst werde, dass ich fühle, wie sich die Luft ihren Weg rau in meine Lungen bahnt, wie eisig der geschmolzene Schnee in Rinnsalen meinen Nacken hinunterläuft.
Ich verstehe, was er mir sagen will: für mich fünf Minuten, für andere ein ganzes Leben.
Ich soll mir kein Urteil anmaßen.
Aber Lu ist tot, will ich protestieren, und Raman und Curvelli. Ich löse mich von Aureljo und trete einen Schritt zurück.
»Ich weiß«, sagt er. »Ich finde es auch schrecklich. Aber wir dürfen dem Hass nicht freie Bahn lassen, sonst bestimmt er unser Denken.«
Zum ersten Mal, seit ich die furchtbare Nachricht gehört habe, möchte ich lächeln. Aureljo hat sich selbst übertroffen, er hat in meinem Gesicht gelesen, als wäre es ein Buch.
Grauko wäre stolz auf ihn.
4
3Einheiten Eiweiß, 5Einheiten Kohlehydrate, 1Einheit Fett, zeigt der Salvator an, als ich ihn zum Schlafen abnehmen will. Ich lockere die breite Manschette und wische über das handtellergroße Display. Die Buchstaben blinken rot – wenn ich nicht auf Ausgleichen gehe, wird die Information ins Medcenter geschickt. Das fehlt mir gerade noch.
Der Gedanke, jetzt noch etwas zu essen, verursacht einen Aufruhr in meinem Magen und ich beschließe, auf den Ausgleich zu pfeifen. Niemand profitiert davon, wenn ich kostbare Lebensmittel auskotze.
Das Gerät pfeift schrill und protestierend, als ich es per Knopfdruck in den Ruhemodus schalte, ohne zuvor zu tun, was es von mir verlangt.
Dann ist es still um mich herum. Ich drehe das Licht im Zimmer auf die unterste Stufe, stelle mich ans Fenster und sehe den Sentineln dabei zu, wie sie auf der Mauer ihre Rundgänge machen. Die dicken Mäntel lassen sie wie Tiere wirken, die ich nur aus Büchern kenne.
Drei Röhrchen Blut kostet mich mein Ungehorsam, von der Zeit, die ich im Medcenter verschwende, ganz abgesehen. Ich bin mitten aus einer Geologie-Lektion geholt worden und werde meine Gesteinsschichtenanalyse später nachholen müssen. Entsprechend großartig ist meine Laune.
Der Arzt, dessen Namen ich nicht kenne, hält mir drei Päckchen Eiweißkekse unter die Nase, doch bevor er seine Ansprache über die Ernährungsrichtlinien beginnen kann, springe ich vom Stuhl auf.
»Ich habe gestern eine Freundin verloren und erwarte Verständnis dafür, dass mir das den Appetit verdirbt.« Mein Ton ist scharf und ich habe nicht die geringste Absicht, ihn zu mäßigen. Der übereifrige Doktor soll ruhig merken, dass ich sauer bin, egal ob er dreimal so alt ist wie ich. Prompt beginnt er, sich zu verteidigen.
»Wir werden dafür verantwortlich gemacht, wenn einer von euch zusammenklappt«, erklärt er. »Und wenn es einer der ersten zehn ist, umso schlimmer. Ihr seid das wichtigste Kapital der Borwin-Akademie, auf euch müssen wir ein besonderes Auge haben. Aber du ersparst dir einen weiteren Besuch hier, wenn du dich an das hältst, was dir dein Salvator vorgibt.«
Ich werfe einen Blick auf die Kekse in meiner Hand. Luftdicht verpackt in blaugrauer Folie. »Niemand von uns leidet an Mangelernährung«, gebe ich zurück. »Wir werden ausgebildet, Verantwortung zu tragen, und wenn ich es für richtig halte, eine Mahlzeit auszulassen, weil ich einen schweren persönlichen Verlust erlitten habe, dann will ich, dass das respektiert wird. Mein medizinisches Wissen reicht aus, um beurteilen zu können, ob mir das schadet oder nicht.« Ich lasse ihn nicht aus den Augen. Beim nächsten Mal soll er sich genau überlegen, ob er mich herzitieren lässt wegen ein paar nicht konsumierter Kalorien.
Der Arzt rutscht unbehaglich auf seinem Stuhl herum. Es ist nicht mein Ton, der ihn aus der Ruhe bringt, es ist meine Reihung. Mit der 7 werde ich später auf jeden Fall einen hohen Posten im Sphärenbund bekleiden, er will es sich mit mir nicht verscherzen, obwohl es ihm sichtlich nicht leichtfällt, sich von einer Achtzehnjährigen abkanzeln zu lassen.
Er schluckt, blickt auf seine Hände, dann lenkt er ein. »Tut mir leid. Aber es war nicht als Schikane gedacht. Wir sorgen uns, wenn Unregelmäßigkeiten auftreten.«
»Beim nächsten Mal sorgen Sie sich bitte erst, wenn mit meinen Werten etwas nicht stimmt. Dann werde ich bereitwillig hier antanzen und mir Blut abzapfen lassen.« Ich überlege, ob ich die Kekse schwungvoll auf den Tisch werfen soll, entscheide mich aber dagegen. Ich bin schon zu weit gegangen, habe den Arzt gedemütigt, obwohl er nichts anderes getan hat, als die Vorschriften zu befolgen. Nur weil ich demonstrieren wollte, dass ich mich nicht bevormunden lasse. Nicht wegen einer solchen Kleinigkeit.
»Du bekommst deine Ergebnisse in drei Stunden«, murmelt er, ohne mir in die Augen zu sehen. »Du musst nicht herkommen, ich schicke sie auf deinen Salvator, wenn du einverstanden bist.«
»Gut.« Er hat nachgegeben, so wie ich es wollte, und nun merke ich, dass Scham in mir hochkriecht und sich in meinem Nacken festsetzt. Aureljo würde sich nie so verhalten, nie seine Position als Nummer 1 der Akademie dazu nutzen, einen anderen zurechtzuweisen. Verdammt. Ich atme tief durch und will gerade gehen, als die leise Stimme des Arztes mich innehalten lässt.
»Luria war oft bei mir. Mich trifft ihr Tod sehr. Sie wollte ein Praktikum im Medcenter beginnen, wusstest du das?«
»Nein.« Ich sehe ihn an, entschuldige mich stumm.
»So jung, so gesund«, murmelt er. »So begabt.«
Ich nicke. Unter den Augen des Doktors zeigen sich erste Ansätze von Tränensäcken und mit einem Mal möchte ich ihm über sein ordentlich gescheiteltes Haar streichen.
Er könnte mein Vater sein, wenn ich einen hätte.
Der Nachmittag gehört den Gewächshäusern in den äußeren Kuppeln 19 und 20. Die jüngeren Studenten suchen die Pflanzen auf Schädlinge ab, während wir Stichproben für die chemische Analyse vorbereiten.
Ich stehe zwischen Tudor und Aureljo, die heute ungewöhnlich schweigsam sind. Jedes Mal, wenn auf der Galerie, die sich hoch über unseren Köpfen an die Wände schmiegt, Sentinel in unser Sichtfeld kommen, hebt Tudor den Kopf. Ich weiß, wonach er Ausschau hält, aber der farblose Sentinel ist mir seit gestern Nachmittag nicht wieder begegnet.
»Warum fragst du nicht Morus?«, erkundige ich mich, als Tudors Blick einmal mehr hochzuckt, wie elektrisiert vom Geräusch der Schritte über uns.
»Was?«
»Morus. Deinen Mentor. Er wird wissen, was es bedeutet, wenn ein Sentinel keine Farben trägt, er wird es dir –«
»Lass das! Hör auf, so zu tun, als wüsstest du, was in meinem Kopf vorgeht!«
Diese heftige Reaktion habe ich tatsächlich nicht kommen sehen und weiche einen Schritt zurück, was Tudor mit Genugtuung zur Kenntnis nimmt.
Sofort ist Aureljo an meiner Seite. »Achte auf deinen Ton, ja? Ria war freundlich, du hast kein Recht, sie anzuschreien.«
Wieder Schritte über uns. Tudor hat seine Augen immer noch auf mich gerichtet und ich kann beinahe fühlen, wie schwer es ihm fällt, nicht nach oben zu blicken.
»Warum fragst du ihn nicht einfach?«, wiederhole ich.
Tudor schüttelt den Kopf. Richtet seine Aufmerksamkeit wieder auf die Tomatenpflanze, die er gerade untersucht. Etwas an seiner Haltung lässt mich vermuten, dass er nicht fragen will, weil er die Antwort bereits kennt.
Die Sentinel haben bereits mehrfach ihre Runde über den Steg an der Kuppelinnenseite gemacht, als ein Mädchen sich einen Weg durch die Bepflanzungsreihen bahnt und auf mich zusteuert. Sie ist jünger als wir, fünfzehn, höchstens sechzehn, und ich kenne sie vom Sehen, aus einer der Gemeinschaftsküchen in den äußeren Quartieren.
»Ria!« Sie winkt, schenkt Aureljo ein strahlendes Lächeln und Tudor ein schüchternes, bevor sie mich am Arm nimmt. »Sie brauchen dich auf der Auffangstation. Es sind drei diesmal, zwei davon noch ziemlich klein. Terissa möchte, dass du kommst.«
Ich wische meine erdigen Hände an einem Leinentuch ab und folge dem Mädchen, dessen geflochtener Zopf auf seinem Rücken hin- und herschwingt. Rotes Haar. Selten wie Sonnenschein.
Die Auffangstation ist in Kuppel 2d untergebracht, nicht weit von den Quartieren der Sentinel. Sie sind es, die die winzigen Bündel während der Patrouillengänge finden, sie in ihre dicken Mäntel wickeln, mit ihren Körpern wärmen und in die Sphäre bringen.
Eine der Kinderschwestern hält mir die Tür auf, sie lächelt und sagt etwas, das ich nicht verstehen kann, so laut ist das Gebrüll hinter ihr.
»Es sind drei«, wiederholt sie auf meine Nachfrage hin. »Zwei Jungen, ein Mädchen.«
Ich gehe in den Raum, in dem ich mit den Kleinen allein sein und sie kennenlernen kann. Hierher komme ich gern, alles erinnert mich an meine Kindheit: alte Polstermöbel, Teppiche, an den Wänden Bilder von grünen Pflanzen unter einer hellen Sonne. Ein ähnliches Bild gab es in der Sphäre Neu-Colonia, wo ich aufgewachsen bin. Es hing an der Wand schräg gegenüber von meinem Bett und zeigte eine weite Fläche voller Blumen, die sehr hoch und sehr gelb waren. Sonnenblumen nannte Baja sie und ich fand den Namen wunderschön, auch wenn er natürlich erfunden war.
Die Schwester bringt mir das brüllende Kind als Erstes, es windet sich, als sie es mir in die Arme legt. Dunkle Locken kleben an seiner Stirn, in dem aufgerissenen Mund kann ich noch keine Zähne entdecken. Das Gesicht ist rot wie ein Warnlicht, die Fäuste rudern gefährlich nah an meiner Nase vorbei.
Ein Mädchen. Fünf Monate, vielleicht sechs. Mager.
»Hat sie getrunken?«, frage ich die Kinderschwester, die schon wieder halb aus der Tür ist.
»Ja. Eine ganze Einheit. Dafür hat sie sogar kurz mit dem Schreien aufgehört.«
Babys zu lesen ist schwierig. Sie verstellen sich nicht, kein Stück. Doch es sind gerade die Fehler, die winzigen Ungereimtheiten der Verstellung, die am meisten aussagen.
Das Mädchen in meinen Armen schreit, während ich mit ihm spreche, ihm den Bauch massiere, mit ihm durch den Raum gehe. Ihre Haut ist warm und sie krümmt sich nicht, sie schreit nicht vor Schmerz. Doch egal, was ich tue, sie hört nicht auf, denn ich bin die Falsche. Das Kind schreit nach seiner Mutter und es wird weiterschreien, bis es vor Erschöpfung einschläft.
Ich schaukle es, singe und küsse das rote, verkrampfte Gesicht. »Sie hat dich weggegeben, damit du es gut hast. Warm, sicher und geborgen. Wir kümmern uns um dich, mach dir keine Sorgen.« Ich spreche mit der Kleinen, als würde sie mich verstehen, wiege sie und erzähle ihr von den Spielkuppeln in der Sphäre Neu-Colonia, wo die Kinder klettern, sich Höhlen bauen oder Wände bemalen dürfen. Irgendwann hört sie auf zu schreien und sieht mich an.
»Du wirst nicht allein sein«, sage ich zu ihr. »Nie wieder wirst du im Schnee liegen und frieren und die Wölfe heulen hören. Du bist jetzt eine von uns.«
Sie schließt die Augen, ihre Fäuste lockern sich. Es ist sicher nicht meine Stimme, die das bewirkt, sondern die Erschöpfung. Trotzdem.
Als Terissa hereinkommt und mich fragend ansieht, so wie sie es jedes Mal tut, habe ich meine Entscheidung getroffen. »Schick sie zu Baja, dort passt sie hin.« Ich drücke ihr das schlummernde Mädchen in die Arme, streiche ihm eine Haarsträhne aus der Stirn. Baja wird sie mit ihrer Wärme umfangen, so wie sie das bisher bei allen getan hat, uns Vitros und den Aufgelesenen, ohne Unterschied. Von anderen Ziehmüttern habe ich gehört, dass sie die Vitros bevorzugen, als wäre künstlich gezeugtes Leben wertvoller. Jemand Besseres als Baja kann der Kleinen nicht passieren.
Mit den beiden Jungen ist es viel einfacher. Der eine quietscht die ganze Zeit vor Vergnügen und reißt mir büschelweise Haare aus, der andere schmiegt sich an mich und schläft innerhalb von Minuten ein.
»Der Erste könnte sich in der Sphäre Bozen wohlfühlen«, empfehle ich Terissa, als sie ihren Kopf wieder durch die Tür steckt. »Der Zweite sollte eventuell nach Spessart 3 oder nach Neu-Konstanz, die ruhige Atmosphäre dort wird ihm gefallen, denke ich.« Ich lege ihr vorsichtig das schlafende Kind in die Arme, das sich kurz regt, aber nicht aufwacht.
»Danke«, flüstert Terissa und trägt den Jungen hinaus.
Ich bleibe noch einen Moment sitzen, atme den Babygeruch ein und frage mich, warum ich mich nicht zufriedener fühle. Ich habe die drei Kleinen nach bestem Wissen zugeteilt, etwas, das ich schon oft getan habe. Beim ersten Mal war ich zwölf. Bisher habe ich fast immer richtiggelegen, nur zwei der Kinder, die durch meine Hände gingen, mussten später umgesiedelt werden.
Das schreiende Mädchen geht mir nicht aus dem Kopf. Seine wütende Verzweiflung, seine Einsamkeit.
Nur die Ruhe, sage ich mir. Du hast für sie getan, was du konntest. Sie wird es warm haben und nicht hungern, und wenn sie begabt ist, wird sie die gleichen Chancen haben wie ein Vitro. Aus Kindern, die vom Sphärenbund aufgezogen werden, wird das Beste herausgeholt.
Und außerdem, versuche ich mich zu beruhigen, hast du sie zu Baja geschickt, die sie lieben und verwöhnen und sie gleichzeitig fördern wird. So wie sie es bei dir getan hat.
Auch dieser Gedanke sticht. Es dauert eine Sekunde, bis ich begreife, dass es Sehnsucht ist. Nach der Sphäre meiner Kindheit, dem Geruch der Küche, des Studierzimmers, der frischen Bettwäsche. Nach Baja. Wenn ich könnte, würde ich mit dem sechs Monate alten Mädchen tauschen.
Vor der Auffangstation sitzt Tomma auf dem Mäuerchen, das den Gehweg von den Schienen für die Transportkarren trennt. Es hat ganz den Anschein, als würde sie auf mich warten.
»Sie haben mich für heute freigestellt«, erklärt sie.
Beim Näherkommen bemerke ich ihre geschwollenen Lider und die roten Äderchen im Weiß ihrer Augen. Sie muss geweint haben. Ihre Nase läuft noch immer.
»Was ist passiert?«
»Nichts. Ich … ich muss mich beim letzten Außengang erkältet haben«, murmelt sie und hustet ein wenig, als wollte sie mir etwas beweisen.
Ich setze mich neben sie. Lege einen Arm um ihre Schultern, die sofort zu beben beginnen.
»Nachdem du weg warst, haben wir weitergearbeitet. Es lief wunderbar, die Analyseergebnisse waren so vielversprechend, der Weißkohl wird so gut wie noch nie.«
Wenn Tomma das sagt, kann man die Hand dafür ins Feuer legen. Sie kann aus Pflanzen lesen wie ich aus Menschen.
»Aber dann …« Sie senkt den Blick. »Dann dachte ich, ich sehe Lu. Links, bei den Tomatenstauden. Ich wollte auf sie zulaufen, da hat sie sich umgedreht und … es war bloß ein Mädchen, das ihr von hinten ähnlich sah. Ich … ich habe zu weinen begonnen. Einfach so. Konnte nicht mehr aufhören.« Ein Tropfen fällt auf ihre Hose, malt einen dunkelgrünen Punkt auf den hellgrünen Stoff. Grün, das wir alle tragen, um an das fruchtbare Land zu erinnern, das es nicht mehr gibt. Ich drücke sie fester an mich.
»Was, glaubst du, haben sie mit ihr gemacht?« Die Tränen fallen weiter, doch ihre Stimme klingt klar.
»Ich weiß es nicht.«
»Wieso sagt uns niemand etwas? Wenn wir wenigstens wüssten, welcher Clan sie getötet hat!«
Daraus würden wir einiges schließen können, aber vielleicht ist es besser, wenn wir es nicht wissen. So schlafen wir ruhiger.
Als ich klein war, erzählten die älteren Kinder uns nachts Geschichten über die Clans und Stämme, um uns Albträume zu bescheren. Dass die Nachtläufer die Zähne ihrer getöteten Feinde in alte Rohre füllen und auf diese Weise Rasseln bauen, die sie für ihre Kriegsrituale verwenden. Dass die Weißen Greifer sich in Schneehöhlen verbergen, verirrte Wanderer zu sich hinabzerren und ersticken. Dass der Clan Schwarzdorn seine Kinder nackt durch Dornenhecken treibt und nur die Überlebenden großzieht. Über die Schlitzer wurde nichts erzählt – da genügte schon die Erwähnung des Namens, um uns alle in Tränen ausbrechen zu lassen.
Wenn wir am nächsten Tag zu unseren Zieheltern liefen und uns beklagten, dann trösteten sie uns, doch kein einziges Mal bezeichneten sie das Erzählte als Unsinn. Nicht einmal Baja. Sie knöpfte sich die Größeren zwar vor, doch über die Geschichten verlor sie kein Wort.
»Sie haben die Särge nicht geöffnet«, flüstert Tomma, »damit wir nicht sehen, dass ihnen die Zähne und die Ohren fehlen. Oder dass sie … zerquetscht wurden.« An ihrer Hand klebt noch Erde, die sie nun im Gesicht verschmiert, als sie sich die Tränen von den Wangen wischt. »Es gibt einen Clan im Osten, der mit schweren Steinen … mit großen Steinen Menschen zerdrückt, als wären sie Schaben.«
»Unsinn«, entgegne ich energisch. Wäre unsere Expedition ihnen zum Opfer gefallen, hätte nicht nur ein leerer Sarg auf dem Podium gestanden, sondern drei. Das behalte ich jedoch für mich.
»Ich bin sicher, sie sind schnell gestorben«, versuche ich, sie zu beruhigen. »Sonst hätten die Sentinel noch eingreifen können. Der Überfall muss überraschend gekommen und in wenigen Sekunden vorbei gewesen sein.«
Tomma glaubt mir, weil sie mir glauben will. Sie schnieft getröstet und verwischt weitere Erde in ihrem Gesicht. »Du hast recht.« Mit einem Ruck stößt sie sich von dem Mäuerchen ab, hält einen Moment inne und dreht sich dann zu mir um. »Ich werde die Sphäre nicht mehr verlassen, nicht, solange da draußen noch Prims herumlaufen. Die gehören weg. Alle.«
5
Ich gehe nicht zu den Gewächshäusern zurück, sondern direkt in mein Quartier, wo ich mich auf dem Bett ausstrecke und die Augen schließe. Die letzten Wochen waren hart, wir sind alle angespannt, das ist sicherlich auch ein Grund für Tommas harte Worte. Wir hätten die Entscheidungen, die anstehen, gerne schon hinter uns. Es wird nicht mehr lange dauern bis zu unserem Abschluss. Die Akademie verlassen, eine Laufbahn wählen aus den Möglichkeiten, die uns vorgelegt werden. Je kleiner die Zahl, desto schwerer die Wahl, sagt Zilla immer. Ich war viel zu lange nicht mehr bei ihr, dabei könnte ich psychologische Unterstützung im Moment gut gebrauchen. Die 7 ist ziemlich klein.
Mein Hunger auch. Trotzdem, und weil ich mein Versäumnis von gestern wiedergutmachen will, stehe ich noch einmal auf, halte den Salvator unter den Scanner und warte auf das Piepsen, das anzeigt, dass er alle wichtigen Daten gelesen hat und diese nun an die Küche schickt. Dann erst lege ich mich wieder aufs Bett.
Draußen, auf der Mauer, ziehen die Sentinel ihre Kreise. Ihr Anblick hat mich schon als Kind beruhigt und ich spüre, wie meine Lider schwer werden.
Dass ich eingeschlafen bin, wird mir aber erst klar, als der schrille Ton meiner Türklingel mich weckt. Ich nehme der Küchenhilfe das Tablett aus der Hand, sage ein paar Worte, an die ich mich Sekunden später nicht mehr erinnere, und stelle das Essen auf den Tisch. Dort liegen noch die Geschichtsbücher, die ich morgen in die Bibliothek zurückbringen muss. Kostbare alte Werke, echtes Papier. Der Zweite Weltkrieg 1939–1945. Der Nahostkonflikt. Die Wasserkriege 2036–2040. Die Sphärenattentate 2092.
»Wenn wir regieren wollen, müssen wir wissen, welchen Gefahren es auszuweichen gilt«, sagt Aureljo oft. Er weiß alles über die Kriege: wann und warum sie begonnen haben, wer davon profitiert und wer besonders darunter gelitten hat.
Regieren nennt es Aureljo, herrschen Tudor, und es beeindruckt ihn gar nicht, wie oft Herrscher im Laufe der Geschichte einen Kopf kürzer gemacht worden sind.
In meinem Essensbehälter finde ich Gemüsebrei, ein Stück Huhn und einen großen Klacks gekochte Weizenkörner. Kein Gebäck – der letzte Transport, der Mehl hätte bringen sollen, wurde von Prims geplündert.
Ich esse alles auf und schicke den leeren Behälter zurück. Jetzt habe ich frei. Endlich. Ich stelle die Geschichtsbücher weg und lade mir einen Roman auf mein Terminal, einen von früher. Ich liebe die Beschreibungen von Tieren, von frei stehenden Häusern, von Wiesen – und alles leuchtet in sonnenbeschienenen Farben. Eines Tages wird es wieder so sein. Es heißt, wenige Hundert Kilometer südlich von hier beginnt der Schnee zu schmelzen, monatelang liegt der Boden frei, jeden Sommer ein bisschen mehr.
Ich habe kaum fünf Seiten gelesen, da summt die Kommunikationsanlage.
»Besuch«, vermeldet der diensthabende Sentinel.
Jetzt noch? »Wer ist es?«
»Nur ich«, sagt eine andere, wärmere Stimme. Aureljo.
»Sie können öffnen.«
Ich höre Aureljo die Treppen hinauflaufen und erwarte ihn an der Tür, schlinge meine Arme um ihn und ziehe ihn ins Zimmer.
»Ich dachte, du kommst noch mal zurück«, sagt er atemlos. »Ich habe mir Sorgen gemacht.«
Meine Hände streicheln sein Gesicht, vermeiden die Narben am Haaransatz, vermissen das Muttermal neben dem Auge. »In der Auffangstation hat es länger gedauert. Danach wollte ich lieber allein sein.«
Er legt einen Arm um meine Schultern und zieht mich zum Sofa. »Erzähl mir von den Kindern.«
Sein Interesse ist echt, immer. Nicht nur, wenn es um mich geht. Aureljo umfängt die Menschen mit seiner Aufmerksamkeit und hüllt sie darin ein, weshalb er auf die meisten wie ein Magnet wirkt. Es kostet ihn keine Mühe, denn es ist seine Natur. Ich kenne niemanden, der nicht gern in seiner Nähe ist, und ich frage mich immer wieder, wieso er gerade mich liebt.
Ich lege meinen Kopf an seine Schulter. »Es waren drei. Zwei Jungen, die sich wunderbar zurechtfinden werden. Fröhlich und zufrieden. Das Mädchen dagegen wird Zeit brauchen. Ich habe es nach Neu-Colonia geschickt.«
»Das war sicher richtig.« Aureljos Hand spielt mit meinem Haar. »Waren sie gut ernährt?«
»Zu dünn, alle drei.«
Sein Brustkorb hebt sich, er seufzt. »Weißt du was, Ria? Ich kann es kaum erwarten, die Akademie abzuschließen. Wir werden an Schlüsselstellen sitzen und dann werden wir die Welt verändern.«
Liegt mein Kopf so wie jetzt auf seiner Schulter, kann ich seine Worte gleichzeitig hören und spüren. Schließe ich dabei noch die Augen, glaube ich sie sogar. Wir werden Lösungen für alle Probleme finden: Essen, Wärme, Sicherheit. Keine unterernährten Kinder mehr, die im Schnee ausgesetzt werden. Keine Überfälle auf Studenten mehr, die nach neuen Nahrungsquellen forschen. Aureljo glaubt daran und ich denke oft, dass er an erster Stelle gereiht ist, weil er diesen Glauben auf andere übertragen kann. Nicht so sehr, weil ihm jemand zutraut, diese hochgesteckten Ziele wirklich zu erreichen.
»Soll ich heute Nacht hierbleiben?«, murmelt er.
Ich überlege kurz, dann schüttle ich den Kopf. »Ich bin keine gute Gesellschaft im Moment. In meinem Kopf ist so viel, das ich ordnen möchte.« Dass ich außerdem allein sein will, mit der Nacht außerhalb der Kuppel, den lautlos herabsinkenden Schneeflocken und den Schatten der Sentinel, die draußen ihre Runden ziehen, das behalte ich für mich.
Später, als Aureljo fort ist, bereue ich meine Entscheidung. Der Roman mit all seinem Sonnenschein und den Problemen einer längst vergangenen Welt macht mich wider Erwarten traurig. Ich lade ein anderes Buch herunter, einen Kriminalroman, in dem es um eine Mordserie in Sphäre Neu-Berlin 1 geht, doch die Geschichte ist flach und vorhersehbar. Also spare ich Energie, schalte das Licht neben meinem Bett aus und versuche zu schlafen.
Am darauffolgenden Tag sind wir mitten im Körpertraining, als mir die abgelaufene Leihfrist wieder einfällt. Wenn ich die Bücher nicht innerhalb der nächsten halben Stunde in die Bibliothek zurückbringe, verliere ich das Privileg, alte Werke mit in mein Quartier nehmen zu dürfen. Außerdem bedeutet es ein Wochenende lang Ordnerdienst. Zurückgegebene Bücher einsortieren, Regale putzen, Leseterminals auf unerlaubte Dateien hin überprüfen. Und all das in der grell orangefarbenen Ordneruniform, zur Unterhaltung der jüngeren Jahrgänge.
Ich überhole Tomma, die vor mir ihre Runden dreht, lege die Gewichtsmanschetten ab, die ich um Handgelenke und Fußknöchel trage, dann sprinte ich – mit einem Mal viel leichter – auf dem kürzesten Weg durch die Kuppeln 5 und 7 zu meinem Quartier.
Wenn ich mich beeile, halte ich nicht nur den Rückgabetermin ein, sondern bin auch pünktlich zum Mittagessen in der Mensa. Mein Salvator wird keinen Grund haben, eine Meldung zu schicken, und alle sind zufrieden.
Alte Bücher bekommt man nur in einer Schatulle aus Metall ausgehändigt, in der man sie aufbewahren und transportieren soll. Ich klemme mir den schweren und unhandlichen Kasten unter den linken Arm, so geht es, obwohl die Kanten sich unangenehm in meine Achselhöhle drücken.
Wenn ich die Wahl zwischen kostbarem, bedrucktem Papier und einem Download auf mein Datenterminal habe, entscheide ich mich meistens für das Buch, auch wenn es unpraktischer ist. Besonders dann, wenn es um Geschichte geht. Die Seiten vermitteln den Eindruck, als hätten sie all das, was auf ihnen geschrieben steht, selbst miterlebt. Andere haben lange vor mir ihren Blick auf die gleichen Zeilen gerichtet und manchmal kommt es mir so vor, als könnte ich ihre Gedanken hören.
Das Buch über die Wasserkriege hat auch Lu gelesen, vor ungefähr zwei Monaten, sie hat mir kopfschüttelnd davon erzählt. So weit kann es heute nicht mehr kommen, nicht, solange der Sphärenbund besteht, hat sie gesagt. Wenn ich den ausgebleichten Buchrücken berühre, um den auch sie ihre Hände gelegt hat, ist es, als könnte ich Kontakt zu ihr aufnehmen.
Ich bin schneller gewesen als vermutet, ich werde es rechtzeitig schaffen. Vorbei am Medcenter, das die ganze Kuppel 7 für sich beansprucht, vorbei an den inneren Quartieren. Da ist die Bibliothek, ich habe noch Luft, nehme zwei Stufen auf einmal und erreiche die Rückgabestelle fünf Minuten vor Ablauf der Frist.
Eine der jüngeren Studentinnen nimmt die Bücher entgegen, legt sie auf das Lesegerät, dessen Licht vier Mal grün aufleuchtet. »Gerade noch so«, meint sie. »Willst du dir etwas Neues raussuchen?«
Nein, nicht heute. Ich schüttle den Kopf und schlage den Weg zu den Lesesälen ein. Durch den hinteren Ausgang ist es kürzer zur Akademie.
»Nicht dort entlang«, ruft die Ordnerin mir nach. »Es ist abgesperrt, die kleinen Lesesäle und Bücherspeicher werden renoviert!«
Seufzend mache ich kehrt. Von hier aus noch mal zum Hauptausgang zu gehen, bedeutet einen riesigen Umweg.
Nachdem ich um die nächste Ecke bin, sieht die diensthabende Studentin mich allerdings nicht mehr. Es ist nur eine kleine Verletzung der Regeln. Ich werde nichts anfassen und nichts schmutzig machen.
In dem Gang, der zu einer der Hintertreppen führt, ist es kalt und wie ausgestorben. Leitern lehnen an den Wänden, daneben stapeln sich leere Behälter, in denen sich einmal hellgrüne Farbe befunden hat. Eine große Kunststoffwanne, voll mit Schutt, steht neben der Treppe, die ich hinuntergehen will. Ich setze meinen Fuß auf die erste Stufe und halte mitten in der Bewegung inne. Hinter mir höre ich eine Stimme, zwar unterdrückt, aber trotzdem sehr deutlich. Und sehr ungehalten.
»… für eine Besprechung nicht der richtige Ort!«
Ich drehe mich um, aber da ist niemand. Die Stimme muss aus einem der frisch renovierten Räume kommen und ich glaube zu wissen, wem sie gehört. Diese Art, die harten Konsonanten auszuspucken, kenne ich von Gorgias.
»Es ist für den Anlass der denkbar beste Ort.« Die Stimme, die antwortet, kenne ich nicht. Keiner meiner Mentoren, so viel ist sicher. Sie klingt verhalten, fast wie ein Zischen, und ungeduldig.
Ich versuche herauszufinden, hinter welcher der Türen die beiden Männer sich befinden – noch nie habe ich Gorgias so reden gehört. Hektisch, unwillig, als würde er unter Druck gesetzt. Seine Unruhe steckt mich an. Ist die Akademie vielleicht in Schwierigkeiten? Ist die Regierung des Sphärenbundes mit den Ergebnissen, die wir liefern, unzufrieden?
Vorsichtig setze ich einen Fuß vor den anderen, dankbar, dass ich noch immer meine Laufschuhe trage. Meine Schritte sind lautlos.
Dann eine dritte Stimme, deren Sprecher ich unzweifelhaft erkenne: Morus.
»Lassen Sie uns zur Sache kommen«, verlangt er.
Sie müssen in dem Raum hinter der weiß gestrichenen Tür sein, von mir aus gesehen ist es die zweite von links. Sie ist zu, aber das Schloss ist noch nicht wieder eingesetzt, durch die Öffnung dringt jedes gesprochene Wort bis zu mir. Etwas stimmt nicht – und einen Moment später weiß ich, was es ist. Gorgias’ persönliche Sentinel fehlen. Wie Wachtürme stehen sie normalerweise vor jedem Raum, in dem er sich aufhält. Um seine Wichtigkeit zu betonen, wie Tudor meint.
»Wir haben es mit einer Verschwörung zu tun.« Wieder die raspelnde Stimme des Unbekannten. »Der Präsident nimmt den Fall sehr ernst. Er will, dass es schnell erledigt wird.«
»Wie ich Ihnen vorhin schon gesagt habe, ist das Unsinn!«, braust Gorgias auf. »An meiner Akademie gibt es keine Verschwörung, hier studiert die Elite des gesamten zentraleuropäischen Sphärenbundes. Der Präsident selbst hat diese Schule absolviert!«
Das Wort hat sich sofort in mir festgehakt. Verschwörung. Im ersten Moment will alles in mir Gorgias zustimmen – niemand hier würde sich gegen den Sphärenbund wenden. Im Gegenteil, wir fiebern alle dem Tag entgegen, an dem wir endlich das einsetzen können, was wir an der Akademie gelernt haben. Wir wollen die bewohnbare Welt vergrößern, verbessern, verstärken. Nicht zerstören.
Andererseits … ich kenne auch nicht jeden Einzelnen hier. Für die breite Masse kann ich meine Hand nicht ins Feuer legen.
»Das wäre ein Skandal«, murmelt Morus. »Unvorstellbar, Sie müssen sich irren –«
»Es ist völlig nebensächlich, was Sie für vorstellbar halten und was nicht«, zischt der Unbekannte. »Wir haben es mit einem Plan zu tun, der den gesamten Bund zerstören könnte. Was wir erfahren haben, übersteigt die Befürchtungen der Regierung bei Weitem.«
»Aber … das …« Gorgias stammelt nur noch.
Ich kann ihn verstehen, meine eigene Kehle ist trocken und wie zugedrückt, etwas ganz weit hinten könnte zu einem Hustenreiz werden. Doch das darf nicht passieren, ich muss hören, worin genau die Gefahr besteht, die uns droht.
Gorgias scheint sich wieder gefasst zu haben. Als er nun spricht, klingt seine Stimme lauter und viel energischer. »Das ist unmöglich. Alle meine Studenten sind dem Sphärenbund treu ergeben. Sie absolvieren regelmäßig psychologische Tests, wir stellen sie bei Auswärtsmissionen auf die Probe, wir wissen, worüber sie sich unterhalten und was sie bewegt. Eine Verschwörung wäre von uns enttarnt worden, bevor sie dem Präsidenten zu Ohren hätte kommen können.«
Etwas an Gorgias’ Verteidigungsrede irritiert mich. Ich brauche einen Augenblick, bis ich es zu fassen bekomme. Wir wissen, worüber sie sich unterhalten. Tatsächlich? Woher?
Das werde ich nachher mit Aureljo besprechen, unter vier Augen – hoffe ich wenigstens –, doch jetzt beansprucht das gedämpfte Lachen des Unbekannten meine ganze Aufmerksamkeit.
»Ich zweifle nicht daran, dass Sie gut informiert sind. Aber unsere Quellen sind doch ein wenig vielfältiger. Der Verdacht, den ich angesprochen habe, besteht schon längere Zeit. Nun hat er sich bestätigt.«
Eine Pause entsteht, in der ich mein Herz klopfen hören kann. Wenn der Fremde recht hat und es Verräter an der Akademie gibt, kenne ich sie wahrscheinlich. Zumindest vom Sehen, vom Einanderzunicken auf den Gängen. Oder wir haben in der Mensa gemeinsam angestanden.