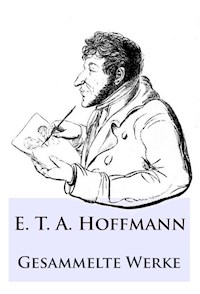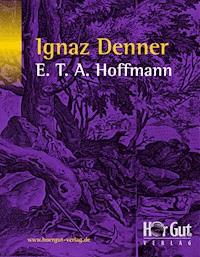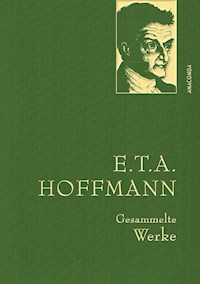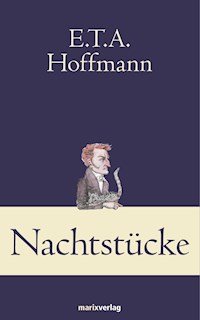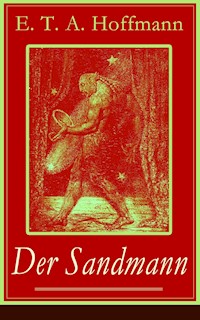3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein böses Verhängnis in Gestalt eines Teufelselixiers treibt den Kapuzinermönch zu wahnsinniger Liebe und Mord. Fantastisch, metaphysisch und gruselig, aber mitunter auch lustig geht es zu in diesem Meisterwerk deutscher Romantik.
Coverbild: © brullikk / Shutterstock.com
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Die Elixiere des Teufels
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenZum Buch + Vorwort des Herausgebers
Zum Buch
Die Elixiere des Teufels
E. T. A. Hoffmann
Coverbild: © brullikk / Shutterstock.com
Vorwort des Herausgebers
Gern möchte ich dich, günstiger Leser, unter jene dunklen Platanen führen, wo ich die seltsame Geschichte des Bruders Medardus zum ersten Male las. Du würdest dich mit mir auf dieselbe in duftige Stauden und buntblühende Blumen halbversteckte steinerne Bank setzen; du würdest so wie ich recht sehnsüchtig nach den blauen Bergen schauen, die sich in wunderlichen Gebilden hinter dem sonnichten Tal auftürmen, das am Ende des Laubganges sich vor uns ausbreitet.
Aber nun wendest du dich um und erblickest kaum zwanzig Schritte hinter uns ein gotisches Gebäude, dessen Portal reich mit Statuen verziert ist. Durch die dunklen Zweige der Platanen schauen dich Heiligenbilder recht mit klaren, lebendigen Augen an; es sind die frischen Freskogemälde, die auf der breiten Mauer prangen.
Die Sonne steht glutrot auf dem Gebirge, der Abendwind erhebt sich, überall Leben und Bewegung. Flüsternd und rauschend gehen wunderbare Stimmen durch Baum und Gebüsch; als würden sie steigend und steigend zu Gesang und Orgelklang, so tönt es von ferne herüber.
Ernste Männer, in weit-gefalteten Gewändern, wandeln, den frommen Blick emporgerichtet, schweigend durch die Laubgänge des Gartens. Sind denn die Heiligenbilder lebendig worden und herabgestiegen von den hohen Simsen?
Dich umwehen die geheimnisvollen Schauer der wunderbaren Sagen und Legenden, die dort abgebildet; dir ist, als geschähe alles vor deinen Augen, und willig magst du daran glauben.
In dieser Stimmung liesest du die Geschichte des Medardus, und wohl magst du auch dann die sonderbaren Visionen des Mönchs für mehr halten als für das regellose Spiel der erhitzten Einbildungskraft.
Da du, günstiger Leser, soeben Heiligenbilder, ein Kloster und Mönche geschaut hast, so darf ich kaum hinzufügen, dass es der herrliche Garten des Kapuzinerklosters in B. war, in den ich dich geführt hatte.
Als ich mich einst in diesem Kloster einige Tage aufhielt, zeigte mir der ehrwürdige Prior die von dem Bruder Medardus nachgelassenen, im Archiv aufbewahrten Papiere als eine Merkwürdigkeit, und nur mit Mühe überwand ich des Priors Bedenken, sie mir mitzuteilen.
Eigentlich, meinte der Alte, hätten diese Papiere verbrannt werden sollen.
Nicht ohne Furcht, du werdest des Priors Meinung sein, gebe ich dir, günstiger Leser, nun das aus jenen Papieren geformte Buch in die Hände.
Entschließest du dich aber, mit dem Medardus, als seist du sein treuer Gefährte, durch finstre Kreuzgänge und Zellen – durch die bunte – bunteste Welt zu ziehen und mit ihm das Schauerliche, Entsetzliche, Tolle, Possenhafte seines Lebens zu ertragen, so wirst du dich vielleicht an den mannigfachen Bildern der Camera obscura, die sich dir aufgetan, ergötzen.
Es kann auch kommen, dass das gestaltlos Scheinende, so wie du schärfer es ins Auge fassest, sich dir bald deutlich und rund darstellt. Du erkennst den verborgenen Keim, den ein dunkles Verhängnis gebar und der, zur üppigen Pflanze emporgeschossen, fort und fort wuchert in tausend Ranken, bis eine Blüte, zur Frucht reifend, allen Lebenssaft an sich zieht und den Keim selbst tötet.
Nachdem ich die Papiere des Kapuziners Medardus recht emsig durchgelesen, welches mir schwer genug wurde, da der Selige eine sehr kleine, unleserliche mönchische Handschrift geschrieben, war es mir auch, als könne das, was wir insgemein Traum und Einbildung nennen, wohl die symbolische Erkenntnis des geheimen Fadens sein, der sich durch unser Leben zieht, es festknüpfend in allen seinen Bedingungen, als sei der aber für verloren zu achten, der mit jener Erkenntnis die Kraft gewonnen glaubt, jenen Faden gewaltsam zu zerreißen und es aufzunehmen mit der dunklen Macht, die über uns gebietet.
Vielleicht geht es dir, lieber Leser, wie mir, und das wünschte ich denn aus erheblichen Gründen recht herzlich.
Erster Teil
Erster Abschnitt: Die Jahre der Kindheit und das Klosterleben
Nie hat mir meine Mutter gesagt, in welchen Verhältnissen mein Vater in der Welt lebte; rufe ich mir aber alles das ins Gedächtnis zurück, was sie mir schon in meiner frühesten Jugend von ihm erzählte, so muss ich wohl glauben, dass es ein mit tiefen Kenntnissen begabter lebenskluger Mann war.
Eben aus diesen Erzählungen und einzelnen Äußerungen meiner Mutter über ihr früheres Leben, die mir erst später verständlich worden, weiß ich, dass meine Eltern von einem bequemen Leben, welches sie im Besitz vieles Reichtums führten, herabsanken in die drückendste bitterste Armut und dass mein Vater, einst durch den Satan verlockt zum verruchten Frevel, eine Todsünde beging, die er, als ihn in späten Jahren die Gnade Gottes erleuchtete, abbüßen wollte auf einer Pilgerreise nach der Heiligen Linde im weitentfernten kalten Preußen.
Auf der beschwerlichen Wanderung dahin fühlte meine Mutter nach mehreren Jahren der Ehe zum ersten Mal, dass diese nicht unfruchtbar bleiben würde, wie mein Vater befürchtet, und seiner Dürftigkeit unerachtet war er hocherfreut, weil nun eine Vision in Erfüllung gehen sollte, in welcher ihm der heilige Bernardus Trost und Vergebung der Sünde durch die Geburt eines Sohnes zugesichert hatte.
In der Heiligen Linde erkrankte mein Vater, und je weniger er die vorgeschriebenen beschwerlichen Andachtsübungen seiner Schwäche unerachtet aussetzen wollte, desto mehr nahm das Übel überhand; er starb entsündigt und getröstet in demselben Augenblick, als ich geboren wurde.
Mit dem ersten Bewusstsein dämmern in mir die lieblichsten Bilder von dem Kloster und von der herrlichen Kirche in der Heiligen Linde auf. Mich umrauscht noch der dunkle Wald – mich umduften noch die üppig aufgekeimten Gräser, die bunten Blumen, die meine Wiege waren.
Kein giftiges Tier, kein schädliches Insekt nistet in dem Heiligtum der Gebenedeiten; nicht das Sumsen einer Fliege, nicht das Zirpen des Heimchens unterbricht die heilige Stille, in der nur die frommen Gesänge der Priester erhallen, die, mit den Pilgern, goldne Rauchfässer schwingend, aus denen der Duft des Weihrauchopfers emporsteigt, in langen Zügen daherziehen.
Noch sehe ich mitten in der Kirche den mit Silber überzogenen Stamm der Linde, auf welche die Engel das wundertätige Bild der heiligen Jungfrau niedersetzten. Noch lächeln mich die bunten Gestalten der Engel – der Heiligen – von den Wänden, von der Decke der Kirche an!
Die Erzählungen meiner Mutter von dem wundervollen Kloster, wo ihrem tiefsten Schmerz gnadenreicher Trost zuteil wurde, sind so in mein Innres gedrungen, dass ich alles selbst gesehen, selbst erfahren zu haben glaube, unerachtet es unmöglich ist, dass meine Erinnerung so weit hinausreicht, da meine Mutter nach anderthalb Jahren die heilige Stätte verließ.
So ist es mir, als hätte ich selbst einmal in der öden Kirche die wunderbare Gestalt eines ernsten Mannes gesehen und es sei eben der fremde Maler gewesen, der in uralter Zeit, als eben die Kirche gebaut, erschien, dessen Sprache niemand verstehen konnte und der mit kunstgeübter Hand in gar kurzer Zeit die Kirche auf das Herrlichste ausmalte, dann aber, als er fertig worden, wieder verschwand.
So gedenke ich ferner noch eines alten fremdartig gekleideten Pilgers mit langem grauem Barte, der mich oft auf den Armen umhertrug, im Walde allerlei bunte Moose und Steine suchte und mit mir spielte; unerachtet ich gewiss glaube, dass nur aus der Beschreibung meiner Mutter sich im Innern sein lebhaftes Bild erzeugt hat.
Er brachte einmal einen fremden wunderschönen Knaben mit, der mit mir von gleichem Alter war. Uns herzend und küssend saßen wir im Grase, ich schenkte ihm alle meine bunten Steine, und er wusste damit allerlei Figuren auf dem Erdboden zu ordnen, aber immer bildete sich zuletzt daraus die Gestalt des Kreuzes.
Meine Mutter saß neben uns auf einer steinernen Bank, und der Alte schaute, hinter ihr stehend, mit mildem Ernst unsern kindischen Spielen zu.
Da traten einige Jünglinge aus dem Gebüsch, die, nach ihrer Kleidung und nach ihrem ganzen Wesen zu urteilen, wohl nur aus Neugierde und Schaulust nach der Heiligen Linde gekommen waren.
Einer von ihnen rief, indem er uns gewahr wurde, lachend:
„Sieh da, eine heilige Familie, das ist etwas für meine Mappe!“
Er zog wirklich Papier und Krayon hervor und schickte sich an, uns zu zeichnen, da erhob der alte Pilger sein Haupt und rief zornig:
„Elender Spötter, du willst ein Künstler sein, und in deinem Innern brannte nie die Flamme des Glaubens und der Liebe; aber deine Werke werden tot und starr bleiben wie du selbst, und du wirst wie ein Verstoßener in einsamer Leere verzweifeln und untergehen in deiner eignen Armseligkeit.“
Die Jünglinge eilten bestürzt von dannen.
Der alte Pilger sagte zu meiner Mutter:
„Ich habe Euch heute ein wunderbares Kind gebracht, damit es in Eurem Sohn den Funken der Liebe entzünde, aber ich muss es wieder von Euch nehmen und Ihr werdet es wohl sowie mich selbst nicht mehr schauen.
Euer Sohn ist mit vielen Gaben herrlich ausgestattet, aber die Sünde des Vaters kocht und gärt in seinem Blute, er kann jedoch sich zum wackern Kämpen für den Glauben aufschwingen; lasset ihn geistlich werden!“
Meine Mutter konnte nicht genug sagen, welchen tiefen, unauslöschlichen Eindruck die Worte des Pilgers auf sie gemacht hatten; sie beschloss aber dem unerachtet, meiner Neigung durchaus keinen Zwang anzutun, sondern ruhig abzuwarten, was das Geschick über mich verhängen und wozu es mich leiten würde, da sie an irgendeine andre höhere Erziehung, als die sie selbst mir zu geben imstande war, nicht denken konnte.
Meine Erinnerungen aus deutlicher, selbstgemachter Erfahrung heben von dem Zeitpunkt an, als meine Mutter auf der Heimreise in das Zisterzienser-Nonnenkloster gekommen war, dessen gefürstete Äbtissin, die meinen Vater gekannt hatte, sie freundlich aufnahm.
Die Zeit von jener Begebenheit mit dem alten Pilger, welche ich in der Tat aus eigner Anschauung weiß, sodass sie meine Mutter nur rücksichts der Reden des Malers und des alten Pilgers ergänzt hat, bis zu dem Moment, als mich meine Mutter zum ersten Mal zur Äbtissin brachte, macht eine völlige Lücke: Nicht die leiseste Ahnung ist mir davon übrig geblieben.
Ich finde mich erst wieder, als die Mutter meinen Anzug, so viel es ihr nur möglich war, besserte und ordnete. Sie hatte neue Bänder in der Stadt gekauft, sie verschnitt mein wildverwachsnes Haar, sie putzte mich mit aller Mühe und schärfte mir dabei ein, mich ja recht fromm und artig bei der Frau Äbtissin zu betragen.
Endlich stieg ich an der Hand meiner Mutter die breiten steinernen Treppen herauf und trat in das hohe, gewölbte, mit heiligen Bildern ausgeschmückte Gemach, in dem wir die Fürstin fanden.
Es war eine große, majestätische, schöne Frau, der die Ordenstracht eine Ehrfurcht einflößende Würde gab. Sie sah mich mit einem ernsten, bis ins Innerste dringenden Blick an und frug:
„Ist das Euer Sohn?“
Ihre Stimme, ihr ganzes Ansehen – selbst die fremde Umgebung, das hohe Gemach, die Bilder, alles wirkte so auf mich, dass ich, von dem Gefühl eines innern Grauens ergriffen, bitterlich zu weinen anfing.
Da sprach die Fürstin, indem sie mich milder und gütiger anblickte:
„Was ist dir, Kleiner, fürchtest du dich vor mir? – Wie heißt Euer Sohn, liebe Frau?“
„Franz“, erwiderte meine Mutter.
Da rief die Fürstin mit der tiefsten Wehmut „Franziskus!“ und hob mich auf und drückte mich heftig an sich, aber in dem Augenblick presste mir ein jäher Schmerz, den ich am Halse fühlte, einen starken Schrei aus, sodass die Fürstin erschrocken mich losließ und die durch mein Betragen ganz bestürzt gewordene Mutter auf mich zusprang, um nur gleich mich fortzuführen.
Die Fürstin ließ das nicht zu; es fand sich, dass das diamantne Kreuz, welches die Fürstin auf der Brust trug, mich, indem sie heftig mich an sich drückte, am Halse so stark beschädigt hatte, dass die Stelle ganz rot und mit Blut unterlaufen war.
„Armer Franz“, sprach die Fürstin, „ich habe dir wehgetan, aber wir wollen doch noch gute Freunde werden.“
Eine Schwester brachte Zuckerwerk und süßen Wein, ich ließ mich, jetzt schon dreister geworden, nicht lange nötigen, sondern naschte tapfer von den Süßigkeiten, die mir die holde Frau, welche sich gesetzt und mich auf den Schoß genommen hatte, selbst in den Mund steckte.
Als ich einige Tropfen des süßen Getränks, das mir bis jetzt ganz unbekannt gewesen, gekostet, kehrte mein munterer Sinn, die besondere Lebendigkeit, die nach meiner Mutter Zeugnis von meiner frühesten Jugend mir eigen war, zurück. Ich lachte und schwatzte zum größten Vergnügen der Äbtissin und der Schwester, die im Zimmer geblieben.
Noch ist es mir unerklärlich, wie meine Mutter darauf verfiel, mich aufzufordern, der Fürstin von den schönen herrlichen Dingen meines Geburtsortes zu erzählen, und ich, wie von einer höheren Macht inspiriert, ihr die schönen Bilder des fremden, unbekannten Malers so lebendig, als habe ich sie im tiefsten Geiste aufgefasst, beschreiben konnte. Dabei ging ich ganz ein in die herrlichen Geschichten der Heiligen, als sei ich mit allen Schriften der Kirche schon bekannt und vertraut geworden.
Die Fürstin, selbst meine Mutter blickten mich voll Erstaunen an, aber je mehr ich sprach, desto höher stieg meine Begeisterung, und als mich endlich die Fürstin fragte: „Sage mir, liebes Kind, woher weißt du denn das alles?“ – da antwortete ich, ohne mich einen Augenblick zu besinnen, dass der schöne wunderbare Knabe, den einst ein fremder Pilgersmann mitgebracht hätte, mir alle Bilder in der Kirche erklärt, ja selbst noch manches Bild mit bunten Steinen gemalt und mir nicht allein den Sinn davon gelöset, sondern auch viele andere heilige Geschichten erzählt hätte.
Man läutete zur Vesper, die Schwester hatte eine Menge Zuckerwerk in eine Tüte gepackt, die sie mir gab und die ich voller Vergnügen einsteckte.
Die Äbtissin stand auf und sagte zu meiner Mutter:
„Ich sehe Euern Sohn als meinen Zögling an, liebe Frau, und will von nun an für ihn sorgen.“
Meine Mutter konnte vor Wehmut nicht sprechen, sie küsste, heiße Tränen vergießend, die Hände der Fürstin.
Schon wollten wir zur Tür hinaustreten, als die Fürstin uns nachkam, mich nochmals aufhob, sorgfältig das Kreuz beiseite schiebend, mich an sich drückte und heftig weinend, sodass die heißen Tropfen auf meine Stirne fielen, ausrief:
„Franziskus! – Bleibe fromm und gut!“
Ich war im Innersten bewegt und musste auch weinen, ohne eigentlich zu wissen warum.
Durch die Unterstützung der Äbtissin gewann der kleine Haushalt meiner Mutter, die unfern dem Kloster in einer kleinen Meierei wohnte, bald ein besseres Ansehen. Die Not hatte ein Ende, ich ging besser gekleidet und genoss den Unterricht des Pfarrers, dem ich zugleich, wenn er in der Klosterkirche das Amt hielt, als Chorknabe diente.
Wie umfängt mich noch wie ein seliger Traum die Erinnerung an jene glückliche Jugendzeit!
Ach, wie ein fernes heiliges Land, wo die Freude wohnt und die ungetrübte Heiterkeit des kindlichen unbefangenen Sinnes, liegt die Heimat weit, weit hinter mir, aber wenn ich zurückblicke, da gähnt mir die Kluft entgegen, die mich auf ewig von ihr geschieden.
Von heißer Sehnsucht ergriffen, trachte ich immer mehr und mehr die Geliebten zu erkennen, die ich drüben, wie im Purpurschimmer des Frührots wandelnd, erblicke, ich wähne ihre holden Stimmen zu vernehmen.
Ach! Gibt es denn eine Kluft, über die die Liebe mit starkem Fittich sich nicht hinwegschwingen könnte? Was ist für die Liebe der Raum, die Zeit! Lebt sie nicht im Gedanken, und kennt der denn ein Maß?
Aber finstre Gestalten steigen auf, und immer dichter und dichter sich zusammendrängend, immer enger und enger mich einschließend, versperren sie die Aussicht und befangen meinen Sinn mit den Drangsalen der Gegenwart, dass selbst die Sehnsucht, welche mich mit namenlosem, wonnevollem Schmerz erfüllte, nun zu tötender heilloser Qual wird!
Der Pfarrer war die Güte selbst, er wusste meinen lebhaften Geist zu fesseln, er wusste seinen Unterricht so nach meiner Sinnesart zu formen, dass ich Freude daran fand und schnelle Fortschritte machte.
Meine Mutter liebte ich über alles, aber die Fürstin verehrte ich wie eine Heilige, und es war ein feierlicher Tag für mich, wenn ich sie sehen durfte. Jedes Mal nahm ich mir vor, mit den neuerworbenen Kenntnissen recht vor ihr zu leuchten, aber wenn sie kam, wenn sie freundlich mich anredete, da konnte ich kaum ein Wort herausbringen, ich mochte nur sie anschauen, nur sie hören. Jedes ihrer Worte blieb tief in meiner Seele zurück, noch den ganzen Tag über, wenn ich sie gesprochen, befand ich mich in wunderbarer feierlicher Stimmung, und ihre Gestalt begleitete mich auf den Spaziergängen, die ich dann besuchte.
Welches namenlose Gefühl durchbebte mich, wenn ich, das Rauchfass schwingend, am Hochaltare stand und nun die Töne der Orgel von dem Chore herabströmten und, wie zur brausenden Flut anschwellend, mich fortrissen – wenn ich dann in dem Hymnus ihre Stimme erkannte, die wie ein leuchtender Strahl zu mir herabdrang und mein Inneres mit den Ahnungen des Höchsten – des Heiligsten erfüllte.
Aber der herrlichste Tag, auf den ich mich wochenlang freute, ja, an den ich niemals ohne inneres Entzücken denken konnte, war das Fest des heiligen Bernardus, welches, da er der Heilige der Zisterzienser ist, im Kloster durch einen großen Ablass auf das Feierlichste begangen wurde.
Schon den Tag vorher strömten aus der benachbarten Stadt sowie aus der ganzen umliegenden Gegend eine Menge Menschen herbei und lagerten sich auf der großen blumichten Wiese, die sich an das Kloster schloss, sodass das frohe Getümmel Tag und Nacht nicht aufhörte. Ich erinnere mich nicht, dass die Witterung in der günstigen Jahreszeit (der Bernardustag fällt in den August) dem Feste jemals ungünstig gewesen sein sollte.
In bunter Mischung sah man hier andächtige Pilger, Hymnen singend, daherwandeln, dort Bauerbursche sich mit den geputzten Dirnen jubelnd umhertummeln – Geistliche, die in frommer Betrachtung, die Hände andächtig gefaltet, in die Wolken schauen – Bürgerfamilien, im Grase gelagert, die die hochgefüllten Speisekörbe auspacken und ihr Mahl verzehren.
Lustiger Gesang, fromme Lieder, die inbrünstigen Seufzer der Büßenden, das Gelächter der Fröhlichen, Klagen, Jauchzen, Jubel, Scherze, Gebet erfüllen wie in wunderbarem, betäubendem Konzert die Lüfte!
Aber sowie die Glocke des Klosters anschlägt, verhallt das Getöse plötzlich – soweit das Auge nur reicht, ist alles, in dichte Reihen gedrängt, auf die Knie gesunken, und nur das dumpfe Murmeln des Gebets unterbricht die heilige Stille. Der letzte Schlag der Glocke tönt aus, die bunte Menge strömt wieder durcheinander, und aufs Neue erschallt der minutenlang unterbrochene Jubel.
Der Bischof selbst, welcher in der benachbarten Stadt residiert, hielt an dem Bernardustage in der Kirche des Klosters, bedient von der untern Geistlichkeit des Hochstifts, das feierliche Hochamt, und seine Kapelle führte auf einer Tribüne, die man zur Seite des Hochaltars errichtet und mit reicher, seltener Hautelisse behängt hatte, die Musik aus.
Noch jetzt sind die Empfindungen, die damals meine Brust durchbebten, nicht erstorben, sie leben auf in jugendlicher Frische, wenn ich mein Gemüt zuwende jener seligen Zeit, die nur zu schnell verschwunden.
Ich gedenke lebhaft eines Gloria, welches mehrmals ausgeführt wurde, da die Fürstin eben diese Komposition vor allen andern liebte.
Wenn der Bischof das Gloria intoniert hatte und nun die mächtigen Töne des Chors daherbrausten: Gloria in excelsis deo! – war es nicht, als öffne sich die Wolkenglorie über dem Hochaltar? Ja, als erglühten durch ein göttliches Wunder die gemalten Cherubim und Seraphim zum Leben und regten und bewegten die starken Fittiche und schwebten auf und nieder, Gott lobpreisend mit Gesang und wunderbarem Saitenspiel?
Ich versank in das hinbrütende Staunen der begeisterten Andacht, die mich durch glänzende Wolken in das ferne bekannte, heimatliche Land trug, und in dem duftenden Walde ertönten die holden Engelsstimmen, und der wunderbare Knabe trat wie aus hohen Lilienbüschen mir entgegen und fragte mich lächelnd:
„Wo warst du denn so lange, Franziskus? Ich habe viele schöne bunte Blumen, die will ich dir alle schenken, wenn du bei mir bleibst und mich liebst immerdar.“
Nach dem Hochamt hielten die Nonnen, unter dem Vortritt der Äbtissin, die mit der Inful geschmückt war und den silbernen Hirtenstab trug, eine feierliche Prozession durch die Gänge des Klosters und durch die Kirche.
Welche Heiligkeit, welche Würde, welche überirdische Größe strahlte aus jedem Blick der herrlichen Frau, leitete jede ihrer Bewegungen!
Es war die triumphierende Kirche selbst, die dem frommen, gläubigen Volke Gnade und Segen verhieß. Ich hätte mich vor ihr in den Staub werfen mögen, wenn ihr Blick zufällig auf mich fiel.
Nach beendigtem Gottesdienst wurde die Geistlichkeit sowie die Kapelle des Bischofs in einem großen Saal des Klosters bewirtet. Mehrere Freunde des Klosters, Offizianten, Kaufleute aus der Stadt, nahmen an dem Mahle teil, und ich durfte, weil mich der Konzertmeister des Bischofs lieb gewonnen und gern sich mit mir zu schaffen machte, auch dabei sein.
Hatte sich erst mein Innres, von heiliger Andacht durchglüht, ganz dem Überirdischen zugewendet, so trat jetzt das frohe Leben auf mich ein und umfing mich mit seinen bunten Bildern. Allerlei lustige Erzählungen, Späße und Schwänke wechselten unter dem lauten Gelächter der Gäste, wobei die Flaschen fleißig geleert wurden, bis der Abend hereinbrach und die Wagen zur Heimfahrt bereitstanden.
Sechzehn Jahre war ich alt geworden, als der Pfarrer erklärte, dass ich nun vorbereitet genug sei, die höheren theologischen Studien in dem Seminar der benachbarten Stadt zu beginnen: Ich hatte mich nämlich ganz für den geistlichen Stand entschieden, und dies erfüllte meine Mutter mit der innigsten Freude, da sie hierdurch die geheimnisvollen Andeutungen des Pilgers, die in gewisser Art mit der merkwürdigen, mir unbekannten Vision meines Vaters in Verbindung stehen sollten, erklärt und erfüllt sah. Durch meinen Entschluss glaubte sie erst die Seele meines Vaters entsühnt und von der Qual ewiger Verdammnis errettet.
Auch die Fürstin, die ich jetzt nur im Sprechzimmer sehen konnte, billigte höchlich mein Vorhaben und wiederholte ihr Versprechen, mich bis zur Erlangung einer geistlichen Würde mit allem Nötigen zu unterstützen.
Unerachtet die Stadt so nahe lag, dass man von dem Kloster aus die Türme sehen konnte und nur irgend rüstige Fußgänger von dort her die heitre, anmutige Gegend des Klosters zu ihren Spaziergängen wählten, so wurde mir doch der Abschied von meiner guten Mutter, von der herrlichen Frau, die ich so tief im Gemüte verehrte, sowie von meinem guten Lehrer recht schwer. Es ist ja auch gewiss, dass dem Schmerz der Trennung jede Spanne außerhalb dem Kreise der Lieben der weitesten Entfernung gleichdünkt!
Die Fürstin war auf besondere Weise bewegt, ihre Stimme zitterte vor Wehmut, als sie noch salbungsvolle Worte der Ermahnung sprach. Sie schenkte mir einen zierlichen Rosenkranz und ein kleines Gebetbuch mit sauber illuminierten Bildern. Dann gab sie mir noch ein Empfehlungsschreiben an den Prior des Kapuzinerklosters in der Stadt, den sie mir empfahl gleich aufzusuchen, da er mir in allem mit Rat und Tat eifrigst beistehen werde.
Gewiss gibt es nicht so leicht eine anmutigere Gegend, als diejenige ist, in welcher das Kapuzinerkloster dicht vor der Stadt liegt. Der herrliche Klostergarten mit der Aussicht in die Gebirge hinein schien mir jedes Mal, wenn ich in den langen Alleen wandelte und bald bei dieser, bald bei jener üppigen Baumgruppe stehen blieb, in neuer Schönheit zu erglänzen.
Gerade in diesem Garten traf ich den Prior Leonardus, als ich zum ersten Mal das Kloster besuchte, um mein Empfehlungsschreiben von der Äbtissin abzugeben.
Die dem Prior eigne Freundlichkeit wurde noch erhöht, als er den Brief las, und er wusste so viel Anziehendes von der herrlichen Frau, die er schon in frühen Jahren in Rom kennengelernt, zu sagen, dass er schon dadurch im ersten Augenblick mich ganz an sich zog.
Er war von den Brüdern umgeben, und man durchblickte bald das ganze Verhältnis des Priors mit den Mönchen, die ganze klösterliche Einrichtung und Lebensweise: Die Ruhe und Heiterkeit des Geistes, welche sich in dem Äußerlichen des Priors deutlich aussprach, verbreitete sich über alle Brüder.
Man sah nirgends eine Spur des Missmuts oder jener feindlichen, ins Innere zehrenden Verschlossenheit, die man sonst wohl auf den Gesichtern der Mönche wahrnimmt.
Unerachtet der strengen Ordensregel waren die Andachtsübungen dem Prior Leonardus mehr Bedürfnis des dem Himmlischen zugewandten Geistes als asketische Buße für die der menschlichen Natur anklebende Sünde, und er wusste diesen Sinn der Andacht so in den Brüdern zu entzünden, dass sich über alles, was sie tun mussten, um der Regel zu genügen, eine Heiterkeit und Gemütlichkeit ergoss, die in der Tat ein höheres Sein in der irdischen Beengtheit erzeugte.
Selbst eine gewisse schickliche Verbindung mit der Welt wusste der Prior Leonardus herzustellen, die für die Brüder nicht anders als heilsam sein konnte. Reichliche Spenden, die von allen Seiten dem allgemein hochgeachteten Kloster dargebracht wurden, machten es möglich, an gewissen Tagen die Freunde und Beschützer des Klosters in dem Refektorium zu bewirten.
Dann wurde in der Mitte des Speisesaals eine lange Tafel gedeckt, an deren oberem Ende der Prior Leonardus bei den Gästen saß. Die Brüder blieben an der schmalen, der Wand entlang stehenden Tafel und bedienten sich ihres einfachen Geschirres, der Regel gemäß, während an der Gasttafel alles sauber und zierlich mit Porzellan und Glas besetzt war.
Der Koch des Klosters wusste vorzüglich auf eine leckere Art Fastenspeisen zuzubereiten, die den Gästen gar wohl schmeckten. Die Gäste sorgten für den Wein, und so waren die Mahle im Kapuzinerkloster ein freundliches, gemütliches Zusammentreten des Profanen mit dem Geistlichen, welches in wechselseitiger Rückwirkung für das Leben nicht ohne Nutzen sein konnte.
Denn indem die im weltlichen Treiben Befangenen hinaustraten und eingingen in die Mauern, wo alles das ihrem Tun schnurstracks entgegengesetzte Leben der Geistlichen verkündet, mussten sie, von manchem Funken, der in ihre Seele fiel, aufgeregt, eingestehen, dass auch wohl auf andrem Wege als auf dem, den sie eingeschlagen, Ruhe und Glück zu finden sei, ja dass vielleicht der Geist, je mehr er sich über das Irdische erhebe, dem Menschen schon hienieden ein höheres Sein bereiten könne.
Dagegen gewannen die Mönche an Lebensumsicht und Weisheit, da die Kunde, welche sie von dem Tun und Treiben der bunten Welt außerhalb ihrer Mauern erhielten, in ihnen Betrachtungen mancherlei Art erweckte. Ohne dem Irdischen einen falschen Wert zu verleihen, mussten sie in der verschiedenen, aus dem Innern bestimmten Lebensweise der Menschen die Notwendigkeit einer solchen Strahlenbrechung des geistlichen Prinzips, ohne welche alles farb- und glanzlos geblieben wäre, anerkennen.
Über alle hocherhaben rücksichts der geistigen und wissenschaftlichen Ausbildung stand von jeher der Prior Leonardus. Außerdem dass er allgemein für einen wackern Gelehrten in der Theologie galt, sodass er mit Leichtigkeit und Tiefe die schwierigsten Materien abzuhandeln wusste und sich die Professoren des Seminars oft bei ihm Rat und Belehrung holten, war er auch mehr, als man es wohl einem Klostergeistlichen zutrauen kann, für die Welt ausgebildet. Er sprach mit Fertigkeit und Eleganz das Italienische und Französische, und seiner besonderen Gewandtheit wegen hatte man ihn in früherer Zeit zu wichtigen Missionen gebraucht.
Schon damals, als ich ihn kennenlernte, war er hochbejahrt, aber indem sein weißes Haar von seinem Alter zeugte, blitzte aus den Augen noch jugendliches Feuer, und das anmutige Lächeln, welches um seine Lippen schwebte, erhöhte den Ausdruck der innern Behaglichkeit und Gemütsruhe. Dieselbe Grazie, welche seine Rede schmückte, herrschte in seinen Bewegungen, und selbst die unbehilfliche Ordenstracht schmiegte sich wundersam den wohlgebauten Formen seines Körpers an.
Es befand sich kein Einziger unter den Brüdern, den nicht eigne freie Wahl, den nicht sogar das von der innern geistigen Stimmung erzeugte Bedürfnis in das Kloster gebracht hätte; aber auch den Unglücklichen, der im Kloster den Port gesucht hätte, um der Vernichtung zu entgehen, hätte Leonardus bald getröstet; seine Buße wäre der kurze Übergang zur Ruhe geworden, und mit der Welt versöhnt, ohne ihren Tand zu achten, hätte er, im Irdischen lebend, doch sich bald über das Irdische erhoben.
Diese ungewöhnlichen Tendenzen des Klosterlebens hatte Leonardus in Italien aufgefasst, wo der Kultus und mit ihm die ganze Ansicht des religiösen Lebens heitrer ist als in dem katholischen Deutschland.
So wie bei dem Bau der Kirchen noch die antiken Formen sich erhielten, so scheint auch ein Strahl aus jener heitern lebendigen Zeit des Altertums in das mystische Dunkel des Christianismus gedrungen zu sein und es mit dem wunderbaren Glanze erhellt zu haben, der sonst die Götter und Helden umstrahlte.
Leonardus gewann mich lieb, er unterrichtete mich im Italienischen und Französischen, vorzüglich waren es aber die mannigfachen Bücher, welche er mir in die Hände gab, sowie seine Gespräche, die meinen Geist auf besondere Weise ausbildeten.
Beinahe die ganze Zeit, welche meine Studien im Seminar mir übrig ließen, brachte ich im Kapuzinerkloster zu, und ich spürte, wie immer mehr meine Neigung zunahm, mich einkleiden zu lassen.
Ich eröffnete dem Prior meinen Wunsch; ohne mich indessen gerade davon abbringen zu wollen, riet er mir, wenigstens noch ein paar Jahre zu warten und unter der Zeit mich mehr als bisher in der Welt umzusehen.
Sowenig es mir indessen an anderer Bekanntschaft fehlte, die ich mir vorzüglich durch den bischöflichen Konzertmeister, welcher mich in der Musik unterrichtete, erworben, so fühlte ich mich doch in jeder Gesellschaft, und vorzüglich, wenn Frauenzimmer zugegen waren, auf unangenehme Weise befangen, und dies, sowie überhaupt der Hang zum kontemplativen Leben schien meinen innern Beruf zum Kloster zu entscheiden.
Einst hatte der Prior viel Merkwürdiges mit mir gesprochen über das profane Leben; er war eingedrungen in die schlüpfrigsten Materien, die er aber mit seiner gewöhnlichen Leichtigkeit und Anmut des Ausdrucks zu behandeln wusste, sodass er, alles nur im mindesten Anstößige vermeidend, doch immer auf den rechten Fleck traf. Er nahm endlich meine Hand, sah mir scharf ins Auge und fragte, ob ich noch unschuldig sei.
Ich fühlte mich erglühen, denn indem Leonardus mich so verfänglich fragte, sprang ein Bild in den lebendigsten Farben hervor, welches so lange ganz von mir gewichen:
Der Konzertmeister hatte eine Schwester, welche gerade nicht schön genannt zu werden verdiente, aber doch, in der höchsten Blüte stehend, ein überaus reizendes Mädchen war.
Vorzüglich zeichnete sie ein im reinsten Ebenmaß geformter Wuchs aus; sie hatte die schönsten Arme, den schönsten Busen in Form und Kolorit, den man nur sehen kann.
Eines Morgens, als ich zum Konzertmeister gehen wollte meines Unterrichts halber, überraschte ich die Schwester im leichten Morgenanzuge, mit beinahe ganz entblößter Brust; schnell warf sie zwar das Tuch über, aber doch schon zu viel hatten meine gierigen Blicke erhascht, ich konnte kein Wort sprechen, nie gekannte Gefühle regten sich stürmisch in mir und trieben das glühende Blut durch die Adern, dass hörbar meine Pulse schlugen. Meine Brust war krampfhaft zusammengepresst und wollte zerspringen, ein leiser Seufzer machte mir endlich Luft.
Dadurch, dass das Mädchen ganz unbefangen auf mich zukam, mich bei der Hand fasste und fragte, was mir denn wäre, wurde das Übel wieder ärger, und es war ein Glück, dass der Konzertmeister in die Stube trat und mich von der Qual erlöste.
Nie hatte ich indessen solche falschen Akkorde gegriffen, nie so im Gesang detoniert als dasmal.
Fromm genug war ich, um später das Ganze für eine böse Anfechtung des Teufels zu halten, und ich pries mich nach kurzer Zeit recht glücklich, den bösen Feind durch die asketischen Übungen, die ich unternahm, aus dem Felde geschlagen zu haben.
Jetzt bei der verfänglichen Frage des Priors sah ich des Konzertmeisters Schwester mit entblößtem Busen vor mir stehen, ich fühlte den warmen Hauch ihres Atems, den Druck ihrer Hand – meine innere Angst stieg mit jedem Momente.
Leonardus sah mich mit einem gewissen ironischen Lächeln an, vor dem ich erbebte. Ich konnte seinen Blick nicht ertragen, ich schlug die Augen nieder, da klopfte mich der Prior auf die glühenden Wangen und sprach:
„Ich sehe, mein Sohn, dass Sie mich gefasst haben und dass es noch gut mit Ihnen steht, der Herr bewahre Sie vor der Verführung der Welt; die Genüsse, die sie Ihnen darbietet, sind von kurzer Dauer, und man kann wohl behaupten, dass ein Fluch darauf ruhe, da in dem unbeschreiblichen Ekel, in der vollkommenen Erschlaffung, in der Stumpfheit für alles Höhere, die sie hervorbringen, das bessere geistige Prinzip des Menschen untergeht.“
Sosehr ich mich mühte, die Frage des Priors und das Bild, welches dadurch hervorgerufen wurde, zu vergessen, so wollte es mir doch durchaus nicht gelingen, und war es mir erst geglückt, in Gegenwart jenes Mädchens unbefangen zu sein, so scheute ich doch wieder jetzt mehr denn jemals ihren Anblick, da mich schon bei dem Gedanken an sie eine Beklommenheit, eine innere Unruhe überfiel, die mir umso gefährlicher schien, als zugleich eine unbekannte wundervolle Sehnsucht und mit ihr eine Lüsternheit sich regten, die wohl sündlich sein mochte.
Ein Abend sollte diesen zweifelhaften Zustand entscheiden. Der Konzertmeister hatte mich, wie er manchmal zu tun pflegte, zu einer musikalischen Unterhaltung, die er mit einigen Freunden veranstaltet, eingeladen.
Außer seiner Schwester waren noch mehrere Frauenzimmer zugegen, und dieses steigerte die Befangenheit, die mir schon bei der Schwester allein den Atem versetzte.
Sie war sehr reizend gekleidet, sie kam mir schöner als je vor, es war, als zöge mich eine unsichtbare, unwiderstehliche Gewalt zu ihr hin, und so kam es denn, dass ich, ohne selbst zu wissen wie, mich immer ihr nahe befand, jeden ihrer Blicke, jedes ihrer Worte begierig aufhaschte, ja mich so an sie drängte, dass wenigstens ihr Kleid im Vorbeistreifen mich berühren musste, welches mich mit innerer, nie gefühlter Lust erfüllte.
Sie schien es zu bemerken und Wohlgefallen daran zu finden; zuweilen war es mir, als müsste ich sie wie in toller Liebeswut an mich reißen und inbrünstig an mich drücken!
Sie hatte lange neben dem Flügel gesessen, endlich stand sie auf und ließ auf dem Stuhl einen ihrer Handschuhe liegen, den ergriff ich und drückte ihn im Wahnsinn heftig an den Mund!
Das sah eins von den Frauenzimmern, die ging zu des Konzertmeisters Schwester und flüsterte ihr etwas ins Ohr, nun schauten sie beide auf mich und kicherten und lachten höhnisch!
Ich war wie vernichtet, ein Eisstrom goss sich durch mein Inneres – besinnungslos stürzte ich fort ins Kollegium – in meine Zelle.
Ich warf mich wie in toller Verzweiflung auf den Fußboden – glühende Tränen quollen mir aus den Augen, ich verwünschte – ich verfluchte das Mädchen – mich selbst – dann betete ich wieder und lachte dazwischen wie ein Wahnsinniger!
Überall erklangen um mich Stimmen, die mich verspotteten, verhöhnten; ich war im Begriff, mich durch das Fenster zu stürzen, zum Glück verhinderten mich die Eisenstäbe daran, mein Zustand war in der Tat entsetzlich.
Erst als der Morgen anbrach, wurde ich ruhiger, aber fest war ich entschlossen, sie niemals mehr zu sehen und überhaupt der Welt zu entsagen. Klarer als jemals stand der Beruf zum eingezogenen Klosterleben, von dem mich keine Versuchung mehr ablenken sollte, vor meiner Seele.
Sowie ich nur von den gewöhnlichen Studien loskommen konnte, eilte ich zu dem Prior in das Kapuzinerkloster und eröffnete ihm, wie ich nun entschlossen sei, mein Noviziat anzutreten, und auch schon meiner Mutter sowie der Fürstin Nachricht davon gegeben habe.
Leonardus schien über meinen plötzlichen Eifer verwundert; ohne in mich zu dringen, suchte er doch auf diese und jene Weise zu erforschen, was mich wohl darauf gebracht haben könne, nun mit einem Mal auf meine Einweihung zum Klosterleben zu bestehen, denn er ahndete wohl, dass ein besonderes Ereignis mir den Impuls dazu gegeben haben müsse.
Eine innere Scham, die ich nicht zu überwinden vermochte, hielt mich zurück, ihm die Wahrheit zu sagen, dagegen erzählte ich ihm mit dem Feuer der Exaltation, das noch in mir glühte, die wunderbaren Begebenheiten meiner Kinderjahre, welche alle auf meine Bestimmung zum Klosterleben hindeuteten.
Leonardus hörte mich ruhig an und ohne gerade gegen meine Visionen Zweifel vorzubringen, schien er doch sie nicht sonderlich zu beachten, er äußerte vielmehr, wie das alles noch sehr wenig für die Echtheit meines Berufs spreche, da eben hier eine Illusion sehr möglich sei.
Überhaupt pflegte Leonardus nicht gern von den Visionen der Heiligen, ja selbst von den Wundern der ersten Verkündiger des Christentums zu sprechen, und es gab Augenblicke, in denen ich in Versuchung geriet, ihn für einen heimlichen Zweifler zu halten.
Einst erdreistete ich mich, um ihn zu irgendeiner bestimmten Äußerung zu nötigen, von den Verächtern des katholischen Glaubens zu sprechen und vorzüglich auf diejenigen zu schmälen, die im kindischen Übermute alles Übersinnliche mit dem heillosen Schimpfworte des Aberglaubens abfertigen.
Leonardus sprach sanft lächelnd: „Mein Sohn, der Unglaube ist der ärgste Aberglaube“, und fing ein anderes Gespräch von fremden, gleichgültigen Dingen an.
Erst später durfte ich eingehen in seine herrlichen Gedanken über den mystischen Teil unsrer Religion, der die geheimnisvolle Verbindung unsers geistigen Prinzips mit höheren Wesen in sich schließt, und musste mir denn wohl gestehen, dass Leonardus die Mitteilung alles des Sublimen, das aus seinem Innersten sich ergoss, mit Recht nur für die höchste Weihe seiner Schüler aufsparte.
Meine Mutter schrieb mir, wie sie es längst geahnet, dass der weltgeistliche Stand mir nicht genügen, sondern dass ich das Klosterleben erwählen werde. Am Medardustage sei ihr der alte Pilgersmann aus der Heiligen Linde erschienen und habe mich im Ordenskleide der Kapuziner an der Hand geführt. Auch die Fürstin war mit meinem Vorhaben ganz einverstanden. Beide sah ich noch einmal vor meiner Einkleidung, welche, da mir, meinem innigsten Wunsche gemäß, die Hälfte des Noviziats erlassen wurde, sehr bald erfolgte. Ich nahm auf Veranlassung der Vision meiner Mutter den Klosternamen Medardus an.
Das Verhältnis der Brüder untereinander, die innere Einrichtung rücksichts der Andachtsübungen und der ganzen Lebensweise im Kloster bewährte sich ganz in der Art, wie sie mir bei dem ersten Blick erschienen.
Die gemütliche Ruhe, die in allem herrschte, goss den himmlischen Frieden in meine Seele, wie er mich gleich einem seligen Traum aus der ersten Zeit meiner frühsten Kinderjahre im Kloster der Heiligen Linde umschwebt.
Während des feierlichen Akts meiner Einkleidung erblickte ich unter den Zuschauern des Konzertmeisters Schwester; sie sah ganz schwermütig aus, und ich glaubte Tränen in ihren Augen zu erblicken, aber vorüber war die Zeit der Versuchung, und vielleicht war es frevelnder Stolz auf den so leicht erfochtenen Sieg, der mir das Lächeln abnötigte, welches der an meiner Seite wandelnde Bruder Cyrillus bemerkte.
„Worüber erfreuest du dich so, mein Bruder?“, fragte Cyrillus.
„Soll ich denn nicht froh sein, wenn ich der schnöden Welt und ihrem Tand entsage?“, antwortete ich, aber nicht zu leugnen ist es, dass, indem ich diese Worte sprach, ein unheimliches Gefühl, plötzlich das Innerste durchbebend, mich Lügen strafte.
Doch dies war die letzte Anwandlung irdischer Selbstsucht, nach der jene Ruhe des Geistes eintrat. Wäre sie nimmer von mir gewichen, aber die Macht des Feindes ist groß! Wer mag der Stärke seiner Waffen, wer mag seiner Wachsamkeit vertrauen, wenn die unterirdischen Mächte lauern?
Schon fünf Jahre war ich im Kloster, als nach der Verordnung des Priors mir der Bruder Cyrillus, der alt und schwach worden, die Aufsicht über die reiche Reliquienkammer des Klosters übergeben sollte. Da befanden sich allerlei Knochen von Heiligen, Späne aus dem Kreuze des Erlösers und andere Heiligtümer, die in saubern Glasschränken aufbewahrt und an gewissen Tagen dem Volke zur Erbauung ausgestellt wurden.
Der Bruder Cyrillus machte mich mit jedem Stücke sowie mit den Dokumenten, die über ihre Echtheit und über die Wunder, welche sie bewirkt, vorhanden, bekannt. Er stand rücksichts der geistigen Ausbildung unserm Prior an der Seite, und umso weniger trug ich Bedenken, das zu äußern, was sich gewaltsam aus meinem Innern hervordrängte.
„Sollten denn, lieber Bruder Cyrillus“, sagte ich, „alle diese Dinge gewiss und wahrhaftig das sein, wofür man sie ausgibt? Sollte auch hier nicht die betrügerische Habsucht manches untergeschoben haben, was nun als wahre Reliquie dieses oder jenes Heiligen gilt? So zum Beispiel besitzt irgendein Kloster das ganze Kreuz unsers Erlösers, und doch zeigt man überall wieder so viel Späne davon, dass, wie jemand von uns selbst, freilich in freveligem Spott, behauptete, unser Kloster ein ganzes Jahr hindurch damit geheizt werden könnte.“
„Es geziemt uns wohl eigentlich nicht“, erwiderte der Bruder Cyrillus, „diese Dinge einer solchen Untersuchung zu unterziehen, allein offenherzig gestanden, bin ich der Meinung, dass der darüber sprechenden Dokumente unerachtet wohl wenige dieser Dinge das sein dürften, wofür man sie ausgibt.
Allein es scheint mir auch gar nicht darauf anzukommen. Merke wohl auf, lieber Bruder Medardus, wie ich und unser Prior darüber denken, und du wirst unsere Religion in neuer Glorie erblicken.
Ist es nicht herrlich, lieber Bruder Medardus, dass unsere Kirche danach trachtet, jene geheimnisvollen Fäden zu erfassen, die das Sinnliche mit dem Übersinnlichen verknüpfen, ja unseren zum irdischen Leben und Sein gediehenen Organismus so anzuregen, dass sein Ursprung aus dem höheren geistigen Prinzip, ja seine innige Verwandtschaft mit dem wunderbaren Wesen, dessen Kraft wie ein glühender Hauch die ganze Natur durchdringt, klar hervortritt und uns die Ahnung eines höheren Lebens, dessen Keim wir in uns tragen, wie mit Seraphsfittichen umweht?
Was ist jenes Stückchen Holz – jenes Knöchlein, jenes Läppchen – man sagt, aus dem Kreuz Christi sei es gehauen, dem Körper, dem Gewande eines Heiligen entnommen?
Aber den Gläubigen, der, ohne zu grübeln, sein ganzes Gemüt darauf richtet, erfüllt bald jene überirdische Begeisterung, die ihm das Reich der Seligkeit erschließt, das er hienieden nur geahnet; und so wird der geistige Einfluss des Heiligen, dessen auch nur angebliche Reliquie den Impuls gab, erweckt, und der Mensch vermag Stärke und Kraft im Glauben von dem höheren Geiste zu empfangen, den er im Innersten des Gemüts um Trost und Beistand anrief.
Ja, diese in ihm erweckte höhere geistige Kraft wird selbst Leiden des Körpers zu überwinden vermögen, und daher kommt es, dass diese Reliquien jene Mirakel bewirken, die, da sie so oft vor den Augen des versammelten Volks geschehen, wohl nicht geleugnet werden können.“
Ich erinnerte mich augenblicklich gewisser Andeutungen des Priors, die ganz mit den Worten des Bruders Cyrillus übereinstimmten, und betrachtete nun die Reliquien, die mir sonst nur als religiöse Spielerei erschienen, mit wahrer innerer Ehrfurcht und Andacht.
Dem Bruder Cyrillus entging diese Wirkung seiner Rede nicht, und er fuhr nun fort, mit größerem Eifer und mit recht zum Gemüte sprechender Innigkeit mir die Sammlung Stück vor Stück zu erklären. Endlich nahm er aus einem wohlverschlossenen Schranke ein Kistchen heraus und sagte:
„Hierinnen, lieber Bruder Medardus, ist die geheimnisvollste, wunderbarste Reliquie enthalten, die unser Kloster besitzt. Solange ich im Kloster bin, hat dieses Kistchen niemand in der Hand gehabt als der Prior und ich; selbst die andern Brüder, viel weniger Fremde wissen etwas von dem Dasein dieser Reliquie.
Ich kann die Kiste nicht ohne inneren Schauer anrühren, es ist, als sei darin ein böser Zauber verschlossen, der, gelänge es ihm, den Bann, der ihn umschließt und wirkungslos macht, zu zersprengen, Verderben und heillosen Untergang jedem bereiten könnte, den er ereilt.
Das, was darinnen enthalten, stammt unmittelbar von dem Widersacher her, aus jener Zeit, als er noch sichtlich gegen das Heil der Menschen zu kämpfen vermochte.“
Ich sah den Bruder Cyrillus im höchsten Erstaunen an; ohne mir Zeit zu lassen, etwas zu erwidern, fuhr er fort:
„Ich will mich, lieber Bruder Medardus, gänzlich enthalten, in dieser höchst mystischen Sache nur irgendeine Meinung zu äußern oder wohl gar diese – jene – Hypothese aufzutischen, die mir durch den Kopf gefahren, sondern lieber getreulich dir das erzählen, was die über jene Reliquie vorhandenen Dokumente davon sagen. Du findest diese Dokumente in jenem Schrank und kannst sie selbst nachlesen.
Dir ist das Leben des heiligen Antonius zur Genüge bekannt, du weißt, dass er, um sich von allem Irdischen zu entfernen, um seine Seele ganz dem Göttlichen zuzuwenden, in die Wüste zog und da sein Leben, den strengsten Buße und Andachtsübungen weihte.
Der Widersacher verfolgte ihn und trat ihm oft sichtlich in den Weg, um ihn in seinen frommen Betrachtungen zu stören. So kam es denn, dass der heilige Antonius einmal in der Abenddämmerung eine finstere Gestalt wahrnahm, die auf ihn zuschritt. In der Nähe erblickte er zu seinem Erstaunen, dass aus den Löchern des zerrissenen Mantels, den die Gestalt trug, Flaschenhälse hervorguckten.
Es war der Widersacher, der in diesem seltsamen Aufzuge ihn höhnisch anlächelte und fragte, ob er nicht von den Elixieren, die er in den Flaschen bei sich trüge, zu kosten begehre.
Der heilige Antonius, den diese Zumutung nicht einmal verdrießen konnte, weil der Widersacher, ohnmächtig und kraftlos geworden, nicht mehr imstande war, sich auf irgendeinen Kampf einzulassen und sich daher auf höhnende Reden beschränken musste, fragte ihn, warum er denn so viele Flaschen und auf solche besondere Weise bei sich trüge.
Da antwortete der Widersacher:
Siehe, wenn mir ein Mensch begegnet, so schaut er mich verwundert an und kann es nicht lassen, nach meinen Getränken zu fragen und zu kosten aus Lüsternheit. Unter so vielen Elixieren findet er ja wohl eins, was ihm recht mundet, und er säuft die ganze Flasche aus und wird trunken und ergibt sich mir und meinem Reiche.
Soweit steht das in allen Legenden; nach dem besonderen Dokument, das wir über diese Vision des heiligen Antonius besitzen, heißt es aber weiter, dass der Widersacher, als er sich von dannen hub, einige seiner Flaschen auf einem Rasen stehen ließ, die der heilige Antonius schnell in seine Höhle mitnahm und verbarg, aus Furcht, selbst in der Einöde könnte ein Verirrter, ja wohl gar einer seiner Schüler von dem entsetzlichen Getränke kosten und ins ewige Verderben geraten.
Zufällig, erzählt das Dokument weiter, habe der heilige Antonius einmal eine dieser Flaschen geöffnet, da sei ein seltsamer betäubender Dampf herausgefahren und allerlei scheußliche sinnverwirrende Bilder der Hölle hätten den Heiligen umschwebt, ja ihn mit verführerischen Gaukeleien zu verlocken gesucht, bis er sie durch strenges Fasten und anhaltendes Gebet wieder vertrieben.
In diesem Kistchen befindet sich nun aus dem Nachlass des heiligen Antonius eben eine solche Flasche mit einem Teufelselixier, und die Dokumente sind so authentisch und genau, dass wenigstens daran, dass die Flasche wirklich nach dem Tode des heiligen Antonius unter seinen nachgebliebenen Sachen gefunden wurde, kaum zu zweifeln ist.
Übrigens kann ich versichern, lieber Bruder Medardus, dass, sooft ich die Flasche, ja nur dieses Kistchen, worin sie verschlossen, berühre, mich ein unerklärliches inneres Grauen anwandelt, ja dass ich wähne, etwas von einem ganz seltsamen Duft zu spüren, der mich betäubt und zugleich eine innere Unruhe des Geistes hervorbringt, die mich selbst bei den Andachtsübungen zerstreut. Indessen überwinde ich diese böse Stimmung, welche offenbar von dem Einfluss irgendeiner feindlichen Macht herrührt, sollte ich auch an die unmittelbare Einwirkung des Widersachers nicht glauben, durch standhaftes Gebet.
Dir, lieber Bruder Medardus, der du noch so jung bist, der du noch alles, was dir deine von fremder Kraft aufgeregte Fantasie vorbringen mag, in glänzenderen, lebhafteren Farben erblickst, der du noch wie ein tapferer, aber unerfahrner Krieger zwar rüstig im Kampfe, aber vielleicht zu kühn, das Unmögliche wagend, deiner Stärke zu sehr vertraust, rate ich, das Kistchen niemals oder wenigstens erst nach Jahren zu öffnen, und damit dich deine Neugierde nicht in Versuchung führe, es dir weit weg aus den Augen zu stellen.“
Der Bruder Cyrillus verschloss die geheimnisvolle Kiste wieder in den Schrank, wo sie gestanden, und übergab mir den Schlüsselbund, an dem auch der Schlüssel jenes Schrankes hing; die ganze Erzählung hatte auf mich einen eignen Eindruck gemacht, aber je mehr ich eine innere Lüsternheit emporkeimen fühlte, die wunderbare Reliquie zu sehen, desto mehr war ich, der Warnung des Bruders Cyrillus gedenkend, bemüht, auf jede Art es mir zu erschweren.
Als Cyrillus mich verlassen, übersah ich noch einmal die mir anvertrauten Heiligtümer, dann löste ich aber das Schlüsselchen, welches den gefährlichen Schrank schloss, vom Bunde ab und versteckte es tief unter meine Skripturen im Schreibpulte.
Unter den Professoren im Seminar gab es einen vortrefflichen Redner, jedes Mal wenn er predigte, war die Kirche überfüllt; der Feuerstrom seiner Worte riss alles unwiderstehlich fort, die inbrünstigste Andacht im Innern entzündend.
Auch mir drangen seine herrlichen begeisterten Reden ins Innerste, aber indem ich den Hochbegabten glücklich pries,, war es mir, als rege sich eine innere Kraft, die mich mächtig antrieb, es ihm gleichzutun.
Hatte ich ihn gehört, so predigte ich auf meiner einsamen Stube, mich ganz der Begeisterung des Moments überlassend, bis es mir gelang, meine Ideen, meine Worte festzuhalten und aufzuschreiben.
Der Bruder, welcher im Kloster zu predigen pflegte, wurde zusehends schwächer, seine Reden schlichen wie ein halbversiegter Bach mühsam und tonlos dahin, und die ungewöhnlich gedehnte Sprache, welche der Mangel an Ideen und Worten erzeugte, da er ohne Konzept sprach, machten seine Reden so unausstehlich lang, dass vor dem Amen schon der größte Teil der Gemeinde, wie bei dem bedeutungslosen eintönigen Geklapper einer Mühle, sanft eingeschlummert war und nur durch den Klang der Orgel wieder erweckt werden konnte.
Der Prior Leonardus war zwar ein ganz vorzüglicher Redner, indessen trug er Scheu zu predigen, weil es ihn bei den schon erreichten hohen Jahren zu stark angriff, und sonst gab es im Kloster keinen, der die Stelle jenes schwächlichen Bruders hätte ersetzen können.
Leonardus sprach mit mir über diesen Übelstand, der der Kirche den Besuch mancher Frommen entzog; ich fasste mir ein Herz und sagte ihm, wie ich schon im Seminar einen innern Beruf zum Predigen gespürt und manche geistliche Rede aufgeschrieben habe.
Er verlangte sie zu sehen und war so höchlich damit zufrieden, dass er in mich drang, schon am nächsten heiligen Tage den Versuch mit einer Predigt zu machen, der umso weniger misslingen werde, als mich die Natur mit allem ausgestattet habe, was zum guten Kanzelredner gehöre, nämlich mit einer einnehmenden Gestalt, einem ausdrucksvollen Gesicht und einer kräftigen tonreichen Stimme. Rücksichts des äußern Anstandes, der richtigen Gestikulation unternahm Leonardus selbst mich zu unterrichten.
Der Heiligentag kam heran, die Kirche war besetzter als gewöhnlich, und ich bestieg nicht ohne inneres Erbeben die Kanzel.
Im Anfange blieb ich meiner Handschrift getreu, und Leonardus sagte mir nachher, dass ich mit zitternder Stimme gesprochen, welches aber gerade den andächtigen wehmutsvollen Betrachtungen, womit die Rede begann, zugesagt und bei den Mehrsten für eine besondere wirkungsvolle Kunst des Redners gegolten habe.
Bald aber war es, als strahle der glühende Funke himmlischer Begeisterung durch mein Inneres – ich dachte nicht mehr an die Handschrift, sondern überließ mich ganz den Eingebungen des Moments.
Ich fühlte, wie das Blut in allen Pulsen glühte und sprühte – ich hörte meine Stimme durch das Gewölbe donnern – ich sah mein erhobenes Haupt, meine ausgebreiteten Arme, wie von Strahlenglanz der Begeisterung umflossen.
Mit einer Sentenz, in der ich alles Heilige und Herrliche, das ich verkündet, nochmals wie in einem flammenden Fokus zusammenfasste, schloss ich meine Rede, deren Eindruck ganz ungewöhnlich, ganz unerhört war.
Heftiges Weinen – unwillkürlich den Lippen entfliehende Ausrufe der andachtvollsten Wonne – lautes Gebet hallte meinen Worten nach.
Die Brüder zollten mir ihre höchste Bewunderung, Leonardus umarmte mich, er nannte mich den Stolz des Klosters.
Mein Ruf verbreitete sich schnell, und um den Bruder Medardus zu hören, drängte sich der vornehmste, der gebildetste Teil der Stadtbewohner schon eine Stunde vor dem Läuten in die nicht allzu große Klosterkirche.
Mit der Bewunderung stiegen mein Eifer und meine Sorge, den Reden im stärksten Feuer Ründe und Gewandtheit zu geben. Immer mehr gelang es mir, die Zuhörer zu fesseln, und immer steigend und steigend glich bald die Verehrung, die sich überall, wo ich ging und stand, in den stärksten Zügen an den Tag legte, beinahe der Vergötterung eines Heiligen. Ein religiöser Wahn hatte die Stadt ergriffen, alles strömte bei irgendeinem Anlass, auch an gewöhnlichen Wochentagen, nach dem Kloster, um den Bruder Medardus zu sehen, zu sprechen.
Da keimte in mir der Gedanke auf, ich sei ein besonders Erkorner des Himmels; die geheimnisvollen Umstände bei meiner Geburt am heiligen Orte zur Entsündigung des verbrecherischen Vaters, die wunderbaren Begebenheiten in meinen ersten Kinderjahren, alles deutete dahin, dass mein Geist, in unmittelbarer Berührung mit dem Himmlischen, sich schon hienieden über das Irdische erhebe und ich nicht der Welt, den Menschen angehöre, denen Heil und Trost zu geben ich hier auf Erden wandle.
Es war mir nun gewiss, dass der alte Pilgram in der Heiligen Linde der heilige Joseph, der wunderbare Knabe aber das Jesuskind selbst gewesen, das in mir den Heiligen, der auf Erden zu wandeln bestimmt, begrüßt habe.
Aber so wie dies alles immer lebendiger vor meiner Seele stand, wurde mir auch meine Umgebung immer lästiger und drückender. Jene Ruhe und Heiterkeit des Geistes, die mich sonst umfing, war aus meiner Seele entschwunden – ja alle gemütlichen Äußerungen der Brüder, die Freundlichkeit des Priors erweckten in mir einen feindseligen Zorn.
Den Heiligen, den hoch über sie erhabenen, sollten sie in mir erkennen, sich niederwerfen in den Staub und die Fürbitte erflehen vor dem Throne Gottes.
So aber hielt ich sie für befangen in verderblicher Verstocktheit. Selbst in meine Rede flocht ich gewisse Anspielungen ein, die darauf hindeuteten, wie nun eine wundervolle Zeit, gleich der in schimmernden Strahlen leuchtenden Morgenröte, angebrochen, in der, Trost und Heil bringend der gläubigen Gemeinde, ein Auserwählter Gottes auf Erden wandle.
Meine eingebildete Sendung kleidete ich in mystische Bilder ein, die umso mehr wie ein fremdartiger Zauber auf die Menge wirkten, je weniger sie verstanden wurden.
Leonardus wurde sichtlich kälter gegen mich, er vermied, mit mir ohne Zeugen zu sprechen, aber endlich, als wir einst, zufällig von allen Brüdern verlassen, in der Allee des Klostergartens einhergingen, brach er los:
„Nicht verhehlen kann ich es dir, lieber Bruder Medardus, dass du seit einiger Zeit durch ein ganzes Betragen mir Missfallen erregst.
Es ist etwas in deine Seele gekommen, das dich dem Leben in frommer Einfalt abwendig macht. In deinen Reden herrscht ein feindliches Dunkel, aus dem nur noch manches hervorzutreten sich scheut, was dich wenigstens mit mir auf immer entzweien würde.
Lass mich offenherzig sein! Du trägst in diesem Augenblick die Schuld unseres sündigen Ursprungs, die jedem mächtigen Emporstreben unserer geistigen Kraft die Schranken des Verderbnisses öffnet, wohin wir uns in unbedachtem Fluge nur zu leicht verirren!
Der Beifall, ja die abgöttische Bewunderung, die dir die leichtsinnige, nach jeder Anreizung lüsterne Welt gezollt, hat dich geblendet, und du siehst dich selbst in einer Gestalt, die nicht dein eigen, sondern ein Trugbild ist, welches dich in den verderblichen Abgrund lockt.
Gehe in dich, Medardus! Entsage dem Wahn, der dich betört – ich glaube ihn zu kennen! Schon jetzt ist dir die Ruhe des Gemüts, ohne welche kein Heil hienieden zu finden, entflohen.
Lass dich warnen, weiche aus dem Feinde, der dir nachstellt. Sei wieder der gutmütige Jüngling, den ich mit ganzer Seele liebte.“
Tränen quollen aus den Augen des Priors, als er dies sprach; er hatte meine Hand ergriffen, sie loslassend, entfernte er sich schnell, ohne meine Antwort abzuwarten.
Aber nur feindselig waren seine Worte in mein Innres gedrungen; er hatte des Beifalls, ja der höchsten Bewunderung erwähnt, die ich mir durch meine außerordentlichen Gaben erworben, und es war mir deutlich, dass nur kleinlicher Neid jenes Missbehagen an mir erzeugt habe, das er so unverhohlen äußerte.
Stumm und in mich gekehrt blieb ich, vom innern Groll ergriffen, bei den Zusammenkünften der Mönche, und ganz erfüllt von dem neuen Wesen, das mir aufgegangen, sann ich den Tag über und in den schlaflosen Nächten, wie ich alles in mir Aufgekeimte in prächtige Worte fassen und dem Volk verkünden wollte.
Je mehr ich mich nun von Leonardus und den Brüdern entfernte, mit desto stärkeren Banden wusste ich die Menge an mich zu ziehen.
Am Tage des heiligen Antonius war die Kirche so gedrängt voll, dass man die Türen weit öffnen musste, um dem zuströmenden Volke zu vergönnen, mich auch noch vor der Kirche zu hören.
Nie hatte ich kräftiger, feuriger, eindringender gesprochen. Ich erzählte, wie es gewöhnlich, manches aus dem Leben des Heiligen und knüpfte daran fromme, tief ins Leben eindringende Betrachtungen.
Von den Verführungen des Teufels, dem der Sündenfall die Macht gegeben, die Menschen zu verlocken, sprach ich, und unwillkürlich führte mich der Strom der Rede hinein in die Legende von den Elixieren, die ich wie eine sinnreiche Allegorie darstellen wollte.
Da fiel mein in der Kirche umherschweifender Blick auf einen langen hageren Mann, der mir schrägüber auf eine Bank gestiegen, sich an einen Eckpfeiler lehnte.
Er hatte auf seltsame fremde Weise einen dunkelvioletten Mantel umgeworfen und die übereinandergeschlagenen Arme dareingewickelt. Sein Gesicht war leichenblass, aber der Blick der großen schwarzen, stieren Augen fuhr wie ein glühender Dolchstich durch meine Brust.
Mich durchbebte ein unheimliches, grauenhaftes Gefühl, schnell wandte ich mein Auge ab und sprach, alle meine Kraft zusammennehmend, weiter. Aber wie von einer fremden zauberischen Gewalt getrieben, musste ich immer wieder hinschauen, und immer starr und bewegungslos stand der Mann da, den gespenstischen Blick auf mich gerichtet.
So wie bittrer Hohn – verachtender Hass lag es auf der hohen gefurchten Stirn, in dem herabgezogenen Munde. Die ganze Gestalt hatte etwas Furchtbares – Entsetzliches!
Ja! Es war der unbekannte Maler aus der Heiligen Linde. Ich fühlte mich wie von eiskalten grausigen Fäusten gepackt. Tropfen des Angstschweißes standen auf meiner Stirn – meine Perioden stockten – immer verwirrter und verwirrter wurden meine Reden – esentstand ein Flüstern – ein Gemurmel in der Kirche – aber starr und unbeweglich lehnte der fürchterliche Fremde am Pfeiler, den stieren Blick auf mich gerichtet.
Da schrie ich auf in der Höllenangst wahnsinniger Verzweiflung:
„Ha Verruchter! Hebe dich weg! – Hebe dich weg! – Denn ich bin es selbst! – Ich bin der heilige Antonius!“
Als ich aus dem bewusstlosen Zustand, in den ich mit jenen Worten versunken, wieder erwachte, befand ich mich auf meinem Lager, und der Bruder Cyrillus saß neben mir, mich pflegend und tröstend.
Das schreckliche Bild des Unbekannten stand mir noch lebhaft vor Augen, aber je mehr der Bruder Cyrillus, dem ich alles erzählte, mich zu überzeugen suchte, dass dieses nur ein Gaukelbild meiner durch das eifrige und starke Reden erhitzten Fantasie gewesen, desto tiefer fühlte ich bittre Reue und Scham über mein Betragen auf der Kanzel.
Die Zuhörer dachten, wie ich nachher erfuhr, es habe mich ein plötzlicher Wahnsinn überfallen, wozu ihnen vorzüglich mein letzter Ausruf gerechten Anlass gab.
Ich war zerknirscht – zerrüttet im Geiste; eingeschlossen in meine Zelle, unterwarf ich mich den strengsten Bußübungen und stärkte mich durch inbrünstige Gebete zum Kampfe mit dem Versucher, der mir selbst an heiliger Stätte erschienen, nur in frechem Hohn die Gestalt borgend von dem frommen Maler in der Heiligen Linde.
Niemand wollte übrigens den Mann im violetten Mantel erblickt haben, und der Prior Leonardus verbreitete nach seiner anerkannten Gutmütigkeit auf das Eifrigste überall, wie es nur der Anfall einer hitzigen Krankheit gewesen, welcher mich in der Predigt auf solche entsetzliche Weise mitgenommen und meine verwirrten Reden veranlasst habe: Wirklich war ich auch noch siech und krank, als ich nach mehreren Wochen wieder in das gewöhnliche klösterliche Leben eintrat.
Dennoch unternahm ich es, wieder die Kanzel zu besteigen, aber von innerer Angst gefoltert, verfolgt von der entsetzlichen bleichen Gestalt, vermochte ich kaum zusammenhängend zu sprechen, viel weniger mich wie sonst dem Feuer der Beredsamkeit zu überlassen.
Meine Predigten waren gewöhnlich – steif – zerstückelt. Die Zuhörer bedauerten den Verlust meiner Rednergabe, verloren sich nach und nach, und der alte Bruder, der sonst gepredigt und nun noch offenbar besser redete als ich, ersetzte wieder meine Stelle.
Nach einiger Zeit begab es sich, dass ein junger Graf, von seinem Hofmeister, mit dem er auf Reisen begriffen, begleitet, unser Kloster besuchte und die vielfachen Merkwürdigkeiten desselben zu sehen begehrte.
Ich musste die Reliquienkammer aufschließen, und wir traten hinein, als der Prior, der mit uns durch Chor und Kirche gegangen, abgerufen wurde, sodass ich mit den Fremden allein blieb.
Jedes Stück hatte ich gezeigt und erklärt, da fiel dem Grafen der mit zierlichem altdeutschem Schnitzwerk geschmückte Schrank ins Auge, in dem sich das Kistchen mit dem Teufelselixier befand.
Unerachtet ich nun nicht gleich mit der Sprache heraus wollte, was in dem Schrank verschlossen, so drangen beide, der Graf und der Hofmeister, doch so lange in mich, bis ich die Legende vom heiligen Antonius und dem arglistigen Teufel erzählte und mich über die als Reliquie aufbewahrte Flasche ganz getreu nach den Worten des Bruders Cyrillus ausließ, ja sogar die Warnung hinzufügte, die er mir rücksichts der Gefahr des Öffnens der Kiste und des Vorzeigens der Flasche gegeben.
Unerachtet der Graf unserer Religion zugetan war, schien er doch ebenso wenig wie der Hofmeister auf die Wahrscheinlichkeit der heiligen Legenden viel zu bauen. Sie ergossen sich beide in allerlei witzigen Anmerkungen und Einfällen über den komischen Teufel, der die Verführungsflaschen im zerrissenen Mantel trage, endlich nahm aber der Hofmeister eine ernsthafte Miene an und sprach:
„Haben Sie an uns leichtsinnigen Weltmenschen kein Ärgernis, ehrwürdiger Herr! Seien Sie überzeugt, dass wir beide, ich und mein Graf, die Heiligen als herrliche, von der Religion hochbegeisterte Menschen verehren, die dem Heil ihrer Seele sowie dem Heil der Menschen alle Freuden des Lebens, ja das Leben selbst opferten, was aber solche Geschichten betrifft wie die soeben von Ihnen erzählte, so glaube ich, dass nur eine geistreiche, von dem Heiligen ersonnene Allegorie durch Missverstand als wirklich geschehen ins Leben gezogen wurde.“
Unter diesen Worten hatte der Hofmeister den Schieber des Kistchens schnell aufgeschoben und die schwarze, sonderbar geformte Flasche herausgenommen. Es verbreitete sich wirklich, wie der Bruder Cyrillus es mir gesagt, ein starker Duft, der indessen nichts weniger als betäubend, sondern vielmehr angenehm und wohltätig wirkte.
„Ei“, rief der Graf, „ich wette, dass das Elixier des Teufels weiter nichts ist als herrlicher echter Syrakuser.“