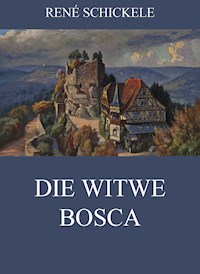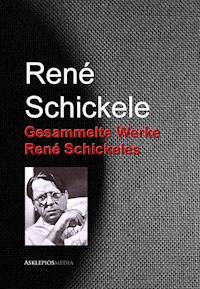Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Reese Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dies ist die groteske Geschichte des optimistischen Anarchisten und Lebenskünstler Richard Wolke, der beschaulich und sorgenfrei in einer Villa an der Côte d'Azur lebt, bis sich in der Nachbarschaft ein Bombenwerfer und seine Mätresse niederlassen. Der Verwicklungen sind viele. "Der Mensch ist weder belehrbar noch vertrauenswürdig, er ähnelt (zu seinem Nachteil) dem Hund. Er benimmt sich um so hündischer, als er nur zwei Beine zum Gehn hat, was ihn eingebildet und rachsüchtig macht." Der "Segler der Lüfte" Wolke wird langsam verrückt oder seine Umgebung ist es, die Lebenssituation ist ohne Ausweg und doch ist es ein witziger, beschwingter Roman, mit leichter Hand und viel Phantasie geschrieben. René Schickele (* 4. August 1883 in Oberehnheim im Elsass; † 31. Januar 1940 in Vence, Alpes-Maritimes) war ein deutsch-französischer Schriftsteller, Essayist, Übersetzer und Pazifist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Ich
Er und Sie
3 Uhr 5 Minuten
Achtung! Er ahnt was!
»Clos fleuri«
Der Prolet klettert
Unser Viertel
Das Geständnis
Ein Kindheitserlebnis
Geschichtliche Anklänge
Tausend Francs
Pipette
Selbstversorger in Liebesbriefen
Der Apéritif
Entartung
Eulen nach Athen
Genaueres über Josefo
Kleider machen Leute
Cimetière Miramar
Besuch
Die Straße
Sorgen um Pipette
Eine außerordentliche Bekanntschaft
Die Liebesnacht
Die Liebesnacht (Fortsetzung)
Leonore
Schweigen
»Amerika, du hast es besser«?
Ein Dichter
Schnee auf der Himmelsküste
Gespräche
Nah und fern
Keinen Alkohol mehr
Scherben
Vom Sterben
Fannys Verwandlung
Arme Nina!
Gewissensfrage
Das Hotelchen
Das Begräbnis
Der Segen der Tränen
Elfi
Konflikt mit einer Großmacht
Die Tat
Kreuzverhör
Die trockene Cholera
Die Anstalt
Abschiedsbrief an Alphons XIII., alias Casimir Castro
»Post für Sie! Post!«
Plato
Die Vogeluhr
Eine Ansichtskarte aus L. (Mittelwesten)
Das Seelenstündchen
»Glückauf!«
Die unterdrückte Hochzeitskantate
Picadores
Josefos Ende
Max
Das Horoskop
Was wollen Sie mehr!
Die Flaschenpost
Über den Autor
Impressum
Hinweise und Rechtliches
E-Books im Reese Verlag:
René Schickele
Die Flaschenpost
Roman
Reese Verlag
In den offenen Särgen schläft nichts mehr als die Kinder
Jean Paul
Ich
Wolke.
Richard Wolke ...
Heute waren die morgendlichen Luftschiffchen alle am Horizont versammelt. Als die Sonne aufging, gab jemand ein Zeichen, und sie segelten um die Wette los über den Himmel.
Eines nach dem andern kenterte, füllte sich mit Bläue und sank - ich sagte mir vergnügt: »darunter auch Richard Wolke«...
Meine Familie wohnt in den Vereinigten Staaten, dort, wo es am langweiligsten ist.
Kürzlich hat ein Sturm den Farmern einfach die Erde weggepustet. Übrig blieb eine Sandwüste.
Übrig blieb die Bank meiner Familie. Ich möchte wissen, mit wem sie jetzt Geschäfte macht. Selbst an Sandflöhen, scheint es, läßt sich verdienen. Mein Wechsel ist um die Hälfte gekürzt, die Beaufsichtigung durch meine Haushälterin Fanny, die sich la gouvernante de Monsieur Richard nennen läßt und gegen die fünfzig geht, merkbar verschärft worden.
Sie ist die Tochter eines Feldwebels und gleicht einer Generalswitwe. Hager, mit einem messerscharfen Profil und Sinn für Feinheit in Kleidung und Benehmen. Im Zwielicht erkennt man an ihr Spuren einstiger Schönheit.
Von Zeit zu Zeit kommt mein älterer Bruder herüber, um nach mir zu sehn. Seine Hauptbeschäftigung in Europa besteht darin, mit meiner Haushälterin zu schlafen. (Drüben müßte er sie heiraten.) Außerdem kauft er ›antike‹ Möbel, die in der Regel jünger sind als Fanny.
Ich bewohne die Villa Aspremonte. Teils weil sie ein ordentliches Badezimmer besitzt, teils weil sie mich an den Feldzug des Spartacus erinnert.
Wir sind deutscher Abkunft, ich kann ohne eine Weltanschauung nicht leben. Ich bin Anarchist. Ein wissenschaftlicher, versteht sich, kein Bombenschmeißer. Bakunin, Krapotkin, Stirner, Wolke. So.
Natürlich weiß es niemand genau, nicht einmal Fanny. Von den genannten Autoren habe ich übrigens wenig im Original gelesen, und wer mir daraus einen Vorwurf machen will, dem antworte ich: brauchst du die Geschichte deiner Familie zu studieren, um deine Brüder zu erkennen?
Trotz andauernder Verfolgungen neige ich zu Frohsinn und liebe die Frauen. Sie sind das anarchische, unbezähmbare Element der Gesellschaft. Leider habe ich verlernt, mit ihnen umzugehn. Man muß sie beherrschen, und das verbietet mir meine Weltanschauung.
»Gib acht, alter Junge, du gehörst zu denen, die von ihnen gefressen werden«, wiederholt mir mein Bruder, und ich merke es mir.
Ich bin ein Freund der Natur, ein Optimist. Mein Leben lang habe ich an die Freiheit und den Fortschritt geglaubt und die Tyrannen gehaßt.
Im Staat erblicke ich eine Organisation von Tyrannen, großen und kleinen. Um Menschen zu machen, muß man den Staat zerstören.
Fanny verläßt selten ihre Küche, sie lacht nicht. Bevor die andre Frau hier auftauchte, lebte ich ruhig.
Die ist, was man früher, als derartiges noch im Preise stand, ein Prachtweib nannte, gesund wie ein Tier und, sofern ich mich nicht täusche, erschreckend gewöhnlich.
Er und Sie
Seit gestern weiß ich, daß er der abgesetzte König von Spanien ist.
Die dicke Unterlippe, die etwas überzwerche Nase. Haus Habsburg, wie es leibt und lebt.
Düster blickt er in eine Welt, von der ihm nichts mehr gehört. Um die Sonne zu genießen, die im Reich seiner Vorfahren nicht unterging, muß er Eintritt bezahlen, nämlich die Fremdensteuer. Das ist der Lauf der Welt, und ich gedenke dafür zu sorgen, daß er ihn nicht aufhält.
Und sie? Nicht so einfach, wie ich dachte. Vorläufig nenne ich sie für mich das Königlich Apostolische Vergnügen. (Daß er von seiner Frau getrennt lebt, stand vor Jahr und Tag in der Zeitung.) Je näher man sie kennt, um so gewinnender wird sie. Aber sie lacht viel.
Wenn sie lacht, empört sich alles an ihr vor Lust, es entsteht ein tolles Durcheinander, eine Art Kosmogonie, mir wird heiß und kalt, aus dem Weltraum tanzen Sonnen und Sterne, und alle Farben des Regenbogens flimmern um ihr kupferrotes Haar.
Die Welt gebiert ein Weib - oder ein Weib die Welt. Die Sintflut nicht zu vergessen. Sie lacht Tränen. Mich beunruhigt es. Ihm scheint es zu gefallen.
Sie überragt ihn um Kopfeslänge und tut auf ihre Weise schön mit ihm. Sie ist keine Katze, sie ist ein Löwe. Mit einem Puppengesicht. Also eine Sphinx. Gewaltig lacht sie den Mann an. Düstere Naturen werden davon angezogen. Im übrigen geht sie mich nichts an. Ich habe mit ihm zu tun.
3 Uhr 5 Minuten
Ich habe ihm gleich mißtraut.
Als er mich das erstemal ansprach, fragte er, ob ich schon lange hier wohne.
»Es ist hübsch einsam bei Ihnen«, meinte er. »Man wird nicht belästigt - wie? Nicht beobachtet? Die Nachbarn kümmern sich nicht um Sie?«
»Manche doch«, sagte ich abweisend, denn damals interessierte er mich noch wenig.
Er grinste in seine Habsburglippe, und seine Dame lachte in beleidigend lauter Weise.
»Die Dame ist wohl Ihre Konkubine?« fragte ich.
»Geraten!« rief sie.
Sie mußte stehn bleiben, von Lachen geschüttelt. Sicher näßte sie ihre Hose - oder, wie hierzulande neben den Preisen schamlos in den Schaufenstern zu lesen steht: ihr Geschlechtsversteck (cachesexe). Ich beobachtete ihn. Er tat, als hätte ich der Schönen ein Kompliment gemacht. Von Moral und Anstand keine Spur.
Wie in einem Wetterleuchten habe ich ihn erkannt und im gleichen Augenblick auch seine furchtbaren Pläne. Kaum vierzehn Tage habe ich gebraucht, um dahinterzukommen.
Das Gefährlichste am Menschen ist sein Mitteilungsdrang. Hätte er mir nicht von Spanien gesprochen, ich wäre vielleicht noch lange im Dunkeln getappt. Aber hat man nicht beobachtet, daß Verbrecher mit Vorliebe an den Ort ihrer Untat zurückkehren? Dieser hier kann es vorläufig nur in Gedanken. Seine Gedanken haben ihn verraten.
Als meine Bestürzung vorbei war, blickte ich auf die Uhr.
Es war 3 Uhr 5 Minuten.
Ein denkwürdiger Tag.
Ich fuhr in die Stadt und kaufte im Warenhaus dieses Heft, eine rosa Kladde mit dem schwarzen Aufdruck Le Lafayette.
Darin werde ich über mein Unternehmen Rechenschaft ablegen, mir selbst, weil mein Gedächtnis täglich schwächer wird, und der Nachwelt, damit sie erfährt, wie ich sie vor der Katastrophe bewahrt habe.
Das Heft enthält hinten ein alphabetisches Register. Ich versehe die wichtigeren Eintragungen mit einem Stichwort, das sich im Register wiederfindet.
Achtung! Er ahnt was!
»Warum wollen Sie überall in der Welt die Monarchie aufrichten?« fragte ich ihn unvermittelt. Er sah mich an und antwortete mit einem seltsamen Lächeln:
»Damit Sie gesund werden, lieber Herr.«
Als wir heute im Begriff waren, uns vor seinem Gartentor zu verabschieden, sagte ich:
»Erinnern Sie sich, wie zu Ende des letzten Krieges die Kronen über das Pflaster rollten?«
»O ja«, erwiderte er. »Eine erquickende Erinnerung! Und auch den Monarchen, die ihre Krone retteten, erging es schlecht genug.«
»Sie haben gut reden«, meinte ich.
Er sah mich groß an:
»Wieso?«
»Im Spätsommer 1914 kam der progressive Mars im viereckigen Aspekt zum Radix, und zugleich zeigten die Horoskope aller gekrönten Häupter des Kontinents unharmonische, zum Teil katastrophale Aspekte mit Mars im Aszendenten. Davon waren zwei Könige ausgenommen. Der eine zumindest sollte Ihnen bekannt sein.«
»Keine Ahnung«, sagte er verblüfft. »Reden Sie Chinesisch?«
»Der eine war der König Victor Emanuel von Italien. Der andre ...«
Ich schmunzelte und betrachtete die dicke Unterlippe, die etwas überzwerche Nase.
»Na also, heraus damit!« rief er.
»Den ändern können Sie sich an der Nase ablesen.« Damit ließ ich ihn stehn.
Der andre war er selbst. Alphons XIII.
Freilich, seitdem ...
Ich drehte mich um, weil ich eine Beunruhigung im Rücken spürte.
Er verweilte noch immer an der Stelle, wo ich ihn verlassen hatte, leicht vorgebeugt, in einer Haltung gespannter Wachsamkeit, ein Jäger auf dem Anstand.
Gierig hing er an jeder meiner Bewegungen - auch jetzt noch, da ich mich ihm zugekehrt hatte.
Nach Verwindung des ersten Schreckens (ich hatte mich plötzlich statt auf der geteerten Straße mitten in der Wildnis gefühlt) rief ich scherzhaft:
»Bitte, nicht schießen! Bitte, bitte!«
Jetzt erst befreite er sich von dem Zwang, der ihn gefangen hielt, und der Jäger enthüllte sich als das Wild ...
Er hob das Händchen und winkte:
»Bye-bye!«
Sein Bye-bye, das er nur bei besonderen Gelegenheiten an wendet, hat einen Anflug von ängstlicher Wehmut, es klingt wie: Ich wäre sehr traurig, mein Lieber, wenn du mir was antätest ...
Höflichkeitsformeln im Dschungel.
Ich habe die Stunde notiert, da ich ihn erkannte, und den Tag vergessen!
Ich könnte Fanny fragen, aber sie würde mir bestimmt aus Bosheit ein falsches Datum nennen.
»Clos fleuri«
Er wohnt gegenüber, fünfzig Schritt quer über die Straße. Vom Gartentor führt ein von Reben überwachsener Sandweg zum Haus. (Bei mir eine Allee von Ölbäumen.) Der Rebgang hat den Vorteil, daß er einen etwa 60 Meter langen Tunnel bildet, Casimir braucht sich nur mit einer automatischen Pistole an der Mündung des Tunnels aufzustellen, um jede unerwünschte Annäherung zu verhindern.
Fremde werden hier beim Vornamen genannt. Man hat die Erfahrung gemacht, daß die ausländischen Familiennamen unmöglich auszusprechen sind, wohingegen die Vornamen ein wahrhaft katholisches, nämlich universales, Gesicht bewahren. In den Kalendern der zivilisierten Völker werden so ziemlich die gleichen Heiligen geführt.
Für die Post, die sich keinen Namen zu merken braucht (sie bekommt ihn allemal schriftlich), heißt er Casimir Castro. Für alle andern geht er, in kurzen Ärmeln und in Sandalen, als Monsieur Casimir auf unserm Hügel spazieren und das Königlich Apostolische Vergnügen, das ein bißchen mehr am Leibe hat, als la dame de Monsieur Casimir. So werde ich im ewigen Sommer hier (nirgends friert man im Winter mehr als im Süden, aber keiner, der da wohnt, will es wahrhaben, der Sommer ist so überwältigend, daß man den Winter immer wieder vergißt) als Monsieur Richard leben und sterben und der Amerikaner vom Sentier du vieux jaune, dessen Reichtum unerschütterlich bleibt, weil sein Geschäft in Buffalo Schönheitsmittel fertigt und die Eitelkeit der Frauen die Weltkrise selbst überdauert, als Monsieur Jonny. Nun wäre ja Castro für unser hauptsächlich von eingewanderten Italienern bewohntes Viertel unschwer auszusprechen. Warum sollte aber gerade für ihn eine Ausnahme gelten, da man ohnedies lediglich aus Takt von einem Casimir spricht, dazu noch mit einem gelegentlich durch Augenzwinkern gehobenen Lächeln, das anzeigt, man sei keineswegs auf den Kopf gefallen, wenn man sich auch als umgänglicher Nachbar und Kavalier ein wenig dumm stelle! ...
Bis vor kurzem wohnte in Clos fleuri eine englische Dichterin, und der Ort bewahrt ihr Andenken als Vermächtnis. Oft genug sind die Dinge treuer als die Menschen.
Das Haus, weiß, mit flachem Dach, leuchtet unter den
Ranken der violetten Bougainvillea wie eine nackte Frau unter einem dichten, jedoch zu knappen Überwurf. Die Terrasse ist eingerahmt von Staudenrabatten, durch die der Länge nach in aneinandergereihten Rundziegeln Wasser fließt. Hier blüht es das ganze Jahr. In den Rundziegeln trinken und baden die Vögel, und die Schmetterlinge, zwischen Licht und Schatten, taumeln von einer Trunkenheit in die andre. Segelfalter kreuzen über der Terrasse. Von Zeit zu Zeit kommt eine Katze geschlichen, schaut sich um und verschwindet im Dschungel der Rabatten. Dann ist lange kein Vogel zu sehn.
Der Prolet klettert
Ein Gewitter bei hellem Sonnenschein. Zwei Schläge, offenbar in die Telefonleitung, es knackt zweimal heftig, und das Telefon geht nicht mehr. Im Petit Méridional ein Bild meines Casimir mit der dicken Unterlippe und etwas überzwerchen Nase: »Alphons XIII., ehedem König von Spanien, der incognito unter uns weilt.«
Fanny kommt mit dem Blatt ins Zimmer gestürzt:
»Le voilà!«
Freilich ist er’s, unser Casimir.
Sie guckt mich beifallheischend an, ungefähr wie: »Na? Habe ich’s nicht schon immer gesagt!«
Dabei wollte sie es mir heute früh noch nicht glauben.
»Mein Sohn hat eine Freistelle im Lyzeum«, erzählt mir Josefo. »Er lernt gut. Seine Kameraden sind Söhne reicher Leute. Er soll es besser haben als ich.«
Josefo ist Kommunist. Sein Sohn, geborener Prolet, hat keinen größeren Wunsch, als zu den reichen Leuten überzugehn, und dem Alten ist es recht. Er sieht darin eine Art Rückversicherung. Kommen die Sowjets, wird der Alte ein großer Mann, kommen sie nicht, wird es der Sohn. Seit der Erklärung der Menschenrechte will alle Welt die Leiter hinaufklettern. Aber so viel Leitern gibt es nicht. Daher das Gedränge.
Wie Abhilfe schaffen? Sehr einfach: indem man den Leuten die Leitern wegnimmt.
Ich habe Fanny erklärt, daß es dann nur noch geistige Leitern geben wird, Jakobsleitern, gewissermaßen. Ich habe ihr ein Volk von Seligen geschildert, die einzig um der Ehre und irdischen Seligkeit willen, in der Verkündung des Allerhöchsten, nämlich ihres Kollektivs, wetteifern. Schließlich riß ihr die Geduld.
»Was scheren mich die Juden, die eine Leiter brauchen, um in den Himmel zu kommen!« erklärte sie. »Mir wäre eine Gehaltserhöhung lieber.«
Der Mensch muß klettern. So oder so. Ich habe Fanny um fünfzig Francs erhöht.
Sie ist mit dem Bild meines Casimir in der Nachbarschaft herumgezogen und hat es dann an die Wand ihrer Stube geheftet.
Herrliches Wetter. Abends steht die Sichel des zunehmenden Mondes in einem grünen Himmel zwischen den Farben des Sonnenuntergangs, kräftig gezeichnet im rosigen Blut. Fanny singt in der Küche. Das Essen ist besser geworden. Die fünfzig Francs haben ihren Ehrgeiz geweckt. Sie denkt an die nächste Sprosse.
Der Prolet klettert. Der eine in der Masse, der andre einzeln.
Der Bürger sieht es ungern, zumal wenn es massenhaft geschieht.
Die Kerle sind so viel frischer als er!
Ein junger Gott glänzt in der Dämmerung, wie die Mondsichel über dem Untergang.
Unser Viertel
1
Ursprünglich wurde unser Viertel durch wohlhabende Fremde verschiedener Nationalität besiedelt, die sich von ihren Geschäften unter den blauen Himmel zurückgezogen hatten. Als die Dämmerung der Zeit sich ankündigte, gingen die meisten dorthin zurück, woher sie gekommen waren, sei es, um ihr brüchig gewordenes Vermögen zu flicken, sei es, um auf dem Posten zu sein, wenn die Entscheidungsschlacht der Riesen und Götter beginnt.
Ihre Villen stehn leer. Viele sind zu verkaufen, ernstlich oder zum Schein. (Wer seine Besitzung nicht bewohnt und sie zum Verkauf ausschreibt, zahlt keine Steuer.) Aber die kleinen Häuser ringsum, die mas oder cabanons beherbergen nach wie vor Blumenzüchter, Landarbeiter und Handwerker. Wegen des Überflusses an Wasser ist es ein bevorzugtes Viertel auch für die Gärtner und ihren Anhang.
In den großen Wasserbehältern aus Zement hausen Massenchöre von Fröschen. Mit ihren ersten Proben beginnen sie bereits im April. Anfangs sind es nur zwei oder drei Sänger, die nicht mehr verhalten können, was sie fühlen. Bald aber, beinah auf einen Schlag, packt auch die ändern die Liebe und damit die Lust, sich überschwenglich mitzuteilen. Der A-capella-Chor unterhalb meines Hauses zeichnet sich durch einen besonders begabten Vorsänger aus. Sein Verdienst ist es, wenn unser Froschgesang, weithin gehaßt und beneidet, seinesgleichen sucht im Lande. Zwar führen die Kollegen ihre Truppe mit bemerkenswerter Hartnäckigkeit allnächtlich von neuem ins Treffen, doch gelingt es ihnen nicht, in der rauhen Nachtmusik zu siegen.
Solange die Villenbesitzer wirtschaftlich noch bei Kräften waren, bekämpften sie, was sie eine Plage nannten, indem sie Fische in die Wasserbehälter setzten. Die Fische fraßen die Froscheier, und die Sommernächte litten darunter. Seitdem die Krise die meist unmusikalischen Geschäftsleute von unserm Hügel weggejagt hat, vermehren sich die Chöre ungestört. Sie wachsen ins Riesenhafte, man hört sie bis in die Stadt hinunter. Und immer behalten, dank der Gewichtigkeit ihres Vorsängers, die knotigen Troubadoure unterhalb meines Hauses die Führung. Und gegen Morgen das letzte Wort.
Fanny haßt sie.
Während des ganzen Sommers droht sie mit Kündigung und beruhigt sich erst, wenn sich auch die Frösche beruhigen.
Neulich ist sie im Nachthemd auf die Terrasse gelaufen und hat auf sie eingeschimpft. Tatsächlich verstummten sie sekundenlang, und als sie wiederum einsetzten, schienen die ersten Töne ais empörte Klage an die unparteiischen Sterne gerichtet.
2
Die eingewanderten, zum großen Teil naturalisierten Italiener sind fleißig, anspruchslos und sparsam. Sie bilden die Mehrheit der werktätigen Hügelbewohner.
Viele glauben an das Bevorstehn von zwei Ereignissen, die sich gegenseitig ausschließen, in ihrem Herzen jedoch eine reibungslose Verbindung eingehn: den Triumph des Kommunismus in der Welt und den Sieg Mussolinis über Frankreich, der die Annexion des Gebietes zwischen dem Var und den Seealpen zur Folge hätte. Eine besondere Vorliebe hegen sie weder für das eine noch das andre. Beides, meinen sie, würde sie zu Eigentümern des von ihnen bebauten Landes machen.
Infolgedessen sind sie gleichzeitig Kommunisten und Faschisten, wie sie gleichzeitig Italiener und Franzosen vorstellen, Proletarier und Grundbesitzer. Ihre Kinder besuchen die französische Schule. Was aus den Familien schließlich wird, ob Franzosen oder Italiener, bedeutet für sie kein Problem. Sie finden es müßig, darüber nachzudenken. Was kommen soll, kommt ohne ihr Zutun. Josefo ist ihr Oberhaupt und, wie es sich für einen rechten Führer gehört, der Brennspiegel ihrer Empfindungen, das Sammel- und Klärbecken ihrer Triebe. Allerdings mit dem Unterschied, daß er bereits besitzt, was sie in ihrer Einfalt begehren - und einiges darüber.
Er ist Freigeist und schickt seine Tochter zu den katholischen Schwestern in die Schule, er verneint die bürgerliche Kultur und läßt seinen Sohn das Lyzeum besuchen. Er sympathisiert mit den Kommunisten, ob Emigranten oder Franzosen, und bewacht sie. Er bewacht auch die paar übriggebliebenen Villenbesitzer, hartnäckige Rentner oder pensionierte höhere Offiziere, denen er in trüben Stunden seinen geistigen Beistand nicht versagt. Er sieht zu, wie ein ehemaliger russischer Weißgardist, den ein polnischer Jude als Chauffeur beschäftigt, die Telegrafenstangen mit Hakenkreuzen beschmiert, und er merkt sich den Mann. Vorläufig geschieht nur, daß die Postverwaltung nach einiger Zeit die Hakenkreuze entfernen läßt. Alle halten Josefo für ihren Freund oder Parteigänger. Eine kleine Drehung des Kopfes, und Josefo hat seinen Standpunkt gewechselt. Diese Bewegung regelt seinen Gang wie das Pendel die Uhr. Ganz gleich, wer ihn ansieht, für jeden geht er richtig.
Seine Besitzung, am Höhenweg gelegen, auf dem die städtischen Autobusse verkehren, umfaßt ein Wohnhaus, zwei Bretterbuden und ein beträchtliches Stück Land. Das Erdgeschoß des Wohnhauses ist als Trink- und Tanzdiele eingerichtet, mit Lautsprecher und russischem Billard. In der größeren der Bretterbuden verkauft seine Frau Nina, ein feingesponnenes, beinahe durchsichtiges Wesen, von dem kaum das Ergebnis seiner vielseitigen Tätigkeit auffällt, ungefähr alles, was man zum Leben braucht, vom echten Parma-Schinken (einer Spezialität des Hauses) bis herab zur Schuhwichse. Die kleinere Bude beherbergt den Schuster Philippe und seine Familie, lauter Köpfe, die leicht überkochen, grundsätzlich strenge, unter Lebensgefahr aus Italien geflüchtete Anarchisten. Sie lehnen es ab, sich naturalisieren zu lassen. Sie verkünden die persönliche Gewalttat, nicht nur gegen den Staat, auch gegen ihren Hauswirt Josefo.
Schuster pflegen von gedrungener Gestalt zu sein. Der unsre dagegen gleicht dem Zerrbild eines Schneiders. Eine überlebensgroße Spinne mit Feueraugen!
»Ohne die Augen würde er im Winter erfrieren«, sagen die Leute.
Wie er es ablehnt, seine Einbürgerung zu beantragen, weil dies die Anerkennung des Staates einbegriffe, so wünscht er als Beweis und Unterpfand seiner Befreiung von der heimatlichen Zwingherrschaft mit Philippe gerufen zu werden statt mit Filippo. Hier stehn wir vor der Gewitterecke des Hügels ...
Im Winkel zwischen dem Haus und den Buden lockt der schönste Hof eines Landes, wo die Terrasse die ›gute Stube‹ der nördlichen Länder vertritt und jede Hütte mit einem wohlgeformten köstlichen Vorplatz aufwarten kann, der sauber gehalten und mit Blumen geschmückt wird. Den Schatten geben bei Josefo Bäume, die man hierzulande wenig sieht: ein Kirsch-, ein Apfel-, ein Birnbaum und den Rest übernimmt eine langgestreckte, nach der einen Seite offene Weinlaube, die er mit Künstlerauge verwildern läßt. Weiter unten streckt sich der Platz für das Boule-Spiel, und dann kommt Josefos Stolz, der Weinacker mit dem Hühnerhof in der Mitte.
Er verabreicht für wenig Geld Mahlzeiten, die seine Frau gewissermaßen mit einem Fuß im Jenseits, in einer Art kulinarischer Verzückung zubereitet.
An Sonn- und Feiertagen sind Gastzimmer und Terrasse überfüllt, und seine beiden Kinder steigen von den Höhen bürgerlicher Bildung herab, um bei der Bedienung der Gäste zu helfen.
Ihr Vater ist dauernd etwas vom Alkohol benommen. Dieser Dämmerzustand hat sein Gutes. Er enthebt Josefo der Notwendigkeit eines entschiedenen Vorgehens, wie er ihn andrerseits vor eindeutigen Ansprüchen der Gesellschaft schützt.
Josefo ist ein Stück Erde, fruchtbarer Boden in bekömmlichem Klima. Das Geschäft blüht von selbst. Er scheint unbeteiligt an seinem Gedeihen, ja, zuweilen sieht es aus, als arbeite er geradezu gegen sein Glück. Und das Glück, da hilft kein Teufel, erweist sich als stärker.
Zum Beispiel war er der erste, den Fanny über den angeblichen Monsieur Casimir aufklärte, und er begriff sofort, was der erregende Umstand für unser Viertel und also für seine Wirtschaft bedeutete. Er griff zu. Auf seine Veranlassung grub der Petit Méridional ein altes Klischee aus und veröffentlichte es mit der Unterschrift: »Alphons XIII., ehedem König von Spanien, der incognito unter uns weilt.«
Als der Schuster und sein Anhang anfingen, den Hügel wegen der Anwesenheit meines Casimir mit mörderischen Drohungen zu erschrecken, hörte Josefo, diesmal von mir, daß Seine Majestät sich für einen Anarchisten ausgebe. Er bezweifelte das eine wie das andre, aber er griff zu. Er nahm den Anarchisten und schenkte ihn, nachdem er sich unter gotteslästerlichen Flüchen ihrer Verschwiegenheit versichert hatte, den ›Wilden‹ der kleinen Bude, der Schusterfamilie, was die Gewitterecke in ein ›Hoch‹ über unseren Hügel verwandelte. Mit Recht fühlt er sich unabhängig vom Gang der Weltgeschichte. Er fährt gleichsam auf ihrem Freilauf.
Am Sonntagabend aber ist er aufrichtig betrunken. Vielleicht kommt der Tag, da läßt Josefo zwei Dutzend oder drei seiner Getreuen an die Mauer seines Gartens stellen und erschießen.
Er ahnt es, aber seine Unvoreingenommenheit ist so wahr, daß er sich nicht einmal fragt, welche es sein werden.
Das Geständnis
Er leugnet nicht mehr.
»Wie geht es Eurer Majestät?« habe ich gefragt.
»Danke gut«, hat er geantwortet. »Ich komme gerade vom Ministerrat. Meine Herren sind unzufrieden mit Ihnen.«
»Darf ich fragen, warum?«
»Sie treiben sich etwas auffällig in der Nähe der Residenz herum. Man hält Sie für einen Anarchisten. Mein Polizeiminister behauptet, eine Bombe in Ihrer Hand gesehn zu haben. Nur mit Mühe habe ich ihn überzeugen können, daß es eine Spielkugel war.«
Er klopfte mir leutselig auf die Schulter und verabschiedete sich mit den Worten: »Sie sind gewarnt!«
Jawohl, ich bin gewarnt, aber er hat gestanden.
Im Garten hörte ich das Königlich Apostolische Vergnügen lachen. Der Schweiß brach mir aus.
Ein Kindheitserlebnis
Zur Erklärung einer Eigentümlichkeit, die meinem Gemütsleben anhaftet, muß ich ein frühes Erlebnis berichten. Wir waren fünf Kinder, die meine Mutter in ihrer praktischen und menschenfreundlichen Weise schnell hintereinander zur Welt brachte, so daß der letztgekommene mühelos Anschluß an die vorhergegangenen Spielkameraden fand. Max war der älteste, dann folgte ich, dann Felix, zuletzt das Zwillingspaar Johann und Anna. Als wir fünf waren, erklärte unsre Mutter den Kindersegen für ausreichend, erhob uns zum Selbstverwaltungskörper, den vorübergehende Erzieherinnen deutscher und französischer Sprache nur recht unzulänglich zu beaufsichtigen vermochten, und wandte sich wieder den Geschäften zu. Sie versteht sich besser darauf als der Vater, der in zehn Meilen den Spitznamen ›Der Bank ihr Herzchen‹ (the bank’s sweetheart) führt, woraus sich unter anderm schließen läßt, daß er seine Anziehungskraft mehr persönlichen Reizen als seiner Geschäftstüchtigkeit verdankte. So wuchsen wir nach Wunsch der Mutter und aus eigenem Trieb in einer Kinderwelt auf, deren hohe Mauern für uns durchlässig waren, nicht aber für die ändern. Wir versorgten uns selbst mit allem Nötigen und ließen uns schwerlich etwas aufdrängen. Unsere Mysterien waren undurchdringlicher als die der Inkas, wir pflegten geheimnisvolle Gebräuche, deren Ursprung und Sinn wir heute selbst nicht mehr erforschen vermöchten.
Von Zeit zu Zeit trat eine Katastrophe ein, eine Heimsuchung, vergleichbar dem Überfall einer Pflanzung durch Heuschrecken, eine Prüfung wie ein sechstägiger Sandsturm, ein Bergrutsch, der unsere Welt unter sich zu begraben drohte. Dann stieg aus dem in wohltuender Entfernung kreisenden mütterlichen Gestirn eine Frau hernieder, strahlend schön und nicht gar so viel älter als wir, warf mit lachender Strenge die Kinderwelt in das Chaos zurück, wie man den Inhalt eines Baukastens umstürzt, und erschuf sie von neuem. Und siehe, sie war wunderbarer als zuvor! Alle fünf standen wir, in Anbetung der göttlichen Gestalt versunken, nebeneinander in einer Reihe, und das Gestirn hatte längst wieder seinen Platz am Familienhimmel eingenommen, da schlichen wir noch immer herum, von ihrer Allmacht verwirrt und schwermütig vor Sehnsucht nach ihrer überwältigenden Nähe, bis wir mit eins neue, nie gekannte Kräfte in uns entdeckten, die wir schleunigst und nicht immer zum Vorteil der Umwelt gebrauchten. Ein einziges Mal sahen wir uns nach einem dieser glückhaft gewendeten Schicksalsschläge ernstlich vermindert. Das war, als unsere Schwester Anna durch ein Machtwort des Vaters von uns getrennt wurde. Bei ihrem Zwillingsbruder Johann und (wie sich später zeigte) auch bei Anna hinterließ der Eingriff lebenslängliche Spuren. Bis auf den heutigen Tag bilden beide ein unzertrennliches Paar. Sie halten auf Tod und Teufel zusammen, wobei ein jedes leidenschaftlich an den Erlebnissen des ändern teilnimmt, als litte und freue sich das eigene Fleisch, mit einer Neigung, alles einschließlich ihrer selbst nicht ganz ernst zu nehmen, einer ungemeinen Lust am Possenspiel, deren Opfer ihren Weg bezeichnen. Ihrer Familie stehn sie mit munterer Boshaftigkeit gegenüber und geben ihr gern zu verstehn, Rücksicht auf die Mutter allein verhindere sie, die Firma Browsters und Wolke mit dem Dynamit ihrer Enthüllungen in die Luft zu jagen.