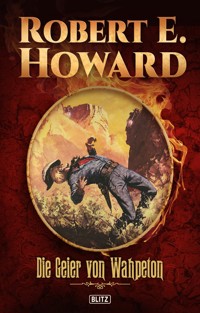
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Kult (Schätze der Unterhaltungsliteratur)
- Sprache: Deutsch
Aus dem Amerikanischen von Markus MüllerEine Bande Gesetzloser terrorisiert das Städtchen Wahpeton. Der Sheriff engagiert einen texanischen Revolverhelden. Der eiskalte Killer soll Recht und Ordnung notfalls mit Gewalt wiederherstellen. Doch schon bald zeigt sich, dass in Wahpeton, einem Ort, der unter dem Goldrausch und Intrigen leidet, nichts so ist, wie es scheint.Die Printausgabe umfasst 150 Buchseiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert E. HowardDIE GEIER VON WAHPETON
In dieser Reihe bisher erschienen:
1001 Edgar Rice Burroughs Caprona - das vergessene Land
1002 Ernst Konstantin Sten Nord - der Abenteurer im Weltraum
1003 Jack Franklin, der Weltdetektiv
1004 Robert E. Howard Die Geier von Wahpeton
Robert E. Howard
DIE GEIER VON WAHPETON
Aus dem Amerikanischen vonMarkus Müller
Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Reihen-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2018 BLITZ-VerlagRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mark FreierSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-773-3Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Seine von zahlreichen Umzügen geprägte Kindheit verbrachte der 1909 im texanischen Peaster geborene Robert E. Howard in zehn verschiedenen, zumeist durch Viehzucht geprägten, Kleinstädten und Dörfern.
Mit 18 Jahren verkaufte Howard seine erste Story an das Weird Tales Magazine. Bevor es ihm gelang, seinen Lebensunterhalt ausschließlich als Schriftsteller zu finanzieren, verdingte er sich in verschiedenen Jobs, beispielsweise als Landvermesser oder Cowboy. Innerhalb weniger Jahre stieg Howard zu einem der erfolgreichsten Pulp-Autoren seiner Zeit auf. Jedoch war es ihm nicht vergönnt, die Früchte seiner Arbeit lange zu genießen. Am 11. Juni 1936 nahm er sich in Cross Plains in Texas im Alter von nur 30 Jahren das Leben.
Obwohl Robert E. Howard keine lange Schaffenszeit vergönnt war, hinterließ er der Nachwelt ein umfangreiches Werk. In Deutschland ist er in erster Linie durch seine Fantasy-Storys um Helden wie Conan den Barbaren bekannt, aber auch durch Horrorerzählungen und die Zugehörigkeit zum Lovecraft Circle. Daneben verfasste er zahlreiche abenteuerliche Geschichten aus dem Orient, Anekdoten rund um schlagkräftige Boxer sowie Western.
Besonders das Westerngenre hatte es Howard angetan, da es ihm die perfekte Möglichkeit bot, die Verbundenheit zu seiner geliebten texanischen Heimat und dem rauen Menschenschlag, den sie damals hervorbrachte, zum Ausdruck zu bringen. Kurz vor seinem Tod verlegte sich Howard fast komplett auf das Schreiben von Western.
Der BLITZ-Verlag hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, den hierzulande fast unbekannten Teil von Howards Schaffen einem interessierten Publikum zur Verfügung zu stellen.
Die amerikanische Erstveröffentlichung des vorliegenden Romans erfolgte posthum im Dezember 1936 im Smashing Novels Magazine unter dem Titel The Vultures of Wahpeton.
Inhaltsverzeichnis
Schüsse im Dunkeln
Die Bretter der schmucklosen Holzvertäfelung an den Wänden des Golden Eagle Saloons schienen noch immer unter dem donnernden Echo der Schüsse in der Dunkelheit zu vibrieren. Noch vor wenigen Sekunden war die Finsternis von blutroten Schussbahnen durchschnitten worden. Lediglich das nervöse Scharren von Stiefeln brach die gedrückte Stille, die sich mit dem Verklingen des Revolverfeuers über den Schankraum gelegt hatte. Doch dann rieb irgendwo ein Streichholz über Leder und ein gelbliches Flackern flammte auf, in dessen Schein sich ein bleiches Gesicht und eine zitternde Hand abzeichneten. Gleich darauf erleuchte eine Öllampe mit zerbrochener Glaseinfassung den Saloon. Dank ihres Lichts wich die Spannung aus den bärtigen Gesichtern der Anwesenden und machte Erleichterung Platz. Der imposante Lüster, der in der Mitte des Raums von der Decke hing, war vollkommen zuschanden gerichtet. Kerosin tropfte von ihm nach unten und bildete eine ölige Lache, direkt neben einer zweiten, weitaus grauenvolleren Pfütze.
In der Mitte des Raums befanden sich zwei Gestalten, direkt unter dem zertrümmerten Kronleuchter. Die eine lag mit dem Gesicht nach unten bewegungslos da, mit ausgestreckten Armen und gespreizten Fingern. Die andere kroch ein Stück vorwärts, dann rappelte sie sich auf. Wieder auf den Beinen, blinzelte sie unkontrolliert und machte vor Benommenheit ein dämliches Gesicht, als habe sie zu tief ins Glas geschaut. Ihr rechter Arm baumelte schlaff von der Schulter, die Hand hielt kraftlos einen langläufigen Revolver. Plötzlich regten sich die Gäste, die zuvor stocksteif in einer Reihe an der Bar gestanden hatten. Einer nach dem anderen trat nach vorne, um einen Blick auf den niedergestreckten Mann zu werfen. Kaum, dass sich eine wilde Diskussion erhob, ertönten von draußen eilige Schritte. Die Menge bildete eine Gasse, als sich der Neuankömmling zielstrebig einen Weg durch diese bahnte. Sofort dominierte er das gesamte Geschehen. Breitschultrig, etwas mehr als mittelgroß, trug er einen weißen Hut, elegante Stiefel und ein schickes Halstuch. Seine Kleidung stand in starkem Kontrast zu den abgewetzten Klamotten der anderen Anwesenden. Gleiches galt für den schmalen, schwarzen Schnurrbart in seinem scharf gezeichneten, finsteren Gesicht, das nur wenig mit den bärtigen Visagen seiner Gegenüber gemein hatte. Der Lauf seiner mit einem Elfenbeinknauf versehenen Kanone zeigte nach oben.
„Welcher Satan hat dieses Werk vollbracht?“, fragte er barsch. Als sein Blick auf den Mann am Boden fiel, weiteten sich seine Augen. „Grimes!“, stieß er hervor. „Jim Grimes, mein Deputy! Wer hat das getan?“ Er hatte etwas Tigerhaftes an sich, als er an die verstörten Männer herantrat. „Wer ist dafür verantwortlich?“, verlangte er mit vorgehaltener Knarre zu wissen. Seine Körperhaltung wirkte, als sei er jederzeit dazu bereit, loszuspringen oder abzudrücken.
Die Männer tippelten mit den Füßen oder wichen zurück. Nur einer von ihnen wagte zu sprechen: „Wir wissen es nicht, Middleton. Jackson hatte gerade beste Laune und hat ein paar Mal in die Decke geballert. Wir anderen waren an der Bar und haben ihm dabei zugeschaut. Da kam Grimes herein und wollte ihn festnehmen ...“
„... und Jackson hat ihn erschossen“, mutmaßte Middleton und richtete seinen Revolver mit verblüffender Schnelligkeit auf den – nach wie vor benommenen – Verdächtigen. Jackson schrie vor Schreck auf und hob die Hände.
Der Mann, der das Wort ergriffen hatte, ging dazwischen und sagte: „Nein, Sheriff. Jackson kann es nicht gewesen sein. Die Trommel seines Revolvers war leer, als das Licht ausging. Er hat sechs Kugeln in die Decke geknallt und der Hahn klickte noch dreimal hörbar nach dem letzten Schuss. Er kann es mit Sicherheit nicht gewesen sein. Als Grimes ihn sich schnappen wollte, hat jemand den Kronleuchter ausgeschossen. Danach hat er noch ein weiteres Mal gefeuert. Sobald es wieder hell war, sahen wir, dass Grimes am Boden lag. Und Jackson hat sich gerade aufgerappelt.“
„Ich war’s nicht“, stammelte Jackson. „Ich hab’s mir einfach nur gut gehen lassen. War ziemlich besoffen, aber jetzt bin ich wieder nüchtern. Ich wollte mich der Verhaftung nicht widersetzen. Hab’ keine Ahnung, was passiert ist, nachdem es dunkel wurde. Ich hab ’nen Schuss gehört und da hat mich Grimes auch schon im Fallen mit nach unten gerissen. Keine Ahnung, wer’s war.“
„Keiner von uns hat was mitbekommen“, meinte ein zerzauster Goldsucher, „aber einer muss ja gefeuert haben ...“
„Nee, mehr als einer“, murmelte ein anderer. „Ich hab’ gehört, wie mindestens drei oder vier Schießeisen losgingen.“
In der folgenden Stille beäugten sich die Männer gegenseitig argwöhnisch. Sie hatten sich wieder dicht gedrängt an die Bar abgesetzt, sodass der Sheriff alleine im Zentrum des Saloons stand. Vor Furcht und Misstrauen wirkten die Männer wie versteinert und es hätte nur eines Funkens bedurft, um eine Explosion zu verursachen. Ein jeder von ihnen wusste, dass einer der Mörder bestenfalls eine Armlänge weit weg von ihm stand. Also vermieden sie es, sich direkt in die Augen zu sehen, aus Angst, darin ein Schuldeingeständnis auszumachen – mit der Folge, als Nächster getötet zu werden. Stattdessen starrten sie den Sheriff an, als erwarteten sie, dass er jeden Moment von den gleichen unerkannten Schützen erledigt würde, die seinen Deputy ermordet hatten.
Als Middletons stahlharter Blick über die stumme Reihe von Männern schweifte, senkten sie die Köpfe. Manche furchtsam, andere undurchschaubar und einige mit höhnischer Miene. Schließlich sagte er: „Jim Grimes’ Mörder sind hier in diesem Raum.“ Er achtete sorgsam darauf, keinen der Versammelten direkt anzuschauen, während er sprach. „Ich habe schon mit so etwas gerechnet. Den Dieben und Mördern, die uns terrorisieren, wird der Boden in der Stadt und den Camps langsam zu heiß unter den Füßen, also haben sie meinem Deputy eine Falle gestellt. Schätze, als Nächstes wollt ihr mich auch noch umlegen. Aber lasst euch das gesagt sein, ihr feigen Ratten: Mich erwischt ihr nicht von hinten!“ Middleton schwieg, sein langgliedriger Körper blieb unter Spannung, er strotzte nur so vor Wachsamkeit. Die Männer an der Bar waren noch immer so verkrampft wie zuvor.
Schließlich entspannte sich der Sheriff, steckte seinen Revolver in das Holster und verzog dabei die Lippen zu einem spöttischen Grinsen. „Ich kenne eure Sorte. Ihr getraut euch nicht, auf einen Mann zu schießen, bevor er euch den Rücken zudreht. Vierzig Leute wurden hier in der Umgebung auf diese Weise im letzten Jahr beseitigt. Kein Einziger hatte die geringste Chance, sich zu verteidigen. Vielleicht sollte dieser letzte Mord ein Ultimatum an mich darstellen. Wenn dem so sein sollte, habe ich schon die passende Antwort parat: Ich bekomme einen neuen Deputy, und den könnt ihr nicht so einfach aufs Kreuz legen wie seinen Vorgänger. Ich werde von nun an Feuer mit Feuer bekämpfen. Morgen früh reite ich aus dem Tal, und wenn ich zurückkomme, habe ich einen Revolverhelden aus Texas bei mir!“
Er legte eine Pause ein, damit sich die Information setzen konnte, dann lachte er grimmig, während sich die Männer gegenseitig verstohlene Blicke zuwarfen.
„Ihr werdet schon bald merken, dass mit ihm nicht gut Kirschen essen ist“, prophezeite er, erfüllt von Rachegelüsten. „Er musste aus Texas abschwirren, weil er dort zu viel auf dem Kerbholz hatte. Aber was geht es mich an, was er dort angestellt hat? Ich freue mich schon darauf, wenn die Mörder von Grimes versuchen, ihn auszutricksen ... Und noch etwas: Ich treffe meinen Mann morgen früh am Ogalala Spring. Ich werde im Morgengrauen alleine dorthin reiten. Falls mir jemand auflauern möchte, hat er also genug Zeit, einen Plan auszuhecken. Ich warte nur darauf!“
Der Sheriff von Wahpeton wandte seinen adrett gekleideten Rücken dem Tresen zu und stiefelte durch die Tür ins Freie.
*
Zehn Meilen östlich von Wahpeton kauerte ein Mann auf den Fersen und briet Hirschfleischstreifen über einem kleinen Feuer. Die Sonne schickte sich gerade an, aufzugehen. In kurzer Entfernung zupfte ein gut gebauter Mustang dürres Gras zwischen den verstreuten Felsen. Der Mann hatte heute Nacht hier campiert, jedoch waren weder sein Sattel noch seine Decke auszumachen. Er hatte sie in den Büschen versteckt, denn er war von vorsichtigem Charakter. Niemand, der dem Trail über Ogalala Spring hinaus folgte, hätte ihn in der Dunkelheit in seinem Versteck im Gestrüpp aufspüren können. Nun, bei Tageslicht, machte er keine Anstalten, seine Gegenwart zu verschleiern.
Der Mann war groß, hatte ausladende Schultern, eine breite Brust und schmale Hüften, wie jemand, der sein Leben hauptsächlich im Sattel verbrachte. Sein ungebändigter, schwarzer Haarschopf passte perfekt zu seinem sonnengegerbten Gesicht, in dem blaue Augen loderten. Weit unten an jeder Hüfte ragte der schwarze Knauf eines schweren Colts aus verschlissenen Holstern. Die Waffen schienen ein selbstverständlicher Teil von ihm zu sein, genau wie seine Hände und Füße. Er trug sie ohne Unterbrechung schon so lange, dass ihr Gebrauch für ihn ebenso natürlich war, wie der seiner Gliedmaßen.
Während das Fleisch gar wurde, beobachtete er den Kaffee, der in einem verbeulten Blechtopf köchelte, ohne dabei nur eine Sekunde zu vernachlässigen, den Trail Richtung Osten auszuspähen. Der Weg kreuzte eine weite, offene Ebene, bevor er zwischen den Rücken einer Hügellandschaft verschwand. Im Westen führte er einen flachen Hang hinauf, hinein in einen Wald, an dessen Ausläufern sich Strauch um Strauch dicht um eine Quelle drängten. Aber der Mann achtete nur auf das, was ihm Osten geschah.
Als dort ein Reiter zwischen den Anhöhen auftauchte, legte er seine Bratpfanne voll saftiger Fleischstreifen zur Seite und schnappte sich ohne Hektik sein Gewehr. Eine Sharps Rifle Kaliber .50 – bestens geeignet für große Entfernungen. Seine Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen, während er den Kopf leicht senkte. Er erhob sich nicht vollständig und verblieb mit einem Knie auf der Erde, das Gewehr lässig in den Händen, den Lauf nach vorne gerichtet, jedoch ohne zu zielen.
Der fremde Reiter kam ohne Zögern näher und hielt erst an, als er sich dem Mann bis auf wenige Meter genährt hatte. Dieser hob den Kopf und entblößte so sein zuvor kaum erkennbares Gesicht.
Bei dem Berittenen handelte es sich um einen sportlichen jungen Mann, dessen lockiges, blondes Haar unter dem Hut hervorquoll. Er wirkte unbefangen, und ein ansteckendes Lächeln kräuselte seine Lippen. Er trug kein Gewehr auf seinen Oberschenkeln, aber ein 45er mit Perlmuttknauf baumelte an seiner rechten Hüfte. Sein Gesichtsausdruck zeigte keinerlei Reaktion, als er das Antlitz des anderen sah, mit Ausnahme eines raschen, unwillkürlichen Muskelzuckens rund um die Mundwinkel. Eine Reaktion, die auch bei strenger Selbstbeherrschung kaum zu unterdrücken ist. Dann grüßte er und sagte: „Das riecht vorzüglich, Fremder!“
„Steig ab und hilf mir dabei, es zu verdrücken. Du kannst dich auch gerne am Kaffee bedienen, wenn es dich nicht stört, aus dem Topf zu trinken.“ Er legte die Sharps zur Seite, als sich der Ankömmling aus dem Sattel schwang.
Der blonde junge Mann schlang die Zügel um den Hals des Pferds, griff in die zusammengerollte Decke auf dessen Rücken und fischte einen verbeulten Blechbecher heraus. Dann trat er gemächlich an das Feuer.
„Ich hatte noch kein Frühstück“, gestand er ein. „Ich hab’ mein Nachtlager ein Stück weiter hinten aufgeschlagen. Dann kam ich hierher, um jemanden zu treffen. Ich glaubte zunächst, du wärst derjenige, bevor du aufgeblickt hast.“ Er nahm gegenüber dem größeren Mann Platz, der ihm daraufhin nacheinander die Bratpfanne und den Kaffeetopf mit der linken Hand reichte. Dessen Rechte ruhte dabei auffällig lässig an der Taille. Der Jüngere füllte seinen Becher und trank den schwarzen, ungezuckerten Kaffee mit sichtlichem Wohlbehagen. Er schenkte sich nach, bevor er mit den Fingern einige Stücke des abkühlenden Fleisches aus der Pfanne herauspickte. Darauf bedacht, ebenfalls nur seine linke Hand zu verwenden, um sich an seiner Rechten, mit der er danach den Becher zum Mund führte, keine fettigen Finger einzuhandeln. Es schien, als bemerke er die Position der rechten Hand des anderen nicht.
„Mein Name ist Glanton“, stellte sich der blonde Jüngling vor. „Billy Glanton aus Texas. Guadalupe-Gegend. Ich kam den Trail mit ’ner Herde bockiger Rinder rauf. Hab’ die ganze Kohle, die ich verdient hab’, in Hayes City verzockt. Pleite, wie ich war, bin ich dann auf der Suche nach Gold in den Westen geritten. War verdammt erfolgreich, aber jetzt wird’s Zeit, dass ich einen besseren Job kriege. Der Mann, den ich hier treffen will, soll einen für mich haben ... Wie du aussiehst, bist du auch ein Texaner?“ Der letzte Satz klang mehr wie eine Feststellung als eine Frage.
„Exakt“, antworte der Angesprochene knurrend. „Ich heiße O’Donnell und stamme ursprünglich aus dem Gebiet um den Pecos River.“
Diese Ortsangabe war genauso schwammig wie jene von Glanton. Sowohl Pecos als auch Guadalupe umfassten beträchtliche Territorien. Aber Glanton grinste schelmisch und streckte ihm die Hand entgegen.
„Schlag ein! Ich bin froh, einen Hombre aus der Heimat zu treffen, auch wenn ein gutes Stück Weg zwischen unseren alten Wirkungsstätten liegt.“
Ihre Hände – braune, schwielige Hände, die nie einen Handschuh getragen hatten – trafen sich und schlossen sich kurz umeinander. Beide drückten mit der Wucht einer nach vorne schnellenden Stahlfeder zu.
Anschließend wurde O’Donnell lockerer. Nun setzte er den Kaffeebecher nicht mehr auf der Erde ab, bevor er sich ein Stück Fleisch nahm. „Ich war in Kalifornien“, erzählte er freimütig. „Mein Rückweg führte mich vor einem Monat auf der gegenüberliegenden Seite der Berge zurück. Die letzten Wochen habe ich mich hier aufgehalten, aber die Jagd nach dem Gold macht mir keinen Spaß. Ich bin und bleibe nun mal ein Cowboy. Jetzt geht’s zurück nach Texas.“
„Warum probierst du dein Glück nicht in Kansas?“, fragte Glanton. „Dort wimmelt es nur so von Texanern, die Vieh hochtreiben. Der Trail von dort geht nach Wyoming und Montana. Da findest du Arbeit für fast ein Jahr.“
„Vielleicht sollte ich das.“ O’Donnell hob gedankenverloren den Becher an. Die rechte Hand ruhte auf seinem Schoß, ganz in der Nähe des schwarzen Revolverknaufs. Doch seine angespannte Haltung war gewichen. Völlig relaxed saugte er in sich auf, was Glanton berichtete. Der Gebrauch seiner Linken und die Positionierung seiner rechten Hand erfolgten automatisch – eine unbewusste Gewohnheit.
„Kansas hat viel zu bieten“, schwärmte Glanton. Er senkte den Kopf, um das unkontrollierte, triumphierende Flackern in seiner Mimik geheim zu halten. „Weites Land und überall, wohin die Eisenbahn gebaut wird, sprießen neue Städte wie Pilze aus dem Boden. Mit Rindfleisch aus Texas wird dort ein Vermögen gemacht. Ich wünschte, dass ich das geahnt hätte, als ich jung war. Ich hätte 50.000 herrenlose Maverick-Rinder in Texas eingefangen und ihnen mein Brandzeichen verpasst. Dann hätt’ ich nur zu warten brauchen, bis die Preise hochgehen.“ Er lachte selbstgefällig.
„Damals waren die nur einen Scheißdreck wert“, fügte er hinzu. „Sechs Viertel-Dollar gab’s für ein Rindvieh. Heute liegt der Spitzenpreis bei über zwanzig Dollar.“
Er leerte seinen Becher und stellte ihn rechts neben sich ab. Die Worte sprudelten weiter aus ihm heraus, während seine Hand in atemberaubender Geschwindigkeit zum Holster schnellte und den schweren Colt zog.
Zwei Schüsse fielen fast gleichzeitig, sodass sie aus der Ferne wie ein einziger klangen.
Der blonde junge Mann kippte zur Seite, die rauchende Kanone fiel ihm aus den Fingern und ein wachsender Fleck aus blutigem Rot tränkte sein Hemd. Entsetzt fixierte er den Revolver in O’Donnells rechter Hand. „Corcoran ...“, gurgelte er. „Ich dachte, ich hätte dich getäuscht, du ...“ Ein heiseres Lachen voller Selbstironie brach aus seiner Kehle hervor, als er – zynisch bis zum Letzten – starb.
Der Mann, der in Wirklichkeit Corcoran hieß, stand auf und begutachtete emotionslos sein Opfer. Er selbst hatte an der Seite ein Loch im Hemd zu verzeichnen; die aufgeschlitzte Haut über den Rippen brannte wie Feuer. Als das tödliche Blei aus seiner Waffe Glantons Brust aufriss, verfehlte dessen Kugel ihn nur knapp.





























