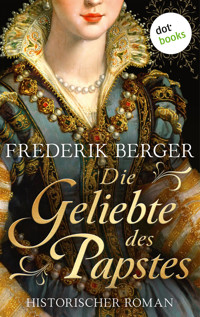
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das Siegel der Farnese
- Sprache: Deutsch
Glanz und Schatten im Vatikan zur Zeit der Borgia: Der opulente Historienroman »Die Geliebte des Papstes« von Frederik Berger als eBook bei dotbooks. Rom im ausgehenden 15. Jahrhundert: Im Petersdom feiern die Borgia ausschweifende Feste und geben sich immer verboteneren Gelüsten hin. Der Kardinal Alessandro Farnese dagegen will ein neues Kapitel in der Kirchengeschichte schreiben – und brennt doch insgeheim für eine Frau, die schöne Silvia Ruffini, mit der er auf schicksalhafte Weise verbunden ist. In jungen Jahren rettete er die schöne Adlige aus der Hand von Wegelagerern und schmiedete so zwischen ihnen ein unzertrennliches Band. Als Alessandro in die Intrigen des Vatikans verwickelt wird, kann nur Silvia ihm helfen. Gemeinsam nehmen sie den Kampf um die Papstkrone auf – und für ihre verbotene Liebe … Frederik Berger schafft ein farbenprächtiges Sittengemälde – und einen großen Roman, der die italienische Renaissance in all ihrer Pracht und Sündhaftigkeit zum Leben erweckt: »Das Geschehen wird so lebensprall und mit viel Zeitkolorit beschrieben, als hätte sich ein Shakespeare der Prosa zugewandt«, urteilt die Wilhelmshavener Zeitung. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der prachtvolle historische Roman »Die Geliebte des Papstes« von Frederik Berger ist der erste Teil seiner Romantrilogie über den Aufstieg der Farnese zu den unangefochtenen Herrschern Roms – als hätten Hilary Mantel und Matteo Strukul zusammen einen großen Renaissance-Roman geschrieben. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 929
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Rom im ausgehenden 15. Jahrhundert: Im Petersdom feiern die Borgia ausschweifende Feste und geben sich immer verboteneren Gelüsten hin. Der Kardinal Alessandro Farnese dagegen will ein neues Kapitel in der Kirchengeschichte schreiben – und brennt doch insgeheim für eine Frau, die schöne Silvia Ruffini, mit der er auf schicksalhafte Weise verbunden ist. In jungen Jahren rettete er die schöne Adlige aus der Hand von Wegelagerern und schmiedete so zwischen ihnen ein unzertrennliches Band. Als Alessandro in die Intrigen des Vatikans verwickelt wird, kann nur Silvia ihm helfen. Gemeinsam nehmen sie den Kampf um die Papstkrone auf – und für ihre verbotene Liebe …
Frederik Berger schafft ein farbenprächtiges Sittengemälde – und einen großen Roman, der die italienische Renaissance in all ihrer Pracht und Sündhaftigkeit zum Leben erweckt: »Das Geschehen wird so lebensprall und mit viel Zeitkolorit beschrieben, als hätte sich ein Shakespeare der Prosa zugewandt«, urteilt die Wilhelmshavener Zeitung.
Über den Autor:
Frederik Berger (geboren 1945 in Bad Hersfeld) studierte Literatur- und Sozialwissenschaften und lebte einige Zeit im englischen Cambridge und in der Provence. Er arbeitete als Literaturwissenschaftler und Journalist, bevor er hauptberuflich Schriftsteller wurde. Neben Gegenwartsromanen, Sachbüchern und zahlreichen Aufsätzen verfasste er verschiedene historische Romane über den Glanz und die Schatten europäischer Adelsfamilien. Frederik Berger reist viel und ist begeisterter Fotograf. Er lebt mit seiner Frau in Schondorf am Ammersee.
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine historische Romantrilogie »Das Siegel der Farnese« mit den Bänden »Die Geliebte des Papstes«, »Die Tochter des Papstes« und »Die Kurtisane des Papstes«. Außerdem erschienen seine opulenten historischen Romane »Die heimliche Päpstin« und »Die Provençalin«. Weitere Titel sind in Vorbereitung.
Die Website des Autors: www.frederikberger.de
Der Autor auf Instagram: www.instagram.com/fritzgesing/
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2023
Copyright © der Originalausgabe 2001 by Aufbau Taschenbuch Verlag GmbH, Berlin
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung eines Gemäldes von Alessandro Allori
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-98690-869-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Geliebte des Papstes«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Frederik Berger
Die Geliebte des Papstes
Historischer Roman – Das Siegel der Farnese 1
dotbooks.
Für Patricia
Saccio trovare lo mondo quando voglio
Et faccio nascere le cose.
Ich bin fähig, alles zu finden, wenn ich es nur will,und ich lasse die Dinge entstehen.
Kardinal Alessandro Farnese,
der spätere Papst Paul III., 1504
Prolog
»Es war Liebe auf den ersten Blick«, sagte Fürst del Drago, als er mich in die Loggia seines Palazzos in Bolsena führte. Wir standen vor dem Bildnis einer vornehm gekleideten jungen Frau, die mir ernst, forschend, abwartend in die Augen schaute und mich sofort fesselte. »Als ich dieses Porträt sah«, erklärte er, »wußte ich, daß ich den kleinen Palazzo hier kaufen mußte und alles, was dazu gehörte. Die Isola Bisentina dort im See, den gesamten Nachlaß der Familie Crispo, Möbel, die nur noch für die Müllkippe taugten, ein paar schöne Bilder, von Motten zerfressene Brokatkleider und Kardinalsroben, auch einige alte Dokumente.«
Er führte mich zu der Fensterfront, von der wir einen weiten Blick auf den im Gegenlicht liegenden See hatten. »Schauen Sie. Dort hinten liegt ihre Schicksalsinsel.«
»Sie sprechen von Silvia Ruffini, nicht wahr?« fragte ich.
Bei meinen Nachforschungen, die mich durch die farnesischen Burgen des nördlichen Latium, durch einige verstaubte Bibliotheken und zum Schluß auch in die Vorzimmer des vatikanischen Geheimarchivs geführt hatten, war ich auf allerlei Material der Familie Farnese gestoßen, allerdings noch nie auf ein Bildnis der Frau, die mich beschäftigte, seitdem ich etwas über die ungewöhnliche und abenteuerliche Jugend von Papst Paul III. erfahren hatte.
»Sie kennen sie«, erklärte Fürst del Drago.
»Wen?«
»Sie kennen Silvia Ruffini. Jeder, der nach Rom pilgert, kennt sie. Nur: Keiner weiß es. Noch nicht einmal die Kunsthistoriker wollen es wahrhaben.« Er lachte abschätzig und führte mich wieder zurück zu dem kunstvoll in die Holzvertäfelung eingefügten Bild. Forschend schaute er mich an. »Auch Sie fangen Feuer, das sehe ich.«
»Nun, Silvia Ruffini interessiert mich sehr.«
Fürst del Drago machte eine Handbewegung, als wollte er das Bild streicheln. »Ich lebe mit ihr. Ich liebe sie wie meine eigene Mutter. Ich liebe sie, wie Tiberio Crispo sie geliebt haben muß oder vielleicht auch Pierluigi Farnese, ihr schwuler Sohn.«
Ich trat einen Schritt zurück.
»Aber war Pierluigi Farnese nicht verheiratet und hatte fünf Kinder?«
Fürst del Drago lachte über soviel Naivität.
»War nicht auch Alessandro Farnese Kardinal, später sogar Papst und hatte trotzdem vier Kinder?«
»Das ist richtig.«
Während ich von neuem das Porträt studierte, um mich dem Wesen dieser schönen und geheimnisvollen Signora zu nähern, beobachtete mich Fürst del Drago.
»Und Sie interessieren sich wirklich für Silvia Ruffini?«
»Ich sagte es bereits.«
»Sie wollen ein Buch über sie schreiben.«
»Wenn ich genügend Material finde.«
»Ha!« Fürst del Drago bewegte sich behende zu einem wurmstichigen Schreibpult und fingerte einen Schlüssel aus seiner Weste. Der Fürst sah aus, als wäre er einem der späten Filme von Visconti entsprungen. Die Haare waren streng gescheitelt, die blaßfarbenen Augen lagen tief in den Höhlen, ein Menjoubärtchen zierte seine Oberlippe, und sein Anzug schimmerte in einem cremigen Weiß.
Er hatte inzwischen die Pultplatte geöffnet. »Hier!« sagte er nicht ohne Nonchalance. »Hier liegt alles, was Sie brauchen, Briefe, alte Urkunden, sogar der Beginn einer handgeschriebenen Autobiographie von Silvia Ruffini. Natürlich sind das alles nur Kopien, die Originale liegen in meinem Banksafe. Ich sehe Ihre Augen leuchten. Ja, dies ist ein Schatz. Daraus können Sie einen Roman stricken und müssen noch nicht einmal viel erfinden. Das eine oder andere Detail vielleicht« Er lachte mit heller Stimme.
»Und Sie würden mir die Papiere zur Einsicht überlassen?« fragte ich ohne Umschweife.
Nun sah er mich spöttisch an. »Warum nicht? Aber ich warne Sie. Ein Großteil soll gefälscht sein. Dies haben mir die Herren Archivare des Vatikans erklärt und zum Beweis eine chemische Analyse des Papiers sowie das Gutachten eines Graphologen vorgelegt. ›Außerdem hat Papst Paul III. weder eine Vergewaltigung noch gar einen Mord begangen, wie manche der angeblichen Dokumente nahelegen‹, erklärten sie. ›Bekanntlich gibt es eine umfängliche Rufmordliteratur über ihn. Sie begann schon mit Luther, der dem Papst Sodomie und inzestuöses Verhalten nachsagte. Die Familie Crispo scheint fleißig Material über ihn gesammelt zu haben. Darauf darf man nicht hereinfallen.‹ Ich wurde also durchaus überzeugend über den historischen Wert dieser Unterlagen aufgeklärt.«
Fürst del Dragos Stimme klang auffallend ironisch.
Er seufzte, kramte in den Papieren und zog ein paar zusammengeheftete Seiten hervor. »Hier, der Beginn ihrer Autobiographie! Leider ist sie nicht weit gekommen, die alte Dame. Wahrscheinlich starb sie. Oder litt an altersbedingter Amnesie. Wissen Sie...«
Fürst del Drago unterbrach sich, trat wieder ans Fenster und blickte plötzlich verloren über den See. »Eigentlich wollte ich selbst eine Biographie über den Papst und seine Geliebte schreiben. Aber es wurde immer ein Roman daraus. Irgendwann gab ich es auf. Ich lebe ja mit meiner geliebten Silvia, kann ihr täglich in die Augen schauen. Was muß ich einen Roman über sie schreiben! Aber Sie, Sie können es versuchen. Ich bin nicht eifersüchtig. Finden Sie heraus, wie Silvia gelebt und geliebt hat!«
TEIL I
Das Ende der Unschuld
Kapitel 1
Silvias Mutter hatte ihr erstes Ziel erreicht. Das Oberhaupt der Orsini-Familien lud Rufino Ruffini, seine Gemahlin sowie seine Tochter auf die Burg am Lago Bracciano ein, um die Möglichkeit einer Ehe zwischen einem der zahlreichen Orsini-Söhne und Silvia auszuloten. Es war das Jahr des Herrn 1486, Papst Innozenz VIII. Cibö war Oberhirte der Christenheit.
Silvia schlief die letzte Nacht vor dem Aufbruch schlecht, weil sie wußte, daß große Veränderungen sie erwarteten. Noch trennten sie drei Jahre vom heiratsfähigen Alter, aber wäre erst einmal der Ehevertrag geschlossen, dann zählte nur noch ihre Zukunft als Mutter, vorbei wären die unbeschwerten Tage der Kindheit, die langen Sommer in Frascati, der Wind in ihren Haaren, während sie den großen Olivenhain entlangritt, über die blumengesprenkelte Wiese ... Übergangslos wechselte sie vom Grübeln in einen Traum. Noch immer sah sie das Bild der Wiese vor sich und an seinem Rand einen sich schlängelnden Fluß, in dem sie schwimmen wollte. Ihre Brüder winkten ihr lachend zu. Aber dann verschwand einer nach dem anderen, und schließlich hörte sie von dem ältesten nur die dunkle Stimme; er wandelte, versteckt unter einer Kutte mit weit übers Gesicht gezogener Kapuze, über die Engelsbrücke zur Burg der Päpste und weiter in Richtung San Pietro. Sie rannte ihm nach, bis er sich in einem grellen Lichtschein verlor und sie schweißgebadet aufwachte.
Schnell zündete sie eine Kerze an und versuchte zu beten. Aber es wollte ihr nicht gelingen, weil das Bild ihres ältesten Bruders nun nicht mehr gnädig eingehüllt vor ihr stand. Der abkühlende Schweiß auf ihrer Haut ließ sie zittern, und ihr Herz schlug schnell und heftig. Bei der Engelsbrücke hatten sie ihn aus dem Tiber gezogen und auf einem Handkarren zum Elternhaus im Rione della Pigna gebracht. Zufällig befand sich ein Stoffband mit seinem Namen an den Resten der Kleidung; sonst hätte man ihn gleich ins Massengrab geworfen, in dem die Heilige Stadt ihre zahlreichen unbekannten oder unkenntlichen Toten begrub.
Silvia stand fassungslos vor dem Bruder, neben ihr der Vater, der ihren Kopf an sich drückte, um sie von dem Anblick der entstellten Leiche zu befreien. Die Mutter wandte sich ab und verließ den Raum. Silvia hörte einen langen, verzweifelten Schrei, der in einem tierischen Wimmern verebbte. Dann sprach die Mutter tagelang nicht mehr. Sie schloß sich in ihr Zimmer ein und war nicht zu bewegen, an dem Begräbnis des Sohnes teilzunehmen. Als Silvia ihr wieder begegnete, hatten sich ihre Gesichtszüge verhärtet, die Augen waren überschattet, die Stimme kalt und scharf.
Obwohl noch gedämpfte Trauerstimmung im Hause herrschte, erklärte die Mutter einige Wochen später, ohne daß das Thema vorher angeschnitten worden war: »Silvia ist zwar erst zwölf Jahre alt, aber wir sollten schon jetzt einen Ehevertrag mit den Orsini abschließen.«
Silvia erstarrte. Der Vater zögerte mit einer Antwort, warf einen traurigen Blick auf seine Tochter, strich ihr dann über den Kopf. Hilfesuchend drückte sie sich an ihn. Aber die Mutter ließ sich nicht abhalten, Silvia ans Fenster zu ziehen, ungeduldig den Sitz von Hemd, Ärmeln und Gürtel zu richten und ihr einige der unbotmäßigen Haare aus der Stirn zu streichen. Dann eilte sie zu ihrer Aussteuertruhe, hob den Deckel, starrte hinein und ließ ihn wieder geräuschvoll fallen. Sie richtete sich auf und rauschte, offensichtlich ziellos, durch den Raum. Das Seidenkleid schleifte über den Boden, die streng geflochtenen Zöpfe schienen sich am Hinterkopf auflösen zu wollen, so daß sie die Haare mit einer nervösen Bewegung zurechtrückte.
Schließlich baute sich die Mutter vor dem Vater auf. »Wenn die Mitgift hoch genug ist, werden die Orsini nicht nein sagen.« Sie schaute ihn auffordernd an. »Dein Vermögen hat sich in den letzten Jahren durch Gottes Hilfe vermehrt, es wird Zeit, daß wir beginnen, seine Früchte zu ernten.«
Der Vater bewegte zweifelnd den Kopf hin und her: »Ich werde den Astrologen fragen, ob der Zeitpunkt günstig ist. Aber ich glaube nicht, daß gerade die Orsini... Sie werden mich auslachen.« Er wandte sich zum Gehen.
»Wenn ihnen deine Golddukaten in ihre gierigen Augen stechen, werden sie ihren Dünkel vergessen.« Die Mutter ließ einen prüfenden Blick über Silvias Gesicht gleiten. »Häßlich ist unsere Tochter auch nicht, außerdem hat sie ein angenehmes Wesen.«
Silvia fühlte sich erröten und schaute auf den Boden.
»Die Mitgift muß überzeugend hoch sein.« Die Stimme der Mutter wurde lauter, fast schrill, während sie erneut an Silvias Kleid herumnestelte. »Die Orsini brauchen unablässig Geld bei ihren Fehden gegen den Papst und die Colonna oder wen auch immer.« Als der Vater das Zimmer schon verlassen hatte, rief sie ihm noch nach: »Dein Astrologe hat zwar düstere Wegstrecken angedeutet, aber Licht am Ende des Weges gesehen. Hoffentlich behält er recht.« Ihre Stimme wurde plötzlich leise. »Der düstre Tod liegt hinter uns, jetzt muß das Licht des Lebens folgen.«
Silvia traten Tränen in die Augen. Sie mußte an ihre Brüder denken und spürte gleichzeitig eine beklemmende Angst vor dem, was sie wie hinter einer Nebelwand erwartete.
Die Mutter wischte ihr mit einer fahrigen Bewegung die Tränen von den Wangen. Plötzlich verzerrte sich ihr Mund, und sie schluchzte für einen kurzen Augenblick auf. Aber die Augen blieben trocken und kalt. Dann drehte sie Silvia wie eine Puppe hin und her.
»Du wirst bald Formen bekommen. Der Allmächtige segne dein Becken!« Während ihr kritischer Blick sich milderte, schluchzte sie erneut auf. »Drei Söhne habe ich diesem Mann geschenkt, und keiner ist mir geblieben. Wo bleibt da Gottes Gerechtigkeit? Wo kann da Licht am Ende des Weges sein?« Nun füllten sich ihre Augen doch mit Tränen.
Silvia riß sich von ihr los und rannte zu ihrem Vater in sein Studiolo. Am liebsten hätte sie geschrien, damit sie dieses beklemmende Würgegefühl verließ, aber sie vergrub nur ihr Gesicht an seiner Brust. Er strich ihr über den Kopf.
»Soll ich dir aus den Metamorphosen des Apuleius vorlesen?« fragte er nach einer Weile beruhigend. Sie nickte heftig. Und als er mit seiner vibrierenden, dunkel und hell werdenden Stimme las, vergaß Silvia die toten Brüder. Statt dessen folgte sie neugierig den abenteuerlichen Wegen des verwandelten Esels, erlebte seine Liebesabenteuer in fernen wunderbaren Welten, rang leidenschaftlich mit Chloë um den verlorenen Amor, weinte und lachte und träumte sehnsüchtig von dem, was jenseits der Wände ihres Hauses lag.
Als der Vater erschöpft und mit müder Stimme das Buch zur Seite legte, wünschte sich Silvia, mit ihm noch auszureiten, auf Bianca, ihrer Schimmelstute, die ihr der Vater zu ihrem zwölften Geburtstag geschenkt hatte – zu den Weinbergen, die sich nach Osten hin an den Palatin anschlossen, oder sogar auf der Via Appia über die Aurelianische Mauer hinaus. Sie wünschte sich, mit ihm nach Frascati zu reisen, zu den silberglänzenden Olivenhainen, den Weinbergen und weise nickenden Pinien, die aussahen wie graue Kardinäle mit ihren runden Schirmhüten.
»Aber mein Kind ...«, antwortete der Vater. »Bis ich die Schutztruppe beisammen habe, wird die Sonne zu tief stehen, und außerdem möchte es deine Mutter nicht.«
Sie waren während der letzten Woche überhaupt nicht mehr zusammen ausgeritten, denn die Einladung der Orsini war eingetroffen, und die Mutter ergriff eine fiebrige Rastlosigkeit, die sich auf die ganze famiglia übertrug.
Und nun brach der Tag an, der sie zu ihrer zukünftigen Familie bringen sollte.
»Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen«, flüsterte Silvia. Wieder ruhiger geworden, glaubte sie noch einmal einschlafen zu können und blies die Kerze aus. Aber sie blieb wach, traumlos, voll wirrer Gedanken, bis sie erste Geräusche im Hause hörte. Noch bevor Rosella, ihre Kammerfrau, sie wecken konnte, stand sie auf, öffnete die Fensterläden und schaute hinaus in den dämmergrauen Himmel der Ewigen Stadt. Dann kniete sie sich vor ihr Kruzifix und das Madonnenrelief, die beide über dem kleinen Pult neben dem Bett hingen, und betete noch einmal das Ave Maria.
Kurz nach Öffnung der Stadttore ritten Silvia und ihre Mutter durch die Porta del Popolo, um über die Via Cassia zum Lago Bracciano zu gelangen. Rosella begleitete sie und außerdem eine kleine bewaffnete Eskorte. Der Vater wollte noch ein letztes Mal den Astrologen konsultieren und später nachkommen.
Bald hatten sie Rom hinter sich gelassen und ritten durch den taufrischen Morgen. Bauern mit vollbeladenen Eseln begegneten ihnen, andere trieben Schweine vor sich her. Junge Frauen trugen frisches Gemüse in einem Korb auf dem Kopf. Auch Pilger waren schon unterwegs, zerlumpte Bettler und Gestalten mit gierigen Blicken. Leichter Dunst lag über den Niederungen, aber die Hügel glänzten in einem satten Grün, das durchsprenkelt war von rotem Mohn.
Noch bevor die Sonne im Zenit stand, lagen einige Meilen hinter ihnen. Es war heiß geworden, und nun begegnete ihnen kein Mensch mehr. Silvias Mutter tupfte sich die Schweißperlen von der Stirn, und Rosella schlug vor, im Schatten eines nahegelegenen Wäldchens zu rasten und zu frühstücken. Die Mutter nickte. Die Männer der Eskorte ritten voran, suchten nach einem geeigneten Platz. Zwei ließen sich auf den Boden fallen und schlossen die Augen, die anderen erklärten, sie wollten nach Wasser suchen, hier gebe es zweifellos Quellen. Sie verschwanden hinter den Bäumen. Silvia hörte ihre Stimmen noch eine Weile. Dann schienen sie vom Wald verschluckt. Vögelgezwitscher erklang statt dessen, unterbrochen vom Kläffen des Zwergspaniels, den die Mutter unbedingt hatte mitnehmen wollen. Rosella plapperte, ganz gegen ihre Gewohnheit, aufgeregt vor sich hin, während sie die Tragetaschen des Maultiers leerte und den Proviant aus den Körben holte.
Silvia hatte sich auf den Boden fallen lassen.
»Papa wird uns hier nicht finden«, sagte sie zu ihrer Mutter, die, auf dem Rücken liegend, verärgert die Fliegen verscheuchte.
»Doch, doch«, rief Rosella.
»Wie ich ihn kenne, wird dein Vater gar nicht vor heute mittag aufbrechen«, antwortete die Mutter und schloß seufzend die Augen.
Das Hündchen bellte noch immer aufgeregt. Rosella fauchte es an und trat nach ihm, um das Gekläffe zu beenden, aber erst als Silvia es auf den Arm nahm, beruhigte es sich.
Rosella schaute sich um und verschwand dann hinter einem Busch, um, wie sie rief, ihre Notdurft zu verrichten. Aber kaum war sie verschwunden, stieß sie einen lauten Schrei aus. Die beiden gerade noch vor sich hin dösenden Soldaten sprangen auf, griffen nach ihren Waffen. Silvia schaute sich verwirrt um und flüchtete sich zu ihrer Mutter – da stürzten schon drei Männer hinter dem Gebüsch hervor. Verfilzte Haare, Stoppelbart, vor Schmutz starrende Kleidung – doch aus edelsten Stoffen! Für einen Augenblick schien Silvia alles unwirklich, überlaut hörte sie ihren kleinen Spaniel bellen, und schon befand sie sich mittendrin im blutigen Handgemenge. Die beiden Schutzsoldaten versuchten noch zu kämpfen, aber dem einen schlugen die Wegelagerer die Hand ab, bevor er sein Schwert heben konnte, dann rammten sie ihm einen Spieß in die Brust, dem anderen spalteten sie den Kopf. Auch das Hündchen mußte sterben, mit einem Streich schlugen sie es in zwei Teile.
Silvia klammerte sich noch immer an ihre Mutter, die um Erbarmen bettelte und Lösegeld anbot. Einer der Männer riß die beiden auseinander und hielt der Mutter den Mund zu, der andere warf Silvia auf den Boden, und ehe sie sich versah, waren schon ihre Hände und Füße gefesselt. Die Mutter wehrte sich mit erstickender Stimme verzweifelt gegen die keuchenden und schnaufenden Männer. Silvia wand sich auf dem Boden und suchte Hilfe zu erspähen. Vergeblich. Als sie laut »Rosella, Rosella!« rief, drückte ihr einer der Wegelagerer den Mund zu und hielt ihr sein Messer an die Kehle. »Ein Laut noch, und ich rasier dich ab«, spie er ihr ins Gesicht. Die Mutter stöhnte und trampelte, während ihr zwei Männer die Kleider vom Leib reißen wollten. Das Messer schnitt Silvia in den Hals; voller Angst und Entsetzen rührte sie sich nicht mehr. Ihre Mutter lag inzwischen halbnackt auf dem Boden, von einem der Männer im Klammergriff gehalten, während der andere ihre Knie auseinanderzudrücken versuchte.
Der Mann, der Silvia gefesselt hatte, griff nun auch ihr zwischen die Beine. Sein stechender Gestank nahm ihr den Atem. Fluchend ließ er wieder von ihr ab, weil ihn die Fesseln behinderten. Die Mutter trat wild um sich. Der Stinkende ließ Silvia liegen und schlug der Mutter mehrmals ins Gesicht, bis ihr Blut aus Nase und Mund floß, und drückte ihr dann sein Messer an den Hals. Sie erstarrte und gab den Widerstand auf. Der erste machte sich über sie her. Die Mutter zuckte, bäumte sich auf, wollte schreien, wurde aber gewürgt. Dann lag sie wie tot da, während die Männer sich gegenseitig anstachelten und sich, einer nach dem anderen, zwischen ihre Beine knieten.
Hinter dem Busch tauchte nun ein vierter Wegelagerer auf, der Rosella hinter sich her zerrte. Ihre Haare standen nach allen Seiten ab, ihr Hemd war so eingerissen, daß eine ihrer Brüste freilag. Zwischen den Beinen des Mannes baumelte unverdeckt sein Geschlechtsteil; grinsend machte er eine unmißverständliche Geste. Freudiges Gejohle der anderen Männer war die Antwort. Silvia schrie schrill um Hilfe. Sofort ließ der Mann Rosella los und warf sich auf sie. Er riß einen Stoffetzen von ihrem Reisekleid und stopfte ihn ihr in den Mund. »Gleich bist du dran!« stieß er hervor.
Die Männer fesselten Rosella, nicht ohne grölend ihre zweite Brust freizulegen, durchwühlten anschließend die Taschen, steckten die Dukaten und den Schmuck ein und stopften sich gierig den Proviant in den Mund. Silvia blickte auf ihre Mutter, die regungslos auf dem Rücken lag, die Augen geschlossen. Zwischen ihren Beinen hatte sich eine Blutlache gebildet. Aber dann öffnete sie die Augen und stöhnte auf. Ihr Körper krümmte sich. Die Männer schauten sich auffordernd an.
»Mach du’s!« stieß der eine hervor. Der Angeredete schüttelte den Kopf.
Rosella, die zusammengekauert dabei gehockt hatte, richtete sich plötzlich auf und schrie »Nein!«.
»Halt’s Maul, Hure!« Sie konnte sich gerade noch unter einem Faustschlag wegducken und warf sich wimmernd auf den Boden.
»Wir müssen weg. Die stört nur«, drängte der erste Mann.
Die anderen kauten schmatzend.
»Und die Kleine?«
»Später...«
»Los, würfeln wir!« krächzte der erste Mann, und schon warf er einen kleinen Knochen auf das Tuch. Silvia sah statt der Punkte gekreuzte Schwerter, eine Axt, einen Galgen. Als schließlich ein Totenkopf oben lag, brüllten die Männer auf. Einer zog das Messer, mit dem er gerade ein Stück Schinken geschnitten hatte, durch den Mund und erhob sich verärgert grunzend. Silvia bemerkte nur noch Rosellas entsetzten Blick und schloß die Augen. Einen Augenblick lang herrschte eine ungewöhnliche Stille, keine Schmatzgeräusche, kein Sprechen, kein Schreien. In dieser Stille hörte Silvia plötzlich laut und vernehmlich einen Vogel singen. Und in den Gesang hinein einen erstickten Gurgellaut.
Es dauerte eine Weile, bis sie wieder wagte, die Augen zu öffnen. Rosella hatte ihren Kopf zwischen den Knien verborgen. Der Vogel sang noch immer.
»Wir sollten verschwinden«, sagte einer der Männer zwischen zwei Bissen.
Ein anderer wies mit einer Kopfbewegung auf Silvia. »Und sollen wir die etwa mitschleppen?«
»Die ist sicher noch Jungfrau«, sagte der dritte und leckte sich über die Lippen.
Ein dreckiges Lachen folgte, und vier Augenpaare richteten sich gierig auf ihren Körper. »Bald nicht mehr!« Ein weiteres Gelächter, dann rissen sie wieder mit ihren faulen Zähnen Stücke aus dem gepökelten Fleisch, wie Straßenköter, die sich über Aas hermachen.
»Wir packen die Weiber aufs Pferd und hauen ab, die hatten sicher nicht nur zwei Männer dabei.« Der Mann goß sich Wein aus einem Ziegensack in den Mund, und der rote Saft floß ihm über die Mundwinkel in den Bart. Sein Kumpan kroch mit gezücktem Messer auf Silvia zu und schnitt ihr die Fußfesseln durch.
»He, das Täubchen läuft uns noch weg!«
»Keine Angst«, rief der Mann und entblößte seine braunen Zahnstummel. »Die pfähl ich, daß sie sich nicht mehr rühren kann.« Er schnitt Silvia ins Reitkleid und entblößte ihre Beine.
»Laß sie, wir hauen ab! Später ist noch genug Zeit...«
Einer zerrte Rosella zum Pferd und band sie bäuchlings auf dem Sattel fest. Aus aufgerissenen Augen blickte sie Silvia bettelnd an. Schon schlug Silvia wieder der unglaubliche Gestank des Mannes entgegen. Er nahm ihr den Knebel aus dem Mund und stülpte ihr seine Lippen entgegen, als wolle er sie küssen. Schnell wandte sie sich ab. Ihr Blick fiel auf ihre Mutter. Sie lag noch immer auf dem Rücken, den Kopf zur Seite gedreht, die Augen starr nach oben gerichtet. Aber ihr Hals ... ihr Hals klaffte wie ein aufgeschnittener Granatapfel.
Silvia öffnete den Mund, um zu schreien. Die Stimme versagte. Sie glaubte, sich übergeben zu müssen, doch ihr Körper bebte nur und verkrampfte sich. Dann überschwemmte sie wieder eine Woge des Gestanks. Der Mann mit dem entblößten Geschlechtsteil biß sie ins Ohr und kniete sich dann zwischen ihre Beine. Silvia starrte auf das gerötete Teil, das sich drohend aufrichtete, das immer höher wuchs und gierig zuckte. Und daneben die blutverkrustete Hand, auf der sich lange schwarze Haare wie eine Schlangenbrut ringelten. Sie schloß die Augen, und mit Gewalt spreizte der Mann ihre Schenkel.
Silvia glaubte, sterben zu müssen. Sie wartete auf den Schmerz, der spitz in sie eindringen mußte, um ihr dann das Becken auseinanderzureißen. Das Schnaufen kam näher. Stumm begann sie, das Ave Maria zu beten. Sie krampfte sich zusammen, und ihre Sinne strömten alle zu der Körperöffnung zwischen ihren Beinen. Plötzlich Hufgetrappel, ein aufwieherndes Pferd, Schreie und Flüche. Sie riß ihre Augen auf, flog zur Seite. Vor ihr, hoch zu Roß, ein Mann, ein junger Edelmann. Ein flammender Retter, von der Jungfrau geschickt, ein Erzengel, ein Gottesstreiter. In seiner Hand hielt er einen Jagdspieß. Hinter ihm tauchten zwei Gehilfen auf.
Die Wegelagerer stürzten zu ihren Waffen. Da schnellte der Arm des Reiters nach vorne, und schon steckte der Jagdspieß einem der Räuber in der Brust. Der Räuber starrte hoch, aus seinem Mund quoll ein Schwall von Blut, er torkelte einen Schritt vor und brach zusammen. Der Retter riß nun sein Schwert aus der Scheide und trieb sein Pferd direkt auf den zweiten Wegelagerer zu. Dann ließ er sein Roß vor ihm hochsteigen und ausschlagen. Vom Huf an der Schulter getroffen, ging der Mann zu Boden. Inzwischen rangen die Jagdgehilfen mit den zwei restlichen Räubern, und wenig später stürzten auch die Männer, die Wasser hatten holen wollen, aus dem Wald herbei. Blut spritzte Silvia ins Gesicht. Drei Wegelagerer lagen schon reglos auf dem Boden. Der vierte versuchte zu fliehen. Aber der Retter setzte ihm nach, spannte seinen Bogen, und mitten im Galopp ließ er den Pfeil abschwirren. Kopfüber stürzte der Flüchtende zu Boden.
Silvia war gerettet. Starr lag sie auf dem Rücken, die Bilder des Geschehenen wirbelten zusammen und stürzten ab, ihr wurde schwarz vor Augen. Aber dann war sie wieder da, ganz wach, und wollte aufspringen.
Rosella wurde losgebunden. Sie lachte und weinte, schluchzte und schrie.
Silvia griff nach dem Kleid und bedeckte ihre Blöße. Ihr Retter war vom Pferd gestiegen und wies auf die Mutter. »Legt sie in eine Decke!« rief er seinen Gehilfen zu.
»Mama!« flüsterte Silvia und warf sich auf den leblosen Körper.
Der rettende Engel nahm sie in den Arm. »Ihr ist nicht mehr zu helfen. Der Herr hat sie zu sich genommen.«
Silvia drohte zu Boden zu sinken. Er hielt sie. Sie fühlte nichts mehr.
»Ihr seid gerettet«, flüsterte er.
Silvia entzog sich seinen Armen und starrte auf die Decke, unter der die Mutter lag.
Rosella richtete ihr Kleid. Mehrfach warf sie einen forschenden Blick auf den Retter, und als dieser ihn mit einem erstaunten Gesichtsausdruck erwiderte, wandte sie sich wieder Silvia zu. »Meine Kleine«, stieß sie unter Schluchzen hervor. »O Gott, was ist geschehen! Diese Mörderbande!«
Als Silvia, noch immer am ganzen Körper zitternd, dem Retter dankte, trat er einen Schritt zurück und neigte seinen Kopf. »Mein Name ist Alessandro Farnese. Ich bin apostolischer Skriptor. Ich war auf der Jagd. Zum Glück...«
»Ich heiße Silvia Ruffini«, brachte sie hervor. »Meine Mutter wollte mit mir nach Bracciano reisen, damit ich...« Ihre Stimme versagte, und der starke Engel nahm sie erneut in die Arme.
Angeführt von Alessandro Farnese und seinen beiden Jagdgehilfen, ritten sie schließlich nach Rom zurück. Zwei Männer der Schutztruppe verdrückten sich, nachdem sie die Porta del Popolo durchschritten hatten. Die Decke, in die die Mutter eingewickelt war, troff vor Blut. Es lief die Flanke des Maultiers hinab und tropfte auf den Boden. Hinter ihnen eine Blutspur und das Geschrei neugieriger Menschen.
Als sie das Haus der Ruffini erreichten, tobte die Menge, als wäre sie von einer Hinrichtung angestachelt. Die Mägde stürzten aus dem Portal und schrien auf, die Pferdeknechte brüllten nach dem Vater. Er eilte die Treppe herunter. Als er sah, daß man eine eingewickelte Leiche auf eine Bahre legte, erstarrte er. Er faßte sich an den Hals und bedeckte dann sein Gesicht mit den Händen. Schließlich bekreuzigte er sich und schlug die Decke zurück. Noch hatte niemand ein erklärendes Wort geäußert. Alle starrten den Vater an, danach die Tote. Silvia sah ihre Mutter zum letzten Mal – mit einem schwarzen Kranz um den Hals, einem aufgerissenen Mund und halbgeöffneten, starren Augen. Rosella wollte sich jammernd über sie werfen, aber Alessandro Farnese hielt sie zurück, und sie warf sich an seine Brust. Er befreite sich von ihr und trat mit dem Vater noch näher an die Mutter heran. Sie bekreuzigten sich erneut, dann berührte der Vater die Tote mit den Lippen. Seine Miene war versteinert, aschfahl sein Gesicht. »Er hat es gewußt!« flüsterte er tonlos. Auch Silvia beugte sich noch einmal über die Mutter.
Der Vater befahl, die Tote ins Haus zu bringen und einen Priester zu rufen. Dann ließ er sich erzählen, was geschehen war. Wortlos umarmte er schließlich den Retter seiner Tochter.
Alessandro Farnese blieb bis zum Abend bei ihnen, und Silvia spürte, wie sie sich darüber freute. Ihr Vater dankte ihm immer wieder. Tränen rannen den Männern über die Wangen. Silvia versuchte, das Zittern ihres Körpers zu unterdrücken. Sie starrte auf Alessandros lange, feingliedrige Finger, als könnten sie ihr Trost spenden, als läge in ihrer Berührung ein tiefer Segen. Dann schaute sie ihm ins Gesicht: liebevolle Augen voller Mitleid und Güte. Er sagte etwas, was sie nicht verstand, sie hörte nur die weiche Stimme. Er war ihr so seltsam vertraut...
Langsam ließ das Zittern nach.
Der Vater jammerte. »Ich verstehe es nicht. Ich bin ein friedlicher Mann, noch nicht einmal besonders reich, habe keine Feinde ... O Gott, zuerst meine Söhne, jetzt meine Frau, warum muß der Herr mich so strafen!« Und er brach wieder in Schluchzen aus.
Alessandro nickte und warf dann, schmerzlich lächelnd, einen Blick auf Silvia. »Eure wunderbare Tochter hat der Herr verschont«, sagte er, ohne seinen Blick von ihr abzuwenden. »Er muß mit ihr noch viel vorhaben.« Er zupfte sich seinen Jagdkittel zurecht und strich sich über die Haare.
Der Vater drückte Silvia an sich. Sie spürte seine Wärme, den vertrauten Geruch. Ach, ihr geliebter Vater, ohne ihn könnte sie nicht leben! Für einen Augenblick schien die geschändete und ermordete Mutter nicht mehr zu existieren. Die beiden Männer blickten Silvia an und schienen sich dann gegenseitig einer Prüfung zu unterziehen.
»Die Orsini sind für uns verloren«, sagte der Vater, und seine Stimme wurde sachlich und kalt. »Wenn erst einmal durchsickert, was geschehen ist ... Hoffentlich sind andere Familien nicht so anspruchsvoll und übersehen das Unglück. Sonst bleibt nur das Kloster.«
Entsetzt schrie Silvia »Nein!«.
»Ist ja gut, mein Püppchen«, versuchte ihr Vater, sie zu beruhigen.
»Sie blieb unberührt, das ist sicher«, flüsterte Alessandro dem Vater zu. »Es gibt keinen Grund, Ihr versteht...«
Dann starrten die Männer stumm in die verrußte Öffnung des Kamins. Silvia hockte, in Decken gehüllt, dabei. Immer wieder lief das blutige Geschehen vor ihren Augen ab, und immer strahlender erschien ihr der von Gott gesandte Retter.
Kapitel 2
Es war unfaßbar, und er glaubte zu träumen. Doch was er sah, war kein Traumbild, er konnte aufstehen und sich bewegen, der Körper gehorchte ihm – aber weiter als bis zur Tür gelangte er nicht. Der Raum war verschlossen. Draußen würfelten lärmend die Wachen. Ja, er saß im Kerker. Vor ein paar Tagen war er zur Jagd gegangen, hatte das Wild nur nachlässig verfolgt, weil er den Tag in der freien und frischen Natur genoß, er stieß auf Wegelagerer, verhinderte, daß ihrem ruchlosen Überfall nicht nur eine, sondern drei Frauen zum Opfer fielen – und heute saß er in einer Zelle im Turm der Engelsburg, wie ein Verbrecher, er, von Vaterseite ein Farnese, von Mutterseite ein Caetani, unter seinen Vorfahren ein Papst und viele Kardinäle, er saß im Kerker und wußte nicht, warum. Er, der apostolische Skriptor, hatte einer Jungfrau das Leben und die Ehre gerettet – und dies war nun die Antwort des Papstes. Aber so waren die Verhältnisse unter Innozenz VIII. Cibò: Rechtlosigkeit und Wegelagerei, ja, bürgerkriegsartige Kämpfe im Umland der Ewigen Stadt. Sogar in Rom selbst waren private Rachefeldzüge an der Tagesordnung, und nachts herrschte ohnehin das Recht der schnellsten Dolche. Jeden Morgen fischte man Tote aus dem Tiber. Und gleichzeitig wurden unschuldige Menschen eingekerkert, gefoltert und hingerichtet. Wer sich nicht freikaufen konnte, hatte schlechte Karten. Wer dagegen Dukaten klimpern ließ, dem war der Mord schon verziehen, bevor er ihn überhaupt begangen hatte. Und die Kassen des Papstes brauchten immer Geld.
Alessandro ging unruhig in der Zelle auf und ab. Wahrscheinlich beruhte alles auf einem Mißverständnis. Oder auf einer Verleumdung. Bald kämen seine Mutter und sein älterer Bruder Angelo und holten ihn heraus. Im Notfall mußten sie einige Dukaten hinlegen. Und dann würde er hocherhobenen Hauptes vor den Heiligen Vater treten: Er hatte das höchste Gut einer Jungfrau gerettet! Und dabei zwei Verbrecher persönlich den Orkus hinabgeschickt. Noch jetzt zitterte seine Hand, wenn er daran dachte. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er getötet, er, ein Mann der Kurie, der die niederen Weihen bereits empfangen hatte, der einmal, wenn es nach seiner Mutter ging, Kardinal werden sollte ... Signora Ruffini hatte er nicht mehr retten können, er fand sie in ihrem Blut, nackt, mit verdrehtem Kopf und klaffender Wunde. Aber ihre bezaubernde Tochter hatte er vor Schändung und Schande bewahrt, die erwachende Rose, die reine Lilie, mit ihren dunkelbraunen, leicht schräg stehenden, ach so verwundeten Augen, wenigstens sie... Er hatte sich als Mann bewährt – und dafür saß er nun im Kerker.
In der Nacht hatten ihn die sbirren aus dem Stadtpalast der Farnese geholt, über den Campo de’ Fiori geschleppt, wo noch die am Abend zuvor Gehenkten baumelten, und zum Torre di Nona gebracht. Er tobte und beschimpfte den Bargello, aber der lachte nur. Vom Heiligen Vater persönlich sei die Festnahme angeordnet, erklärte er schließlich, der Skriptor Farnese sei nicht zur Niederschrift eines wichtigen breve erschienen, ohne Entschuldigung, und dies nun schon zum wiederholten Male. Es war ein höhnisches, widerliches Lachen, gleichzeitig fast gutmütig, und gerade dieser väterliche Ton steigerte Alessandros Wut noch. Aber es nützte nichts. Die sbirren schleppten ihn über die Engelsbrücke in die Burg der Päpste, in das alte Mausoleum des Hadrian, übergaben ihn dem Kastellan, der ihn mit den Worten »Die Fledermäuse schwirren bald zurück« begrüßte. Mit den Händen ahmte er ihren zackigen Flug nach. »Pst, pst!« machte er und legte einen Finger auf die Lippen. Dann ließ er Alessandro die Fesseln abnehmen und winkte ihn zu sich.
»Hat sie dich drangekriegt?« flüsterte er ihm ins Ohr.
Alessandro schaute ihn verständnislos an und wollte aufbrausen.
Der Kastellan winkte ab. »Vorzugsbehandlung«, flüsterte er, »ein sauberes Bett, regelmäßige Leerung des Eimers, anständiges Essen und genug Wasser.« Dabei rieb er Daumen und Zeigefinger aneinander. »Bei entsprechender Bezahlung, versteht sich, aber Madonna wird sich schon großzügig zeigen.« Er grinste und betrachtete Alessandro, der sich kaum hatte anständig ankleiden können. »Der Heilige Vater will persönlich vorbeischauen und Euch die Leviten lesen. Erst kauft die Familie ein Amt, dann füllt der Herr Sohn es nicht aus – bleibt einfach weg, unentschuldigt. Die Ungläubigen hätten dich dafür gehängt. Aber Seine Heiligkeit ist ja so gütig!«
Alessandro trat an eine Schießscharte und schaute nach draußen. Rom lag im frühen Tagesschimmer, rosig eingebettet, als würde es wach geküßt. Die ersten Straßenhändler und Wasserträger hörte er schon brüllen.
Nein, es war ein schlechter, elend langer Traum.
»Meine Kinderchen kehren zurück. Da, siehst du sie?« Der Kastellan wies auf schwarze Schatten, die unters Gebälk krochen. Mit plötzlich veränderter Stimme brüllte er nach den Wachen: »Satansbrut ihr! Führt ihn in seine Zelle, reicht ihm Wasser und Brot und verriegelt die Tür!«
Wie ohnmächtig war Alessandro in einen kurzen Schlaf gesunken. Jetzt lag er auf seinen Strohsäcken und starrte auf die Balken, über die langsam und suchend ein Insekt kroch. In dem Stadtpalast der Farnese schlief er unter einem samtenen Baldachin, und auch in Capodimonte oder in einer der anderen Burgen der Familie gab es anständige Betten, die vor Ungeziefer schützten, das sich gern nachts von der Decke fallen ließ. Und gegen Wanzen wurde ein Pulver gestreut. Duftkräuter zerrieben. Morgens kleidete ihn ein Kammerdiener an, und jederzeit stand eines der vielen Mädchen im Haus bereit. Fortuna war eine Dirne, das sagten schon die Alten, heute war man Herrscher und morgen Sklave, die Griechen verkauften ganze Städte in die Sklaverei – nein, Sklave würde er nie, und nie würde er lange eingekerkert bleiben, nicht er, Alessandro Farnese, der Sohn eines Kriegergeschlechts.
Er starrte auf das Insekt, das bewegungslos abwartete. Der zweitgeborene Sohn eines Kriegergeschlechts! Und das bedeutete: Titel und Lehen erbte sein Bruder Angelo, der Erstgeborene mußte das Geschlecht fortpflanzen, während dem zweiten Sohn der Kirchendienst blieb. So war es Onkel Caetani ergangen und weiteren fünf Kardinälen Caetani, nicht zuletzt dem Urahn Benedetto, Papst Bonifaz VIII., den die Mutter nie aufhörte, als leuchtendes Vorbild im Munde zu führen.
Ach, seine Mutter! Seit sein Vater vor einem Jahr gestorben war, herrschte die Mutter über die Familie, nicht etwa sein älterer Bruder Angelo, der bestimmt war, Condottiere zu werden. Dabei grübelte Angelo lieber über Gott nach und fragte jeden, warum eigentlich Christus, Gottes einziger Sohn, am Kreuz hatte sterben müssen.
Eine dumme Frage. So war es eben. Jesus von Nazareth starb am Kreuz, um die Sünden der Welt auf sich zu nehmen, um sie alle zu erlösen. Basta. Und auf zum fröhlichen Jagen. Zum Fechten und Rennen. Zum Ringen und Tanzen. Gut – auch um Cicero zu lesen. Seine Lehrer an der Accademia Romana hatten sich über die Bibelgläubigen lustig gemacht. »Abergläubische Kinder«, erklärte Pomponeo Leto und fuhr lachend fort, die Messe sei antiken Opferkulten nachempfunden, sei eigentlich heidnisch, Gotteslästerung, der wahre Gott, so es ihn gebe, brauche keinen Weihrauch und protzige Häuser, er sei fern, unaussprechbar, unnahbar, nicht zu fassen, ein deus absconditus, die Natur bestehe aus kleinen Teilen und zerfalle nach dem Tod, alles vergehe, das habe schon Lukretius Carus gesagt, De rerum natura, und vor ihm die Griechen, Demokritos zum Beispiel...
Aber sein gottsuchender Bruder Angelo hatte zu heiraten, Kinder zu zeugen und in einer Schlacht zu fallen, während er als der Jüngere langweilige Messen lesen sollte, Beichten abnehmen, Sakramente spenden, und bevor er das tun durfte, mußte er noch langweiligere breves und bullae schreiben, in dunklen, staubigen Skriptorien hocken, mit weindunstigen Prälaten Kurtisanenwitze austauschen und immer wieder vor dem Papst buckeln.
So wollte es seine Mutter.
Und die Folge war: Er saß im Kerker, von einem Papst eingesperrt, unter dem Bestechung und Verbrechen herrschten. Dabei hatte das Sagen im Vatikan sowieso Kardinal della Rovere, der starke Mann im Heiligen Kollegium. Er hatte den Cibò auf den Stuhl Petri gehievt, aber er ließ auch dessen Nepoten- und Günstlingswirtschaft zu.
Wann kam endlich seine Mutter und kaufte ihn hier frei? Vielleicht wußte sie noch nicht ... Man mußte ihr Boten nach Capodimonte schicken ... Aber der Kastellan hatte doch von einer Madonna gesprochen. Damit konnte er nur seine Mutter meinen. Jeder in Rom kannte seine Mutter, Madonna Caetani, wie sie sich nannte. Daß sie jetzt eine Farnese war, interessierte sie wenig. Die Caetani standen haushoch über den Farnese, glaubte sie, waren ein kuriales Schwergewicht – und die Farnese? Als Condottieri hatten sie sich mit Söldnern herumgeprügelt. Allerdings mußte man sich fragen, warum seine geliebte Mutter Giovannella Caetani dann Pierluigi Farnese geheiratet hatte. Hatte nicht sogar schon der Bruder des Vaters eine Orsini in sein Haus geholt? Die Farnese brauchten sich vor niemandem zu verstecken, vor keiner Caetani, keiner Orsini oder Colonna. Und schon gar nicht vor der Familie des Papstes. In den Farnese steckte die unverbrauchte Kraft eines klugen und schnellen Leoparden, sie waren Kämpfer, Sieger...
Aber sein Vater war seit einem Jahr tot, seine Mutter dagegen erfreute sich bester Gesundheit. Sie verkehrte mit Kardinälen, wie Giuliano della Rovere, auch mit den Spaniern, wie Rodrigo Borgia, sogar mit dem Heiligen Vater stand sie auf bestem Fuß – weil sie ihnen zu schmeicheln wußte. Seine Mutter beherrschte alle Formen der Verstellung.
Morgen würde sie in den Vatikan eilen und Papst Innozenz bitten, ihren pflichtvergessenen Heldensohn freizulassen. Schließlich hatte er nicht nur Hirsche gejagt, sondern die junge Ruffini gerettet. Ganz Rom würde davon sprechen. Er hatte dem Verbrecher den Speer in die Brust gejagt. Jeden Stier hätte er mit einem solchen Stoß zur Hölle geschickt. Noch jetzt sah er die brechenden Augen des einen Mannes, den er mit dem Speer erledigt hatte, hörte er den Aufschrei des anderen, dem sein Pfeil in den Rücken gedrungen war. Arme und Beine zuckten, das Gesicht im Dreck, eine Hand umklammerte einen morschen Zweig, unter dem Leib bahnte sich ein blutiges Rinnsal seinen Weg.
Alessandro stellte sich an die Maueröffnung, die ein wenig frische Luft hereinließ. Ihm war schlecht. Die stickige Luft und die Erinnerung an die Toten ... Er hatte zwei Männer im Kampf getötet! Aus ihm war endgültig ein Mann geworden. Sein Bruder Angelo hatte noch niemanden im Kampf getötet, ja, er hatte noch nicht einmal in einer Schlacht gekämpft. Selbst bei der Jagd war er ungeschickt. Vor Keilern hatte er Angst, vor Bären sowieso. Dabei war Bärenjagd der Höhepunkt allen Jagdglücks. Alessandro liebte wie fast alle Männer, die er kannte, die Jagd: Dieses Suchen, Verfolgen, Stellen und Töten erregte ihn. Aber das Blutvergießen stieß ihn auch ab, insbesondere wenn ein Tier keine Chancen hatte zu entkommen oder sich wenigstens tapfer zu wehren, weil eine ganze Hundemeute es zerfleischen wollte und eine Jägermeute sich mit seinen Spießen auf es stürzte. Bei der Bärenjagd allerdings mußte man tagelang in die Berge reiten. Lautlos tappten die Bären davon und versteckten sich im unwegsamen Gelände. Aber wenn man sie stellte ... jeder Prankenschlag streckte einen Jagdhund nieder, die Pfeile brachen sie ab, und wenn sie sich auf die Jäger stürzten, dann galt es gemeinsam und schnell zu handeln. Sein bester Jagdhüter war das letzte Mal tödlich verletzt worden, und das braune Vieh war entkommen. Er, Alessandro Farnese, hatte einen Moment zu lange gezögert. Dieser Kampf hatte ihm lange Zeit den Spaß an der Bärenjagd genommen. Der Blick des Jagdhüters, bevor er sein Leben aushauchte ... Immerhin ließ Alessandro ihm mehrere Messen lesen und versorgte die Witwe mit Geld, besorgte ihr sogar einen Mann und bezahlte die Mitgift.
Seine Mutter hatte ihn ausgelacht, ihn sogar getadelt. So viele Dukaten wegen eines lächerlichen Jagdhüters! »Wenn du für jeden toten Diener aus deiner famiglia Goldmünzen rollen läßt, wirst du nie mehr Geld haben für die wirklich wichtigen Dinge im Leben, zum Beispiel für ein teures Amt. Du sollst einmal Kardinal werden, kein Almosengeber. Für die guten Taten haben wir die Heiligen.«
Vielleicht werde er einmal ein Heiliger, hatte er mit ironischem Unterton geantwortet.
Seine Mutter lachte schrill. »Du Tunichtgut ein Heiliger? Eher geht eine ganze Kamelherde durch ein Nadelöhr!«
»Als daß ein Farnese ins Reich Gottes komme?«
Manchmal liebte er, mit seiner Mutter zu streiten. Wenn er sie im Wortgefecht besiegte, dann sah er in ihren Augen Stolz aufglimmen.
»Soll ich nicht Kardinal werden?« fuhr er mit erhobenem Finger fort. »Aber du traust mir nur zu, Kameltreiber zu werden.«
»Für einen Kameltreiber bist du zu ungeduldig. Aber Kardinal könntest du werden, denn Kardinäle kommen nie ins Himmelreich. Wenn sie geschickt sind, kommen sie ins Reich des Geldes. Das ist schon Segen genug.« Die Mutter lachte wieder voller Genugtuung.
»Das sind gotteslästerliche Redensarten.«
Verächtlich zog sie die Augenbraue hoch, aber dann nahm sie ihn in den Arm und küßte ihn auf die Stirn. »Ich segne dich, mein Sohn, du bist ein Caetani und ein Farnese. Auch wenn du nur mein Zweitgeborener bist, könntest du es weit bringen. Sehr weit.«
Die frische Luft, die aus dem Loch in der Wand in seine Zelle strömte, tat ihm gut. Er fühlte wieder die alte Kraft in sich aufsteigen. Noch immer konnte er nicht fassen, was mit ihm geschah. Er reckte sich, spannte seine Muskeln und machte einen Handstand. Vorsichtig seinen Körper ausbalancierend, bewegte er sich zur Zellentür. Er hörte die Wärter würfeln.
»He!« rief er. »Öffnet die Tür und laßt mich mitwürfeln!«
Das Fensterchen wurde geöffnet. »Schaut mal, was der junge Kirchenmann für Kunststücke beherrscht!«
Alessandro bewegte sich vorsichtig zurück, noch immer auf den Händen.
Die Tür wurde geöffnet. »Bravo, Gaukler!«
Er sprang wieder auf die Füße und kramte seinen letzten Dukaten aus dem Geldsäckchen. »Das ist Gold und glänzt verführerisch.« Er hielt ihn in die Höhe und drehte ihn hin und her.
Der Kastellan kam herangeschlurft, eine Flasche Wein in der Hand. »Was ist mit Euch? Her mit dem Geld!«
Blitzschnell ließ Alessandro die Münze verschwinden.
Der Kastellan wollte sich auf ihn stürzen, stolperte aber und fiel zu Boden. Keiner der Wärter rührte sich, um ihn aufzurichten. Der Kastellan rieb sich fluchend sein Knie. »Spielst du Schach?« stieß er, noch immer auf dem Boden, hervor.
»Ich spiele alles, was ihr wollt«, sagte Alessandro, »und hier geht es nicht um wertloses Kupfergeld.«
»Ich könnte dich erdrosseln lassen«, polterte der Kastellan.
»Sicher, wenn du anschließend hängen willst.«
Der Kastellan fletschte seine Fledermauszähne, schwieg aber.
»Kommt her, laßt uns eine Runde würfeln!« rief Alessandro. Er setzte sich auf einen Schemel, nahm die Weinflasche, die auf dem Tisch stand, und setzte sie an den Mund. Dann griff er sich den Würfelbecher und ließ die Würfel verführerisch gegeneinander schlagen. »Setzt euch, ihr Engelswärter, ich laufe euch schon nicht davon!« Wieder ließ er die Goldmünze zwischen seinen Fingern aufleuchten. »Und Ihr, Herr der Fledermäuse, geruht, Euch zu uns zu setzen und das Glück herbeizurufen. Das Glück ist eine Dirne!«
Alessandro ließ die Würfel rollen, noch bevor sich alle gesetzt hatten.
Drei Sechsen! Er warf auf Anhieb drei Sechsen. Die Wachen glotzten, als hätten sie es mit Magie zu tun.
»Der Satan ist mit ihm«, zischte der Kastellan. Die Wachen glotzten noch immer. Alessandro lachte verächtlich auf.
Kapitel 3
Mit dem Überfall hatte erneut der Tod in Silvias Leben eingegriffen. Er hatte sich in all seiner blutigen Gewaltsamkeit gezeigt, war aber über Nacht verschwunden. Hinterlassen hatte er einen Dämon, der die Herrschaft über das Haus der Ruffini an sich zu reißen drohte.
Die Mutter wurde ohne großen kirchlichen Pomp in der Familiengruft in Santa Maria ad Martyres beigesetzt. Zur Ausrichtung einer standesgemäßen Zeremonie fehlte dem Vater die Kraft. Er schloß sich tagelang in sein Studio ein, ließ nur seinen Astrologen zu sich und manchmal seinen Beichtvater. Versorgen ließ er sich von Rosella. Silvia suchte vergeblich seine Nähe, und sie verstand nicht, warum er sie nur flüchtig berührte, wenn er ihr nicht ausweichen konnte. Dann begann er, zur Frühmesse das Haus zu verlassen und erst wieder in der Nacht zurückzukommen, manchmal gar nicht. Ein Teil der Dienerschaft lief davon. Silvia irrte durch die leeren Korridore des Hauses. Wenn wenigstens Rosella für sie dagewesen wäre! Rosella, die doch alles hatte miterleben müssen, die, hinter dem Gebüsch verborgen, hatte ertragen müssen, wovon Silvia gerade noch verschont worden war. Rosella aber bediente sie nicht mehr und ließ sie allein.
Der einzige, der Silvia in diesen Tagen half, war ein Zeisig, mit dem sie oft spielte. Er hüpfte fröhlich hin und her und flog immer wieder heran, setzte sich auf ihre Schulter und pickte ans Ohr oder ließ sich auf ihrem Finger nieder und gab ihr ein Küßchen. Hilfreich war auch der Gedanke an ihren Retter, an Alessandro Farnese. An den Helden, der furchtlos die Wegelagerer getötet hatte. An den Ritter hoch auf seinem Roß, mit langen dunkelbraunen Haaren, mit dunklen Brauen über großen vertrauenswürdigen Augen und einer stolz geschwungenen Adlernase. Warum klopfte er nicht an das Portal des Hauses und besuchte sie?
Auch die Bücher des Vaters konnten Silvia nicht ablenken. Sie las das große Werk des Livius, und lange Stunden grübelte sie über die Geschichte vom Raub der Sabinerinnen. Käme Alessandro und raubte sie, würde sie zwar ihrem Vater nachweinen und um Rache schreien, aber gleichzeitig jubeln. Denn von ihrem Retter träumte sie. Sie träumte, er würde sie aus den Fängen der verdreckten, stinkenden Männer befreien, auf sein Pferd ziehen und mit ihr davonreiten. Wohin genau, das vermochte sie sich nicht vorzustellen.
Und dann vertiefte sie sich in die Geschichte der Lukrezia, die nicht ertragen konnte, ihre jungfräuliche Ehre verloren zu haben, und sich selbst entleibte. Beinahe wäre es ihr ähnlich ergangen. Lukrezia war ihre Schwester. Sie spürte noch das Blut, das ihr in Erwartung des Schmerzes in den Unterleib schoß. Ja, dort zwischen den Beinen, an diesem Ort der weiblichen Ehre, lag ein Geheimnis. Nicht nur, daß dort ein Kind gezeugt wurde. Tastete sie vorsichtig mit ihren Fingern die kleinen Rundungen ab, die Vertiefung, die bei Rosella ein dunkles Haarbüschel verbarg, spürte sie dieses den ganzen Körper erfassende Geheimnis, etwas Angenehmes, Süßes, Wildes.
Silvia zog sich mit ihrem Zeisig auf die Dachterrasse zurück und las erneut die Geschichte von Lukrezia. Der Zeisig hüpfte um sie herum und suchte nach Körnchen. Manchmal flatterte er auf, kam aber immer wieder zurück. Silvia schaute ihm nach, ohne ihn wirklich wahrzunehmen: Hätte sie sich ebenfalls den Tod geben müssen, wenn Alessandro sie nicht gerettet hätte? War wirklich die verlorene Ehre schlimmer als der Tod? Nein, entschied sie. Wurde eine Frau zu einer unsittlichen Tat gezwungen, konnte niemand sie dafür zur Verantwortung ziehen. Den Ehrverlust zu ertragen, vom Schmerz ganz abgesehen, war schon Strafe genug. Das Leben brauchte nicht zu enden.
Silvia holte ihren Blick, der sich in der Ferne verloren hatte, wieder zurück und suchte nach dem Zeisig. Er war verschwunden. Saß auch nicht auf der Brüstung. Flatterte nicht herbei, als sie ihn mit süßen Rufen lockte. Tränen füllten ihre Augen. Sie rief und rief, aber der Vogel hatte sie verlassen.
Silvia rannte durch das Haus und suchte Rosella. Zum Glück fand sie ihre Dienerin. Rosella lachte, brach dann in Tränen aus, schüttelte sich schließlich wieder vor Lachen. »Ein Zeisig, Bambolina, was ist schon ein Zeisig! Der sucht die Freiheit.«
Aber am nächsten Tag hockte der Zeisig wieder auf der Brüstung der Dachterrasse und flog auf ihre Schulter, als sie ihm entgegenstürzte. Beinahe hätte sie ihn vor Freude erdrückt.
Abends betete Silvia lange den Rosenkranz, weil sie sich schuldig fühlte. Sie freute sich unmäßig über die Rückkehr des Zeisigs, dachte aber zu wenig an ihre Mutter und vergaß, sie in ihre Fürbitten einzuschließen. Dies mußte eine Sünde sein. Ihre arme Mutter hatte ein schreckliches Ende gefunden. Daran zu denken schmerzte und verwirrte. Daher fühlte sie eine Erleichterung, als sie beigesetzt war. Um ihre Brüder, ihre Spielgefährten, hatte Silvia mehr geweint. Gemeinsam mit dem Vater waren sie ausgeritten oder hatten sich in den Ruinen herumgetrieben, zwischen Unkraut, Schlangen, verwilderten Hunden und Bettlergesindel, waren dort auf seltsame Marmorstücke gestoßen, auf einzelne Hände oder Füße. Einmal fanden sie ein halbzerstörtes Relief: Zu erkennen war ein Kind, das eine verschleierte Frau einem Mann reichte, und daneben eine auf den Kopf gestellte Fackel. Silvia hatte sich mit ihrem ältesten Bruder um dieses Relief gestritten, bis der Vater es schließlich ihr zugesprochen hatte. Jetzt hing es an der Wand ihres Zimmers, neben dem Kruzifix und einem Bildnis der Muttergottes. Der Bruder war ihr aber nicht böse gewesen. Abends kuschelten sie vor dem Kamin, der Vater erzählte aus seiner Kindheit und Jugend, von seinen weiten Reisen. Nur die Mutter hockte nicht dabei. Sie trat in den Raum, warf einen strengen Blick auf die Familie und verschwand wieder.
Und dann starben kurz nacheinander die jüngeren Brüder, schließlich wurde der älteste bei der Engelsbrücke aus dem Tiber gezogen. Die Mutter hüllte sich in lange schwarze Kleider. Wenn sie Rosella begegnete, blitzte Haß in ihren Augen auf. Der Vater bestand jedoch darauf, daß Rosella weiterhin zur famiglia gehörte.
Als Silvia eines Abends mit einem Talglicht durch das Haus zog und in einer Fensternische auf einen dunklen Schatten stieß, erschrak sie so, daß ihre Beine weich wurden. Der Tod, schoß es ihr durch den Kopf. Aber es war nur Rosella, die, in ein langes Tuch eingewickelt, wie ein großes düsteres Tier in die Fensteröffnung kroch, als wolle sie sich jeden Augenblick auf die Straße stürzen. Silvia blieb vor ihr stehen.
Rosella brach plötzlich in Tränen aus. »Ich bin schwanger«, schluchzte sie auf, »ich bin schwanger!«
Silvia drückte sich an sie und weinte mit ihr. Rosella ließ sich auf den Boden gleiten. Als ihre Tränen versiegt waren, starrte sie ins Leere und flüsterte unvermittelt: »Ich habe Angst.« Silvia schaute sie fragend an. Kaum noch verständlich, fügte Rosella an: »Ich hasse sie alle!«
»Wen haßt du?« rief Silvia ungeduldig.
Aber Rosella schien ihre Frage nicht gehört zu haben. Nach dumpfem Brüten stieß sie plötzlich wütend und gleichzeitig verzweifelt aus: »Wenn der Bastard auf die Welt kommt, bringe ich ihn um und gehe in den Tiber!«
Silvia rief entsetzt und gleichzeitig bettelnd: »Du mußt immer bei mir bleiben!«
Rosella lachte verächtlich und befreite sich aus ihrer Umklammerung.
Dann geschah etwas, was Silvia aus ihrem dunklen Trott riß. Ein dunkler Vorhang schien zur Seite geschoben, nein, heruntergerissen. Die langen düsteren Gänge des Hauses hatten tausend Verstecke und überall Augen. Silvia beobachtete, wie Rosella ihren Vater in eine Ecke des Hauses zog und heftig auf ihn einredete. Er schüttelte den Kopf, drückte sie dann aber an die Wand und hob ihren Kittel. Sie wehrte ihn ab und flüsterte etwas, wies auf den sich schwach vorwölbenden Bauch. Dann drehte sie sich bereitwillig um und bückte sich.
Silvia sah, wie ihr Vater sich mit gebeugtem Rücken hechelnd an Rosella krallte und sein Becken immer wieder stoßweise gegen ihr Hinterteil drückte. Ekel und Abscheu ließen Silvia tagelang nichts essen. Sie kniete vor dem kleinen Elfenbeinkruzifix in ihrem Zimmer und betete unaufhörlich. Wenn sie nicht betete, las sie in der Bibel. Nachts träumte sie von dem Überfall, immer wieder tauchten die dreckigen Gestalten auf und griffen ihr zwischen die Beine, dann machten sie sich über Rosella her, legten eine ihrer Brüste frei, wie auf den Bildern der Muttergottes, und leckten daran oder nahmen sie in den Mund, wie der Jesusknabe, aber nun verwandelten sie sich in ihren Vater, und schließlich kam Alessandro wie der heilige Georg herangeritten und durchbohrte ihn mit seiner Lanze. Silvia wollte schreien, brachte aber keinen Laut heraus. Am Morgen war sie noch ganz benommen.
Erst auf der Dachterrasse kam sie zu sich, versuchte, alle schrecklichen Bilder aus ihrem Kopf zu verbannen, nur ihn nicht, ihren Retter. Ihn wünschte sie sich groß, stark und strahlend. Aber sie brauchte es sich nicht zu wünschen. Er war groß, stark und strahlend. Wieder in ihrem Zimmer, schrieb sie Alessandro einen Brief. Ein Knecht sollte ihn überbringen. Er habe den Brief abgeliefert, erklärte der Knecht, aber trotzdem antwortete Alessandro nicht und besuchte sie noch immer nicht.
Eines Tages gelang es Silvia, ihren Vater nach ihm zu fragen, und er erzählte ihr, Alessandro Farnese sei in die Engelsburg gesperrt worden, der Heilige Vater persönlich habe dies angeordnet.
Entsetzt rief sie: »Das darf er nicht!« Und nach einer kurzen Pause: »Ich will zu ihm!«
Der Vater lachte sie aus.
Silvia verstand ihn nicht mehr und begann zu weinen.
»Gut«, sagte er, »ich werde mich erkundigen, warum man ihn in den Kerker geworfen hat.« Nach einer Weile, als Silvia nicht aufhören wollte, laut und verzweifelt zu schluchzen, fügte er ernst an: »Der Papst ist leicht erregbar und launisch; außerdem ist er Wachs in den Händen von Kardinal della Rovere. Wer weiß, was die beiden gegen die Farnese im Schilde führen. Die Familie Farnese stand immer auf seiten der Orsini, und die Orsini betrachtet der Papst zur Zeit als Verbündete seiner Feinde.« Als Silvia sich noch immer nicht beruhigen wollte, nahm er sie seit langer Zeit zum ersten Mal wieder in den Arm. »Dein edler Retter wird schon wieder freikommen. Wahrscheinlich ist alles ein Mißverständnis. Du bist wohl verliebt in ihn?«
Silvia entwand sich seinen Armen und rannte in ihr Zimmer. Sie verschloß die Tür, kniete nieder und betete, noch immer weinend, zu Maria, der Gnadenreichen. Warum half ihr die Muttergottes nicht, die Verwirrungen, die Schmerzen, das Fieber und die Sehnsüchte zu überwinden?
Rosella verbarg inzwischen nicht mehr, daß sie jeden Abend zu dem Vater ins Bett kroch, und ließ sich von den Kammerfrauen der Mutter bedienen, als wäre sie die Herrin des Hauses. Sie legte sich lange in einen dampfenden Badezuber, das Wasser duftete betäubend nach Kräutern, und sang leise vor sich hin. Sie rief Silvia zu sich, strich ihr über den Kopf, und forderte sie auf, ihr Petrarca-Verse vorzusingen. Silvia tat es widerwillig. Rosella war schließlich nichts anderes als ihre Kammerfrau gewesen, und nun sorgte an ihrer Stelle ein dicklicher Trampel aus Trastevere für sie, während Rosella ihren sich rundenden Leib pflegte. Der Lehrer, bei dem Silvia das Lautespiel lernte, begab sich nach den Unterrichtsstunden zu Rosella, und dann hörte Silvia auch sie zupfen und danebengreifen. Aber sie griff nur anfangs daneben. Sehr schnell, dies mußte Silvia sich eingestehen, spielte Rosella fast ebenso geschickt wie sie selbst, und als sie dann auch noch zu singen begann, mußte Silvia weinen vor Neid und Rührung. Rosellas Stimme klang weich wie Samt und klar wie ein Glockenton von Santa Maria della Pace.
Endlich erhielt Silvia einen Brief von Alessandro. In ihrer Aufregung achtete sie nicht darauf, daß sein Siegel erbrochen war. Seine Schrift zog sich in langen Schwüngen über das Papier, insbesondere die Schleifen glitten tief unter die Zeile. Das »g« zum Beispiel schien hinabstürzen zu wollen, kopfüber, aber dann riß es sich wieder hoch und setzte seine Reise auf dem Papier ruhig fort. Stundenlang hätte Silvia mit ihren Fingern der Feder nachfolgen können.
Zu ihrem Vater kam manchmal eine Zigeunerin, die in seiner Hand las und die tatsächlich einen Bruch in seiner Lebens- und Herzlinie festgestellt hatte. Ihr zeigte sie Alessandros Brief. Die Augen der Zigeunerin verdunkelten sich, und sie verlangte erst einmal einen Dukaten. Über diese Geldgier war Silvia so verärgert, daß sie die Zigeunerin davonjagte. Später bereute sie ihre Tat.
»Liebste Silvia«, schrieb Alessandro. O Gott, war sie wirklich seine Liebste? »Horaz schrieb einmal: Das Schicksal stiftet Unglück, damit wir besser unseren Wert erkennen können. So mag es Dir ergangen sein, so ergeht es mir jetzt. Nach Deiner wundersamen Rettung, durch die der Allmächtige unsere Lebenswege hat kreuzen lassen, hat ER mich nun in den Kerker geführt. Der Heilige Vater selbst war SEINE rechte Hand. Statt auf die Jagd zu gehen (und Dich retten zu dürfen), hätte ich bei ihm sein müssen, um den Entwurf eines breve zu notieren. Seine Heiligkeit war tief gekränkt, und in Demut muß ich gestehen, daß ich sehr nachlässig meinen Pflichten nachgegangen bin, seitdem mein Vater mir vor vier Jahren das für einen Vierzehnjährigen ehrenvolle Amt eines apostolischen Skriptors erworben hat. Aber so wie nicht nur ein einziger Planet über das Firmament zieht und in manchen Jahren Mars und Saturn in Konjunktion stehen, so mögen viele Gründe sich in einer Tat verdichten, und nur der Allwissende überschaut sie alle. Wenn sich unsere Lebensbahnen nun gekreuzt haben – als begegneten sich Venus und Jupiter –, so war auch dies schon am Firmament vorgezeichnet. Wie meine Schwester Giulia warst Du mir vertraut. Oder als sei ich Dir schon in einem früheren Leben begegnet.
Giulia wirst Du hoffentlich eines nicht allzu fernen Tages kennenlernen. Sie ist nur wenig älter als Du, aber beide entsteigt ihr wie die schaumgeborene Venus auf der Muschel dem tiefblauen, sanft schimmernden Meerestraum des Weltenschöpfers, um den jungen Männern von Rom den Kopf zu verdrehen. Euer Bildnis hilft mir, die Tage im Kerker mit Gleichmut zu überstehen. Der HERR weiß, was ER tut. ER prüft uns, damit wir stärker werden. Dies gilt auch für Dich, meine liebste Silvia. Schließe mich in Deine Gebete ein, Dein Alessandro.«





























