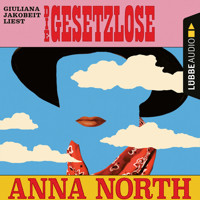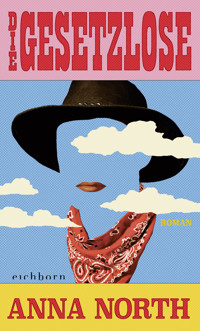
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1894, der Wilde Westen: Nach einer mysteriösen Grippewelle herrscht Unfruchtbarkeit. Umso wichtiger, dass Frauen ihrer weiblichen Pflicht nachkommen, heiraten und gebären. Als die siebzehnjährige Ada jedoch trotz Ehe nicht schwanger wird, verdächtigt man sie, mit einem Fluch belegt zu sein. Sie wird verstoßen und flieht - zur berüchtigten »Hole in the Wall«-Gang. Doch einmal von der Gang aufgenommen, stellt Ada fest, dass die Gesetzlosen ganz anders sind, als der örtliche Sheriff glauben machen will.
Die diverseste Gruppe von Geächteten, die der altehrwürdige Wilde Westen je gesehen hat. Ein wilder Ritt von einem Buch!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Danksagung
Über das Buch
1894, der Wilde Westen: Nach einer mysteriösen Grippewelle herrscht Unfruchtbarkeit. Umso wichtiger, dass Frauen ihrer weiblichen Pflicht nachkommen, heiraten und gebären. Als die siebzehnjährige Ada jedoch trotz Ehe nicht schwanger wird, verdächtigt man sie, mit einem Fluch belegt zu sein. Sie wird verstoßen und flieht – zur berüchtigten »Hole in the Wall«-Gang. Doch einmal von der Gang aufgenommen, stellt Ada fest, dass die Gesetzlosen ganz anders sind, als der örtliche Sheriff glauben machen will. Die diverseste Gruppe von Geächteten, die der altehrwürdige Wilde Westen je gesehen hat. Ein wilder Ritt von einem Buch!
Über die Autorin
Anna North hat den Iowa’s Writer’s Workshop absolviert, ist Journalistin und Autorin dreier Romane, von denen The Life and Death of Sophie Stark mit dem Lambda Literary Award und dem Prix des lecteurs et des lycéens de Vincennes ausgezeichnet wurde. Ihr neuer Roman Die Gesetzlose wurde weltweit in zahlreiche Länder verkauft. Ihre journalistischen Arbeiten sind u.a. in Vox, Jezebel, BuzzFeed, The Atlantic und der New York Times erschienen. Anna North lebt in Brooklyn.
ANNA NORTH
ROMAN
Aus dem amerikanischen Englisch von Sonia Bonné
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Eichborn Verlag in der Bastei Lübbe AG
Titel der amerikanischen Originalausgabe:»Outlawed«
Für die Originalausgabe:Copyright © 2021 by Anna North
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, KölnLektorat: Eva Wagner, DorfenUmschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille unter Verwendung eines Designs von Rachel Willey, Motive: © Alina Solovyova-Vincent/Getty Images and CSA ImageseBook-Erstellung: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-2060-1
luebbe.delesejury.de
Für meine Familie
KAPITEL 1
Im Jahr des Herrn 1894 wurde ich zur Gesetzlosen. Wie so vieles im Leben geschah auch das nicht von heute auf morgen.
Zunächst einmal musste ich heiraten. Am Tag meiner Hochzeit fühlte ich mich wie ein Glückskind. Ich war siebzehn und nicht die erste Braut in meiner Schulklasse, aber immerhin war ich eine Braut, und mein Ehemann ein hübscher Junge aus gutem Hause. Er hatte drei Geschwister, wie ich, und seine Mutter war eins von sieben Kindern. War ich verliebt? Damals behaupteten meine Freundinnen und ich ständig, in unsere Verehrer verliebt zu sein – ich weiß noch, wie ich stundenlang von seinen breiten Schultern schwärmte, von seiner ungeschickten, aber charmanten Art zu tanzen und seiner schüchternen Art, meinen Namen zu sagen.
Die ersten paar Ehemonate waren schön. Mein Mann und ich hatten ständig Lust aufeinander. In der neunten Klasse, als Mädchen und Jungen getrennt auf das Eheleben vorbereitet wurden, hatte Mrs Spencer uns erklärt, es würde später einmal unsere Pflicht sein, unserem Mann beizuwohnen und Babys für das Jesuskind zu bekommen. Von der Sache mit den Babys hatten wir schon gehört, denn wir hatten jedes Jahr seit der dritten Klasse Burtons Geschichten vom Jesuskind gelesen und wussten deshalb, dass Gott die Große Grippe geschickt hatte, wie damals vor vielen Jahrhunderten die Sintflut, um die Welt vom Bösen zu säubern. Wir wussten, das Jesuskind war Mary von Texarkana erschienen, kurz nachdem die Grippe zwischen Boston und Kalifornien neun von zehn Männern, Frauen und Kindern umgebracht hatte, und wir wussten auch, dass Es einen Bund mit ihr geschlossen hatte: Wenn die Überlebenden fruchtbar waren, sich mehrten und die Welt nach Seinem Ebenbild bevölkerten, würde Es ihre Nachkommen behüten und vor weiterer Krankheit verschonen, bis in alle Ewigkeit.
Und in der neunten Klasse erfuhren wir dann, wie wir unserem künftigen Ehemann beiwohnen würden. Wir sollten uns vorher waschen, uns Parfüm hinter die Ohren tupfen, langsam atmen, um alle Muskeln zu entspannen, und unserem Gatten währenddessen in die Augen blicken. Angeblich würde es bluten.
»Keine Sorge«, fügte die Lehrerin lächelnd hinzu. »Es tut nur beim ersten Mal weh. Nach einer Weile wird es euch gefallen. Nichts ist schöner, als wenn zwei Menschen zusammenfinden und ein Kind zeugen.«
Anfangs wusste mein Mann nicht so recht, wie er es anstellen sollte, aber er nahm seine Verantwortung sehr ernst, und was ihm an Erfahrung fehlte, machte er mit Eifer wieder wett. Damals wohnten wir bei seinen Eltern, während er auf ein eigenes Haus sparte. Beim Frühstück scherzte seine Mutter immer, bald würde ich für zwei essen.
Tagsüber begleitete ich meine Mutter weiterhin zu ihren Hausbesuchen. Ich war ihr ältestes Kind und das einzige, das wirklich etwas über Steißgeburt, Morgenübelkeit und Kindbettfieber lernen wollte, und folglich würde ich, wenn sie zu alt für ihren Beruf sein würde, ihre Aufgaben übernehmen. Bei den Hausbesuchen trug ich meinen neuen Ehering. Die werdenden Mütter zwinkerten mir zu und neckten mich.
»Gut, dass du das alles jetzt schon lernst«, sagte Alma Bunting, vierzig Jahre alt, schwanger mit dem sechsten Kind und von Hämorrhoiden geplagt. »Dann bist du nicht so überrascht, wenn es dir passiert.«
Ich lachte nur. Ich war nicht wie meine Freundin Ulla, die jetzt schon acht Babynamen ausgesucht hatte, vier für Jungen und vier für Mädchen. Als ich zehn Jahre alt war und meine Schwester Bee gerade zwei Monate, hatte meine Mutter sich ins Bett gelegt und konnte ein Jahr lang nicht mehr aufstehen. Ich wusste also, was es hieß, Mutter zu sein – ich hatte Bee gewickelt und mit der Flasche gefüttert, wenn meine Mutter sie nicht stillen konnte, und nachts hatte ich sie getröstet, obwohl ich selbst noch ein Kind war und mich im Dunkeln fürchtete. Ich hatte es nicht gerade eilig, die Erfahrung zu wiederholen, und von den Hausbesuchen wusste ich, dass schwanger zu werden manchmal Monate dauerte, selbst für so junge Frauen wie mich. Ich war zufrieden damit, mit meinem frischangetrauten Ehemann zu schlafen, mich gelegentlich aus dem Haus zu schleichen, mit Ulla, Susie und Mary Alice hinter der Scheune der Petersens Felsenbirnenwein zu trinken und mich um niemanden zu kümmern außer um mich selbst.
Aber eines Morgens – die Hochzeit war sechs Monate her, und ich stand gerade in der Küche und räumte das Frühstücksgeschirr weg – sprach mich meine Schwiegermutter an.
»Weißt du«, sagte sie, »du darfst, wenn ihr es getan habt, nicht einfach aufstehen und herumlaufen. Wenn es klappen soll, musst du mindestens eine Viertelstunde liegenbleiben und stillhalten.«
Normalerweise redete sie mit mir, als wären wir zwei Gleichaltrige, die nach der Schule den neuesten Tratsch austauschen. Aber das hier war kein Tratsch, und wir waren keine Schulfreundinnen. Ich versuchte, froh und unbekümmert zu klingen.
»Mama sagt, das spielt keine so große Rolle«, erklärte ich. »Sie meint, es kommt vor allem auf den richtigen Zeitpunkt an. Deswegen trage ich ihn jeden Monat in den Kalender ein.«
»Deine Mutter ist eine sehr kluge Frau«, sagte sie, dabei hatte sie meine Mutter nie leiden können. »Aber manchmal muss man eben ein kleines bisschen nachhelfen.«
Sie nahm mir die Teetassen aus der Hand.
»Ich erledige das«, sagte sie. »Geh und mach dich für die Arbeit fertig.«
Ich befolgte den Ratschlag meiner Schwiegermutter nicht – faul im Bett herumzuliegen hatte mir noch nie gefallen. Aber ich fing an, jeden Morgen meine Temperatur zu messen, um die fruchtbaren Tage nicht zu verpassen. Noch machte ich mir keine Sorgen – meine Mutter hatte mir erzählt, es habe acht Monate gedauert, bis sie mit mir schwanger wurde, mein Vater hätte sie deswegen sogar beinahe verlassen. Später, bei Janie, Jessamine und Bee, sei es einfacher gewesen. Wann immer wir allein waren, machte mein Mann sich über seine Mutter lustig. In die Ehe seines großen Bruders hatte sie sich angeblich so sehr eingemischt, dass seine Schwägerin ihr Hausverbot erteilt hatte.
Aus sechs glücklichen Monaten wurde ein ganzes Jahr.
»Jetzt gibt es nur noch eine Lösung«, sagte meine Mutter. »Du musst mit einem anderen schlafen.«
In der Hälfte der Fälle, erklärte sie, liege das Problem beim Mann.
Ich war schockiert. Mrs Spencer hatte uns immer erzählt, die meisten Paare bekämen deswegen kein Kind, weil die Frau ihrem Ehemann nicht oft genug beiwohnte, oder weil sie zu beten vergaß. Eine Frau, die ihre Pflichten gegenüber dem Ehemann und dem Jesuskind vernachlässigte, sei höchstwahrscheinlich von einer Hexe verflucht worden – für gewöhnlich von einer Frau, die selbst unfruchtbar war und andere mit ihrem Leid anstecken wollte.
Von meiner Mutter wusste ich, dass es so etwas wie böse Flüche nicht gab und der Körper manchmal einfach so versagte, aber von unfruchtbaren Männern hatte ich noch nie gehört. Als Maisie Carter und ihr Ehemann kein Kind bekommen konnten, war es Maisie, die aus dem Haus gejagt wurde und unten am Fluss bei den Kesselflickern und den Säufern leben musste. Als Lucy McGarry nicht schwanger wurde, ging sie zurück zu ihrer Familie, und als in dem Sommer zwei Nachbarinnen eine Fehlgeburt erlitten, schoben alle die Schuld auf Lucy. Sie wurde als Hexe gehängt. Damals war ich erst elf und begleitete meine Mutter noch nicht auf Hausbesuche. Ich hatte noch nie jemanden sterben sehen. Das Ganze machte mir große Angst – nicht die Gewalt an sich, sondern wie unvermittelt sie kam. Im einen Moment stand Lucy noch auf dem Podest, im nächsten baumelte sie reglos in der Luft. Ich stellte mir vor, wie es wäre zu sehen, zu denken und zu fühlen und dann plötzlich in die Finsternis zu stürzen – in weniger als Finsternis, ins Nichts. Die Furcht hielt mich nächtelang wach, aber dort unten vor dem Galgen hatte ich gejubelt wie alle anderen. Nur meine Mutter hatte nicht gejubelt.
»Ich will nicht mit einem anderen schlafen«, sagte ich. »Können wir es nicht noch eine Weile versuchen?«
Meine Mutter schüttelte den Kopf.
»Die Leute reden schon über euch«, sagte sie. »Meine Patientinnen fragen ständig, ob du endlich schwanger bist.«
Sie würde jemanden für mich finden, sagte sie. Es gebe Männer, die es für Geld machten, Männer, deren Zeugungskraft bewiesen war und die ein Geheimnis für sich behalten konnten. An den entsprechenden Tagen würde ich einen von ihnen treffen, tagsüber und am besten gleich mehrere Tage hintereinander.
»Du darfst nicht glauben, du würdest deinem Mann damit untreu«, sagte meine Mutter. »Betrachte es als Selbstschutz.«
Der Mann überraschte mich. Wir trafen uns im Haus meiner Mutter, wo er sich als Handwerker ausgab (und tatsächlich den Herd reparierte). Er stellte sich als Sam vor, aber ich wusste gleich, dass das nicht sein richtiger Name war. Er war im selben Alter wie meine Mutter und ziemlich hässlich mit seinem zotteligen mausgrauen Schnurrbart, dem dicken Bauch und den dünnen Beinen. Aber er war nett und nahm mir die Nervosität.
»Wenn du willst, dass ich aufhöre, musst du mir nur ein Zeichen geben«, sagte er und zog sich die Socken aus.
Ich wollte nicht, dass er aufhörte. Ich wollte, dass er sich beeilte mit dem, was nötig war, damit ich mit einem Kind im Bauch zu meinem Mann zurückgehen konnte und nie wieder Angst haben musste.
Wir trafen uns vier Mal, und während ich in der Zeit danach darauf wartete zu erfahren, ob es funktioniert hatte, fragte ich meine Mutter, was eine Frau wirklich unfruchtbar machte. Meine Mutter wusste vieles, wovon Mrs Spencer und die anderen Leute in unserer Stadt keine Ahnung hatten. Zum Beispiel wusste sie, dass die Grippewelle, die ihre acht Urgroßeltern und neun von zehn Männern, Frauen und Kindern zwischen Boston und Kalifornien umgebracht hatte, entgegen allen Behauptungen keine Strafe durch Jesus und die heilige Jungfrau Maria gewesen war. Ihre Lehrerin Sarah Hawkins, eine erfahrene Hebamme, hatte ihr erklärt, die Grippe sei an Bord eines Schiffes nach Amerika gekommen, zusammen mit Gewürzen und Zucker, und dann hatte sie sich von Ehemann zu Ehefrau übertragen, von Mutter zu Kind und von Händler zu Händler; durch Küsse, durch einen Händedruck, durch Biergläser, die Freunde und Fremde teilten, durch den Husten und das Niesen von Männern und Frauen, die von ihrer Krankheit nichts wussten und deshalb einen fatalen Tag zu lang Essen serviert, Stoffe verkauft oder mit Biberfellen gehandelt hatten. Sarah Hawkins sagte, die Große Grippe sei nur eine Grippe gewesen, eine Krankheit wie jede andere, aber die Leute mussten ihr einen Sinn geben, weil die Trauer sie sonst verrückt gemacht hätte. Meine Mutter sagte, Sarah Hawkins sei der klügste Mensch, den sie je getroffen habe.
Aber als ich meine Mutter nach der Unfruchtbarkeit fragte, schüttelte sie nur den Kopf.
»Das weiß niemand«, sagte sie.
»Warum nicht?«, fragte ich. Nie zuvor hatte ich sie etwas gefragt und keine Antwort bekommen.
»Wir wissen ja nicht einmal genau, wie das Kind im Mutterleib entsteht«, sagte sie. »Woher sollen wir da wissen, warum er manchmal leer bleibt?«
Ich sah auf meine Hände nieder, und sie merkte, wie enttäuscht ich war.
»Aber eins kann ich dir versprechen«, sagte sie. »Dahinter steckt keine Hexerei.«
»Woher willst du das wissen?«
»Die Leute reden immer gleich von Hexerei, wenn sie etwas nicht verstehen«, sagte sie. »Wie damals, als alle Frauen der Stadt glaubten, eine Hexe hätte Bürgermeister Van Duyn verflucht. Nachdem er gestorben war, entdeckte der Arzt in seiner Lunge lauter Tumoren. Der wahre Fluch war seine Pfeife.«
»Warum erklärst du es ihnen nicht?«, fragte ich. »Alle hören auf dich.«
Meine Mutter schüttelte wieder den Kopf.
»Früher habe ich mit meinen Patientinnen darüber gesprochen«, sagte sie. »Jede Frau, die zwei Monate nach der Hochzeit noch nicht schwanger ist, fürchtet sich vor einem Fluch. ›Das ist nur ein albernes Märchen‹, sagte ich immer. Aber sie haben mir nicht geglaubt. Schlimmer noch: Manche wurden misstrauisch, gerade so, als hätte ich sie verflucht.«
In der Freien Stadt Fairchild war meine Mutter diejenige, die die Babys auf die Welt holte, und obendrein heilte sie viele Krankheiten. Sie hatte mehr Knochenbrüche gerichtet als Dr. Carlisle und mehr Beichten abgenommen als Pater Simon. Ihr Ruf war tadellos, und obwohl sie nach Bees Geburt ein Jahr lang das Bett gehütet hatte, standen die Patientinnen schon am Tag ihrer Genesung wieder vor unserer Tür Schlange. Alle vertrauten meiner Mutter.
»Das verstehe ich nicht«, sagte ich. »Warum haben sie dir nicht geglaubt?«
»Wenn ein Mensch etwas glaubt«, sagte meine Mutter, »kann man ihm das nicht einfach nehmen. Du musst ihm etwas zum Tausch anbieten. Und ich habe nichts anzubieten, weil ich die Ursache für Unfruchtbarkeit nicht kenne.«
In dem Monat wurde ich nicht schwanger, und im darauffolgenden auch nicht. Meine Schwiegermutter beäugte mich pausenlos, als wollte sie mich beim Hexen erwischen. Einmal kam sie ins Schlafzimmer, als ich mich gerade wusch. Während ich mir Achseln und Geschlecht reinigte, verwickelte sie mich in ein Gespräch und nötigte mir höfliche Antworten ab. Wie nie zuvor schämte ich mich für meinen Körper, für meine kleinen Brüste und den flachen, leeren Bauch. Morgens zwang sie mich, zum Jesuskind zu beten. Zusammen knieten wir nieder und baten um ein Kind für unsere Familie. Meine Schwiegermutter war eigentlich kein religiöser Mensch. Wie alle in Fairchild hatte sie eine Krippe über dem Herd und eine Ausgabe von Burtons Jesusgeschichten im Regal, doch in die Kirche ging sie nur an Feiertagen oder wenn sie besonders fromm erscheinen wollte. Dass sie nun an meiner Seite betete – gestammelte Zeilen, an die sie sich wahrscheinlich von den Bibelstunden ihrer Kindheit erinnerte –, bewies mir, wie verzweifelt sie inzwischen war.
Nachts berührte mein Mann mich nur noch an den fruchtbaren Tagen, und auch er behielt mich stets im Blick. Anscheinend vertraute er mir nicht mehr. Als ich einmal ein paar Nächte später an ihn heranrutschte, sagte er, seine Mutter sei der Ansicht, wir sollten unsere Kräfte für den richtigen Moment aufsparen. Dass er mit seiner Mutter darüber gesprochen hatte, wunderte mich kein bisschen, aber ich war trotzdem empört.
Seltsamerweise wurden die Treffen mit Sam zu meinem Rückzugsort. Im Haus meiner Mutter beobachtete uns niemand. Anders als mein Ehemann zwang Sam mich danach nie, stillzuhalten oder die Beine hochzulegen. Er zog sich an, verabschiedete sich und ging, und ich lag in meinem alten Kinderbett und stellte mir vor, ich hätte nie geheiratet.
Sam und ich redeten nicht viel miteinander, aber im dritten Monat unserer Treffen fragte er mich, ob er mich, wenn wir es taten, anfassen solle.
»Vielleicht hilft es dir, dich zu entspannen«, sagte er. »Manche sagen, das erhöht die Chancen auf ein Kind.«
Zu dem Zeitpunkt vertraute ich Sam längst. Er hatte nie etwas versucht, was ich nicht wollte. Er war wie ein hilfsbereiter Freund, der sich anbietet, einen Gegenstand aus einem zu hohen Regal herunterzuholen. Also sagte ich Ja, er könne mich gern anfassen. Und das war der Anfang vom Ende.
Was das Eheleben betraf, hatten wir Mädchen neben Mrs Spencer noch andere Informationsquellen. Wir kannten junge Frauen, die bereits verheiratet waren und uns in ein Netz aus Gerüchten und guten Ratschlägen einsponnen, als wollten sie uns beschützen. Von ihnen erfuhren wir, dass es gefährlich war, vor der Ehe zu oft mit einem Mann zu schlafen, denn falls man nach wenigen Monaten Spaß nicht schwanger war, würde er einen nie heiraten. Schlimmer noch, er könnte das Gerücht verbreiten, man sei unfruchtbar. Wir wussten auch, dass man, wenn der Ehemann sich nach der Hochzeit als grausam entpuppte, am besten so schnell wie möglich Kinder bekam. Eine Frau mit drei Kindern konnte sich scheiden lassen und würde wahrscheinlich schnell einen neuen Ehemann finden – meine Mutter hatte es nie ausgesprochen, aber ich wusste, dass sie nur auf Janie und Jessamine gewartet hatte, um unseren Vater verlassen und mit uns nach Fairchild ziehen zu können, wo eine neue Hebamme gebraucht wurde. Eine Frau mit vier Kindern durfte tun und lassen, was sie wollte – sie konnte sich wieder verheiraten oder auch nicht. Ich wusste, das war einer der Gründe, warum niemand schlecht über sie sprach, nicht einmal, als sie sich nach dem Verschwinden von Bees Vater gegen eine weitere Ehe entschied.
Außerdem gab es ein Buch, das unter den Mädchen und jungen Frauen von Fairchild zirkulierte und den lapidaren Titel Fruchtbare Ehe trug. Es war freizügiger als Mrs Spencers Unterricht. Obwohl das Buch nicht ausdrücklich verboten war, galt es als skandalös, bei der Lektüre erwischt zu werden. Als Susies Mutter es beim Aufräumen gefunden hatte, hatte sie Susie nicht bestraft, sondern das Buch wieder unters Bett zurückgeschoben (und vorher vermutlich selbst ein bisschen darin geblättert).
Fruchtbare Ehe zeigte Skizzen von nackten, eng umschlungenen Männern und Frauen. Die Autorin, eine gewisse Wilhelmina Knutson, erwähnte auch den sogenannten »Höhepunkt«, welchen sie entmutigenderweise als »Augenblick des unbeschreiblichen Genusses« beschrieb. Die Fähigkeit zum Höhepunkt, schrieb Mrs Knutson, zeichne das körperlich und seelisch gesunde, für die Mutterschaft reife Individuum aus. In einem Punkt ließ Mrs Knutson keine Zweifel: Der Höhepunkt war nur zu erreichen, wenn »der beste Freund« des Mannes tief im Körper der Frau steckte.
Mit meinem Mann hatte ich nie einen Höhepunkt erlebt, und in den folgenden Monaten fing ich an, es für ein weiteres Zeichen meiner körperlichen Unzulänglichkeit zu halten. Doch als Sam nun rhythmisch und geduldig die Öffnung meiner Scheide streichelte – zwei Minuten oder zwei Stunden lang, ich wusste es nicht genau –, spürte ich plötzlich ein heftiges Gefühl, das ich entweder für einen Höhepunkt hielt oder für einen gefährlichen, vielleicht sogar lebensbedrohlichen Krampf. Etwas Ähnliches hatte ich schon früher erlebt, wenn ich aus einem hitzigen Traum von fremden Händen und Mündern aufgewacht war und mich unter der Bettdecke gestreichelt hatte. Aber was ich mit Sam erlebte, war viel intensiver, und nachdem er sich an dem Tag verabschiedet hatte, blieb ich zittrig liegen und war mir absolut sicher, dass ich dieses Mal schwanger geworden war.
Als ich eine Woche später mit Ulla und Susie hinter der Scheune saß, musste ich immer noch daran denken. Mary Alice war zum ersten Mal schwanger und im vierten Monat, deswegen traf sie sich nicht mehr mit uns. Ulla war seit zwei Monaten verheiratet, Susie war verlobt und würde beim Erntefest im November heiraten. Zuerst alberten wir herum und tauschten wie immer den neuesten Klatsch über das Liebesleben unserer ehemaligen Mitschülerinnen aus. Doch schon bald hielt ich meine Neugier nicht mehr aus.
Als die Flasche bei mir ankam, nahm ich einen großen Schluck.
»Habt ihr jemals einen Höhepunkt gehabt?«, fragte ich.
Susie zog nachdenklich die Augenbrauen zusammen.
»Ich glaube schon«, sagte sie. »Einen kleinen.«
Ulla lachte. Die Lücke zwischen ihren Schneidezähnen ließ sie draufgängerisch wirken, als könnte nichts sie schockieren.
»Mit Ned ist es ungefähr so«, sagte sie und machte eine Geste, als schlüge sie mit einem Hammer einen Nagel ein. »Meistens fühle ich mich dabei bloß wund. Aber meine Mama sagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Man braucht keinen Höhepunkt, um schwanger zu werden.«
Sie trank einen Schluck aus der Flasche.
»Wieso?«, fragte sie dann. »Du?«
»Ich glaube schon«, sagte ich. Ich hätte den Mund halten sollen, aber die Zuversicht gab mir Mut. Meine Monatsblutung war einen Tag überfällig, und ich wusste, dass es mit Sam und mir endlich geklappt hatte.
»Und wisst ihr was?«, sagte ich. »Ich glaube, ein Mann kann dich mit den Fingern zum Höhepunkt bringen.«
Ulla sah mich ungläubig an.
»Mit den Fingern«, wiederholte sie.
»Genau«, sagte ich. »Er berührt dich zwischen den Beinen, über der Öffnung. Es ist genau so, wie Mrs Knutson sagt … schwierig zu beschreiben, aber sehr intensiv. Fast wie Ohnmächtigwerden.«
»Dein Mann hat das geschafft?«, fragte Ulla. »Nur durch Anfassen?«
»Ja«, sagte ich in möglichst überzeugendem Tonfall.
Ulla schüttelte den Kopf.
»Das ist unmöglich«, sagte sie. »Jeder weiß, dass eine Frau nur innerlich zum Höhepunkt kommen kann. Das hat Mrs Knutson so geschrieben.«
»Tja«, sagte ich, und Stolz schwang in meiner Stimme mit, »vielleicht kennt mein Mann sich besser aus als Mrs Knutson.«
Ulla sah skeptisch aus.
»Wo hat er das denn gelernt?«, fragte sie.
Langsam wurde mir klar, dass ich einen Fehler begangen hatte.
»Was meinst du damit?«, fragte ich, um Zeit zu gewinnen.
»Ich meine damit, dass Mr Vogel die Jungs wohl kaum über diese Art von Höhepunkt aufgeklärt hat, denn andernfalls hätten wir davon gehört. Und in Fruchtbare Ehe ist nirgends davon die Rede. Also, woher hat er das?«
»Aus einem anderen Buch«, sagte ich, »das nur die Jungs kennen.«
»Wirklich?«, fragte Ulla. »Wie heißt es?«
»Fruchtbare Ehe für Männer«, sagte ich und verfluchte mich im gleichen Moment selbst. »Es ist ziemlich selten. Ein Cousin meines Mannes hat uns neulich besucht und seine Ausgabe mitgebracht.«
Ulla trank noch einen Schluck, ohne mich aus den Augen zu lassen.
»Tja«, sagte sie, »dann muss ich es unbedingt auftreiben. Ned könnte es gebrauchen.«
Ich werde nie erfahren, wer eins und eins zusammengezählt hat, ob es Ulla war, Susie oder beide. Sie konnten sich denken, dass ich die Erfahrung höchstwahrscheinlich mit einem Fremden gemacht hatte und nicht mit einem der Jungen aus unserer Stadt, denn die waren so jung und unerfahren wie wir und mit denselben Ammenmärchen aufgewachsen. Ich weiß nur, dass ich eines Abends von den Hausbesuchen nach Hause kam und mein Ehemann verschwunden war. Seine Mutter und sein Vater saßen am Küchentisch.
»Weißt du«, sagte meine Schwiegermutter, »ich habe dich immer verteidigt.«
»Was geht hier vor?«, fragte ich.
Mamas alter Koffer, in dem ich meine Kleidung und meine medizinischen Bücher mitgebracht hatte, stand neben dem Herd.
»Henry hielt dich für eine schlechte Partie. Er hat gesagt, deine Mutter wäre unzuverlässig. Er sagte, ohne die Hilfe eurer Nachbarn wäre deine kleine Schwester damals gestorben.«
Mein Schwiegervater wirkte leicht betreten. Er hatte noch nie mehr als drei Worte mit mir gewechselt. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass er all das zu seiner Frau gesagt haben sollte.
»Das ist nicht wahr. Ich habe mich um Bee gekümmert, als Mama krank war. Sie war nie in Gefahr.«
»Das habe ich auch gesagt«, fuhr meine Schwiegermutter fort. »Und ich habe ihm erzählt, dass deine Mama bis heute alle Kinder im Umkreis von zehn Meilen entbindet. Das spricht doch für sich, habe ich gesagt.«
Sie hielt inne, ganz so, als erwartete sie ein Dankeschön. Ich schwieg.
»Hörst du mir zu?«, fragte sie. »Ich versuche, dir zu erklären, warum es mich so schmerzt zu erfahren, dass du uns hintergangen hast. Zu hören, dass du dich mit einem anderen getroffen hast, obwohl mein Sohn dich so sehr liebt. Er hätte sogar ein weiteres Jahr gewartet!«
Ich stellte mir die Gespräche vor, die sie über meine Unfruchtbarkeit geführt haben mussten, und wie sie ihm eingeredet hatte, er solle sich für meine fruchtbaren Tage aufsparen. Ich war überzeugt, dass weder er noch sie ein weiteres Jahr gewartet hätten.
»Ich wollte nicht mit ihm schlafen«, sagte ich. »Ich wollte dir nur ein Enkelkind schenken.«
Meine Schwiegermutter verdrehte die Augen.
»Und, hat es funktioniert? Bist du schwanger?«
Ich schüttelte den Kopf. Als ich an diesem Morgen eine Babywundsalbe aus Eibisch und Bienenwachs angerührt hatte, hatte meine Monatsblutung eingesetzt.
»Natürlich nicht«, sagte sie.
War sie enttäuscht? Was wäre passiert, hätte ich Ja gesagt? Hätten wir das Kind zusammen großgezogen, mein Mann und ich? Hätte ich es wieder getan? Manchmal sehne ich mich immer noch nach jenem anderen Leben, nach allem, was es bedeutet hätte.
Meine Schwiegermutter nickte ihrem Mann zu. Er nahm den Koffer und gab ihn mir.
»Deinen Ehering kannst du auf dem Tisch liegen lassen«, sagte sie.
Später an dem Tag aß ich mit meiner Mutter und meinen Schwestern zu Abend, als wäre nichts geschehen. Janie und Jessamine waren froh, mich zu sehen. Aufgeregt erzählten sie, was in der siebten Klasse passiert war: Arthur Howe hatte gesagt, sein Vater sei in die Berge geritten, um sich der Hole-in-the-Wall-Gang anzuschließen, obwohl doch jeder wusste, dass er nur zwei Städte weiter mit einer anderen Frau zusammenlebte; Agnes Fetterly bekam schon ihre Tage, und trotzdem warb niemand um sie, denn sie war ein Einzelkind; Lila Phelps hatte versucht, ihre mittels Hühnerblut vorzutäuschen, damit ihre Mutter Nils Johansson endlich erlaubte, ihr den Hof zu machen, aber dann hatte ihre Mutter sie dabei erwischt, wie sie das Blut aufs Bettlaken kippte, und nun musste sie einen Monat lang die ganze Wäsche allein waschen. Mich zu erinnern, wie ich in diesem Alter gewesen war, tat fast körperlich weh. Vor nicht allzu langer Zeit war ich selbst ein halbes Kind gewesen, mein Körper noch unverändert und mein Kopf voller Flausen und Streiche. Die Finsternis der Erwachsenenwelt hatte gerade erst angefangen, zu mir durchzudringen.
Während meine Schwestern erzählten, warf Bee mir verstohlene Blicke zu. Ganz offensichtlich spürte sie, dass etwas nicht stimmte. Dieses Jahr würde sie acht werden. Meine Mutter sagte immer, Bee und ich seien wie zwei Seiten derselben Medaille. Ich war in ihrem Alter gesprächig gewesen und hatte immerzu Fragen gestellt, aber Bee war still – was sie wissen wollte, erfuhr sie, indem sie beobachtete und zuhörte.
Als Jessamine und ich gerade das Geschirr abspülten, kam Sheriff Branch zu Besuch. Er war mit unserer Mutter befreundet und kam oft vorbei, um ein wenig zu plaudern und meinen Schwestern Malzbonbons oder Babytränen mitzubringen. Er erzählte gern, meistens Lügen geschichten über seinen Kampf gegen Jesse James oder The Kid, den mysteriösen Anführer der Hole-in-the-Wall-Gang. The Kid war über zwei Meter groß, behauptete der Sheriff, und so stark wie drei Männer. Sein Blick war so scharf, dass er jemanden aus einer Meile Entfernung erschießen konnte, und sein Herz so kalt, dass er Witwen den Ehering und Babys den Schnuller aus dem Mund stahl. Einmal hatte der Sheriff es persönlich mit The Kid zu tun bekommen, doch aufgrund eines Missgeschicks – ein Hufeisen hatte sich gelöst – konnte er den Gesetzlosen leider nicht verhaften. Er versicherte uns, bei der nächsten Begegnung würde er dafür sorgen, dass The Kid die Gesetze Dakotas nie wieder mit Füßen trat.
Susies Vater und die anderen Männer der Stadt erzählten ihren Kindern oft von Gesetzlosen wie diesen, um ihnen Angst zu machen. Doch Sheriff Branch hatte nie die Absicht, uns zu erschrecken. Er versprach jedes Mal, dass uns, solange er in Fairchild die Verantwortung trug, kein Bandit und auch sonst niemand ein Haar krümmen würde.
»Solange ihr brav auf eure Mutter hört«, fügte er mit einem Zwinkern hinzu. »Aber wenn ich höre, dass ihr ihr Ärger macht, schleppe ich euch eigenhändig vor Gericht!«
Eigentlich mochte ich Sheriff Branch und seine Besuche. Er ritt eine ruhige Stute namens Maudie, und wenn er vorbeikam, durften wir ihre Mähne bürsten und sie mit Möhren aus dem Garten und Zuckerwürfeln füttern. Aber an dem Abend musste ich an Lucy McGarry denken und bekam plötzlich Angst. Dass ich damit richtiglag, wusste ich, als der Sheriff Kaffee und Gewürzkuchen ablehnte.
»Ich bleibe nicht lang«, sagte er. »Vielleicht können wir drei Erwachsenen uns ungestört unterhalten?«
Meine Mutter bat Janie und Jessamine, Bee nach oben zu bringen, und da erst ließ Sheriff Branch sich am Tisch nieder. Er nahm den weißen Hut ab, den er nur im Dienst trug, starrte auf die Krempe und wischte etwas nicht vorhandenen Staub davon ab. Trotz seines Amtes war Sheriff Branch ein schüchterner Mensch.
»Ich habe gehört, es gab Probleme in deiner Ehe«, sagte er schließlich.
Meine Mutter wartete meine Antwort nicht ab.
»Es ist Claudines Schuld«, sagte sie. »Sie hat Ada nie leiden können und ihr das Leben in dem Haus zur Hölle gemacht. Unruhe ist nicht hilfreich für die Empfängnis, das wissen Sie doch.«
Sheriff Branch hatte nur ein Kind, eine Tochter. Er hätte gar kein Kind gehabt, und vielleicht auch keine Frau mehr, wäre meine Mutter nicht gewesen. Der Sheriff hatte seinen Freund Dr. Carlisle gebeten, die Geburt zu überwachen, aber Dr. Carlisle hatte wenig Erfahrung, und als Liza Branchs Wehen stockten und der Kopf des Kindes im Geburtskanal stecken blieb, brach er in Panik aus, lief im Zimmer auf und ab und führte Selbstgespräche, während Liza vor Schmerzen schrie. Schließlich ließ er meine Mutter holen, der es gelang, den Kopf des Kindes so zu drehen, dass Liza es herauspressen konnte. Sophia kam blau und fast ohne Atmung zur Welt, doch meine Mutter konnte sie wiederbeleben. Eine weitere halbe Stunde im Geburtskanal, und dem Kind wäre nicht mehr zu helfen gewesen.
Nach dieser Entbindung konnte Liza keine Kinder mehr bekommen. Meine Mutter hatte sie viele Male besucht, sie massiert und ihr Stärkungsmittel gegeben, aber nichts davon hatte geholfen. Irgendwann musste sie den Branches sagen, dass ihnen weitere Kinder vielleicht einfach nicht bestimmt waren. Sheriff Branch zog sich von seiner Frau zurück, doch seine Tochter überschüttete er mit einer Liebe, die für fünf gereicht hätte.
»Claudine kann sehr anstrengend sein«, sagte er nun. »Aber die Leute beschweren sich bei mir. Greta Thorsdottir behauptet, sie hätte Ada nachts mit einem toten Hasen in der Hand über die Felder laufen sehen. Agatha Dupuy erzählt, sie und ihre Töchter hätten letzten Monat allesamt schlimme Frauenleiden gehabt.«
Meine Mutter schüttelte den Kopf, aber sie wirkte vollkommen gefasst.
»Nun«, sagte sie, »Sie kennen Ada, seit sie ein Kind war. Wie können Sie die Unterstellungen dieser Frauen ernst nehmen? Sie wissen doch, dass Aggie und ihre Töchter ständig irgendwelche Leiden haben, und meistens sind sie eingebildet.«
Der Sheriff nickte und runzelte die Stirn. Wieder und wieder drehte er den Ehering an seinem Finger.
»Das ist wahr«, sagte er. »Ada, du warst immer ein braves Mädchen. Solange du bei deiner Mama bleibst und dich von Ärger fernhältst, werde ich mich nicht einmischen.«
Er wandte sich wieder an meine Mutter.
»Selbstverständlich kann sie Sie nicht mehr zu den Geburten begleiten«, sagte er. »Sie wird sich eine andere Beschäftigung suchen müssen.«
Bee kam die Treppe herunter, gerade als unsere Mutter den Sheriff verabschiedete.
»Das ist lächerlich«, sagte sie, »aber bitte sehr. Sie kann mir hier zu Hause mit den Kräutern und Tinkturen helfen.«
Der Sheriff erhob sich und griff nach seinem Hut.
»Tut mir leid«, sagte er. »Ich wollte Ihnen diesen Besuch gar nicht abstatten.«
»Warum haben Sie es dann getan?«, fragte meine Mutter. Sie klang ruhig, doch ich merkte, wie wütend sie war.
»Evelyn, Sie wissen doch, was meiner Meinung nach das Wichtigste an meinem Job ist.«
»Die Kinder zu beschützen«, sagte meine Mutter. »Und meine Tochter hat niemandem etwas getan. Sie ist doch fast selbst noch ein Kind.«
Der Sheriff nickte. »Und hoffentlich wird sie niemandem Leid zufügen. Doch falls auch nur die Möglichkeit besteht, dass sie einem Baby schadet oder verhindert, dass eines zur Welt kommt … das könnte ich mir nie verzeihen.«
Seine Stimme brach.
»Das verstehen Sie doch, Evelyn, oder? Gerade Sie?«
»Wir werden tun, was Sie verlangen«, sagte meine Mutter, stand auf und ging zur Tür. »Mehr kann ich nicht versprechen.«
Wochenlang lebte ich unter einer Art Hausarrest. Morgens stand ich auf und machte meinen Schwestern das Frühstück, und dann setzte ich mich in mein Zimmer und las, während meine Mutter ihre Runden drehte. Nachmittags backte ich manchmal Muffins aus Maismehl, damit das Haus bei ihrer Heimkehr gut roch. Kein schlechtes Leben, vor allem nicht nach der Zeit bei meinen Schwiegereltern, und vielleicht wäre es noch lange so weitergegangen, wenn nicht Anfang März in der ganzen Stadt die Röteln ausgebrochen wären. In nur einer Woche verloren gleich drei Schwangere ihr Kind: Lisbeth, eine Nichte des Bürgermeisters, Mrs Covell, die an der Schule die unteren Klassen unterrichtete, und Rebecca, Albert Camps neue Frau, die in der Bank arbeitete und im Jahr zuvor Witwe geworden war.
Die Schule wurde geschlossen, meine Schwestern blieben daheim. Janie und Jessamine flochten sich gegenseitig Zöpfe und erzählten immer verrücktere Geschichten davon, was sie alles unternehmen würden, sobald sie wieder nach draußen durften. Bee saß am Fenster und beobachtete die menschenleere Straße. Meine Mutter arbeitete weiter, doch wenn sie abends nach Hause kam, wirkte sie unruhig, lief rastlos durch die Zimmer und erledigte dies und das, ganz so, als müsse sie sich ablenken.
»Der Gemischtwarenladen ist geschlossen«, sagte sie, »Und die Bank auch. Die Kirche ist leer. Pater Simon geht einmal am Tag hin, um Kerzen für die Kinder anzuzünden. Selbst der Saloon ist wie ausgestorben.«
Sie sprach es nicht aus, doch ich wusste, was sie befürchtete: Zu viele Babys waren gestorben, bald schon würden die Leute anfangen, nach der Hexe zu suchen. Ich war nicht die einzige unfruchtbare Frau in der Gegend. Maisie Carter lebte noch und war noch jung. Wäre sie fruchtbar gewesen, hätte sie noch immer Kinder bekommen können. Doch kaum einer bekam sie zu Gesicht, denn sie war nur selten in der Stadt und blieb meist für sich. Ich hingegen war aus dem Haus meines Mannes verstoßen worden, ich hatte für einen Skandal gesorgt, und meine Unfruchtbarkeit war allgemeines Gesprächsthema.
Nach einer Woche beruhigte sich die Lage. Es gab keine weiteren Todesfälle, denn die für ungeborene Kinder so tödlichen Röteln konnten denjenigen, die bereits auf der Welt waren, nichts anhaben. Der Saloon bediente seine Gäste, die Gemeindemitglieder kehrten in die Kirche zurück, Gemischtwarenladen und Bank wurden wieder geöffnet. Aber dann kam meine Mutter aschfahl nach Hause: Ulla hatte ihr Kind verloren.
»Ich wusste nicht einmal, dass sie schwanger war«, sagte ich.
Meine Mutter ignorierte mich. »Sie haben mich wieder weggeschickt«, sagte sie kopfschüttelnd. »Dr. Carlisle war bei ihr. Wenn sie verblutet, geschieht es ihrer dummen Mutter nur recht.«
»Warum haben sie dich weggeschickt?«, fragte ich.
Ich sah die Sorge und die Trauer in ihren Augen und wusste die Antwort, bevor ich sie hörte.
»Ulla behauptet, du hättest sie verflucht. Sie sagt, sie hätte das Kind deinetwegen verloren.«
»Ich habe Ulla seit Monaten nicht gesehen.«
»Das spielt keine Rolle«, sagte meine Mutter. »Ihre Familie wird dafür sorgen, dass du wegen Hexerei angeklagt wirst. Und wenn die anderen auf ihrer Seite sind, wird der Sheriff dich nicht mehr beschützen können.«
Ich wusste: Jeder Widerspruch war zwecklos. Ich hatte es längst begriffen – meine Zeit war gekommen, und das Wenige, was mir noch blieb, würde mir bald entrissen werden. Ich widersprach trotzdem.
»Du hast von Röteln gesprochen. Du hast immer gewusst, wie gefährlich Röteln für Schwangere sind, und du hast es allen erzählt. Warum sollten sie glauben, da wäre Hexerei im Spiel?«
»Sie fragen sich, was die Röteln ausgelöst hat«, sagte meine Mutter. »Alles wäre einfacher, wenn es nur eine Frau getroffen hätte oder zwei. Ein paar Tage lang dachte ich, wir hätten vielleicht Glück. Aber nun dieser weitere Verlust, kurz nachdem die Leute sich beruhigt hatten … Sicher wollen sie, dass jemand dafür bezahlt, Ada. Und du wirst diejenige sein.«
Wir saßen auf dem Bett, das Bees Vater gekauft hatte, kurz bevor er meine Mutter verließ. Da war sie schon seit fünf Monaten krank. Es war doppelt so groß wie das alte und hatte ein schweres Kopfteil aus Vermonter Ahorn. Bee, Janie und Jessamine liebten es, sich in diesem Bett an meine Mutter zu kuscheln. Mich hingegen erinnerte es an die Zeit der Krankheit, als ich nachts bei ihr saß, sobald Bee schlief, und mich fürchtete, allein mit ihr im Dunkeln zu sein, weil sie mir so fremd geworden war. Nicht weniger hatte ich gefürchtet, sie könnte, sobald ich die Augen schloss, einfach aufgeben und aufhören zu atmen, so wie sie aufgehört hatte, sich anzuziehen, zu kochen oder überhaupt einmal das Bett zu verlassen. Jede Nacht döste ich im Sessel neben dem Bett meiner Mutter, ein ganzes Jahr lang, und jeden Morgen wachte ich auf und fand sie unverändert vor – bis zu dem Tag, an dem ich aufwachte und sie genesen war.
»Und was soll ich jetzt tun?«
Sie strich mir eine Haarsträhne hinters Ohr.
»Ich kenne einen Ort«, sagte sie. »Er wird dir nicht gefallen, aber dort bist du in Sicherheit.«
Als ich Bee an dem Abend ins Bett brachte, erzählte ich ihr, ich müsse für eine Weile fort. Sie nickte nur und lauschte mit großen Augen.
»Du musst Mama unterstützen«, sagte ich. »In ein paar Jahren wirst du alles über ihren Beruf lernen.«
»Janie und Jessamine sind größer als ich«, sagte Bee.
»Jess fällt beim Anblick von Blut in Ohnmacht«, sagte ich, »und Janie kann sich ja nicht mal lange genug konzentrieren, um eine Socke zu stopfen. Wie sollte sie da eine Wunde vernähen? Das wird irgendwann deine Aufgabe sein.«
Bee nickte. Sie hatte dunkle Augenbrauen, wie ihr Vater, der halb Pole, halb Chippewa und sehr gutaussehend war – anders als meiner, von dem mir nicht mehr geblieben war als eine vage Erinnerung an sein längliches, blasses Raubvogelgesicht. Bees Vater hatte sich am Anfang wirklich um sie gekümmert, trotzdem war ich die Einzige gewesen, die sie trösten konnte. Er schickte immer noch alle paar Monate Geld, manchmal auch einen Brief. Das war mehr, als mein Vater je getan hatte.
»Keine Sorge«, sagte ich. »Du wirst das sehr gut machen. Es kommt hauptsächlich darauf an, den Leuten zuzuhören, und wie das geht, weißt du schon jetzt.«
Ich wollte ihr einen Vorsprung verschaffen, außerdem sollte sie sich, wenn ihre Ausbildung begann, an mich erinnern. Also brachte ich ihr das Lied bei, das meine Mutter mir beigebracht hatte und das die sieben wichtigsten medizinischen Kräuter und ihre Anwendung nennt. Ich zeigte ihr, wie man einen Puls misst, und ich erklärte ihr, was es bedeutet, wenn er zu stark ist oder zu schwach. Wir waren gerade bei den sechs Arten von Fieber bei Kindern, als ich bemerkte, dass ihr Blick umherschweifte und sie die Stirn runzelte.
»Was ist denn?«, fragte ich.
»Hast du keine Angst?«
»Angst wovor, Honeybee?«
Sie schlug die Augen nieder.
»Ich weiß, dass manche Leute sterben«, sagte sie. »Mama redet nicht darüber, aber ich weiß, dass Sally Temple gestorben ist.«
Sally Temple hatte mit ihrem Mann, dem Rattenfänger, am Stadtrand gewohnt. Sie war sehr jung gewesen – keine fünfzehn, wie manche sagten –, und ihr Kind war so schnell zur Welt gekommen, dass es sie innerlich zerriss. Meine Mutter konnte die Blutung stoppen, doch Sally hatte schon zu viel verloren und starb im Kindbett, während ihr neugeborener Sohn im Nebenzimmer lag und brüllte. Ich war dabei gewesen und hatte wochenlang von ihrem kleinen, spitzen Gesicht geträumt, aus dem die Farbe wich, von der Verwirrung und der Wut und zuletzt der Panik in ihrem Blick. Später hatte meine Mutter mir erklärt, warum sie, obwohl so etwas jederzeit passieren kann, trotzdem immer weitermachte.
»Mama sagt, bei jeder Geburt ist der Tod mit im Zimmer. Man kann versuchen, ihn zu ignorieren, oder man akzeptiert seine Anwesenheit und begrüßt ihn wie einen Gast, dann muss man keine Angst mehr vor ihm haben.«
Bee wirkte skeptisch.
»Wie begrüßt man ihn? ›Hallo, Tod‹?«
»Mama denkt an die letzte Patientin, die sie verloren hat«, sagte ich. »An den Tod, der im Gedächtnis am frischesten ist. Sie stellt sich vor, die Frau stünde neben ihr am Bett. Sie mustert die Frau von Kopf bis Fuß. Die Frau sagt nichts, aber manchmal nickt sie Mama zu. Und dann ist sie bereit.«
»Das funktioniert?«, fragte Bee.
Manchmal hatte ich gesehen, wie groß die Angst meiner Mutter war, beispielsweise wenn das Kind zu früh oder verkehrt herum herauskam, oder wenn die Schwangere zuckerkrank war oder hohen Blutdruck hatte. Ihre Miene blieb immer zuversichtlich, aber trotzdem konnte jeder im Raum spüren, dass etwas nicht stimmte, und manchmal begann die Hand der Tante, die der Gebärenden den Schweiß von der Stirn tupfte, zu zittern. In solchen Momenten richtete meine Mutter den Blick ins Leere und nickte, und dann konzentrierten sich alle Energien auf sie, und die Geburt verlief bestmöglich, denn sie hatte alles unter Kontrolle.
»Ja, es funktioniert«, sagte ich.
Ich beugte mich vor und nahm Bee in die Arme, eher mir als ihr zuliebe. Sie roch nach Seife und Zedernholz, wie damals, als sie noch ein Baby war.
»Wenn ich groß bin«, sagte sie in den Stoff an meiner Schulter, »werde ich losreiten und dich finden.«
Ich richtete mich auf und sah ihr ins Gesicht.
»Bee«, sagte ich, »ich komme zurück, bevor du groß bist.«
»Okay«, sagte sie und glaubte mir kein Wort. »Aber falls nicht, besorge ich mir ein Pferd und eine Landkarte und komme dir zur Hilfe, egal, wo du bist.«
KAPITEL 2
Die Oberin der Schwesternschaft vom Heiligen Kinde sagte, ich könne im Kloster eine Zuflucht finden, solange ich das Jesuskind im Herzen trage. Jesus hatte mir nicht geholfen, schwanger zu werden, wobei das wohl auch für die vier Gläser Milch am Tag, die hochgelegten Beine und die Treffen mit Sam galt. Ich hatte nichts gegen das Jesuskind.
»Ich trage Es im Herzen«, sagte ich.
Die Oberin zog eine Augenbraue hoch.
»Du bekommst Bibelunterricht bei Schwester Dolores«, sagte sie. »Falls sie in sechs Monaten glaubt, dass du bereit bist, wirst du das Gelübde ablegen. Dann bist du eine von uns.«
Schwester Rose stellte mir Goldie, Holly und Izzy vor. Schwester Rose war ein dünnes Mädchen, das beim Lächeln viel Zahnfleisch zeigte. Wir teilten uns eine Zelle – zwei schmale Betten, zwei Nachttöpfe, eine Waschschüssel und eine Krippe.
Rose kannte sich mit Tieren aus. Die drei Kühe wurden bei ihrem Anblick sichtlich ruhiger, und wenn Rose ihnen gurrend über den Rücken strich, wirkte sie beinahe anmutig. Holly, ein Holstein-Rind, war die Einzige, die mich näher an sich heranließ. Die anderen beiden zuckten mit dem Schwanz, traten aus und wichen ruckartig vor meinen Händen zurück, doch Holly hielt still und beobachtete mich aus halb geschlossenen Augen, fast so, als täte ich ihr leid. Schwester Rose zeigte mir, wie man so zudrückt, dass das Tier keinen Schmerz spürt und die Milch in einem sauberen Strahl in den Eimer schießt.
Das tägliche Melken war eine gute Gelegenheit zum Weinen, denn im Kloster war ich fast nie allein. Egal ob bei der Morgenandacht oder beim Frühstück, beim Bibelstudium, bei der Vesper oder beim Abendbrot – immer war ich von Nonnen umgeben. Beim Melken übernahm Schwester Rose Goldie und Izzy, während der Wind über die Weiden heulte, an den Scheunenfenstern rüttelte und mein Schluchzen übertönte.
Ich weinte aus purer Trauer. Voll Kummer erinnerte ich mich an Bees weiche Babyhaut und an die Stimmen von Janie und Jessamine, die morgens durchs Haus schallten. Ich weinte auch vor Wut. Nie im Leben hatte ich etwas so Böses getan wie das, was Ulla mir angetan hatte. Ich wusste, sie hatte nur versucht, sich selbst zu retten – ihre Schwiegermutter war noch schlimmer als Claudine, und ihr Mann noch schwächer als meiner, außerdem hatte sie von Anfang an als riskante Partie gegolten, weil sie nur eine Schwester hatte, die zudem einen Klumpfuß hatte und an Atemnot litt. Für manche Familien reichte eine einzige Fehlgeburt aus, um die junge Braut zu verstoßen, selbst wenn eine Krankheit die Ursache war. Trotzdem konnte ich Ulla nicht verzeihen. Sie war schon meine beste Freundin gewesen, als wir noch jünger waren als Bee heute. Sie hatte in meinem Bett geschlafen, wenn ihr die Wutanfälle ihrer Mutter zu viel wurden, und ich hatte ihr übers Haar gestreichelt und sie getröstet.
Wenn die Trauer und die Wut meinen Körper verlassen hatten und ich vom Weinen schon ganz heiser war, folgte die Angst, wie der Blitz auf den Donner folgt. Ich wusste, meine Mutter hatte recht. Die Familien, die ein Kind verloren hatten, würden jemanden dafür verantwortlich machen, und nun fürchtete ich, ihr Kummer könnte sich gegen meine Schwestern richten. Ich hatte es schon einmal erlebt – als Lucy McGarrys Nachbarin eine Fehlgeburt erlitt, wurde Lucys ganze Familie verdächtigt, selbst ihre kleine Schwester, die gerade einmal fünf Jahre alt war. Manche Leute behaupteten, Lucy leite im Haus ihrer Mutter einen Hexenzirkel. Sobald man sie gehängt hatte, lösten sich die Gerüchte in Luft auf, und die Familie widmete sich wieder ihrem Alltag. Später heiratete die kleine Schwester sogar den Neffen des Bürgermeisters.
Ich wusste, meine Mutter hatte all das bedacht. Sie glaubte, dass sie und meine Schwestern nach meiner Abreise in Sicherheit wären. Wahrscheinlich glaubte sie, dass ihr guter Ruf ihr helfen würde, alles Kommende zu überstehen. Die Leute würden eine Weile tuscheln, aber irgendwann würden sie merken, dass Dr. Carlisle von Geburtshilfe keine Ahnung hatte, und zu ihr zurückkehren. Doch was, wenn der Bürgermeister eine neue Hebamme bestellte? Ich wusste nicht, was aus der Vorgängerin meiner Mutter geworden war, doch Fairchild hatte sich schon einmal eine neue Hebamme gesucht und würde es wieder tun, sobald die Angst um die ungeborenen Kinder die Leistungen meiner Mutter überstieg.
Und immer endete die Liste meiner Ängste mit einem beunruhigenden Gedanken: dass meine Mutter wahrscheinlich dieselbe Liste im Kopf gehabt hatte. Sie wusste, wie gefährlich es war, mich wegzuschicken, statt mich dem Sheriff zu übergeben. Sie hatte ihre Sicherheit und die meiner Schwestern gegen mein Leben abgewogen und war zu dem Schluss gekommen, dass ich das Risiko wert war.