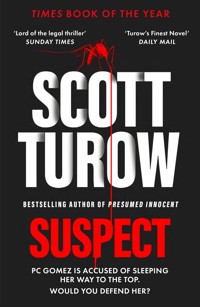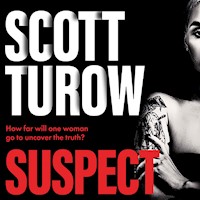8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Auf Anhieb Platz 1 der amerikanischen Bestsellerliste! Wurde mit Dustin Hoffman in der Hauptrolle verfilmt!
Der Anwalt Robbie Feaver ist auf Schadenersatzklagen spezialisiert. Er hat eine florierende Kanzlei in Kindle County, eine fatale Schwäche für das andere Geschlecht und ein geheimes Bankkonto, von dem regelmäßig gewisse Beträge in die Taschen bestechlicher Richter fließen. Als ihm der Generalstaatsanwalt Stan Sennett auf die Schliche kommt, verspricht er, Milde walten zu lassen - vorausgesetzt, Robbie liefert ihm die Missetäter ans Messer ...
Feaver geht auf Sennetts Angebot ein. Zusammen mit dem Anwalt einer der geschädigten Versicherungsgesellschaften konstruiert er Scheinfälle und lässt sich für die Bestechungsverhandlungen "verdrahten", das heißt mit Mikrofon und Minikamera ausrüsten; auch vier korrupte Richter sind schnell gefunden. Doch das FBI wird erst zufrieden sein, wenn er ihm den größten - und korruptesten - Fisch an die Angel liefert: Brendan Touhey, den Präsidenten des Zivilgerichts.
Für Robbie, den Lebenskünstler und geborenen Schauspieler, der nichts so sehr liebt, wie seine Umgebung hinters Licht zu führen, wird es eng, als die bedrohten Richter zum Gegenschlag ausholen. Selbst Evon Miller, die FBI-Agentin, die zu seiner Überwachung in die Kanzlei eingeschleust wird, kann ihn nicht mehr schützen ...
Ein finsteres Drama um Gier und Gerechtigkeit, in dem die Moral schließlich auf der Strecke bleibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 780
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
FÜR GAIL HOCHMAN
Willkommen, du freundlicher Blender! Du Größter aller Diebe; der unschwer eindringt in unser Leben und, unbemerkt, uns unserer selbst beraubt.
John Dryden, All For Love
Der Anfang
1
Er wusste, es war nicht in Ordnung gewesen, und sie würden ihn schnappen. Er habe es gewusst, sagte er. Eines Tages würde es so weit sein.
Er wusste, sie hatten eine Dummheit gemacht – schlimmer noch, die Gier hatte sie getrieben. Er wusste, er hätte damit aufhören sollen. Aber jedes Mal, wenn er glaubte, jetzt sei der richtige Zeitpunkt, hatte er sich gefragt, wie viel schlimmer es denn werden würde, wenn er es noch ein letztes Mal versuchte. Doch jetzt wusste er, er steckte in der Klemme.
Ich kannte die Tour. In gut zweiundzwanzig Berufsjahren hatte ich eines gelernt: Die Leute da drüben in dem Leder-Clubsessel vor meinem Schreibtisch kamen allesamt immer nur auf die üblichen Standardfloskeln. Ich-war-es-nicht. Der-andere-ist-es-gewesen. Wieso-kommen-die-ausgerechnet-auf-mich. Dieser hier hatte sich für die einfachste Formel entschieden. Tut-mir-Leid. Doch von mir wollten sie dann immer nur das eine Lied hören – Kann-sein-ich-hole-Sie-da-wieder-raus. Das sage ich immer, obwohl ich weiß, dass es nachher oft ganz anders kommt. Aber es ist eben nicht leicht, wenn man für jemanden die letzte Hoffnung ist.
Dies ist eine Anwalts-Geschichte. Eine von der Sorte, wie man sie unter Anwälten gerne erzählt. Er hieß Robert Feaver. Gerufen wurde er nur Robbie, wenn er dafür auch allmählich ein bisschen zu alt war. Dreiundvierzig, hatte er auf meine Frage geantwortet. Es war die zweite Woche im September 1992. Die Polit-Gurus waren sich nicht mehr so sicher, ob Ross Perot wirklich der nächste Präsident der Vereinigten Staaten werden würde, und in den PCs kannten sich die Kürzel »dot« und »com« erst seit kurzem. Ich kann mich deswegen so genau an diese Zeit erinnern, weil ich eine Woche zuvor nach Virginia zurückgekehrt war, um meinen Vater zu Grabe zu tragen. Jahrelang hatte ich geglaubt, ich würde mich mit seinem Tod abfinden können, weil es nun einmal der natürliche Lauf der Dinge war, doch nun hatte mich dieses Ereignis in einen permanenten Trancezustand versetzt. Es ging so weit, dass ich sogar, wenn ich an meine Hand dachte, das Gefühl hatte, sie führe ein von meinem übrigen Körper getrenntes Eigenleben.
Robbie Feaver hatte andere und dringendere Probleme. Am Abend zuvor hatte er zu Hause Besuch von drei Sonderermittlern des Internal Revenue Service bekommen. Anders gesagt, die Steuerfahndung saß ihm im Nacken. Einer hatte das Wort geführt, die beiden anderen hatten zugehört. Wie nicht anders zu erwarten, war es ein Auftritt im Knautschlook gewesen: billige Trenchcoats, verkniffene Gesichter. Aber höflich waren sie gewesen. Sie hatten ihm eine Vorladung vor die Grand Jury präsentiert. Die Jury sollte darüber befinden, ob öffentlich Anklage gegen ihn zu erheben war. Dazu müssten alle Finanzbewegungen seiner Kanzlei offen gelegt werden, hatten sie ihm erklärt. Außerdem wollten sie von Robbie Genaueres über seine bisherigen Einkommensteuererklärungen wissen. Klugerweise hatte er die Auskunft verweigert.
Er könne auch Selbstanzeige erstatten, hatte der Ermittler, der das Wort führte, erwidert. Aber ein paar Dinge hatten sie doch noch loswerden müssen. Gute Nachrichten und schlechte. Zuerst die schlechten.
Sie wussten Bescheid. Sie wussten, was er und sein Partner Morton Dinnerstein getrieben hatten. Sie wussten, dass die beiden jahrelang immer wieder einen Honorarscheck für einen gewonnenen Prozess oder einen Vergleich – gewöhnlich ging es um Schadenersatz bei Personenschäden – auf ein geheimes Girokonto bei der River National Bank eingezahlt hatten. Über diese Bank wickelte ihre Kanzlei sonst keinerlei Zahlungsverkehr ab. Sie wussten, dass Dinnerstein und Robbie von diesem Konto bei der River National Bank jedem seinen Anteil an ihren Einkünften zukommen ließen – zwei Drittel gingen an die Mandanten, ein Neuntel an die Referenzanwälte, einige kleinere Summen an Gutachter oder die Gerichtsstenografen. Nur das Finanzamt war leer ausgegangen. Aber jetzt wussten die Steuerfahnder, dass Feaver und sein Partner jahrelang mit Barschecks Geld von diesem Konto abgehoben und so den Kontostand nach unten gedrückt hatten. Und sie hatten nie einen Penny Steuern davon bezahlt.
Ihr seid mir schon kaltschnäuzige Burschen, hatte der Ermittler noch gemeint. Als Robbie ihn jetzt so zitierte, lachte er. Allerdings nur kurz.
Ich fragte Robbie nicht, wie er und sein Partner überhaupt auf die Idee hatten kommen können, dass eine derart simple Masche funktionieren würde. Diese dumm und schlecht gestrickten Methoden, mit denen die Leute sich selbst in die Klemme bringen, waren mir schon lange bekannt. Immerhin waren sie mit dem Schmu jahrelang durchgekommen. Ein Konto, das keine Zinsen abwarf, fiel den Finanzbehörden kaum auf. Offen gesagt fiel eher auf, dass die Sache überhaupt entdeckt worden war. Dazu hatte entweder ein verrückter Zufall geführt, oder jemand hatte die beiden angeschwärzt.
Feaver hatte die Ermittler in sein Wohnzimmer gebeten und ihnen gegenüber auf einem Sofa Platz genommen, einem Zweisitzer mit ausgefallenem Bezug aus gebleichter Rohseide. Er hatte sich bemüht, Haltung zu bewahren. Zu lächeln. Sich keine Blöße zu geben. Aber als er den Mund aufmachte und etwas sagen wollte, spürte er doch überrascht den Schweiß, der ihm als schmales Rinnsal von den Rippen bis unter das Gummiband seiner Boxershorts lief.
Und die gute Nachricht?, hatte er dann wissen wollen.
Zu der kämen sie jetzt, sagte der Ermittler. Die gute Nachricht: Robbie habe eine Chance, aus der Sache herauszukommen. Vielleicht gebe es da etwas, das er für sich nutzen könne. Ein Mann in seiner familiären Situation sollte sich das schon mal durch den Kopf gehen lassen.
Dann verließ der Ermittler das Zimmer, ging durch den Marmorflur zur Haustür und öffnete sie. Draußen auf Robbies Eingangsstufen stand Bundesanwalt Stan Sennett. Feaver kannte ihn aus dem Fernsehen, kurzbeinig, schmächtig, mit geradezu zwanghaft ordentlichem Scheitel. Im Schein der Außenlampe schwirrten ein paar Mücken über Sennetts gepflegtem Haupt. Er begrüßte Feaver mit offizieller Miene, hart und humorlos wie die Klinge eines Kriegsbeils.
Robbie hatte keine Erfahrungen mit Strafverfahren und noch nicht einen Tag an der Strafkammer zugebracht. Doch er wusste, was es bedeutete, wenn ein Bundesanwalt spätabends höchstpersönlich vor seiner Tür stand. Ihm war, als starre er in die größte Kanone, die einer überhaupt auf ihn richten konnte. Das hier bedeutete, dass man an ihm ein Exempel statuieren wollte. Und es bedeutete, dass er da nie ohne Blessuren herauskommen konnte.
Robbie Feaver geriet in Panik. Nur ein vernünftiger Gedanke sei ihm noch gekommen.
Ich will einen Anwalt, sagte er.
Das sei sein gutes Recht, erwiderte Sennett, aber vielleicht solle sich Robbie doch erst einmal anhören, was er vorzubringen habe. Als Sennett seine polierte Stiefelspitze über die Schwelle gesetzt hatte, wiederholte Robbie seine Forderung.
Ich kann nicht versprechen, dass wir morgen noch einen Deal wie heute zu Stande bekommen, hatte Sennett gesagt.
Einen Anwalt, hatte Feaver wiederholt.
Da hätten sich die Ermittler wieder eingeschaltet und ihm den Rat gegeben: Wenn schon ein Anwalt, dann ein guter, der sich auskenne. Und mit dem Anwalt solle er reden – aber mit niemandem sonst. Nicht mit Mom. Nicht mit der Angetrauten. Und ganz bestimmt nicht mit seinem Partner Dinnerstein. Der Bundesanwalt habe dem Ermittler seine Karte gegeben, und der habe sie an Feaver weitergereicht. Sennett erwarte dann den Anruf des Anwalts. Kurz bevor er nach draußen in die Dunkelheit trat, habe er Robbie noch über die Schulter gefragt, ob er einen bestimmten im Auge habe.
Interessante Wahl, habe Sennett mit dünnem Lächeln bemerkt, als er meinen Namen hörte.
»Ich bin kein Spitzel«, sagte Robbie Feaver jetzt zu mir. »Aber so läuft das Spiel wohl, nicht wahr, George? Er will, dass ich irgendwen ans Messer liefere.«
Ich fragte ihn, ob er an jemanden Bestimmtes denke.
»Also, auf keinen Fall Mort. Meinen Partner verraten? Nie und nimmer. Über den kriegen die kein Wort aus mir heraus.«
Feaver und Dinnerstein seien schon ihr ganzes Leben lang Freunde, erzählte er mir. Als Nachbarskinder seien sie hier in DuSable zusammen aufgewachsen, in einer jüdischen Enklave, dem Warren Park. Anschließend seien sie Zimmergenossen im College und an der Law School gewesen. Und das geheime Konto lief auf beider Namen. Beide hatten Einzahlungen getätigt, beide hatten darauf Barschecks ausgestellt, aber die Einkünfte nie angegeben. Die sie belastenden Unterlagen reichten bei weitem aus, sodass die Steuerfahndung wohl kaum zusätzliche Hilfe brauchte, um beide in ihre Trophäensammlung aufnehmen zu können.
Ich fragte Robbie, ob die Regierung durch ihn vielleicht noch an andere Informationen über Mort oder sonst wen herankommen wolle. Doch Feaver zuckte nur schlapp mit einer Schulter und blickte ins Leere.
Ich kannte Robbie Feaver nicht besonders gut. Als er mich am Morgen angerufen hatte, waren mir gelegentliche Begegnungen in der Lobby des LeSueur Building eingefallen, wo wir beide unsere Kanzleien haben, und die Ausschusssitzungen der Anwaltsvereinigung des Kindle County während der Zeit meines Vorsitzes dort vor ein paar Jahren. Meine Erinnerungen an ihn waren nur vage und durchaus nicht immer angenehm. Gemessen an den noch verbliebenen Kriterien meiner wohl geordneten Südstaatler-Kindheit, war an diesem Typ einfach alles ein bisschen »zu viel des Guten«. Zu gut aussehend und sich dessen allzu bewusst. Ein zu dichter und zu sorgfältig fixierter schwarzer Haarschopf, dem man die aufwändige Pflege zu deutlich ansah. Zu jeder Jahreszeit tief gebräunt. Außerdem steckte er zu viel Geld in seine Kleidung – italienische Maßanzüge, todschicke Halstücher und dazu der viele Schmuck. Er redete stets etwas zu laut und sprach selbst Fremde im Aufzug allzu leutselig an. Eigentlich redete er bei jeder Gelegenheit zu viel – eben einer von der Sorte, die ihren Descartes auf ihre ganz persönliche Weise interpretieren: Ich rede, also bin ich. Doch jetzt erkannte ich eine offensichtliche Tugend an ihm: Er wusste das alles und würde es auch zugeben. Zwar wirkte er ein wenig eingeschüchtert, bewahrte sich aber dennoch eine gewisse Offenheit, zumindest im Hinblick auf seine eigene Person. Gemessen an den Mandanten, mit denen ich gewöhnlich zu tun hatte, lag er damit nach meinem ersten Eindruck über dem Durchschnitt.
Als ich wissen wollte, was der Ermittler denn mit dem Hinweis auf seine Familie gemeint haben mochte, sackte er ein wenig zusammen.
»Kranke Frau«, sagte er, »kranke Mutter.« Wie viele Anwälte, die sich auf Schadensersatz und Fälle von Körperverletzung spezialisiert haben, führte Feaver einen ständigen Krieg gegen das medizinische Establishment, und so war er zu einer Art wandelndem medizinischem Wörterbuch geworden. Seine Mutter lebe im Pflegeheim. »Apoplex«, erklärte er fachmännisch. Also Schlaganfall. Seiner Frau Lorraine gehe es noch schlimmer. Vor fast zwei Jahren habe man bei ihr ALS, Amyotrophische Lateralsklerose, diagnostiziert, auch Lou-Gehrigsche Krankheit genannt, und die führe mit Sicherheit in Form einer Bulbärparalyse zur totalen Lähmung und schließlich zum Tod.
»Sie hat vielleicht noch ein Jahr, bis es wirklich schlimm wird. Genau weiß das keiner.« Er zeigte eine stoische Ruhe, doch sein Blick blieb starr auf den Teppich gerichtet. »Ich meine, ich kann sie nicht verlassen. Allein aus praktischen Überlegungen heraus. Es gibt sonst niemanden, der sich um sie kümmern könnte.«
Das hatte der Ermittler gemeint. Entweder würde Feaver reden oder hinter Gittern sitzen, wenn seine Frau den Zustand völliger Hilflosigkeit erreichte oder schließlich starb. Diese Aussicht bedrückte uns beide.
Wir schwiegen, und ich griff nach der Karte, die Feaver vor mir auf den Schreibtisch gelegt hatte. Ohne sie hätte ich ja noch bezweifelt, dass Robbie den Mann vor seiner Haustür auch richtig erkannt hatte. Der Bundesanwalt, dem zweiundneunzig Staatsanwälte unterstanden und der sich um einige hundert Fälle kümmern musste, würde sich nicht so ohne weiteres höchstpersönlich eines schlichten Falls von Steuerhinterziehung annehmen, nicht einmal dann, wenn er einen erfolgreichen Schadenersatzanwalt betraf. Was immer Sennett letzte Nacht vor Robbies Haus getrieben hatte, es musste mehr als eine Lappalie gewesen sein.
»Was meinte Sennett damit«, fragte Feaver, »als er sagte, George Mason sei eine ›interessante Wahl‹? Kann er Sie nicht riechen, oder hält er Sie für einen kleinen Fisch?«
Das sei etwas komplizierter, gab ich zurück. Ich sei der Meinung, Stan würde mich unter bestimmten Umständen als engen Freund bezeichnen.
»Das ist doch nicht schlecht, oder?«, fragte Feaver.
Bei Stan Sennett war ich da nie so sicher.
Manchmal sind wir Freunde, sagte ich. Rivalen sind wir immer.
2
Wie bei hochrangigen Amtsträgern üblich, hatte das persönliche Büro des Bundesanwalts gewaltige Ausmaße. Der grobe Teppichboden war zwar hier und da schon etwas zerschlissen, und die Vorhänge aus grünlicher Rohseide an der Fensterfront nach Norden hingen sicher schon seit den Fünfzigerjahren dort. Aber die Räumlichkeiten waren so weitläufig, dass man sie fast in Hektar messen konnte. Es gab ein eigenes Bad mit Dusche und ein kleineres Arbeitszimmer, in das man sich zurückziehen konnte. Auf der einen Seite des Hauptraums stand ein wuchtiger Konferenztisch aus dem Regierungsfundus. Gegenüber am anderen Ende präsentierten sich in einer langen Reihe von Mahagoni-Vitrinen diverse gefährdete Tierarten. Inspektoren von der Naturschutzbehörde hatten sie bei illegal arbeitenden Präparatoren beschlagnahmt: einen Weißkopfseeadler zum Beispiel, eine gesprenkelte Schlange, daneben so etwas wie einen Krallenaffen. Hinter einem Schreibtisch von den Ausmaßen eines Sarkophags erhob sich Stan Sennett, ein Exemplar dieser kleinen, dunkelhaarigen, umtriebigen Männer, denen man ständig auf den Gerichtsfluren über den Weg läuft.
»Hey, Georgie«, begrüßte er mich. Seine außergewöhnlich freundliche Stimmung rührte wohl daher, dass er es kaum erwarten konnte, mit mir über Feaver zu reden.
»Ein schreckliches Zeug«, bemerkte ich zu seiner Sekretärin, als sie Kaffee anbot. Wir hielten uns ein paar Minuten bei persönlichen Dingen auf. Stan zeigte mir Fotos von seinem einzigen Kind, Asha, einem dreijährigen Mädchen mit dunklem Haar und wonnig anzuschauen. Nach vielen vergeblichen Bemühungen, der eigenen Fruchtbarkeit auf die Sprünge zu helfen, inklusive In-vitro-Fertilisation, hatten es Stan und Nora Flinn, seine zweite Frau, adoptiert. Ich berichtete von den gemächlichen Fortschritten meiner beiden Söhne beim Absolvieren der höheren Lehranstalten und prahlte ein bisschen mit meiner Frau Patrice. Sie war Architektin und gerade als Siegerin aus einem internationalen Wettbewerb um den Entwurf für ein Aufsehen erregendes Kunstmuseum in Bangkok hervorgegangen. Stan, der 1966 in Thailand stationiert gewesen war, erzählte mir ein paar muntere Geschichten über das Land.
In gelockerter Stimmung konnte Stan Sennett ein heiterer, äußerst geistreicher Mann sein, ein amüsanter Sammler von sonderbaren Anekdoten und ein kluger Beobachter der Machtspielchen und Drohgebärden der hiesigen Politiker. Ansonsten hatte man es bei ihm mit einer komplizierten Mixtur von Mensch zu tun – hier ein Tausend-Megahertz-Verstand, dort eine geballte Ladung Emotionalität, an der sich sein Gegenüber schon fast versengt hatte, bevor Stan noch die Lider senken konnte.
In unserem Jahrgang hatte er die Easton Law School als Bester abgeschlossen. Als Anwalt kann man sein Leben lang im Windschatten seines Law-School-Erfolgs segeln. Doch Stan hatte die Einkommensmöglichkeiten und politischen Spitzenpositionen, die Washington gewöhnlich für Juristen seines intellektuellen Kalibers bereithält, links liegen gelassen. Er war mit Leib und Seele Staatsanwalt. Nach seiner Arbeit für Richter Burger am Obersten Bundesgericht war er ins Büro der Staatsanwaltschaft von Kindle County zurückgekehrt. Wegen seiner unbestreitbaren Verdienste stieg er schließlich zum Stellvertreter von Raymond Horgan auf. In den frühen Achtzigern war er nach der Scheidung von seiner ersten Frau in den Dienst des Justizministeriums getreten. Zuerst ging er nach San Diego und wurde dann in die Hauptstadt nach D. C. gerufen, bevor ihn Präsident Bush zum Bundesanwalt ernannte. Hier in Kindle County verfügte er über beste Beziehungen zu den örtlichen Sicherheitskräften, und politische Ambitionen konnte ihm niemand nachsagen. Aller Voraussicht nach würde er seine vierjährige Amtszeit, die nächstes Jahr endete, hinter sich bringen, ohne bei den politischen Kabalen und Rivalitäten Schaden genommen zu haben, die nach dem Tod unseres legendären Bürgermeisters und County-Politikers Augustine Bolcarro ausgebrochen waren.
Wie die meisten Menschen hütete ich mich vor jenem Stan Sennett, der einem mehr als gefährlich werden konnte. Aber als Juristen saßen wir stets im selben Boot. Als Studenten hatten wir uns die Arbeit geteilt: Er machte mich mit den tieferen rechtlichen Dimensionen der Fälle vertraut, die wir studierten. Ich wiederum war, soweit ich weiß, der Erste, der ihm sagte, dass ein Gentleman den Schlips nicht in die Hose steckt. Bei der Ausübung unserer Berufe gingen wir dann entgegengesetzte Wege. Er wurde Staatsanwalt, während ich als State Defender, also als Landesanwalt im Dienst des County anfing. Zu jeder Zeit verband uns eine gegenseitige Bewunderung, die an Neid grenzte. Die »gute Kinderstube«, die ich zufällig genossen hatte, war in meinen Augen bloße Fassade und damit stets eher eine Art Last, für Sennett aber offenbar ein Ideal. Ich glaube, nach Stans Ansicht schlossen persönliche Aufrichtigkeit und Charme einander aus. Von Anfang an beeindruckten mich seine Fähigkeiten und insbesondere seine ausgeprägte Überzeugung, dass er einen höheren Auftrag zu erfüllen hatte.
Einige Verteidiger-Kollegen, zum Beispiel mein Freund Sandy Stern, kamen mit Sennetts Berufung auf die »höheren Werte« und seinen oft plumpen Methoden nicht zurecht – wie zum Beispiel seinem spätabendlichen Überraschungsbesuch bei Feaver. Doch in meiner Zeit erlebte ich Stan als den ersten Bundesanwalt, der furchtlos seine Unabhängigkeit bewahrte. Mit ihm hatte eine längst überfällige Ära begonnen, in der schmutzige Geschäfte und Gaunereien aller Art nicht mehr geduldet wurden. Schließlich waren diese Methoden seit je als naturgegebene Rechte eines Amtsinhabers hingenommen worden. Auch mit mächtigen Wirtschaftsinstitutionen wie der Moreland Insurance, dem größten privaten Arbeitgeber im Kindle County, hatte er sich angelegt. Er schreckte nicht davor zurück, diese Versicherungsgesellschaft wegen Betrugs zu verfolgen. Kurzum, Stan sah es als seine Aufgabe an, die dunklen Ecken und Winkel des Kindle County mit dem hellen Licht von Recht und Gesetz auszuleuchten. Als sein Freund ertappte ich mich häufig dabei, wie ich ihm heimlich applaudierte – während ich den entsetzten Gesichtsausdruck aufsetzte, den man von einem Verteidiger einfach erwartete.
Schließlich kam er auf meinen neuen Mandanten zu sprechen.
»Für mich schon ein seltsamer Knabe«, sagte Stan mit einem berechnenden Augenzwinkern in meine Richtung. Wir beide wussten, dass Robbie Feaver trotz seiner Armani-Anzüge der typische Kindle-County-Schlawiner blieb, mit waschechtem South-End-Akzent und zu viel Eau de Cologne. »Nein, er ist wohl schon eine Marke. Denn was die da drüben bei der River National mit ihrem Konto inszeniert haben, ist reichlich merkwürdig. Die Kanzlei Feaver & Dinnerstein hat über zehn Jahre ein Jahreseinkommen von weniger als einer Million angegeben. Vier kämen dem Durchschnitt näher. Ich hoffe, du hast das gewusst, George, als du sein Mandat übernahmst.« Dazu huschte ein feines Lächeln über seine Lippen, die angemessene Revanche eines Mannes, der sein Leben lang von einem Regierungsgehalt gelebt hatte. »Ist schon seltsam, dass jemand angesichts solcher Beträge noch bei den Steuerprozenten mogelt, oder?«
Ich zuckte mit den Achseln. Wenn es eine Erklärung gab, so würde sie nur für die Betroffenen einen Sinn ergeben. Aber wie ich mit der Zeit hatte erfahren müssen, konnten nur die Armen ihre Geldwünsche rational begründen.
»Und dann gibt es da etwas noch Seltsameres, George. Es vergehen Monate ohne eine einzige Kontobewegung, und dann sind es zack, mit einem Schlag zehn-, zwanzigtausend Dollar in bar binnen einer Woche. Und in der Zwischenzeit, George, heben sie immer wieder etwas am Geldautomaten ab. Woher also dieser plötzliche Appetit auf Bargeld?«, fragte Stan. »Und wohin ist es dann weitergeflossen?«
Bohrinseln. Drogengeschäfte. Das Übliche. Abgesehen von den so allgegenwärtigen Lastern, die die Strafgesetze des Bundes nicht erfassen.
»Seitensprünge?«, meinte Stan und dachte über diese Alternative nach, die mir noch einfiel. »Und wie! Ihr Knabe bräuchte einen Zähler am Hosenschlitz, um den Überblick zu behalten.« Er rollte mit den Augen, als sei ihm entfallen, dass es die Schwäche für eine seiner Sekretärinnen im Staatsanwaltsbüro gewesen war, die seiner ersten Ehe ein Ende gesetzt hatte. Ich erwähnte Robbies kranke Frau, und Sennett gluckste abfällig. Feaver, meinte er, habe schon seit langem einen Ehrenplatz an der Abschleppmeile unten an der Grand Avenue, wo die teuren Zapfstellen liegen. Aus diesem Grund wurde der Straßenabschnitt auch gern die »Street of Dreams« genannt.
»Aber Mort ist ein solider Familienvater«, fügte er hinzu. »Während Ihr Knabe mehr Betten kennt als ein Zimmermädchen im Hotel. Der zahlt keinem Partygirl die Wohnung. Dahin verschwindet also kein Geld. Möchtest du meine Theorie hören, George? Ich glaube, es ist das Bargeld, das sie verstecken, nicht das Einkommen.«
Sennett bog eine Büroklammer auf und zwirbelte sie zwischen den Fingern. Selbstgefällig hockte er da hinter seinem riesigen Schreibtisch wie ein fetter Hauskater. Das war der echte Stan, der Junge mit dem dunklen Haarschopf, der ständig darauf brannte, sich und der Welt zu beweisen, dass er der gescheiteste Kerl war, den er kannte. Das Licht der Welt hatte er als Constantine Nicholas Sennatakis erblickt. Aufgewachsen war er in den Hinterzimmern eines Familienrestaurants. »Das war meine Umgebung«, hatte er mir einmal an der Law School trocken erklärt. »Die Speisekarten in diesen Schmutz abweisenden Plastikhüllen und immer ein Familienmitglied hinter der Registrierkasse.« Bei seiner Amtseinführung als Bundesanwalt wurde er sentimental und erzählte, wie schwer es seine Eltern gehabt hätten. Aber im Wesentlichen hatte er dieses ganze ethnische Theater mit einem ordentlichen Schuss Selbstbewusstsein hinter sich gelassen. In der Öffentlichkeit war Stan einer, der sich bis in die Fingerspitzen unter Kontrolle hatte. Privat, unter Freunden und Kollegen, spielte er gern den Mürrischen, dem nichts mehr fremd war und der allen Schmutz dieser Welt kannte. Doch für mich blieb Stan, wenn er das auch sehr gut kaschieren konnte, das Einwandererkind, das erbittert um seinen Platz in der Gesellschaft kämpfte. Oft schien es für ihn bei einem einzigen Fall um alles oder nichts zu gehen, so als sei es seine unwiderrufliche Pflicht, jede Gelegenheit zu nutzen, um weiterzukommen. Was dazu führte, dass er unter Niederlagen weit mehr litt, als er seine vielen Siege genießen konnte. Aber eines wusste er: Bei diesem Fall würde er gewinnen.
»Willst du mich gar nicht fragen, wie ich über diese Typen und ihre private Bargeldmaschine gestolpert bin?« Das hätte ich bestimmt schon getan, wenn ich auf eine Antwort hätte hoffen können. Doch offensichtlich regte ihn der heutige Fall zu sehr an, als dass er sich auf seine gewohnte Verschwiegenheit zurückziehen mochte. »Unsere Freunde von der Moreland Insurance waren es«, sagte Stan. »Die haben die beiden an den Hammelbeinen gepackt.«
Auf den Gedanken hätte ich auch selbst kommen können. Stans Aufsehen erregende Ermittlungen in den Achtzigerjahren gegen die Moreland Versicherungsgesellschaft wegen diverser betrügerischer Verkaufsmethoden hatten zu einer gesalzenen Geldstrafe geführt: Über dreißig Millionen Dollar waren fällig geworden. Auch Bewährungsstrafen waren ausgesprochen worden. In deren Verlauf war ihnen gar nichts anderes übrig geblieben, als mit der Bundesanwaltschaft zu kooperieren und alles wieder gutzumachen, was sie verbrochen hatten. Und auch sonst auszupacken. Kein Wunder, dass Moreland die Gelegenheit gleich nutzte, sich nicht nur selbst zu bezichtigen, sondern auch ihren natürlichen Feinden am Zeug zu flicken, also all jenen Anwälten, die sie berufsmäßig mit Zivilklagen zu überziehen pflegten.
Bei fast jeder Klage auf Schadensersatz ist der eigentliche Beklagte eine Versicherungsgesellschaft. Da bringt einer seinen Nachbarn vors Gericht, weil von dessen Grundstück ein Baum auf das eigene Dach gefallen ist. Aber es ist seine Versicherung, die den Schaden zu begleichen hat, zu dem Zweck ihre Anwälte auffährt und sich oft genug von den Anwälten der Gegenseite in die Ecke gedrängt sieht. Mir war klar, dass man aller Wahrscheinlichkeit nach über einen Scheck von Moreland Insurance an Feaver & Dinnerstein aus den vergangenen Jahren deren geheimem Bankkonto auf die Spur gekommen war. Und unglücklicherweise hatten die Moreland-Unterlagen mehr als nur das enthüllt.
»Dein Mandant ist ein ziemlich harter Gegner«, sagte Stan. »Irgendwie ist es Moreland noch nie gelungen, bei einem wichtigen Fall gegen ihn und seinen Partner zu gewinnen. Inzwischen hat die Versicherung gelernt, sich mit ihnen zu vergleichen. Und das vor allem, weil jedes Verfahren, in dem deinem Mandanten eine sechsstellige Summe vorschwebt, stets vor derselben Hand voll Richtern landet. Und weißt du, was das heißt? Wir haben uns durch die Gerichtsakten gewühlt und sind schon bald auf ein Muster gestoßen, das auch für andere Versicherungen gilt. Immer wenn Feaver & Dinnerstein großen Zahltag vermuten, läuft das gleiche Schema ab: Entscheidungen zu Ungunsten der Versicherungen. Zumindest einträgliche Vergleiche. Und stets sind es dieselben vier ehrenwerten Organe der Rechtsprechung, mein lieber George, denen die Fälle zugeteilt werden. Und das, obgleich sie angeblich immer nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden und obgleich die Zivilabteilung des Gerichtes über immerhin neunzehn Richter verfügt.« Sennett sah mich scharf an. »Verstehst du, worauf ich hinauswill, George? Wohin das Geld fließen könnte?«
Ich wusste es. Durch die Gänge der Gerichte von Kindle County waberten Gerüchte über seltsame dort ablaufende Geschäfte. Das war schon so gewesen, als ich von der Law School hierher gezogen war. Aber nie konnten hieb- und stichfeste Beweise vorgelegt werden. Die geschmierten Richter seien sorgsam abgeschirmt, hieß es. Die Gelder flössen über Mittelsmänner, man verständige sich über Codewörter. Und die zahlenden Anwälte hielten natürlich den Mund. Es ging das Gerücht, es handele sich um eine kleine Gruppe, eine alteingesessene verschworene Gesellschaft. Deren Ursprünge reichten Jahrzehnte zurück bis zu Highschool-Zeiten oder hatten ihre Wurzeln in Glaubensgemeinschaften, Beziehungen zur Staatsanwaltschaft, als es um diese auch noch nicht zum Besten bestellt war, in Studentenverbindungen und sogar in Kontakten zur Unterwelt. Und stets hatte eine überhitzte Parteipolitik diese Bande noch gefestigt.
Verdächtigungen dieser Art wurden immer wieder einmal von griesgrämigen Verlierern vor den Gerichten des Kindle County geäußert. In meinen naiveren Zeiten war ich jedoch noch bereit gewesen, dieser Kritik wenig Bedeutung zuzumessen und zu glauben, dass schlichte Vetternwirtschaft die offensichtlichen Begünstigungen erklärte und nicht etwa bares Geld. Im Laufe der Jahre war ich wiederholt – wie jeder andere Anwalt auch – Zeuge derartiger Machenschaften geworden. Im Interesse meines Mandanten war ich mittlerweile nicht mehr so blauäugig.
»Und ich sage dir, was meinen Verdacht endgültig erhärtet«, sagte Stan. »Morton Dinnersteins Onkel ist Brendan Tuohey.« Sennett machte eine Pause, um den Namen auf mich wirken zu lassen. »Brendans ältere Schwester ist Morton Dinnersteins Mutter. Sie hat Brendan aufgezogen, nachdem die Mutter der beiden den Löffel abgegeben hatte. Er hängt sehr an ihr. Und an ihrem Sohn. Für mich sieht es so aus, als habe Tuohey seinen Neffen Morty wirklich tatkräftig unterstützt.«
Wie Stan erwartet hatte, war ich überrascht. Als ich in den späten Sechzigern ins Kindle County gezogen war, galt eine Heirat zwischen einer Tuohey und einem Dinnerstein noch als eine Art verpönter Rassenvermischung. Um aber wieder auf den Punkt zu kommen, Brendan Tuohey war jetzt Vorsitzender der Zivilabteilung, an der alle Schadensersatzfälle verhandelt wurden. Als ehemaliger Cop und zeitweiliger Stellvertretender Bezirksstaatsanwalt war er inzwischen berühmt für seine ausgeklügelten politischen Beziehungen, seine allgemeine Verbundenheit mit der irisch-stämmigen Bevölkerung und seine gelegentlich hemmungslose Bösartigkeit. In den meisten einschlägigen Kreisen, etwa bei den Zeitungsreportern, galt er als fähiger Mann, hart, aber fair. Tuoheys Name fiel am häufigsten, wenn darüber spekuliert wurde, wer die Nachfolge des greisen Richters Mumphrey antreten und somit die weit reichenden Befugnisse eines Präsidenten des gesamten Obersten Gerichts von Kindle County in Händen halten würde. Während meiner Zeit als Vorsitzender der Anwaltskammer hatte Brendan mich immer freundlich und zuvorkommend behandelt. Doch Stan und ich konnten uns beide an Tuoheys Amtsführung in der Abteilung für Kapitalverbrechen erinnern, als sich hartnäckig Gerüchte hielten, ein Toots Nuccio, immerhin ein stadtbekannter Großdealer, ginge in seinem Büro ein und aus.
Vorsichtig fragte ich Stan, ob er es denn für fair halte, Robbie Feaver wegen der Verwandten seines Partners zu verurteilen. Doch inzwischen hatte Sennett die Geduld verloren, da er mein Verhalten als Hinhaltetaktik wertete.
»Mach du deinen Job, George. Und ich mache meinen. Rede mal mit dem Knaben. Da ist was im Busch. Das sehen wir doch beide. Wenn er fromm und brav ist, können wir ihm helfen. Gibt er nichts zu, schicke ich ihn wegen Verschleierung ins Gefängnis. Solange ich kann. Und bei diesem Konto und diesen Summen kommen wir da schon auf ein paar Jährchen. Jetzt hat er seine Chance. Nutzt er sie nicht, komm mir nicht in einem halben Jahr angekrochen und sing mir das Klagelied von seiner armen Frau und ihrem schrecklichen Gesundheitszustand.«
Stan drückte das Kinn auf die Brust und sah mich grimmig an. Jetzt war er der Stan Sennett, den die wenigsten mochten. Mit dem sie am wenigsten klarkamen. Hinter seinem Fenster schwenkte einen Block entfernt der Ausleger eines riesigen Baukrans durch die Luft. An ihm hing ein Balken, auf dem rittlings ein todesmutiger Arbeiter saß. In dieser Stadt wurden solche Tätigkeiten ausnahmslos von Indianern durchgeführt. Sie kannten, wie jeder wusste, einfach keine Furcht. Ich beneidete sie. Irgendwie hatte der Tod meines Vaters mir empfindlich klargemacht, wie ängstlich ich von Kindheit an gewesen war.
Stan hielt mein Schweigen für ein Zeichen von Geringschätzung. Gelegentlich empfand ich es als wohltuend für unsere Freundschaft, dass meine Meinung ihn auch einmal verletzen konnte, vielleicht weil er wusste, dass ich meist sehr positiv über ihn dachte.
»Bist du böse auf mich?«, fragte er.
Nicht mehr als sonst, versicherte ich ihm.
Er verzog den Mund und stand auf. Vermutlich wollte er mich zur Tür begleiten. Stan war berühmt für seine abrupte Art, Gespräche zu beenden. Doch diesmal blieb er vor seinem Mahagoni-Schreibtisch stehen und lehnte sich mit dem Rücken gegen die Vorderkante. Da fiel mir ein, dass ich ihn schon immer fragen wollte, wie er es schaffte, nachmittags um halb fünf noch immer im glatt gebügelten, weißen Hemd ohne alle Knitter und Falten dazustehen. Doch wie immer war jetzt wohl nicht der richtige Zeitpunkt.
»Hör mal«, sagte er, »ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Einverstanden? Sie wird dich umhauen, mach dich also auf etwas gefasst. Hast du jemals gewusst, wann mein Entschluss, Staatsanwalt zu werden, gefallen ist?«
Ich kannte die Geschichte wohl noch nicht.
»Na gut, ich erzähle sie auch nicht oft. Aber jetzt werde ich es tun. Es hat mit Petros, dem Bruder meines Vaters, zu tun. Wir Kinder nannten ihn Peter. Onkel Peter war das schwarze Schaf. Er führte kein Restaurant wie wir, sondern besaß einen Zeitungsstand.« Stan meinte das witzig und gestattete sich ein nicht ganz so verkniffenes Lächeln. »Wenn einer von schwerer Arbeit redet – ich höre hier schon mal Klagelieder von jungen Anwälten, dass man an manchen Sachen ganze Nächte sitzt –, dann kann ich dir nur eines sagen, mein Freund, das war harte Arbeit. Morgens um vier Uhr raus aus dem Bett. Bei jedem Wetter in dieser kleinen Bude an der Ecke stehen. Bei Eiseskälte, Regen, Graupel. Jeden Tag. Zeitungen austeilen, Pennys einnehmen. Zwanzig Jahre lang hat er das gemacht. Als er dann fast vierzig war, hatte es Petros so weit geschafft, dass er sich nach etwas anderem umschauen konnte. Ein paar Kumpel von ihm hatten eine Tankstelle drüben an der Ecke Duhaney und Plum. Mitten in Center City. Sie war eine Goldgrube. Und die Besitzer gaben sie auf. Petros kaufte sie ihnen ab. Jeden Cent, den er hatte, steckte er hinein, all seine Ersparnisse aus zwanzig Jahren Schinderei. Und dann stelle sich natürlich heraus, dass es da ein paar Dinge gab, die Onkel Peter nicht wusste. Zum Beispiel die Tatsache, dass diese Ecke und der ganze verdammte Block von den Stadtplanern von Center City zur Enteignung vorgesehen waren. Nur zwei oder drei Tage, nachdem Onkel Peter seinen Stand geschlossen hatte, ging der Plan an die Öffentlichkeit. Ich sage dir, es war ein absoluter, dreckiger Betrug, und die Behörden von Kindle County steckten dahinter. Alles, was der arme Kerl besessen hatte, war mit einem Schlag weg. Jede einzelne Drachme.«
Stan zuckte mit den Schultern. »Ich war damals ein kleiner Junge. Aber ich hatte, verdammt noch mal, in Staatsbürgerkunde aufgepasst. Warum gehst du nicht vor Gericht, Onkel Peter, sagte ich, und klagst? Er sah mich nur an und lachte. ›Ein armer Mann wie ich?‹, sagte er. ›Ich habe kein Geld, um mir einen Richter zu kaufen.‹ Er sagte nicht: ›Ich kann mir keinen Anwalt leisten.‹ Obwohl er das tatsächlich nicht konnte. Aber er wusste nur zu gut, dass jeder, der schon im Voraus erfahren hatte, was im Stadtentwicklungsplan für Center City stand, vor dem Obersten Gericht von Kindle County nicht verlieren würde. Da beschloss ich, Staatsanwalt zu werden. Nicht bloß Anwalt. Ankläger. Ich wusste plötzlich, es war das Beste, was ich tun konnte. Ich würde dafür sorgen, dass die Petros’ dieser Welt nicht mehr übers Ohr gehauen werden. Ich würde die korrupten Richter schnappen und die Anwälte, von denen sie sich schmieren ließen. Und all die anderen üblen Burschen, die die Welt so hundsgemein und unfair machten. Genau das habe ich mir damals mit dreizehn geschworen.«
Stan brach ab und schöpfte Atem. Abwesend fuhr er mit den Fingern über die Brandschnitzerei am Schreibtischrand. Stan Sennett in seinem Element. Er war sich seiner Wirkung bewusst.
»So oder so, dieser Misthaufen stinkt in diesem County schon zu lange zum Himmel. Zu viele anständige Leute haben die Augen verschlossen in der Hoffnung, dass alles gar nicht wahr ist. Aber es ist wahr. Oder sie haben sich eingeredet, es sei immerhin schon besser als in den zurückliegenden schlechten Zeiten. Was natürlich überhaupt keine Entschuldigung ist.« Er beugte sich vor, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, und mir schnürte es die Kehle zu. Doch was ihn da antrieb, war echte Leidenschaft und kein Vorwurf gegen mich. »Also habe ich aufgepasst. Und gewartet. Und jetzt habe ich meine Chance. Augie Bolcarro ist tot, und seine Machenschaften sollen mit ihm untergehen. Hör mir genau zu: Ich werde diesen Schweinehund Tuohey und seine ganze miese Bande festnageln und seinen Stall ausmisten. Ich habe nicht vor, dem Verein bloß ein paar Trottel aus der unteren Etage auf die Pelle zu schicken und dann zuzusehen, wie Tuohey in einem Jahr zum Obersten Richter im County aufsteigt und sich alles wiederholt, nur eine Nummer größer. So wie es immer gelaufen ist.
Ich weiß, wie die Leute über mich reden. Ich weiß, was sie denken. Aber ich tue das wirklich nicht zum höheren Ruhme Stan Sennetts. Du kennst das Sprichwort? ›Wenn du schon auf den König schießt, dann musst du ihn auch töten.‹«
Das sei frei nach Machiavelli, sagte ich. Stan dachte einen Moment nach, unsicher, ob ihm der Vergleich tatsächlich gefiel.
»Also, wenn ich auf Tuohey schieße und ihn verfehle – wenn ich ihn verfehle, George –, dann bin ich diesen Job los und muss aus der Stadt verschwinden. Das weiß ich. Kein Anwalt, der bei Verstand ist, würde sich auch nur aus der Ferne noch mit mir blicken lassen. Weder sie noch ich würden dann nämlich noch einen einzigen Fuß in dieses Gericht setzen können. Aber ich werde es tun. In jedem Fall. Ich werde dem nicht einfach untätig zusehen. Nicht, solange ich hier ein Wächteramt innehabe. Du wirst mir das nachsehen, George. Bitte. Aber ich habe es meinem Onkel Petros geschworen und all den anderen Menschen in diesem County und diesem Bezirk. Ich tue etwas gottverdammt Richtiges, George.«
3
»Es hat nicht so angefangen, wie Sie glauben«, sagte Robbie Feaver. »Morty und ich sind nicht zu Brendan marschiert und haben gesagt, kümmere dich um uns. Es gab nichts, worum er sich hätte kümmern oder was er für uns hätte einfädeln müssen. Mort und ich hatten uns auf den Bereich ›Schadensersatz‹ spezialisiert und ihn gemeinsam beackert: Forderungen aus kleinen Unfällen, Handwerker-Pfusch und so weiter. Dann bekamen wir vor ungefähr zehn Jahren, sogar noch vor Brendans Ernennung zum Vorsitzenden der Zivilabteilung, die erste reelle Chance, höher mitzuspielen. Es ging um einen ärztlichen Kunstfehler bei einem Säugling. Ein Doc hatte einem Baby bei einer Zangengeburt den Kopf wie eine Walnuss zerquetscht. Es war das übliche Pro und Contra. Ich kriege den Auftrag, 2,2 Millionen zu fordern. Das ruft den Versicherungs-Dachverband auf den Plan, und der bürgt für die Anwaltskosten der beklagten Partei. Die wissen genau, ich bin kein Staranwalt, kein Peter Neucriss. Sie zwingen mich, Geld vorzuschießen, als wüchse es in meinem Hinterhof auf den Bäumen. Ich musste medizinische Experten auffahren. Nicht einen. Vier. Einen Pathologen. Einen Anästhesisten. Einen Kinderarzt. Einen Neurologen. Und eine Fotodokumentation für den Gerichtssaal, alles mehrfach vergrößert. 125 000 Dollar Aufwendungen hatte ich, ein ganzes Stück mehr, als wir uns leisten konnten. Wir marschieren also zur Bank, Mort und ich, und nehmen die zweite Hypothek auf unsere Häuser auf.«
Die Geschichte hörte ich nun zum soundsovielten Mal. Die aktuelle Fassung war an Sennett adressiert, eine Spezialausfertigung, vorgetragen bei einem inoffiziellen Treffen, das Stan die Gelegenheit bot, Robbie persönlich zu taxieren. Eine Woche nach meinem Besuch in Stans Büro saßen wir in einem Tagungsraum des Dulcimer House Hotel, umgeben von feinem Brokat. Reserviert worden war es für uns im Namen einer »Petros-Gesellschaft«. Sennett hatte einen eher fade wirkenden Begleiter namens Jim mitgebracht, Mondgesicht, aber nett. Ich erkannte ihn als FBI-Agenten, noch bevor Stan ihn vorgestellt hatte, denn er trug sogar an einem Sonntagnachmittag eine Krawatte. Alle saßen gespannt nach vorn gebeugt in feinen Armsesseln mit medaillonförmigen Rückenlehnen, während Robbie neben mir auf dem Sofa erzählte.
»Der Richter, dem unser Fall zugeteilt war, hieß Homer Guerfoyle. Also, ich weiß nicht, ob Sie sich an Homer erinnern. Er ist schon lange tot. Aber er war reines, altes Kindle-County-Gewächs, ein Lakai, Sohn eines Alkoholschmugglers, den sie bei der Beerdigung regelrecht in den Erdboden rammen mussten, so ein verdammter Gauner war er. Aber als er es schließlich auf die Richterbank geschafft hatte, hielt er sich plötzlich für einen Lord im Oberhaus. Kein Scherz. Man hatte immer das Gefühl, er hätte sich lieber mit ›Euer Lordschaft‹ ansprechen lassen als mit ›Euer Ehren‹. Seine Frau war tot, und so tat er sich mit einer einige Jahre älteren Dame aus der besseren Gesellschaft zusammen, ließ sich ein schütteres Schnurrbärtchen wachsen, ging in die Oper und trug im Sommer auf der Straße immer einen steifen Strohhut.
Gut. Nun zur Gegenseite. Auf der steht Carter Franch, ein feiner Pinkel, Groton und Yale. Guerfoyle behandelte ihn wie ein höheres Wesen. Als genau den Mann, der Homer selbst so gern gewesen wäre. Er ist ganz Auge und Ohr, welchen Quark Franch auch immer gerade von sich gibt. Eines Morgens treffen sich Mort und ich mit Brendan zum Frühstück und jammern ihm vor, wie sich dieses Verfahren entwickle und was für ein wichtiger Fall das sei, dass wir nicht ungeschoren aus der Sache hervorgehen würden und am Ende ohne Haus und Hof dastünden. Zwei Greenhorns, die Mortys klugem alten Onkel von ihren Problemen erzählen. ›Na ja‹, meint Brendan, ›ich kenne Homer seit Jahren. Er hat für uns innerhalb der Boylan Organization Wahlkreise betreut. Homer ist in Ordnung. Ich bin sicher, er wird für einen fairen Prozess sorgen. ‹«
»Nett, dass er das glaubt«, sagte Robbie. Feaver blickte auf, und wir lächelten alle beipflichtend, um ihn zum Weiterreden zu ermuntern. »Unser Fall lässt sich gut an. Keine Rückschläge. Kurz bevor wir unseren letzten Gutachter präsentieren, der vortragen soll, wie eine vernünftige Zangengeburt durchzuführen ist, rufe ich den beklagten Doc in den Zeugenstand, nur um ihn über ein paar technische Dinge zum Ablauf zu befragen. Zuletzt stelle ich ihm natürlich die übliche Gretchenfrage: ›Würden Sie es noch einmal so machen? ‹ ›Nicht angesichts dieses Ergebnisses‹, sagt er. Nicht schlecht. Wir beenden das Verhör, und bevor die Verteidigung beginnt, stellen beide Seiten die Standardanträge auf einen Spruch der Geschworenen gemäß richterlicher Belehrung – und, schlagen Sie mich tot, Guerfoyle folgt meiner Linie. Robbie gewinnt ein Haftpflichtmatch durch technischen K. o.! Der Arzt habe schuldhaft gehandelt, sagt Homer. Er habe mit seiner Aussage, die Zange nicht noch einmal einsetzen zu wollen, praktisch zugegeben, dass er nicht die angemessene Vorsicht walten gelassen habe. Nicht einmal ich hatte etwas in der Art unterstellen wollen. Carter Franch reißt sich fast das Herz aus der Brust, aber nachdem es nur um einen reinen Schadensfall geht, kann er gar nicht anders als sich vergleichen. 1,4 Millionen. Das sind dann an die 500 000 für Morty und mich.
Zwei Tage später stehe ich wieder vor Guerfoyle und stelle in einer anderen Sache einen Antrag. Und er bestellt mich kurz ins Richterzimmer. ›Also, das ist doch prima für Sie ausgegangen, Mr. Feaver.‹ Blablabla. Ich denke, mich tritt ein Pferd. Ich kapiere nichts. Absolut nichts. Wie soll ich mit so etwas umgehen? Bleibt mir nur übrig zu sagen: Danke, Euer Ehren, vielen Dank, ich weiß das wirklich zu schätzen, wir haben hart daran gearbeitet. ›Gut. Bis demnächst mal, Mr. Feaver.‹
Am nächsten Wochenende zieht Kosic, einer von Brendans Leuten, Morty bei einem Familienschwof in eine Ecke und meint: ›Was spielt ihr Jungs denn da mit Homer Guerfoyle für üble Spielchen? Wir haben viel für Homer übrig. Ich habe dafür gesorgt, dass er erfährt, dass Sie Brendans Neffe sind. Es passt uns ganz und gar nicht, wenn ihr Jungs keinen Respekt vor ihm habt.‹ Am Montag treffe ich Mort im Büro, und wir sehen uns nur stumm an. ›Üble Spielchen? ‹ – ›Respekt?‹
Können Sie sich vorstellen, was als Nächstes passiert? Ich gehe hin, präsentiere den Vergleichsantrag, und Guerfoyle weigert sich, ihn zu unterzeichnen. Er sagt, er habe noch einmal über den Fall mit dem Doc nachgedacht. Ganz für sich allein. Er habe sich überlegt, dass es vielleicht besser wäre, die Jury entscheiden zu lassen, ob der Doc seine Verantwortung nun eingestanden habe oder nicht. Selbst Franch staunt nicht wenig, weil der Richter sich während der Verhandlung noch taub gestellt hatte, als Franch genau in die Richtung argumentierte. Also vertagen wir die Verhandlung, um uns neu zu munitionieren. Als ich den Saal verlasse, schüttelt Ray Zahn, Homers Gerichtsdiener, nur den Kopf.
Und so sitzen diese beiden Greenhorns, also Mort und ich, da und sondieren die Lage. He, Mort, glaubst du, er will Geld? Klar, Rob, das glaube ich. Er will Geld. Irgendwer musste Homers neuen Lebensstil ja finanzieren, nicht?
Gut, wir grübeln einen Tag, dann kommt Morty zu mir und sagt Nein. Einfach: Nein. Kommt nicht in Frage. Kein Wie und kein Was. Er habe nicht geschlafen, knurrte er dreimal und legte los. Im Vergleich zu dem hier sei das Gefängnis ja eine Erholung.
So ist Morty. Einfach zu schwache Nerven. Als er das erste Mal vor der Richterbank stand, fiel er fast in Ohnmacht. Damit liegt die ganze Last auf Robbies Schultern. Doch was sollte ich nun tun? Kommen Sie mir jetzt nicht mit den Weisheiten des Konfuzius. Hier geht’s ums richtige Leben. Sollte ich jetzt ein Honorar von 490 000 Dollar plus ein paar Zerquetschte in den Wind schießen, nach Hause gehen und die Koffer packen? Sollte ich hingehen und den Eltern von diesem verunstalteten Kind erzählen: Tut mir Leid, euch falsche Hoffnungen gemacht zu haben mit dieser Million Scheine, die ihr kriegen solltet. Da müssen wir wohl high gewesen sein, nicht? Wie lange würden sie Ihrer Meinung nach brauchen, bis sie einen neuen Anwalt hätten, dessen Versprechungen sie trauen konnten? Was, zum Teufel, bedeutete das für Mortys Onkel? Und was würde aus uns? Verlierer sind in dieser Stadt nicht sonderlich beliebt. Also, Morty hin, Morty her, es gibt nur eine einzige Frage zu beantworten, wie beim Trinkgeldgeben in Europa. Wie viel ist genug? Und von wem erfährst du das? Es ist wirklich komisch. Wo findet man einen College-Kurs in Bestechung, wenn man ihn so bitter benötigt? Also marschiere ich zur Bank und hebe 9000 ab, denn bei mehr als 10 000 melden sie es ans FBI weiter. Wegen Geldwäsche und so. Ich schiebe es zu unseren Anträgen in einen Umschlag und gebe ihn Ray, dem Gerichtsdiener. Mein Mund ist so trocken, dass ich nicht einmal mehr eine Briefmarke hätte anfeuchten können. Was, zum Teufel, soll ich nur sagen, wenn wir das alles falsch interpretiert haben. »Ach Gott, das habe ich gerade von meiner Bank geholt: Ist wohl aus Versehen drin geblieben«? Ich hatte den Umschlag so dick mit Klebstreifen verkleistert, dass er zum Öffnen eine Handgranate brauchte, und ich sagte zu Zahn: Bitte, achten Sie darauf, dass Richter Guerfoyle das hier persönlich bekommt, und sagen Sie ihm, es tut mir Leid wegen des Missverständnisses. Dann gehe ich zum Aufruf zu einem Sammeltermin in einen anderen Verhandlungssaal, und als ich wieder rauskomme, wartet Zahn im Gang auf mich und schaut mich verdammt ernst an. Dann geht er einige Schritte neben mir her. Man konnte bei Gott hören, wie meine Socken in den Schuhen quietschten. Schließlich legte er den Arm auf meine Schulter und flüsterte: »Nächstes Mal vergessen Sie mich nicht.« Und dann reicht er mir den von Homer unterzeichneten Vergleich und den Einstellungsbeschluss.« Noch jetzt, zehn Jahre danach, raufte sich Feaver vor Erleichterung die wohl frisierten Haare, die ihm in blauschwarzen Wellen über den Kragen fielen.
»So war das. Für Morty erfand ich die Geschichte, Guerfoyle habe anscheinend gemerkt, dass wir an eine Berufung gegen seine Entscheidung dachten, und gekniffen. Dann ging ich zu Brendan und machte meinen Kratzfuß vor seiner Ehrenwache, sprich: seinen Kumpanen Rollo Kosic und Sig Milacki. Im Hinausgehen sagt Sig zu mir: ›Wann immer Sie wieder so einen besonderen Fall haben, rufen Sie mich an.‹ Von da an lief das so.«
Für das, was dann an unvermeidlichen Machenschaften folgte, hatte Robbie nur noch ein Achselzucken übrig. Er sah uns prüfend an, wie er bei uns wohl angekommen sein mochte. Ich schlug ihm vor, auf einen Kaffee hinauszugehen. Robbie war noch nicht aus der Tür, da verdrehte Sennett die Augen.
»Was er über Mort sagt, ist ein Märchen«, meinte er.
Ich blickte ihn mit großen Augen an und markierte den Überraschten, dabei hatte ich mir meinen Mandanten privat schon ganz schön vorgenommen. Trotzdem schwor Feaver Stein und Bein, Dinnerstein habe zehn Jahre lang keine Ahnung gehabt. Genau das habe Brendan Tuohey, der seinen Neffen so abgöttisch liebte, gefallen. Als Partner habe Mort immer die Hälfte vom Gewinn aus Tuoheys Schiebereien bekommen, aber null Risiko getragen. Nur Robbie habe die Richter mit den Geldkuverts beliefert.
Laut Feavers Ausführungen war Mort nicht einmal über Sinn und Zweck des geheimen Kontos bei der River National Bank informiert. In vielen Berufen – Krankenpfleger, Bestattungsunternehmer, Cop – müssen Menschen jemandem, der schwer verletzt oder ernsthaft geschädigt wurde, einen Anwalt empfehlen. Aus ethischen Gründen darf dieser Anwalt dann mit denen, die ihn empfohlen haben, das Honorar für seine Leistungen nicht teilen. Aber die Krankenschwester oder der Cop, die Robbies Visitenkarte weitergegeben haben, fragen vielleicht doch einmal nach, ob etwas für sie abfällt. Und Robbie war nicht der erste Anwalt, der es für besser hielt, ein paar Scheine weiterzureichen. Ansonsten könnte einer seine Telefonnummer einfach zu leicht wieder vergessen. An die gehe das Bargeld vom Konto auf der River National Bank, hatte Robbie Mort erzählt. (Was ja für einen Teil auch tatsächlich stimmte.) Der Kammerausschuss für Zulassung und Disziplinarangelegenheiten könne, wenn er je davon Wind bekäme, gegen Mort wegen Beihilfe zu diesen Tricksereien disziplinarische Maßnahmen ergreifen. Doch vor einer strafrechtlichen Verfolgung bewahrte Robbies Erklärung Dinnerstein auf jeden Fall, zumindest in unserem Bundesstaat. Nicht einmal die steuerlichen Vergehen wurden für die Staatsanwaltschaft relevant, da Robbie nach seiner Version Mort in dem Glauben gelassen hatte, durch diese anstößigen Praktiken würden die von ihnen nicht deklarierten Einkünfte vollständig aufgebraucht. Für Stan war das alles zu glatt und bequem.
»Er deckt seinen Partner, und das ist dumm. Egal, zu welchem Deal wir am Ende kommen, wenn sich herausstellt, dass er lügt, fängt sich dein Knabe mir nichts, dir nichts ein paar Jahre Knast ein.«
Ich kannte Morton Dinnerstein so gut, wie ich Feaver kannte, das heißt, nicht besonders gut, sondern nur von beiläufigen Begegnungen rund ums LeSueur Building. Soweit ich es überblickte, war er in dem Duo der »Gelehrte«, also derjenige, der die Schriftsätze verfasste, Anträge formulierte, die Akten im Griff hatte, während Robbie für die Auftritte vor Gericht zuständig war. Diese Art von Arbeitsteilung wurde in vielen Sozietäten mit Erfolg praktiziert. Ich war keineswegs so sicher wie Stan, dass Feaver tapfer für seinen Partner den Kopf hinhielt und Gefängnis riskierte. Mort war irgendwie ein Wesen aus einer anderen Welt mit seinem wilden blonden Haar, das langsam dünner wurde und ihm in kleinen widerspenstigen Büscheln wie Streichhölzer vom Kopf abstand. Er hinkte stark, und seine Schüchternheit zeigte sich in einem leichten Stottern und einem ständigen Blinzeln während der langen Pausen, wenn er nach Worten suchte. Morts Arglosigkeit und die lebenslange Symbiose zwischen den beiden Männern ließ es möglich erscheinen, dass Feaver die Wahrheit sagte, und darüber stritt ich längere Zeit mit Sennett, allerdings mit wenig Erfolg.
Die andere Unzulänglichkeit in Robbies Erklärung lag nach Sennetts Ansicht darin, dass Feaver nie direkt mit Brendan Tuohey zu tun hatte. Robbie begriff, dass die stillschweigend vermittelten Arrangements mit einigen Richtern unter dem gewichtigen Einfluss Tuoheys zu Stande kamen. Es ging die Rede – für Feaver war das nicht mehr als ein Gerücht –, dass Brendan »Zinsen« einstrich, einen Anteil dessen, was die Richter von Robbie und ein paar anderen Anwälten erhalten hatten. Das Geld wanderte zu den beiden Gefolgsleuten, die eine klinisch-saubere Barriere zwischen Brendan und allem, was korrupt erscheinen mochte, aufrechterhielten: Rollo Kosic, der Oberste Gerichtsdiener, die rechte Hand von Tuohey, und Sig Milacki, ein Cop, der früher mit Brendan in den Straßen Streife gefahren war. Um an Brendan heranzukommen, würde Sennett die beiden brauchen – oder einen anderen Zeugen, falls Feaver es schaffte, noch einen ans Messer zu liefern.
»Glauben Sie mir, Stan«, sagte Feaver nach der Rückkehr aus der Cafeteria, »egal, wie sehr Sie Brendan hassen mögen, Sie können auf mich zählen. Ich kenne Brendan ein Leben lang, und ich habe so einiges mitbekommen. Ich mag Morty, aber glauben Sie, mir gefällt die Art, wie Brendan mich hier zum Wasserträger degradiert? Abgesehen davon, dass Brendan Leute an der Hand hat, die mir am liebsten die Zunge herausschneiden und sich als Krawatte um den Hals hängen würden, würde ich Ihnen den Kerl nur zu gern auf dem Silbertablett servieren. Nur, ich kann es nicht. Brendan hat Krallen wie eine Raubkatze und ist doppelt auf der Hut. Brendan packen und ihm etwas nachweisen? Viel Glück.«
Sennett fand offenbar Gefallen an dieser Herausforderung. In seinen Augen blitzte für einen Moment die enorme Energie auf, mit der er unvermeidlich auf jeden ernst zu nehmenden Gegner losging. Er nickte Robbie zu und wollte alle Details von ihm hören. Robbie hatte jahrelang viele Richter mit »Aufmerksamkeiten« bedacht. Er erinnerte sich genau an die Umschläge mit den baren Inhalten, die er in Herrentoiletten, Cafeterias und Tavernen in die Hände ausgesuchter Briefboten hatte gleiten lassen oder, allerdings viel seltener, in die der Richter selbst. Trotz Stans Verdacht, dass Feaver Mort deckte, und trotz seiner Enttäuschung, dass Robbie ihn nicht direkt auf Tuoheys Spur führen konnte, sah man doch mit bloßem Auge, wie erregt Sennett war, auch wenn er versuchte, sich so gut wie möglich zu beherrschen.
»Gibt es irgendeinen Grund«, fragte er Feaver kurz vor dem Ende ihres Gesprächs, »warum Sie nicht weiter Ihre ›Aufmerksamkeiten‹ verteilen konnten? Wenn wir Sie so weitermachen ließen und alles so bliebe wie bisher, wären Sie dann einverstanden, dass wir Ihnen eine Wanze verpassen, um die Geldübergaben zu dokumentieren und mir all diese Leute ans Messer zu liefern?«
Das war die Frage, von der wir gewusst hatten, dass sie kommen würde. Das war der Preis, den Feaver auf den Tisch legen konnte, um sich vor dem Gefängnis zu retten. Doch als ihm die Frage jetzt laut und deutlich gestellt wurde, kratzte Robbie sich das lange Kinn und wurde sehr nachdenklich. Ich spürte förmlich, wie ihm das, was ihn an den letzten Abenden beim Gedanken an Sennett und seine »Terrortaktik« aufgewühlt hatte, noch einmal durch den Kopf ging. Er hatte Angst vor der Reihe von grausamen Zwangslagen, in die er geraten würde. Doch dann ließ er, wie es seine Natur war, alle Bedenken fallen. Stattdessen rutschte er auf dem Sofa nach vorn und sah den Bundesanwalt und den leitenden Special Agent an, den ihm D. C. auf den Hals geschickt hatte. Er zeigte keinen Groll. Er sprach nur die bittere Wahrheit aus, zu deren Einsicht man ihn gezwungen hatte.
»Welche Wahl hätte ich denn?«
4
Für alle erfolgreich geführten Verhandlungen gilt, was Tolstoi über unglückliche Familien sagt: Man rauft sich zusammen, aber jedes Mitglied geht doch seiner eigenen Wege. Was seinen Part anging, setzte Feaver sich recht einfache Ziele für einen Handel mit der Regierung. Wenn ich sonst einmal Anwälte vor Gericht vertrat, machten sie sich vor allem Sorgen um ihre Zulassung. Bei Robbie schien das nicht der Fall. Jedenfalls war ihr Entzug wohl unvermeidlich für einen Anwalt, der zugegebenermaßen Richter bestochen hatte. Immerhin war er auf diese Weise inzwischen ein reicher Mann geworden. Und er hoffte, trotz allem und trotz der zu erwartenden Geldbußen und Beschlagnahmungen sein Vermögen retten zu können. Noch wichtiger war ihm allerdings, dem Gefängnis zu entgehen, nicht in erster Linie um seiner selbst willen, meinte er, sondern weil er seiner todkranken Frau auf ihrem schweren Weg bis zum Schluss beistehen wollte.
Sennett wiederum ging es vor allem darum, dass Robbie seine üblen Machenschaften dem Gericht nun auch hieb- und stichfest dokumentierte. Das hieß, er sollte sich mit Mikro und Recorder verkabeln lassen und als Zeuge der Anklage aussagen. Aus dem Grund bestand Stan auch auf einer Verurteilung Feavers. Es würde nämlich dessen Glaubwürdigkeit nur erhöhen, wenn er sich vor einer Jury schuldig bekannte für Taten, die er anderen schließlich auch vorwarf. Doch bevor es so weit war, musste Feavers Rolle im Dienst der Anklage absolut geheim bleiben, vor allem Dinnerstein durfte nichts erfahren, da er sonst womöglich seinen Onkel einweihen würde.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!