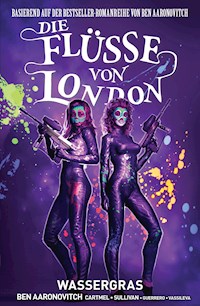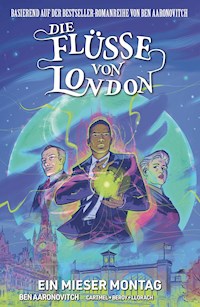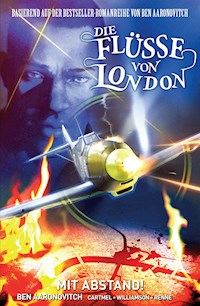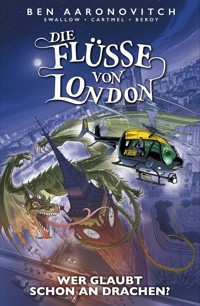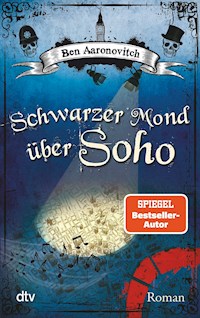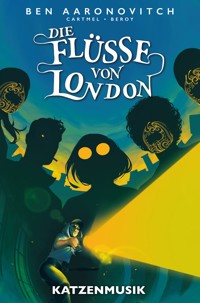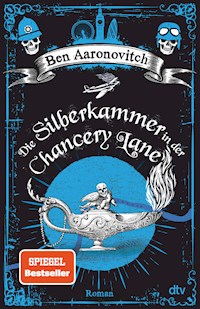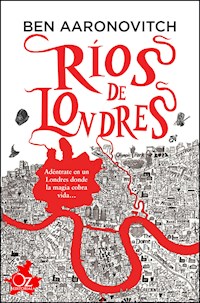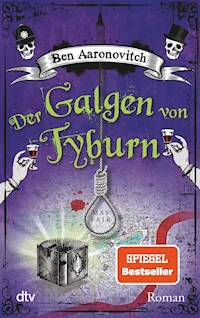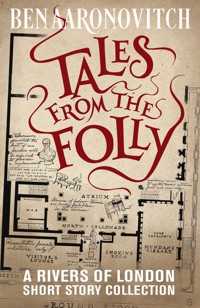9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Flüsse-von-London-Reihe (Peter Grant)
- Sprache: Deutsch
Heiß ersehnt: Der neue, große Roman mit Peter Grant! Constable und Zauberlehrling Peter Grant steht vor seiner größten Herausforderung: Das Schicksal Londons steht auf dem Spiel. Der gesichtslose Magier, verantwortlich für grauenvolle übernatürliche Verbrechen, ist zwar endlich demaskiert und auf der Flucht. Doch er verfolgt einen perfiden Plan, der ganz London in den Abgrund stürzen könnte. Um den Gesichtslosen zu stoppen, muss Peter all seine magischen Kräfte aufbieten – und einen bösen alten Bekannten kontaktieren: Mr. Punch, den mörderischen Geist des Aufruhrs und der Rebellion.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Der gesichtslose Magier, verantwortlich für grauenvolle übernatürliche Verbrechen, ist endlich demaskiert. Und auf der Flucht. Um ihn zu fassen, wirft die Londoner Metropolitan Police in gewohnt bürokratischer Manier ihre gesamte Macht in die Waagschale. Constable und Zauberlehrling Peter Grant dient bei der Operation als Verbindungsmann zur Magie. Und er muss feststellen, dass der Gesichtslose weit davon entfernt ist, sich furchtsam zu verkriechen. Im Gegenteil: Ganz offensichtlich ist er dabei, die letzte Stufe eines Plans von langfristiger Perfidie in die Tat umzusetzen. Eines Plans, der London, Peters geliebter Stadt, den Todesstoß versetzen könnte. Um das zu verhindern, muss Peter nicht nur seine Ex-Kollegin und Verräterin Lesley May um Hilfe bitten, sondern auch weit in Londons Geschichte zurückgehen – und einen bösen alten Bekannten kontaktieren: Mr. Punch, den mörderischen Geist des Aufruhrs und der Rebellion.
Ben Aaronovitch
Die Glocke von Whitechapel
Roman
Deutsch von Christine Blum
Dieses Buch ist denen gewidmet, deren Job es ist, auf die Gefahr zuzustürmen, während alle anderen in die entgegengesetzte Richtung rennen.
ριστος τρόπος τοῦ ἀµύνεσθαι τὸ µὴ ἐξοµοιοῦσθαι
Die beste Vergeltung ist es, nicht zu werden wie dein Feind.
Marcus Aurelius, Meditationen, Buch 6
Geheimhaltungsstufe
VS – Nur zum Dienstgebrauch
Vom Gesetz zur Informationsfreiheit ausgenommen
Ja
Öffentlichkeitsarbeit Ja / Nein
Nein
Bezeichnung und Version
Operation Jennifer
Zweck
Kontext
Zusammenfassung
Genehmigung zur Schaffung der Fahndungsgruppe »Operation Jennifer«
Verfasser und Zahlungs-/Bezugsnummer
DAC Robert Folsom
Verantwortliche Einheit
ESA
Datum
14. Nov. 2014
Geprüft durch
N/A
Dem Commissioner vorzulegen
– Ausschließlich in nichtdigitaler Form –
Es wird vorgeschlagen, folgende Ermittlungen zu OPERATIONJENNIFER zusammenzufassen:
OPERATIONTINKER (Mordkommission Bromley – Leitende Ermittlerin DCI Maureen Duffy)
Mord an George Trenchard alias P. Mulkern mittels unbekannter, jedoch als FALCON identifizierter Methode. Trenchard hatte zum einen finanzielle Verbindungen zu Martin Chorley (s. OP. WENTWORTH); zum anderen war Chorley nach Aussage der Zeugin Varvara Sidorovna Tamonina unmittelbar an seiner Ermordung beteiligt.
OPERATIONWENTWORTH (Abteilung Schwerer Betrug, Antiterroreinheit)
Ermittlung wegen Korruption, Finanzbetrugs, Mordversuchs und Verabredung zur illegalen Sprengung eines Gebäudes. Eine Verbindung zu Martin Chorley besteht in Form von Geldflüssen aus der Firma County Gard Holdings und deren zahlreichen Subunternehmen und Tochterfirmen. Zudem wurde seine Beteiligung durch Zeugenaussagen, u.a. der bereits genannten Varvara Sidorovna Tamonina, untermauert.
OPERATIONZUGPFERD (Direktorat für die Aufrechterhaltung der professionellen Standards – Leitender Ermittler DI William Pollock)
Untersuchung des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs gegen die ehemalige Police Constable Lesley May. PC May wurde inzwischen eindeutig als Mittäterin von Martin Chorley identifiziert.
OPERATIONWAGENRAD (Mordkommission Belgravia – Leitender Ermittler DCI Alexander Seawoll)
Ermittlung wegen Verabredung zum Mord an Jason Dunlop und Jerry Johnson; mutmaßlicher Auftraggeber Martin Chorley.
OPERATIONRINGELBLUME (Mordkommission Belgravia – Leitender Ermittler DCI Alexander Seawoll)
S. Anhang 2, 3, 4 u. 9.
Nach einhelliger Überzeugung der leitenden Beamten der o.g. Ermittlungen stellt Martin Chorley eine ernste und unmittelbare Bedrohung für die öffentliche Sicherheit dar, deren Ausmaß möglicherweise das der Terroranschläge vom 7.7.2005 erreichen oder übersteigen könnte. Es wird empfohlen, Chorley so schnell wie möglich aufzuspüren, zu verhaften und vor Gericht zu stellen. Dies kann nur durch eine massive informationsgestützte Großfahndung erreicht werden. Da laut DPS eine Weitergabe polizeiinterner Informationen an Dritte nicht ausgeschlossen werden kann, muss die Operation streng nach dem Need-to-know-Prinzip gestaltet werden und die IT-Unterstützung bereichsweise getrennt erfolgen.
Als zuständige Autorität des Metropolitan Police Service und ganz Großbritanniens für Falcon-Angelegenheiten sehe ich keine andere Möglichkeit, als der Einheit Spezielle Analysen mit ihren offen gesagt recht riskanten und unorthodoxen Methoden die Leitung der Fahndung zu übertragen. Im schlimmsten Falle einer Eskalation in der Öffentlichkeit sollte hierdurch ein gewisses Maß an glaubhafter Abstreitbarkeit gewährleistet sein; auch scheint mir diese Strategie die größten Erfolgschancen bei minimierter Medienaufmerksamkeit zu bieten.
1Chiswick
Sein Name war Richard Williams, und er war das, was man einen Werbefuzzi nennt. Er bewohnte zwar nur eine unspektakuläre Doppelhaushälfte in Chiswick, aber seine Familie stammte aus Fulwood, Sheffield, und hatte genug Kleingeld, um ihn als Tagesschüler nach Birkdale zu schicken, wodurch er in den gleichzeitigen Genuss exklusiver Bildung wie auch anständiger hausgemachter Mahlzeiten kam.
Nachdem er mit einer durchaus beachtlichen Note das Magdalen College in Oxford abgeschlossen hatte, zog er nach London, wo er bei einer großen Werbeagentur anfing und seine erste Frau kennenlernte.
Inzwischen hatte er schon die zweite, jüngere, und gemeinsam mit ihr zwei Töchter im Vorschulalter, und meiner Einschätzung nach war er drauf und dran, ins Thames Valley oder noch weiter nach Westen umzuziehen, um die Mädchen auf eine etwas weniger »bunte« Schule schicken zu können als diejenigen in Chiswick. Dies konnte ich guten Gewissens annehmen, weil ich über Richard Williams so ziemlich alles wusste, was man nur in Erfahrung bringen konnte – von seinen Schulzeugnissen bis hin zu dem letzten Einkauf, den er mit seiner Kreditkarte getätigt hatte. Zweifellos wäre er entsetzt gewesen zu erfahren, dass er dem allgegenwärtigen Überwachungsstaat zum Opfer gefallen war, und noch entsetzter, wenn er wüsste, dass derzeit zwei Polizeibeamte in einem zivilen, erfreulicherweise nicht silbernen Hyundai gegenüber seinem Haus saßen und dieses observierten, nämlich meine Wenigkeit nebst Detective Sergeant (jawohl!) Guleed.
Wir unsererseits waren weniger entsetzt als fast bis zu Tränen gelangweilt.
Wir verbrachten dort unsere Tage, weil Richard Williams in Oxford einem Dining-Club namens »Little Crocodiles« angehört hatte. An sich war das nichts Ungewöhnliches – die Upperclass-Studenten und ihre Groupies aus der Mittelschicht traten scharenweise in Dining-Clubs ein, und sei es nur, um sich hemmungslos besaufen und die Sau rauslassen zu können, ohne Angst haben zu müssen, dass man hinterher in einer reißerischen Fernsehdoku über den moralischen Verfall an den englischen Universitäten auf Channel 5 auftauchte.
Oder, wie mein Dad gern sagt: Zum gesellschaftlichen Problem wird’s nur dann, wenn die Arbeiterklasse mit dabei ist.
Das Besondere an den Little Crocodiles war ihr Gründer: Professor Geoffrey Wheatcroft, DDDPhil FGW und voll ausgebildeter Zauberer. Letzteres abzulesen an dem FGW: das stand für »Fellow der ›Gesellschaft der Weisen‹«, welche auch als Folly bekannt und das offizielle Zentrum der britischen Zauberei seit 1775 ist. Und falls Sie das jetzt schockiert oder erstaunt, möchten Sie sich vielleicht erst ein bisschen Hintergrundwissen verschaffen, bevor Sie weiterlesen.
Geoffrey Wheatcroft fand es offenbar amüsant, ein paar Kleinen Krokodilen das Zaubern beizubringen. Wie vielen, wissen wir nicht genau. Nur, dass ein paar davon richtig gut wurden – wieder ohne genaue Anzahl.
Genau wissen wir hingegen, dass mindestens zwei von ihnen ihre magischen Kräfte einsetzten, um eine Reihe von Schwerverbrechen zu begehen, einschließlich solcher, die man schon als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnen kann – und hier scherze ich ausnahmsweise nicht.
Indem Geoffrey Wheatcroft starb, ehe all das ans Licht kam, gelang es ihm, sich vor den Konsequenzen für seine Handlungen zu drücken. Wobei ich weiß, dass mein Boss manchmal den Drang verspürt, Wheatcrofts Leichnam auszugraben und in Flammen aufgehen zu lassen. Ebenso unbeschwert tot war Albert Woodville-Gentle, auch der gesichtslose Magier Nummer eins genannt. Doch hatte dieser vor seinem Ableben noch massiv mitgeholfen, einen gewissen Martin Chorley auszubilden, der bei uns unter gesichtsloser Magier Nummer zwei lief. (Glauben Sie mir, mit der Zeit steigt man da schon durch.)
Wir wussten, wer Martin Chorley war, und wir wussten, was er getan hatte. Leider wussten wir nicht, wo er war. Oder was er vorhatte. Und das bescherte uns schlaflose Nächte.
Ein cleverer Bursche war er, so viel war sicher. Er hatte zwar nicht damit gerechnet, aufzufliegen, aber rein vorsichtshalber hatte er sich für diesen Fall einige Strategien und Ressourcen zurechtgelegt. Für die Suche nach ihm besaßen wir tatsächlich nur zwei brauchbare Anhaltspunkte. Erstens unser Wissen, dass er schon öfter ehemalige Little Crocodiles rekrutiert hatte, damit die für ihn arbeiteten – und zweitens die Vermutung, dass es von denen noch mehr geben musste, als wir kannten. Und so kam irgendeinem hellen Köpfchen die Idee mit dem »Stich ins Wespennest«.
Wir ließen unsere Analytiker nach geeigneten Kandidaten unter den Kleinen Krokodilen suchen, begannen diese engmaschig zu überwachen, und dann gingen wir hin und jagten ihnen ein bisschen Angst ein – der »Stich ins Wespennest«. Alsdann lehnten wir uns zurück und warteten, ob sie reagierten. Wenn wir Glück hatten, würden sie einen Anruf, eine Mail oder eine Nachricht an einen ungewöhnlichen Kontakt schicken. Und im allerbesten Fall würden sie aus dem Haus stürzen, ins Auto springen und uns in spannende Gefilde führen.
Genau deshalb saßen Guleed und ich in dem Hyundai: damit wir Williams folgen konnten, falls er die Biege machte.
»Das ist ganz allein deine Schuld«, sagte Guleed.
»Irgendwann muss es funktionieren«, sagte ich.
Richard Williams war unser dritter »Stich«. Es herrschte der allgemeine Konsens, dass wir höchstens noch zwei bis drei Versuche hatten, bis entweder Chorley mitkriegte, was da vor sich ging, oder uns eine erzürnte Wespe wegen Belästigung verklagte.
»Da sind sie«, sagte Guleed.
Ich sah hinüber. Vor dem Haus unserer Zielperson hielt gerade ein ramponierter grüner Vauxhall Corsa. Das Haus hatte übrigens wahrscheinlich gut zwei Millionen gekostet mit seinen zwei Etagen plus ausgebautem Dachgeschoss, alles aus rotem Backstein und mit Schmuckelementen an der Überdachung der Vortreppe, die fast nach echtem Arts-and-Crafts-Dekor aussahen – aber nicht ganz. Wenigstens war es frei von Kieselrauputz und falschem Fachwerk. Sogar die originalen Schiebefenster waren noch vorhanden, allerdings mit Rollos versehen worden, der modernen Variante der Gardine – mit deren Hilfe die Mittelschicht seit jeher damit klarzukommen versucht, dass sie ihren Lebensraum mit anderen menschlichen Wesen teilen muss.
Momentan waren die Rollos hochgezogen, aber da wir, um nicht auf den ersten Blick aufzufallen, zehn Meter weiter parkten, war der Winkel zu ungünstig, um ins Hausinnere zu sehen.
Das Wegwerfhandy, das ich in der Hand hielt, pingte, und auf dem Display erschien ein seitliches Smiley.
»Auf die Plätze«, sagte ich.
Wir vermieden es weitgehend, unsere Polizei-Airwaves zu benutzen, nicht nur wegen der Gefahr, dass sie hopsgingen, wenn etwas Magisches passierte. Das Smiley war auch an das Team gerichtet, das die Parallelstraße überwachte, falls jemand nach hinten hinaus zu flüchten versuchte.
Aus dem Corsa stiegen Nightingale und DC David Carey und machten sich auf den Weg zur Eingangstür.
»Und los«, sagte Guleed mit einem unterdrückten Gähnen.
Seit Beginn der Operation hatten wir immer wieder die Rollen gewechselt. Beim letzten »Stich« in Chipping Norton hatten Nightingale und Carey im Observierungsauto gesessen. Wir bezeichneten ihn als »die Aga-Saga«, weil unsere Zielperson nicht aufhören konnte, von ihrer Küche zu schwärmen, die, soweit ich sehen konnte, von denselben Leuten entworfen worden sein musste wie Beutelsend.
»Tür geht auf«, sagte Guleed. Ich notierte die Zeit im Einsatzprotokoll.
Gewöhnlich taucht die Polizei gern in aller Herrgottsfrühe auf, vorzugsweise um sechs Uhr morgens, weil die meisten Leute dann nicht nur zu Hause sind, sondern auch nicht unbedingt in bester Verfassung. Diesmal hatten wir uns allerdings einen Sonntag um die Mittagszeit ausgesucht, weil wir nicht auf Angst und Schrecken aus waren, sondern auf subtiles Grauen. Nightingale ist darin bemerkenswert gut – liegt wahrscheinlich am Akzent.
Vor einiger Zeit hatte Richard Williams für eine Firma namens Slick Pictures gearbeitet, die eine Menge Aufträge von einem Bauträger bekommen hatte, der über eine Reihe von Mutterfirmen komplett einem Unternehmen namens County Gard gehörte. Welches zufällig genau das Instrument war, mit dem Martin Chorley einige seiner kriminellen Machenschaften steuerte.
Eine kümmerliche Verbindung, aber wir waren schon etwas verzweifelt, und zumindest würde es den Druck aufrechterhalten.
Guleed fummelte an ihrem Hijab herum, der ungewöhnlich schlicht für sie war – ein Polizeimodell, darauf ausgelegt, sich sofort zu lösen, wenn jemand daran zog. Unter unseren Jacken trugen wir rein vorsichtshalber die Zivilversion der Stichschutzweste.
Aus dem Garten nebenan sprang eine Katze hervor und schoss die Straße entlang davon. Etwas an ihrem panischen Tempo verursachte mir Unbehagen. Gerade wollte ich das Guleed gegenüber erwähnen, als das Handy wieder pingte und eine Nachricht erschien: aa. Während der Planung der Operation hatten wir eine Reihe von Codes erstellt. Der Buchstabe selbst war irrelevant – die Bedeutung lag in der Anzahl. Drei Buchstaben bedeuteten »Bereithalten«, einer bedeutete »Sofort stürmen – auf sie mit Gebrüll!«, und zwei waren das Zeichen, dass wir unsere vorher bestimmte »Interventionsposition« einnehmen sollten.
Guleed grinste. »Mal was anderes.«
Wir stiegen aus, hinein in die sonntagmittägliche Schwüle der Vorstadt, und gingen auf das Haus zu. Laut Plan sollten wir so unauffällig wie möglich vor dem Gartentor herumlungern und auf weitere Instruktionen warten. Aber wir waren noch mindestens acht Meter vom Haus entfernt, als unser Plan sich höchst spektakulär verabschiedete.
Zuerst traf mich eine Woge von Vestigia vom Haus her, schwer wie ein Hammer und so scharf und präzise wie eine Nadelspitze – Nightingales Signare. So heftig, wie es war, musste er ganz schön vom Leder gezogen haben. Als das das letzte Mal passiert war, landeten die Überreste später auf der Bauschuttdeponie.
Ich sprintete los und kam gerade am Gartentor an, als über dem Dachfirst eine Fontäne von Dachschindeln in die Luft spritzte. Während es im Vorgarten Schieferplatten und -splitter regnete, sah ich, wie eine Gestalt in Pink und Blau von innen aufs Dach herausgeschossen kam. Es war eine Frau, schlank, schwarzhaarig und sehr hellhäutig. Sie huschte so perfekt ausbalanciert die Dachrinne entlang, als wollte sie als Spider-Girl gecastet werden.
Dann wirbelte sie herum und sah mich mit schief gelegtem Kopf an. Selbst aus dieser Entfernung konnte ich sehen, dass ihr Mund und Kinn tiefrot gefärbt waren und die Röte auch auf ihr blaues Adidas-Sweatshirt getropft war. Ich glaubte nicht, dass es sich um ihr eigenes Blut handelte.
Aus unseren Informationen erkannte ich sie als Kindermädchen der Williams – und aus der Art, wie sie die Zähne fletschte, von einem Kampf her, den ich vor Jahren im Trocadero Centre gehabt hatte.
Oh Shit, dachte ich. Ich glaube, ich hab mal deine Schwester getroffen.
Nachdem sie uns gesehen hatte, hätte ich erwartet, dass sie sich in den Garten hinter dem Haus verflüchtigen würde. Daher war ich etwas überrascht, als sie sich geradewegs auf mich zukatapultierte.
Nun sind Guleed und ich nette, ordentliche Detectives mit dem entsprechenden Staatsexamen in der Tasche, deren Aufgabe es keineswegs ist, sich mit irgendwem herumzuprügeln. Dafür sind die Bereitschaftskommandos da. Dennoch hatten wir uns eingedenk unserer aktuellen beruflichen Herausforderungen die Zeit genommen, mit Nightingale, Carey und ein paar weiteren Mitgliedern unseres Teams verschiedene Szenarien durchzusprechen. Folgende Grundsätze kristallisierten sich heraus: Nicht nahe rangehen, nicht auf ein Handgemenge einlassen, nichts Riskantes versuchen. Und bloß nicht zögern.
Ich sprang nach rechts und Guleed nach links.
Die Nanny landete auf dem Bürgersteig wie eine Katze, auf eine meiner Meinung nach allen Gesetzen der Physik widersprechende Art und Weise. Egal wie geschmeidig jemand ist – wenn er nach einem Sprung aus dem zweiten Stock so aufkommt, müsste ihm das die Schienbeine durch die Kniescheiben treiben.
Ich brachte hastig einen hübschen brandneuen Nissan Micra zwischen sie und mich, beschwor ein Impello und haute es ihr gegen die Knie. Guleed war über die Gartenmauer gehüpft und hatte bereits den Schlagstock ausgefahren. Ich sah, wie sie sich anspannte, um loszuspringen, während die Nanny längelang hinschlug.
Und sich in einer lässigen Bewegung herumrollte und im nächsten Moment auf die Motorhaube des Micra schnellte. Was ihr ein zweites Impello mitten ins Gesicht einbrachte – dieser Tage fackele ich nicht mehr lange mit dem Nachsetzen. Es fegte sie von der Motorhaube, und sie landete auf dem Rücken, das Gesicht wutverzerrt.
Eine bessere Gelegenheit würden wir nicht kriegen, daher warfen wir uns beide auf sie – Guleed auf die Arme, ich auf die Beine. Kaum war ich nahe genug, trat sie auf mich ein, ihr nackter Fuß traf mich mit Wucht an der Schulter und stieß mich zur Seite. Schon sah ich die nächste schmutzige Ferse auf mein Gesicht zusausen und konnte gerade noch so weit ausweichen, dass sie wieder nur die Schulter erwischte. Vom ersten Tritt war mir die Schulter taub geworden, aber beim zweiten durchzuckte mich brüllender Schmerz. Trotzdem versuchte ich die Nanny an den Beinen zu packen und mit meinem Gewicht am Boden zu halten. Es war wie ein Ringkampf gegen einen Gabelstapler – sie stemmte mich einfach komplett in die Höhe und schleuderte mich rücklings zu Boden.
Ich ließ mich dort nicht häuslich nieder, sondern rollte mich weg – geradewegs in den Rinnstein – und kämpfte mich auf die Füße. Auch die Nanny stand schon wieder, Guleed gegenüber, der es gelungen war, einen ihrer Arme festzuhalten. Während ich zurück ins Getümmel wankte, hieb die Nanny mit der freien Linken nach Guleeds Gesicht. Guleed bog den Kopf zurück, vollführte eine fließende Drehung und schwang ihren Schlagstock. Es entstand ein merkwürdiges Geräusch – wie zerreißende Seide –, dann krachte der Schlagstock der Nanny quer über den Rücken. Sie bäumte sich vor Schmerz auf, und vor meinen staunenden Augen rannte Guleed, immer noch die Hand um den Arm der Nanny gekrallt, auf eine physikalisch eigentlich unmögliche Weise an der Seite des Nissan Micra hinauf und sprang die Nanny mit ihrem ganzen Gewicht an. Diese ging bäuchlings zu Boden.
Ich beschloss, dass das mein Stichwort war, hechtete vorwärts und packte ihre Fußgelenke. Ehe sie reagieren konnte, warf ich mich mit Schwung nach hinten, so dass ihre Beine komplett gestreckt waren. Selbst die stärkste Person kann in so einer Lage nichts ausrichten, wenn sie keinen Hebel hat, und da Guleed ihr auf dem Rücken hockte, hatten wir sie nun beinahe. Wir mussten sie nur so lange festhalten, bis Verstärkung kam. Aber wir hatten noch nicht mal unsere Handschellen draußen, als sie sich zu winden begann wie eine Schlange. Guleed tat ihr Bestes, um sich festzuklammern, aber plötzlich wurde sie hochgeschleudert und krachte in mich hinein, und als wir uns sortiert hatten und wieder auf die Beine gekommen waren, war die Nanny über alle Berge.
»Wo zum Teufel ist Nightingale?«, fragte ich.
Wie wir später erfuhren, rettete er gerade Richard Williams vor dem Verbluten.
»Sie hat versucht, ihm die Kehle durchzubeißen«, erzählte uns Carey.
2Ausgrabungen
Etwas in der Art hätten wir uns auch denken können, als ein Rettungswagen angebraust kam und zwei Sanitäter an uns vorbei ins Haus stürmten. Guleed und ich folgten ihnen nicht, da wir damit beschäftigt waren, die Beschreibung der Nanny an die Einsatzkräfte weiterzugeben, inklusive der Warnung, sich ihr nicht zu nähern, bis Falcon-qualifizierte Beamte eintrafen. Dann requirierten wir einen Einsatzwagen, um hinreichend mobil zu sein, falls sie gesichtet wurde.
Die Mühe hätten wir uns sparen können. Sie schien sich im Sommernachmittag aufgelöst zu haben.
Da wir Falcon-Einsatzteam Nummer 2 waren (Nightingale war Nummer 1), landeten wir schließlich in einem Korridor im University College Hospital, um Richard Williams’ Krankenzimmer zu bewachen, unterstützt von einer ermutigend massiven Personenschutzbeamtin in voller Krawallmontur und mit einer H&K MP5-Maschinenpistole. Sie hieß Lucy und hatte drei Kinder im Alter von null bis fünf Jahren. »Verglichen mit denen«, sagte sie, »ist der Job hier richtig erholsam.«
Für Situationen wie die vorliegende wurde der Personenschutz herangezogen, weil der, anders als die bewaffnete Polizei, auch darin ausgebildet war, Wache zu schieben. Es erfordert schon eine ganz bestimmte Persönlichkeit, um beispielsweise acht Stunden lang im strömenden Regen herumstehen zu können und dabei wach genug zu bleiben, um jemandem in Sekundenschnelle eine Kugel in relevante Körperteile zu jagen.
Nightingale und Carey fahndeten immer noch in Westlondon nach der Bleichen Nanny, und Richard Williams war bis an die Kragenspitzen vollgepumpt mit Schmerz- und Betäubungsmitteln und daher außerstande, uns irgendwas zu erzählen. Wodurch wir zumindest etwas Zeit hatten, um unser Protokoll zu vervollständigen – und ich, um Guleed zu fragen, was es mit dem Geräusch von zerreißender Seide und ihrer kleinen, der Schwerkraft spottenden Parkour-Einlage auf sich hatte.
»Zerreißende Seide?«, fragte sie unschuldig.
»Nicht wirklich ein Geräusch«, erklärte ich. »Ein Vestigium – also, sozusagen der Klang, den Magie macht, wenn du sie wirkst.« Plus der Nachhall, den sie zurücklässt, dachte ich, aber ich versuche meine Kollegen nicht mit Erklärungen zu überfrachten. Nicht einmal Guleed, von der ich den Verdacht hatte, dass sie viel mehr wusste, als sie sich anmerken ließ.
»Ach, das«, sagte sie. Und lächelte.
»Ja, das.«
»Ich hab trainiert.«
»Bei Michael?« Damit meinte ich Michael Cheung, den »Kontakt« des Folly in Chinatown, dessen Visitenkarte ihn als LEGENDÄRENSCHWERTKÄMPFER auswies.
»Das ist genau wie ganz normales Kampfsporttraining«, sagte sie. »Man lernt die Bewegungsabläufe und übt sie – und wird besser.« Sie beugte sich vor. »Und man weiß erst, ob’s funktioniert, wenn man es mal im Ernstfall ausprobiert hat.«
»Und, hat’s funktioniert?«
»Ich glaube schon.«
»Kannst du’s mir beibringen?«
Sie lachte. »Das hat Michael mir ganz ausdrücklich verboten. Egal was du sagen würdest.«
»Warum?«
»Weil Nightingale ihn angerufen und darum gebeten hat.«
»Hat er gesagt, wieso?«
»Weil Sie sich vernünftigerweise erst eine Tradition ganz aneignen sollten, ehe Sie zur nächsten übergehen«, sagte Nightingale, der den Korridor entlangkam.
Carey, der ihn begleitete, warf Guleed und mir einen dankbaren Blick zu. Ich konnte ihn verstehen. Mit Nightingale unterwegs zu sein konnte kräftezehrend sein. Vor allem, wenn er in seinem »Mann der Tat«-Modus war und vergessen hatte, dass es nicht darum ging, gleich mit dem Fallschirm über Deutschland abzuspringen.
Wir hielten im Korridor eine improvisierte Nachbesprechung ab, dann schickte Nightingale uns an unsere jeweiligen Aufgaben. Er selbst wollte Richard Williams’ Tür weiter bewachen in der Hoffnung, dass dort jemand auftauchte und es noch mal probierte.
»Sie hätte David und mich überrumpeln können«, sagte er. »Und doch war es ihr wichtiger, Williams zum Schweigen zu bringen. Das scheint mir darauf hinzudeuten, dass er etwas weiß, wovon Martin Chorley nicht will, dass wir es herausfinden.«
Mehr brauchte er nicht zu sagen. Wenn Chorley es für nötig hielt, Williams deswegen auszuschalten, wollten wir ganz entschieden wissen, was es war.
Guleed mit ihrer mitfühlenden Art und ihrer vernehmungstaktischen Erfahrung wurde damit betraut, Williams’ Frau Fiona zu befragen. Wozu diese unverzüglich in die pastellfarbene Retro-Geborgenheit der Optimales-Vernehmungsergebnis-Suite in Belgravia gebracht wurde, wo Guleed ihr sanft intime Details aus dem Familienleben entlocken sollte, ohne sie zusätzlich zu traumatisieren. Später würde ich die Befragungsmitschnitte auf Falcon-Inhalte prüfen, aber vorerst fuhr ich noch einmal nach Chiswick, um zu sehen, ob es in ihrem trauten Heim irgendetwas Interessantes zu entdecken gab.
Fiona war Frau Nummer zwei; Richard hatte sie kennengelernt, als sie 2011 ein Praktikum in seiner damaligen Firma machte. Das Ganze schien ziemlich schnell gegangen zu sein – mit seiner ersten Frau war er damals erst fünf Jahre verheiratet gewesen. Mit Fiona hatte er zwei Töchter, die während der Befragung im Büro von DI Miriam Stephanopoulos deponiert wurden. Aus der früheren Ehe gab es einen Sohn, der aber bei der Mutter lebte, die nach der Scheidung zurück nach King’s Lynn gezogen war.
Das Haus war schon von einem Spezialistenteam auf geheime Räumlichkeiten und raffiniert versteckte peinliche Besitztümer durchsucht worden – ohne Ergebnis. Sämtliche Computer, Laptops, Telefone und die PlayStation 4 waren zur IT-Auswertung nach Dulwich transferiert worden, wo man sie akribisch in Einzelteile zerlegen würde. Da die Informationsanalytiker dieser Operation aus dem Folly-Budget bezahlt wurden, würden wir ihnen verflixt noch mal auch was zu tun geben.
Ich war also im Grunde nur der Magie wegen hier – die sich oft in voller Sicht verbirgt.
Als staatlich geprüfter Police Detective (wie ich mich seit genau einem Monat offiziell bezeichnen durfte) hänge ich viel in den Wohnungen fremder Leute rum, oft ohne deren Einverständnis. Das Zuhause eines Menschen ist wie ein Zeuge: Es neigt zu Falschaussagen. Aber wie Stephanopoulos sagt, je länger jemand irgendwo wohnt, desto in sich aufschlussreicher werden diese Unwahrheiten. Und für die Polizei kann eine aufschlussreiche Unwahrheit ebenso nützlich sein wie die Wahrheit. Manchmal sogar nützlicher.
Das Erdgeschoss war von vorn bis hinten so gut wie aller Innenwände entledigt worden. In dem offenen Wohnbereich standen eine dreiteilige pseudo-antike Ledersitzgarnitur und ein nierenförmiger Couchtisch mit Glasplatte, auf dem überraschenderweise ein Stapel dicker Couchtischbücher herumlag. Die kleine Unwahrheit bestand darin, dass die Sitzecke auf den möglicherweise original antiken Kamin ausgerichtet war und nicht auf den mittelgroßen Flachbildschirmfernseher. Mit der Flimmerkiste geben wir uns gar nicht ab, schien der Raum zu sagen. Aber der Stapel DVDs und die Tatsache, dass beide Fernbedienungen – die des Fernsehers und die des BluRay-Players – auf dem Couchtisch lagen, entlarvten ihn als Lügner.
So weit die kleine Unwahrheit.
Die große bestand in der gänzlichen Abwesenheit von kaputtem Spielzeug, bekritzeltem Papier und angebissenen Süßigkeiten. Nein, in diesem Haus gibt es keine schmutzenden, trotzigen, innovativ-kreativen kleinen Menschlein. Wir leben in einer Oase der Ruhe und Ordnung.
Nun bin ich nicht nur der Sohn einer professionellen Reinigungskraft, sondern auch mit so vielen minderjährigen Cousins und Cousinen gesegnet, dass der durchschnittliche UKIP-Wähler nach Spanien auswandern möchte, und ich weiß ganz genau, dass hier unten mehr Chaos herrschen sollte. Blutrünstige Kreatur der Nacht hin oder her, als Nanny musste unsere flüchtige Verdächtige echt gut gewesen sein. Oder aber sie hatte die Kids mit traumatisierender Härte zur Ordnung gedrillt – um das herauszufinden, würden wir wohl einen Kinderpsychologen heranziehen müssen. Ich machte mir eine Notiz, dass ich darauf achten musste, ob Guleed das Thema bei ihrer Wohlfühl-Befragung angeschnitten hatte.
Die Küche war so eine Edelstahlmonstrosität, die aussah, als eigne sie sich eher dazu, Viren zu Kriegszwecken zu züchten, als ein Abendessen zu kochen. Nur zur Sicherheit schaute ich nach, ob im Kühlschrank vielleicht Petrischalen standen – nichts. Hingegen eine erfreuliche Menge gesunder Joghurts für die Kleinen und ungezuckerte Fruchtsäfte aus echten Früchten.
Wartet nur ab, bis sie erstmals in Kontakt mit richtigen Kindern kommen, dachte ich, dann schreien sie bis in alle Ewigkeit nach Schokoriegeln und Chips.
Die grauen italienischen Fliesen waren blutverschmiert, und gelbe Beweismarker zierten Boden und Arbeitsfläche. Eine diagonale Spur von Blutspritzern an einer Wand verriet, wo Nightingale die Nanny von Richard Williams weggezerrt hatte.
Nach Nightingales Worten hatte man sich gerade zu einer freundlichen, aber subtil beunruhigenden Plauderei im Wohnzimmer niedergelassen, als Richard Williams in die Küche ging, um Kaffee zu machen. Dabei hatte er sich so verdächtig verhalten, dass Nightingale aufgestanden und ihm nachgegangen war – da hörte er ein Krachen und einen Schrei.
»Wer genau schrie, war nicht auszumachen«, sagte er.
Dem zuvor festgelegten Operationsplan gemäß hatte sich Carey sofort nach oben zu Fiona und den Kindern begeben, während Nightingale sich mit dem befasste, was für die Schreie verantwortlich war. Im Flur war er auf die Nanny gestoßen, die die Zähne in Richard Williams’ Hals geschlagen hatte. Wir vermuteten, dass sie ihm eigentlich an die Kehle wollte, aber er konnte sich noch wegducken, und sie riss ihm stattdessen ein großes Stück aus dem rechten Trapezmuskel. Eine zweite Chance ließ Nightingale ihr nicht – er schleuderte ihr ein Impello in die Kniekehlen, um sie dann zu Boden zu zwingen.
Da war sie herumgewirbelt und weggerannt – vernünftigerweise hatte sie es nicht mit Nightingale aufnehmen wollen. Aber warum die Treppe hinauf? Warum nicht zur Vorder- oder Hintertür hinaus? Dann hätte sie über den Gartenzaun in den Nachbargarten und durch die angrenzenden Gärten weiterflüchten können bis zum Ende der Straße. So schnell wie sie sich bewegte, bezweifelte ich, dass unsere ringsum stationierten Teams sie überhaupt bemerkt hätten.
Auf der Treppe gab es weitere Blutstropfen und am Geländer einige rote Handabdrücke. Ich zog meine Spurensicherungs-Überschuhe an, um sowohl den Tatort als auch meine Schuhe vor unerwünschten Spuren zu bewahren, und stieg hinauf.
Das Obergeschoss war ehrlicher als der Wohnbereich. Im Elternschlafzimmer stand ein maßgefertigtes riesiges Doppelbett mit geschnitztem weißem Kopf- und Fußteil. Auf dem polierten Boden lagen genau wie im Erdgeschoss raue Webteppiche aus roten, blauen und gelben Rechtecken. Sichtbare Bücherregale gab es keine, was mich immer etwas irritiert, ebenso wenig Bücher neben oder auf dem Bett. Ich war mir ziemlich sicher, dass das ungewöhnlich war für Leute, die in einem »kreativen Beruf« arbeiteten, aber vielleicht hatten sie sich aus Platzgründen komplett auf eBooks verlegt.
Die Wände waren im selben ins Knallweiße spielenden Mattweiß gestrichen wie die im Wohn- und Esszimmer. Die Farbe sah frisch aus, und als ich die dunkle Ecke hinter dem Bett genauer untersuchte, fand ich kleine Farbnasen an den am schwersten zu erreichenden Stellen über der Fußbodenleiste. Hier war erst vor Kurzem gestrichen worden – und zwar in Schwarzarbeit, denn in den offiziellen Ausgaben der Familie war nichts dergleichen aufgetaucht. Das Haus war für baldige Makler- und Hausbesichtigungstermine vorbereitet worden. Die Williams planten zu verkaufen und hatten schon angefangen auszumisten. Ich nahm mir vor, in den Charity-Shops der Umgebung nachzuprüfen, ob sie dort Bücher hingebracht hatten.
Auf dem Beistelltisch im anschließenden Badezimmer lag neben einer sauber aufgeschichteten Pyramide aus Klopapierrollen ein Exemplar von Ishiguros Der begrabene Riese. Die Klappe des Schutzumschlags steckte zwischen Seite 14 und 15, doch auf dem Cover hatte sich schon eine dünne Staubschicht gesammelt. Netter Versuch, dachte ich, aber so wird das nichts.
So deutlich man dem Elternschlafzimmer den bevorstehenden Auszug anmerkte, so klar machte das Kinderzimmer, dass den Mädchen noch niemand was davon gesagt hatte. Ich war schon in genug Wohlstandseigenheimen gewesen, um mich nicht über die Massen von Spielzeug der Kinder dort zu wundern. Haufenweise Gesellschaftsspiele und Ausmalbücher und Flugdrachen und Puppen und lebensgroße Teddybären. Außerdem besaßen die Mädchen einen Industriecontainer voller Lego und genug Barbies, Kens und deren billigere Imitate, dass man mit ihnen einen ausgewachsenen Stop-Motion-Film hätte drehen können. Hier war es sauber, aber nicht aufgeräumt, was mich erleichterte, weil ich wirklich angefangen hatte, mir Sorgen über die Disziplinvorstellungen der Nanny zu machen.
Und das sage ich als Sohn einer afrikanischen Mutter.
Das Etagenbett erstaunte mich ein wenig – wie sich herausstellte, hatte Richard Williams sich das hintere Kinderzimmer als Arbeitszimmer reserviert.
Auch hier war kürzlich gestrichen worden, aber mittels der verfüllten Dübellöcher in der Wand konnte man noch nachvollziehen, wo die Hängeregale gewesen waren. Unter dem Fenster, wo das Licht am besten war, stand ein kleiner Klapptisch aus hellem Holz mit verschiedenen Lade- und Verbindungskabeln drum herum; die zugehörigen Geräte hatten die Kollegen eingesackt und abtransportiert. Eine Reihe von Kartons war von den Spezialisten geöffnet worden; der Inhalt war sauber auf dem Boden aufgeschichtet und wartete auf genauere Inspektion.
Das meiste sah aus wie die Ausbeute eines Jahrzehnts an Rechnungen, Strom- und Wasserabrechnungen und Versicherungsbescheiden. Das würde alles in unserem Annex landen. Ein Stapel bedruckter Papiere erregte meine Aufmerksamkeit. Zuerst hielt ich sie für Broschüren oder Firmenprospekte, aber tatsächlich waren es Ausgrabungsberichte der MOLA – der Museum of London Archaeology. Schmalformatige technische Dokumentationen mit Spiralbindung und Pappdeckel, innen voller hübscher Schemazeichnungen und mindestens dreißig Seiten Endnoten.
Auch Martin Chorley hatte Interesse an Archäologie, und romantische Vorstellungen vom finsteren Mittelalter dazu. Ich fragte mich, ob da eine Verbindung bestand.
Als eigener Stapel lag da außerdem ein Teil eines Filmdrehbuchs, das die Spezialisten unter den Versicherungsscheinen vergraben gefunden hatten. Es war, wie man mir später sagte, professionell formatiert und wurde von einem metallenen Heftstreifen für gelochte Blätter zusammengehalten, wie sie bei angehenden Drehbuchautoren beliebt sind. Im Heftstreifen steckten noch kleine Papierfetzen, die davon zeugten, dass der fehlende Teil des Manuskripts mit Gewalt herausgerissen worden war. Verblieben waren nur die ersten fünfzehn Seiten. Ich las den Titel.
WIDERDIEFINSTERNIS
Von Richard Williams & Gabriel Tate
Nach einer Idee von John Chapman
Die erste Szene auf der nächsten Seite begann folgendermaßen:
FADEIN
AUSSEN – RUINENDESRÖMISCHENLONDON – SPÄTERABEND
Das genügte mir schon völlig, um im Annex anzurufen und einen umfassenden polizeilichen Datencheck für Gabriel Tate und John Chapman in Auftrag zu geben. Da ich lediglich deren Namen und die Tatsache zu bieten hatte, dass ein Zusammenhang mit Richard Williams bestand, war die Reaktion missmutiges Gebrummel, aber das Gute an Operation Jennifer war, dass wir jetzt massenhaft Leute für genau solche Aufgaben hatten.
Ich stieg in den ausgebauten Speicher hinauf und wurde des Lochs im Dach ansichtig, durch das Nightingale die Bleiche Nanny geworfen hatte.
Der scharfe Nachhall des Vestigium war immer noch zu spüren, und auf der Zunge bemerkte ich einen knackigen Zitronengeschmack. Vielleicht war das aber keine Magie, sondern bloß der Badreiniger, den sie hier verwendeten.
»Ich holte sie ein, als sie zum vorderen Fenster hinauswollte«, hatte Nightingale erzählt. »Es gibt einen recht guten Zauber, mit dem man jemanden an einer Stelle fixieren kann.« Sofort hob er die Hand, damit ich gar nicht erst fragte. »Nächstes Jahr. Nächstes Jahr werden Sie reif sein, um ihn zu lernen. Und da unsere Verdächtige sich freistrampeln konnte, erwies er sich als weniger nützlich, als man denken sollte.«
Nightingale ist sprachlich gern präzise, wenn er also freistrampeln sagt, meint er auch freistrampeln.
»Es war eine magische Komponente daran«, sagte er, als ich ihn bat, das näher zu erläutern. »Ich fürchte, als Reaktion darauf wandte ich mehr Kraft an als nötig.«
Trotzdem war das Impello etwas weniger spektakulär gewesen, als es auf den ersten Blick wirkte, da der Dachgeschossausbau eher windig ausgeführt war: dünne Gipskartonplatten, große Abstände zwischen den Dachbalken und billige Dachlatten. Den größten Teil des Sachschadens hatte vermutlich der Zauber verursacht; unsere Bleiche Nanny war irgendwie auf der Woge der Kraft mit nach oben gesurft.
Durchaus beeindruckend, was Nightingale nicht entgangen war. Er wäre ihr aufs Dach gefolgt, aber in jenem Moment war es wichtiger gewesen, zurück nach unten zu eilen und dafür zu sorgen, dass Richard Williams nicht verblutete.
»Diese hier scheint weit fähiger zu sein als das Individuum, das Sie in Soho getroffen haben«, sagte er.
Aber wer war »diese hier«?
Bei unserer anfänglichen umfassenden Überprüfung der Personen im Haushalt der Williams war sie als Alice McGovern aus Leith, Schottland, angegeben gewesen. Als das Rechercheteam aus Belgravia die echte Alice schließlich fand, stellte sie sich als Heroinabhängige heraus, die ihre Identität an eine Bande aufgeweckter Informationshändler verkauft hatte. Solche Banden verlegen sich gern auf Drogensüchtige, weil diese gewöhnlich danach streben, nicht aufzufallen, und entgegen der Meinung der meisten Leute sehr lange Zeit unter dem Radar der Behörden leben können.
Im Dachgeschoss gab es zwei Schlafzimmer und ein Bad. Das hintere Zimmer war zum Spielzimmer der Mädchen bestimmt worden. In der Mitte, wo das Licht aus dem Fenster hinfiel, stand ein schon halb demoliertes Kinderhaus aus Segeltuch und Bambus. Es gab weitere Regale voller Spielsachen, Puzzles und Bilderbücher, in der Ecke ein Kissenlager für den Mittagsschlaf, und von einem Haken an der Rückseite der Tür hingen zwei rosa Feenkostüme.
Im vorderen Schlafzimmer lag ein Geruch, der mich an die Zeit erinnerte, als ich mit einem halben Dutzend weiterer junger PCs in einem Haus wohnte, und an die Studentenbuden, die ich seither betreten habe. Ein Hauch alter Schweiß und Essensreste und übervolle Tretmülleimer. Das eins vierzig breite Bett der Nanny war ungemacht, und ein Schnuppern sagte mir, dass die Bettwäsche schon seit zwei Wochen nicht gewechselt worden war. Wer auch immer im übrigen Haus saubermachte, in dieses Zimmer hatte er keinen Fuß gesetzt.
Es war im gleichen Mattweiß-Weiß gehalten wie das Erdgeschoss, und die Möbel kamen vermutlich vom Schlussverkauf bei Ikea. Etwa die Hälfte der Klamotten der Bleichen Nanny hing über einem Stuhl mit gerader Lehne und dem dazugehörigen Schreibtisch. Der Rest war ohne ersichtliche Ordnung in mehrere Kommoden gestopft worden. Ihre bevorzugte Kleidung bestand aus Trainingshosen, T- und Kapuzenshirts in Pink, Himmelblau und Marine, und ihre Unterwäsche war praktisch und billig.
Warum war sie nach dem ersten Zusammenstoß mit Nightingale die Treppe hinaufgerannt, statt zur Tür hinauszuflüchten? War in ihrem Zimmer etwas gewesen, was sie noch holen wollte, etwas Wichtiges? Oder ein Erinnerungsstück?
Noch einmal durchsuchte ich die Kommoden, fand darin aber nur einen akuten Mangel an mysteriösen Fotografien.
Ich setzte mich aufs Bett und schaute mich von dort aus im Zimmer um. Nichts sprang mich auf Anhieb an, aber so wie mein Tag bisher verlaufen war, war das vermutlich nur gut so.
3Mehr Peperoni
»Vielleicht wollte sie ihr Handy holen«, sagte Bev. »Ich wette, daran hast du nicht gedacht.«
»Wir haben kein Handy gefunden«, sagte ich. Es stimmte: Daran hatte ich nicht gedacht.
Wir standen in Bevs riesiger Küche und kochten Pasta mit allem, was uns im Kühlschrank in die Hände fiel. Ich briet in einer Pfanne Zwiebeln und Knoblauch an, während Bev das Hackfleisch auftaute, indem sie es drohend anstarrte. Sie hat das schon öfter gemacht, es dauert weniger als eine Minute. Meine derzeitige Arbeitshypothese ist, dass sie die Wassermoleküle mit ihrem Blick in einen Zustand erhöhter Anregungsenergie versetzt. Irgendwann würde ich das Hackfleisch wahnsinnig gern mal verdrahten, um genaue Messwerte zu erhalten, aber Bev lässt mich nicht. Sie sagt, eine Göttin sollte sich ein paar Geheimnisse bewahren. Aber ich habe den Verdacht, dass sie sich das für ihre Doktorarbeit reservieren will. Einmal versuchte ich die Forschung voranzubringen, indem ich sie von hinten umschlang und auf den Nacken küsste in der Hoffnung, dass hierdurch das Hackfleisch in Flammen aufgehen würde. Leider passierte das nicht, aber Bev duftete gut, und überhaupt ist in der Forschung ein negatives Ergebnis fast so gut wie ein positives. Und egal wie anstrengend es in verschiedenen Lebenslagen werden mag, Beverley zu küssen, dem Fortschritt zuliebe bin ich gern bereit, es weiter zu betreiben.
Aus dem Garten hinter dem Haus ertönte ein Kreischen. Abigail und Nicky waren am Flussufer und stellten dort irgendwas Jugendliches an, dessen genauere Umstände mir zum Glück nicht bekannt waren. Zuvor war Beverley mit den beiden in Runnymede Insekten fangen gewesen – Teil unseres laufenden Projekts, Abigail während der Sommerferien davon abzuhalten, in Schwierigkeiten zu geraten.
Als das Fleisch sachte zu dampfen begann, zerteilte Beverley es mit einem Holzspatel und gab es in die Pfanne, wo ich es beim Brutzeln weiter beaufsichtigte.
»Ich wünschte, wir wüssten, was die Bleiche Nanny ist«, sagte ich.
»Du kannst sie nicht Bleiche Nanny nennen«, sagte Beverley, die dabei war, im Vorratsschrank nach etwas zu fahnden, was im weitesten Sinne mit Tomaten zu tun hatte. »Die Bleiche Lady ist stromaufwärts eine sehr spezifische Person, und ihren Namen so leichtfertig zu gebrauchen ist ein Fehler.«
Wenn Bev auf diese Art Fehler sagt, hat das eine ganz bestimmte Bedeutung. Und zwar, dass es eine buchstäbliche Woge der Empörung und sonstige drastische Folgen nach sich ziehen könnte, und damit meine ich nicht in den sozialen Medien.
»Ash hat die in Soho aber als Bleiche Lady bezeichnet«, sagte ich. Wobei sie ihn da gerade auf ein meterlanges Stück Eisen gespießt hatte, also war er in dem Moment nicht unbedingt das, was man unter einem zuverlässigen Zeugen verstehen würde.
Beverley war fündig geworden: Eine Dose geschälte Flaschentomaten hatte sich hinter zwei Monsterdosen mit Kichererbsen versteckt gehalten, von denen ich bezweifelte, dass in diesem Haus jemals jemand so hungrig sein würde, um sie zu kochen.
»War das nicht eine Art Chimäre?«, fragte sie, während sie in einer Schublade nach dem sauberen Dosenöffner wühlte. »Das sagte Abdul doch?«
Dr. Abdul Haqq Walid war der assoziierte Teilzeit-Kryptopathologe des Folly und Sammler seltsamer Spezies. Vor einiger Zeit hatten wir die nötige Kohle zusammengekratzt, um ihm eine qualifizierte Assistentin zur Seite zu stellen, und Dr. Jennifer Vaughan hatte das letzte Jahr damit verbracht, alles komplett neu zu klassifizieren.
»Jennifer meint, ›Chimäre‹ sei nicht unbedingt ein hilfreicher Begriff«, sagte ich. »Und ich stimme ihr zu. Ich glaube, die Lady aus Soho und die Bleiche Nanny waren Hohe Fae.«
Beverley schnaubte. Es war nicht unbedingt hilfreich, dass sie und der Rest der Demi-monde sich ebenfalls nicht auf eine Terminologie einigen konnten.
Das Hackfleisch war gut angebraten, also schaltete ich die Platte aus, damit es nicht verbrannte, und Bev kippte die Tomaten hinein und schaute sich nach etwas Peperoniartigem um.
Unter den Herren Zauberern der Gesellschaft der Weisen hatte es jede Menge Theorien und Klassifizierungssysteme für die Mitglieder der Demi-monde gegeben, von denen die meisten aus einer Mischung aus Latein, Griechisch und falsch interpretiertem Darwinismus bestanden. Fae war bei ihnen das Wort für alles, was vage magisch war und nicht die richtige Schule besucht hatte, und Hohe Fae waren jene Wesen, die in der mittelalterlichen Literatur erwähnt wurden und sich durch burgen- und schlossähnliche Wohnsitze, eine handfeste feudale Organisationsstruktur und das unerklärliche Bedürfnis auszeichneten, tugendhafte christliche Ritter zu ehelichen.
Ich war mir ziemlich sicher gewesen, dass all das reine Folklore war, bis ich eines heißen Sommertags beinahe selbst dauerhaft ins Feenreich entführt worden wäre – das mir verdächtig nach einer Paralleldimension aussah oder wie auch immer die Kosmologen das momentan nennen. Bev rettete mich übrigens damals, weshalb ich mich seither nie mehr mit ihr streite, wer die Spülmaschine ausräumen muss.
Die beste Einteilung, die ich je hörte, kam von dem selbsternannten Halb-Fae Zachary Palmer. Er hatte einmal zu mir gesagt, es gebe im Grunde drei Sorten von Leuten. Diejenigen, die magisch geboren wurden, was für die meisten Fae galt; diejenigen, die sich die Magie aus eigener Kraft aneigneten, so wie ich, Nightingale, alle anderen Praktizierenden und offenbar auch angehende legendäre Schwertkämpferinnen wie Guleed … Und die letzte Gruppe waren diejenigen, die durch Magie verändert worden waren, oft gegen ihren Willen. Ich wusste von erwiesenen Fällen, in denen Kinder in Kontakt mit dem Feenreich gekommen und mit einer anderen Augenfarbe und magischen Fähigkeiten zurückgekehrt waren. Dann gab es jene, die von skrupellosen Praktizierenden in monströse Mischwesen verwandelt worden waren – echte Cat-Girls und Tiger-Boys. Wie schon gesagt, das mit den Verbrechen gegen die Menschlichkeit war nicht übertrieben.
Und schließlich gab es mindestens eine Person, deren Geist und Körper von einem Wiedergänger oder möglicherweise dem Geist eines Gottes besessen gewesen war und die sich dadurch »verändert« hatte. Aber ich klammere mich an den Glauben, dass Biologie nicht gleichbedeutend mit Schicksal ist und wir mehr sind als die Marionetten unserer endokrinen Drüsen – was hätte das alles sonst für einen Sinn?
Beverley schnupperte an der Sauce und krauste die Nase.
»Bist du dir ganz sicher, dass du nirgends Tomatenmark hast?«, fragte ich.
Es war wirklich keines da. Also griffen wir auf den altehrwürdigen Brauch zurück, so lange Peperoni reinzuwerfen, bis es wie etwas schmeckte, was meine Mum gekocht haben könnte.
Wir deckten den Tisch in der Küche und riefen die Mädchen rein.
»Erst Hände waschen«, brüllte Beverley, als Nicky und Abigail angestürmt kamen. Abigail war fünfzehn, klein und mager und beherzte Vorreiterin des hypothetischen Trends, den Afro wieder modisch oder zumindest unvermeidbar zu machen. Außerdem war sie auf nebulös semi-offizielle Art meine Mitauszubildende – nachdem sie einen hastig etwas abgeänderten Lehrlingseid abgelegt hatte, in Anwesenheit und mit schriftlicher Einwilligung ihrer Eltern. Die mich beide persönlich für ihre Sicherheit verantwortlich machten, was absolut gerechtfertigt und für mich extrem unbehaglich war.
Ich sah, wie sie vor der Terrassentür stehenblieb und Nicky die Hände hinhielt.
Welche zwar erst neun Jahre alt, aber die Göttin des Flusses Neckinger war und als solche eine wackelige kopfgroße Wasserkugel heraufbeschwor, in der sich beide Mädchen die Hände wuschen. Nach einem Fingerschnippen verdampfte die Kugel – zurück blieben saubere, trockene Hände.
Abigail bemerkte meinen Blick und zwinkerte mir zu.
Die Lehrer der naturwissenschaftlichen Fächer hatten mitbekommen, dass Abigail sich für Latein und Geschichte interessierte, und versuchten sie jetzt aus Angst, ihre Starschülerin an die Geisteswissenschaften zu verlieren, mit Zusatzkursen am Nachmittag zu ködern. Es war klar, dass sie zu gegebener Zeit freie Uni-Wahl haben würde – von Oxford bis Edinburgh, vom Imperial College bis Manchester.
Ich persönlich hielt es für das Beste, wenn sie in London bleiben würde, wo ich ein Auge auf sie haben konnte.
»Was, du hast Angst, dass sie nach Edinburgh geht?«, hatte mich Beverley gefragt. »Ich würde mir eher Sorgen machen, dass sie nach Massachusetts abhaut.«
Aber ob es in Massachusetts auch so viele Geister gab wie in London?, fragte ich mich, als Abigail beim Essen von dem letzten Schwung Geistersichtungen erzählte. Ungeachtet des Mangels an empirischen Beweisen war sie überzeugt, dass es da einen Zuwachs gab.
»Was ist mit Brents Pferden?«, fragte Bev.
Brent war eine weitere Schwester von Beverley – ihr Fluss lag in Westlondon, aber da sie erst sieben war, wohnte sie abwechselnd bei ihrer Mutter und ihrer Schwester Fleet. Ich hatte Beverley mal gefragt, wie das bei ihnen funktionieren konnte, fast wie ein normaler Mensch aufzuwachsen, aber sie schien die Frage nicht zu verstehen.
Jedenfalls hatte Brent sich im Frühling beklagt, dass da Pferde in ihrem Fluss wären. Da ich nichts dergleichen finden konnte, hatte ich Abigail auf die Sache angesetzt. Auch sie fand nichts heraus, außer dass dort, wo die A315 den Brent überquert, etwa auf Höhe des Premier Inn, eine kleinere Schlacht des englischen Bürgerkriegs stattgefunden hatte, die so ausging, dass die Parlamentarier die Flucht ergriffen und die Royalisten das Städtchen Brentford plünderten. Womit sie zugleich ihre generellen Absichten bezüglich Londons bekannt gaben, was in den Worten eines Historikers signifikant zur Entschlossenheit der Londoner beitrug, die Hauptstadt zu verteidigen.
Die royalistische Kavallerie hatte bei der Schlacht stark mitgemischt, und wir gruben ein paar Berichte aus dem 18. Jahrhundert über geisterhafte Reiter aus, aber weder Abigail noch mir begegnete das, was Brent so erschreckt hatte.
Nach dem Abendessen musste ich Abigail zurück nach Kentish Town bringen. Ich überlegte, ob ich dann wieder den ganzen Weg zurückfahren sollte, um die Nacht mit Bev zu verbringen, aber am nächsten Morgen musste ich früh aufstehen.
Zumindest gab es beim Abschied ein bisschen Geknutsche auf der Türschwelle, mit Gekicher von Nicky und einem Schnauben von Abigail im Hintergrund.
»Du hast ein total blödes Grinsen im Gesicht«, sagte Abigail, als wir ins Auto stiegen.
»Das kommt daher, dass ich verliebt bin«, sagte ich – was den zweifachen Vorteil hatte, dass es erstens die Wahrheit war und ihr zweitens für den gesamten Heimweg die Sprache verschlug.
4Die Gesellschaft der Weisen
Ende des achtzehnten Jahrhunderts befand sich London schon mitten in der wilden, vom Rausch der Technik getriebenen Expansionsphase, die erst in den 1940er Jahren mit der Schaffung des Metropolitan Green Belt zum Stillstand kam. Seither blicken die Stadtentwickler zähneknirschend voller Neid auf jene Zeiten zurück, als es einem Einzelnen noch möglich war, nur mit seinem Verstand und einem gewaltigen Familienerbe bewaffnet das Erscheinungsbild der Stadt fundamental zu prägen.
Wie damals, als der fünfte Herzog von Bedford feststellte, dass sein Landsitz auf drei Seiten vom Regency-London umzingelt war, und zu dem Schluss kam, dass ihm wohl nichts anderes übrig blieb, als den alten Gemüsegarten einzustampfen und dabei ordentlich abzusahnen. Er engagierte den legendären Architekten und Stadtplaner James Burton, der sehr auf elegante Plätze, diese neumodischen Fenster im französischen Stil und rudimentäre Balkone mit dekorativen schmiedeeisernen Brüstungen stand.
Den einzigen Hemmschuh auf dem Weg zum Fortschritt stellte das seltsame Häuflein von Gentlemen dar, die sich seit Neuestem in dem pseudomittelalterlichen Turm trafen, den ein früherer Herzog hatte bauen lassen, um seinem Garten etwas mehr Dramatik zu verleihen. Es schien sich um eine Art Geheimbund zu handeln, allerdings waren die Gentlemen bei gewissen Mitgliedern des Hofes sehr beliebt – insbesondere bei Königin Charlotte.
Als Gegenleistung dafür, dass er den Turm abreißen durfte, erklärte James Burton sich bereit, an der Südseite des Platzes ein prachtvolles Haus in das bauliche Ensemble einzubinden. Es sollte in der Art des berühmten Herrenclubs White’s gebaut werden und über einen Vorlesungssaal, eine Bibliothek, einen Speisesaal, einen Lesesaal und reichlich Zimmer für zu Gast weilende Mitglieder verfügen. Das Atrium, das den Mittelpunkt bildet, ist so eindrucksvoll, dass es heißt, es habe Sir Charles Barry als Inspiration gedient, als dieser vierzig Jahre später den bekannteren Reform Club entwarf.
Das war die Geburtsstunde des Folly.
Und alles für einen Appel und ein Ei.
Nicht umsonst wurde Sir Victor Casterbrook, der erste wirklich respektable Präsident der Gesellschaft der Weisen, gelegentlich der Gänserupfer genannt – allerdings vermutlich nur dann, wenn er es nicht hörte.
Übrigens erklärt das auch, warum er außer Sir Isaac Newton die einzige weitere Person ist, deren Büste das Atrium ziert.
Ich habe ein Zimmer im Dachgeschoss mit nettem Blick zur Straße, ein paar Bücherregalen und einem Gaskamin, der in den ursprünglichen offenen Kamin eingebaut wurde. Im Winter hört man den Wind um die Schornsteine heulen, und wenn man alle vier Flammen über Nacht voll aufdreht, kann man sogar eine Zimmertemperatur über null Grad erzielen. Zu Beginn meiner Lehrzeit wohnte ich hier ständig, aber inzwischen traut mir Nightingale zu, meine Schnürsenkel selber zu binden, deshalb verbringe ich etwa die Hälfte meiner Nächte bei Beverley. Vor allem im Winter.
Bev nennt das Folly manchmal mit hochgestochenem Akzent meinen Londoner Club, aber offiziell ist es an die Metropolitan Police vermietet und wird als ganz normales Revier behandelt – es hat einen Codenamen, »Zulu Foxtrot«, und so weiter. Was ihm leider fehlt, sind dem gesetzlichen Standard entsprechende Arrestzellen, sonst hätten wir unsere Verdächtigen hier einsperren und Mollys Kochkünsten aussetzen können, bis sie entweder gestanden oder platzten.
Seit Operation Jennifer in die Gänge gekommen war, hatte ich mir angewöhnt, früh aufzustehen und erst einmal eine Stunde im höchsteigenen Fitnessraum des Folly zu verbringen. Gut, die Einrichtung stammt aus den dreißiger Jahren, daher mangelt es ihm an Crosstrainern, Steppern und Hanteln, die nicht einfach aus einem grob behauenen Stück Roheisen bestehen. Aber es gibt einen Punchingball, der nach Segeltuch, Leder und Leinöl riecht, den bearbeite ich gern und stelle mir dabei vor, ich wäre Captain America. Oder sagen wir mal, sein schlauerer kleiner Halbbruder.
Neben dem Fitnessraum befindet sich die einzige wirklich funktionierende Dusche im ganzen Gebäude, und wenn ich Molly zwölf Stunden vorher Bescheid sage, kommt auch zehn Minuten lang heißes Wasser. Irgendwann hatte ich den Vorschlag gemacht, mal ein paar Rumänen kommen zu lassen und unsere sanitären Einrichtungen gründlich zu sanieren, aber anscheinend darf man an den Rohren und Leitungen nichts ändern.
»Und ganz abgesehen von allem anderen, Peter«, hatte Nightingale gesagt, »wenn Sie einmal damit anfangen, wer weiß, wo Sie aufhören würden?«
Nach der Dusche musste ich mich an dem Bürocontainer, unserem »Annex«, der die Hälfte des Hofs einnahm, vorbeiquetschen, um die schmiedeeiserne Wendeltreppe zur Tech-Gruft emporsteigen zu können – dem Ort, an dem ich all mein technisches Equipment und den letzten Rest Star Beer aufbewahre. Dort schaute ich nach, ob meine Airwaves aufgeladen waren, und machte drei Wegwerfhandys funktionsbereit – was die anging, hatten wir tendenziell einen hohen Verbrauch. Die Notizen, die ich am Vortag gemacht hatte, tippte ich an meinem Offline-PC ab und druckte sie einmal auf Papier zur Weitergabe aus. Es war gerade Viertel nach sieben, als ich mich wieder an dem Container vorbeizwängte und durch die Hintertür zurück ins Folly ging.
Aus komplizierten und unnötig mystischen Gründen kann man ins eigentliche Folly keine modernen Datenleitungen legen. Deshalb befindet sich die Tech-Gruft auf dem Dachboden über dem alten Kutschenhaus, und deshalb stellten wir die dringend benötigte Organisationszentrale für Operation Jennifer letztendlich in Form dieses Bürocontainers auf den Hof. Unten im Kutschenhaus wäre kein Platz dafür gewesen – dort standen der Jaguar, der Ferrari und das dämonischste Spukauto Großbritanniens.
Nightingale traf ich im Atrium, wo bereits das Personal von Operation Jennifer durch die Vordertür hereintröpfelte und schnurstracks zum Speisesaal marschierte, wo Molly das Frühstück servierte. Eigentlich hatte die Speisung der Fünftausend nicht auf unserem Plan gestanden, aber angesichts so vieler Leute im Folly musste irgendwas in Mollys Gehirn passiert sein, und am dritten Morgen hatte sie den Speisesaal wiedereröffnet und führte nun mit unerbittlicher Hand das Regiment über Frühstück und Mittagessen sowie den Nachmittagstee mit Kuchen und Keksen. Irgendwo auf einer Budgettabelle häuften sich vermutlich die roten Zahlen, aber das war nicht mein Problem – jedenfalls bis jetzt noch nicht.
»Sie sind alle so lächerlich jung«, sagte Nightingale.
»Sie«, das waren in der Hauptsache Polizeiangestellte, also das, was wir nicht mehr Zivilkräfte nennen dürfen – Analytiker und Datenspezialisten, die den Laufpass bekommen hatten, als die Regierung befand, dass Sparmaßnahmen bei der Polizei genau das waren, was London angesichts der verschärften Sicherheitslage wirklich brauchte. Dazu kamen erfahrene Beamte vom Mordteam Belgravia und aus anderen Spezialeinheiten, alle sorgsam von DI Stephanopoulos ausgewählt im Hinblick auf Verlässlichkeit, Kompetenz und Diskretion.
Alle hatten sich schriftlich zur Wahrung des Amtsgeheimnisses verpflichtet und waren zweimal auf Herz und Nieren geprüft worden – einmal von der Met und einmal von mir.
Aus dem Speisesaal kam Guleed, eine Kaffeetasse in der Hand, und gesellte sich zu mir.
»Also, wenn jedes Revier so eine Kantine hätte«, bemerkte sie, »wäre die Arbeitsmoral garantiert deutlich höher.«
»Wir könnten ja aus Mollys Küche ein eigenes Unternehmen machen und ein paar Verträge abschließen«, sagte ich. »Dann kann Molly nach Herzenslust kochen und wir sanieren unser Budget.«
Nightingale nickte nachdenklich. »Interessanter Gedanke.«
»Was? Das sollte ein Scherz sein.«
»Ah. Verstehe«, sagte er. Und verschwand zur Frühbesprechung.
Guleed versetzte mir einen Klaps auf den Arm. »Lern endlich, wann du besser den Mund hältst.«
Darauf wahrte ich klugerweise Schweigen und machte mich auf, um mir auch einen Kaffee zu holen.
Der Salon des Folly war ein langgestreckter Raum gleich neben dem Foyer, der als Ort konzipiert worden war, wo Ehefrauen, Töchter und andere angemessen standesgemäße Gäste von den Mitgliedern empfangen werden konnten, während ihnen zugleich deutlich signalisiert wurde, dass sie im eigentlichen Folly nicht willkommen waren. Immerhin, die Ausstattung war hübsch: Eichentäfelung, Porträts von Sir Isaac Newton, Königin Charlotte und dem fünften Herzog von Bedford sowie einige prächtige Polstermöbel zweiter Wahl.
Zu Anfang von Operation Jennifer hatten wir die meisten Möbel in den Speicher geschafft, von den restlichen die Schonbezüge abgezogen und außerdem ein paar von diesen generischen Büroarbeitsplätzen aufgestellt, die für den modernen Polizeibeamten lebensnotwendig sind. Oder zumindest unumgänglich. Die Reihe hoher Schiebefenster in der einen Wand hätte für reichlich natürliches Licht gesorgt, hätten wir nicht Aluminiumjalousien anbringen müssen, damit niemand mehr reinschauen konnte. Daher bekamen die Wände umlaufende LED-Leuchten, die wir an die einzige Steckdose anschlossen, über die der Raum verfügte. Glücklicherweise gab es hier keine Computer, also liefen wir nicht Gefahr, die Elektrik des Folly zu überfordern. Nur die Besatzung des Raums jammerte permanent, dass sie ihre Handys nirgends aufladen konnte.
An der hinteren Wand war ein Whiteboard montiert, das sich allmählich mit Fotos, Pfeilen, Personen- und Firmennamen und Fragezeichen füllte. Als wir eintraten, stand DCI Seawoll stirnrunzelnd davor.
»Verflucht, wird das kompliziert«, sagte er.
Alexander Seawoll war ein Polizeibeamter von so modernem Schlag, wie nur je einer eine Kampagne zur Verbesserung des Bürgerkontakts autorisiert hatte. Nicht dass man das vermutet hätte, wenn man ihn zufällig traf. Er war ein massiger Mann, trug Kamelhaarmantel und maßgefertigte Schuhe und kam gerüchteweise aus Glossop, einem kleinen Städtchen nicht weit von Manchester, das sich einer hübschen Lage, seiner Rolle in der Baumwollindustrie und der Tatsache rühmen kann, dass es ohne weiteres als Zusatzkulisse für The League of Gentlemen herhalten könnte.
Gemeinsam mit Nightingale, Guleed, den momentan in Belgravia weilenden Kollegen Stephanopoulos und Carey sowie mir bildete Seawoll den inneren Kern der Entscheidungsträger von Operation Jennifer.
»Also, es war ja unser Plan, ins Wespennest zu stechen, bis jemand eine Reaktion zeigt«, sagte Guleed. »Ich würde sagen, in dieser Hinsicht war es ein durchschlagender Erfolg.«
Seawoll bedachte mich mit einem finsteren Blick – wohlgemerkt: mich, nicht Guleed, die sein dienstlicher Augenstern war. »Ja, war es«, sagte er. »Aber so verdammt durchschlagend hätte er auch nicht auszufallen brauchen. Wobei die Analytiker sich freuen wie die kleinen Kinder. Das letzte Mal waren die so drauf, als Doctor Who zurückkam.«
Die Enttarnung der Bleichen Nanny hatte bestätigt, dass Richard Williams nicht nur ein Verbündeter von Martin Chorley war, sondern sogar ein so wichtiger, dass er im Ernstfall zum Schweigen gebracht werden musste. Jetzt konnten die Analytiker alles noch einmal durchgehen, Williams dabei aber eine höhere Gewichtung zuweisen. In der meist so unbestimmten Welt der Informationstheorie hatte der arme Richard plötzlich ungeahnte Solidität erlangt – nicht schlecht für jemanden, der in der Realität gegenwärtig eher ungreifbar war.
»Wir dürfen die Möglichkeit nicht außer Acht lassen, dass seine Frau die Verbindungsperson ist.« Seawoll sah Guleed an. »Apropos, wie ist die Vernehmung gelaufen?«
Guleed zückte ihr Notizbuch und referierte die Ergebnisse. Fiona Williams wusste überhaupt nichts über die Kontakte ihres Mannes aus seiner Zeit in Oxford, lediglich Gabriel Tate kannte sie, weil Richard mit diesem gelegentlich etwas trinken gegangen war.
»Und er hat mit ihm zusammen das Drehbuch geschrieben, das ich gefunden habe«, sagte ich.
Auch Guleed hatte bereits eine umfassende Überprüfung von Tate angeordnet und außerdem in unseren Listen nachgesehen; er war nicht unter unseren mutmaßlichen Kleinen Krokodilen.
»Jetzt schon«, sagte Seawoll.
Da Fiona den Angriff nicht mit angesehen hatte, hatten wir ihr nichts darüber gesagt, außer dass ihr Mann dabei schwer verletzt worden war.
»Sie wirkte verdächtig wenig interessiert daran, was für Verletzungen ihr Mann eigentlich hatte«, sagte Guleed. »Also, ich würde das wissen wollen – Sie nicht?« Fiona hingegen hatte Guleeds Erklärung auf eine Art aufgenommen, die unter Psychologen als »verflachte affektive Resonanz« läuft.
»Sie könnte noch unter Schock stehen«, meinte Seawoll. »Geben wir ihr ein, zwei Tage, um sich zu erholen, dann können Sie sie noch mal angehen.«
Fiona Williams hatte das Kindermädchen über eine Agentur gefunden. Aber als Guleed dort nachhakte, bestritt man, etwas von einer Alice McGovern zu wissen. Ob das Einschleusen unserer Bleichen Nanny unter Mithilfe von Richard Williams erfolgt war oder nicht, würden wir erst erfahren, wenn er aufwachte.
»Falls er aufwacht«, bemerkte ich.
»Abdul schien zuversichtlich, dass er das tun wird«, sagte Nightingale.
Was Williams anging, mussten wir eine Möglichkeit finden, ihn vor künftigen Mordversuchen zu beschützen. Schon früher hatten wir erwogen, Hochrisikozeugen und/oder -verdächtige im Folly zu beherbergen, aber dafür gab es so einige Hürden, von gesetzlichen Bestimmungen bis hin zu sicherheitstechnischen Fragen. Letztlich war es, um die Sicherheit von Leuten wie Richard Williams und seiner Familie zu gewährleisten, schlicht und einfach nötig, Martin Chorley dingfest zu machen.
»Bis er aufwacht, sind wir aufgeschmissen«, sagte Seawoll.
Weder er noch Nightingale wirkten sonderlich glücklich angesichts des bisherigen Mangels an Verwertbarem, aber ich wartete ab – ich hatte bemerkt, dass Guleed ein paar Seiten überblättert hatte, und vermutete, dass sie sich das Beste für zuletzt aufhob. Um sich die extrem schlüpfrige Karriereleiter der Met hochzuarbeiten, muss man es auch draufhaben, zu wissen, wann etwas Show angebracht ist.
»Eins noch«, sagte sie jetzt auch prompt und zwinkerte mir kaum merklich zu. »Richard Williams hatte ein ungewöhnliches Interesse an Glocken.« Sie machte eine angemessene Pause, damit wir applaudieren konnten, und sah dabei ein bisschen aus wie Toby, der auf ein Würstchen wartete. Dann fuhr sie fort: »Er ist mehrere Male zur Glockengießerei in Whitechapel gefahren.«
»Guter Gott«, sagte Nightingale. »Ich wusste nicht, dass die noch existiert.«
»Könnte es mit seiner Arbeit zu tun gehabt haben?«, fragte Seawoll.
»Das überprüfen wir gerade, aber er hat sich ziemliche Mühe gegeben, es vor seiner Frau geheim zu halten«, sagte Guleed.
Die Frau – vielleicht lag es daran, dass sie Frau Nummer zwei war – hatte spitzgekriegt, dass Richard Geheimnisse vor ihr hatte. Und da sie (wen wundert’s) weit stärker an seiner Treue zweifelte als Frau Nummer eins, war sie ihm nach Whitechapel gefolgt, um einmal zu sehen, was er dort trieb. So etwas kommt recht häufig vor: Wenn Leute sich bemühen, etwas heimlich zu tun, erregen sie oft mehr Aufmerksamkeit, als wenn sie es einfach ganz offen täten. Hinzu kommt, dass ihre Verschleierungsmethode manchmal viel illegaler ist als das, was sie verschleiern wollen.
Aber wenn die Leute klüger wären, wäre die Polizeiarbeit ja noch viel schwieriger.
Mit dem Kontaktieren der Glockengießerei hatte Guleed noch gewartet. »Ich wollte niemanden vorwarnen«, sagte sie.
Sowohl Nightingale als auch Seawoll nickten anerkennend.
»Vielleicht sollten Sie beide sich dort mal umschauen«, sagte Seawoll. »Während wir in Chiswick zum Abschluss kommen.« Er sah Nightingale an.
Dieser machte eine auffordernde Handbewegung zu Guleed und mir. »Nun, worauf warten Sie?«
5Die Trinkerglocke
»Ich weiß nicht, mir war’s lieber, als die zwei sich nicht ausstehen konnten«, sagte Guleed.
»Können sie immer noch nicht«, gab ich zurück. »Sie verhalten sich nur professionell.«
So professionell, dass man, wenn man intensiv lauschte, alle beide ganz leise unter dem Druck ächzen hörte. Zum Glück erlaubt die moderne Technologie es dem gemeinen Untergebenen, seine Einsatzvorbereitungen in angenehmem Ambiente fern seiner Vorgesetzten zu erledigen – und nebenbei sogar noch etwas Recherche zu betreiben.
Guleed und ich hatten es uns im Café Casablanca gemütlich gemacht, von dessen Fensterplätzen aus man eine gute Aussicht auf Vorder- und Hintereingang zur Whitechapel-Gießerei hat und wo man einen heißen, starken und anständig großen Kaffee bekommt. Außerdem gibt es dort eine Auswahl hausgemachter indischer Süßigkeiten, die mich schon durch ihren Duft fast überzeugten, dass Diabetes Typ II kein zu hoher Preis für sie wäre.
Nehmen wir mal an, damals in den alten Zeiten, oder vielmehr rursus in diebus antiquis