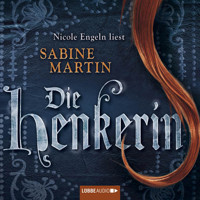8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Henkerin
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Esslingen, 1325: Melisande ist noch ein Kind, als ihre Familie in einem Hinterhalt brutal gemeuchelt wird. Dass sie überlebt, verdankt sie allein Raimund. Dem Henker. Er nimmt sie zu sich, gibt sie als seinen stummen Neffen aus, lehrt sie sogar sein Handwerk - das nicht nur entsetzliche Foltermethoden, sondern auch die Kunst des Heilens umfasst.
Ihre verletzte Seele findet dennoch keine Ruhe, hat sie ihrer sterbenden Mutter doch eines versprochen: den Mörder zu finden und sie zu rächen.
Das neue E-Book der Autorin "Die Tränen der Henkerin" ist bereits erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 711
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autoren
Titel
Impressum
Zitat
Karte
DER HINTERHALT
DAS VERSPRECHEN
DIE HENKERIN
DER FREVEL
DIE FLUCHT
DIE HEILERIN
DIE VERGELTUNG
EPILOG
GLOSSAR
Unsere Empfehlung
Über die Autoren
Hinter Sabine Martin verbirgt sich ein erfahrenes Autorenduo. Martin Conrath hat bereits einige Kriminalromane veröffentlicht, von denen einer als Tatort verfilmt wurde. Sabine Klewe verfasste mehrere, z. T. historische Kriminalromane und arbeitet als Übersetzerin und Dozentin. Die Autoren leben und schreiben in Düsseldorf.
Sabine Martin
DIEHENKERIN
Historischer Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2012 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Dr. Stefanie Heinen
Karte und Vignetten: Dr. Helmut Pesch, Köln
Titelillustration: © corbis/Timothy Hogan; © Suchbild/
Pauline Schimmelpenninck Büro für Gestaltung
Umschlaggestaltung: Pauline Schimmelpenninck
Büro für Gestaltung Berlin
Datenkonvertierung E-Book: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-1094-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
AM TAGISTDER UHUBLIND,
BEI NACHTDER HASE.
WENABERDIE RACHEVERBLENDET,
DERISTBLINDBEI TAGUND NACHT.
Nach einem indischen Sprichwort
DER HINTERHALT
JUNI 1325
De Bruce tätschelte Diabolos Hals. Der Rappe schnaubte leise und scharrte mit den Hufen.
»Immer mit der Ruhe, mein Guter. Es wird nicht mehr lange dauern. Bald wirst du ein Schauspiel erleben, das seinesgleichen sucht. Allerdings darfst du nicht mitspielen. Du bist mir zu wertvoll, als dass ich es zulassen könnte, dass du im Kampf verletzt wirst. Das musst du verstehen.«
Das Pferd legte die Ohren nach hinten und schüttelte die Mähne. De Bruce nickte Adam, seinem neuen Knappen, zu, der ein wenig abseits stand und die Schlucht hinunterspähte. »Diabolo versteht mich immer noch am besten von allen, ist es nicht so?«
Adam neigte den Kopf. »Wie immer habt Ihr recht, Herr.«
De Bruce hob eine Augenbraue. »Du hängst dein Fähnchen nach dem Wind, pass auf, dass nicht eines Tages ein Sturm das Fetzchen Stoff in Stücke reißt.«
Der Knappe lächelte verschmitzt. »Wenn der Sturm kommt, wird die Fahne eingerollt. Meine zumindest. Nur wer versucht, dem Sturm zu trotzen, wird davongeweht.«
De Bruce lachte. Auch zusammengerollte Fähnchen trat er mühelos in den Staub, das würde dieser vorwitzige Bursche noch früh genug begreifen. Er fischte eine Mohrrübe aus einem Leinenbeutel am Sattel und hielt sie dem Pferd vor die Nase. Vorsichtig pickte es die Möhre aus de Bruce’ metallbewehrter Faust.
De Bruce streckte sich und seufzte zufrieden. Er wandte sich Adam zu, der mit zusammengekniffenen Augen den Wald absuchte. »Ja, schau nur. Du wirst nichts sehen. Sie werden es erst merken, wenn sie in der Falle sitzen. Der Sturm wird so schnell über sie hinwegfegen, dass sie keine Zeit haben werden, ihre Fähnchen in Sicherheit zu bringen. Nichts wird von ihnen bleiben. Wie gut, dass die Menschen so einfältig sind, nicht wahr? Und jetzt mach schon, hilf mir hoch.«
Adam stellte einen kleinen Holzschemel vor das Pferd, führte seinen Herrn an die richtige Stelle, hob erst das eine, dann das andere Bein auf den Schemel.
De Bruce griff mit einer Hand an den Sattelknauf, mit der anderen fasste er den Sattel. Mit einem Ruck und Adams tatkräftiger Hilfe schob er sich auf das Pferd, das einen kleinen Schritt zur Seite machen musste, um das Gewicht abzufangen. Reiter und Rüstung wogen an die zweihundertfünfzig Pfund, und das war auch für ein geborenes Schlachtross wie Diabolo keine Kleinigkeit.
»Das machst du gut, mein Bester.« Liebevoll tätschelte de Bruce seinem Pferd den Hals. Er beabsichtigte zwar nicht, sich am Kampf zu beteiligen, war aber dennoch mit der Rüstung auf Nummer sicher gegangen. Ein verirrter Armbrustbolzen, eine Axt, die ihr Ziel verfehlte, oder ein Speer, der irgendwo abprallte, waren jederzeit gefährlich. Außerdem konnte immer noch das Unmögliche geschehen, dass er doch eingreifen musste, und dann brauchte er so viel Metall um sich herum wie möglich. Auf jeden Fall würde er dann das Pferd wechseln. Diabolo durfte keiner Gefahr ausgesetzt werden.
Adam prüfte den Sitz der Beinschienen und die Festigkeit des Sattelgurtes, zog den Schweifgurt strammer, damit der Sattel nicht nach vorne wegrutschen konnte. Die Schlucht war steil, ein Sturz vom Pferd mit großer Wahrscheinlichkeit tödlich.
»Ich danke dir, Adam«, sagte de Bruce. »Wie immer machst du gute Arbeit. Eines Tages wirst du hier oben sitzen, und ein Knappe wird dir dienen. Da bin ich mir sicher.« Vorausgesetzt, du bleibst nicht so ein verweichlichter Geck, der blass wird, wenn man einem Mann die Zunge herausreißt, fügte er in Gedanken hinzu. So einen wie Adam hätte er sich niemals ausgesucht, aber er hatte keine Wahl gehabt. Graf Eberhard I., sein Lehnsherr, hatte ihn gebeten, Adam unter seine Fittiche zu nehmen, ihn jedoch nicht allzu hart anzufassen. Und die Bitte des Grafen kam einem Befehl gleich. Nun war Eberhard tot, und Adam stand unter dem Schutz seines Sohnes, des Grafen Ulrich III., was bedeutete, dass er in fünf Jahren, wenn er einundzwanzig wurde, zum Ritter geschlagen würde, auch wenn er sich im Kampf nicht bewährte.
De Bruce verzog das Gesicht. Schweiß sammelte sich auf seiner Haut, auf dem Rücken, unter den Achseln und am Kopf. Sogar seine Hände begannen zu schwitzen. Der Tag war noch nicht weit fortgeschritten, doch die Luft flimmerte bereits vor Hitze, und die Polsterungen machten aus der Rüstung einen Backofen. Zum Glück würde die Schlacht ohnehin nicht lange dauern.
»Gut.« De Bruce straffte die Schultern. »Lass uns etwas Unglaubliches vollbringen.«
Als er sah, dass Adam sich bekreuzigte, lachte er schallend. »Mein lieber Freund, wenn Gott keinen Gefallen an mir hätte, dann wäre ich schon lange tot. Auf jetzt, unsere Beute wartet!«
Melisande rutschte unruhig auf dem harten Holz hin und her. Anfangs hatte sie versucht, sich dem Rhythmus der Ochsen anzupassen, die den Karren zogen, aber das hatte sie schnell aufgegeben. Der Weg strotzte von Unebenheiten und Löchern, sodass sie sich festhalten musste, um nicht von der Kleidertruhe zu fallen. Immer wenn eins der mühlsteingroßen Räder in den Untergrund einsackte, hob sich das andere in die Luft.
Konrad, Melisandes Vater, hatte darauf bestanden, die Familie in diesem unbequemen Gefährt nach Hause zu bringen. Und Beata, Melisandes Mutter, hatte dafür gesorgt, dass sie ein hässliches Leinenkleid anzog. Wie ein Sack hing der grobe Stoff an ihr herunter, sie sah damit aus wie ein Bauernjunge, der etwas zu schmal geraten war. Die rindsledernen Schuhe hatte Melisande ausgezogen, um sich ein wenig Kühlung zu verschaffen. Ihre langen feuerroten Haare hatte sie mit einer silbernen Spange hochgesteckt, das einzige Schmuckstück, das sie als Tochter der reichen Kaufmannsfamilie Wilhelmis auswies.
Es kam Melisande vor, als seien sie schon seit Tagen unterwegs. Dabei waren sie erst am Morgen aufgebrochen, und es war nicht mehr weit bis Esslingen, wo sie ein großes Haus am Marktplatz bewohnten. Trotzdem fragte sie ihre Mutter wohl zum hundertsten Mal, wann sie denn endlich da sein würden.
»Wenn die Sonne untergeht, sind wir zu Hause«, sagte Beata geduldig und streichelte Gertrud, die in ihren Armen schlief, über den Kopf.
Melisande verzog das Gesicht. Ihre kleine Schwester konnte immer und überall schlafen. Selbst wenn Blitz und Donner alle in Angst und Schrecken versetzten, lag sie zusammengerollt auf ihrem Lager und wachte nicht auf. Sie selbst sehnte sich nach irgendeiner Beschäftigung. Wenn sie wenigstens sticken könnte. Oder lesen. Aber das ging bei dem Gerumpel nicht. Bevor sie auch nur einen Stich in den Stoff gemacht hätte, hätte sie sich zehnmal mit der Nadel in den Finger gestochen. Und die Buchstaben, die von den Abenteuern der edlen Ritter Parzival und Gawan erzählten, würden so wild vor ihren Augen herumtanzen, dass ihr übel würde.
Schreiben war erst recht unmöglich. Sonst hätte sie den Psalm übersetzen können, den ihr der Magister aufgegeben hatte. Psalmen, wie furchtbar! Melisande las lieber Geschichten von Rittern und Drachen. Gawan, das war ein Held nach ihrem Geschmack. Wie tapfer er war! Und wie gewandt. Wenn sie doch nur im wirklichen Leben einmal einem solchen Ritter begegnen würde! Stattdessen musste sie die Bücher Moses abschreiben und Psalmen auswendig lernen.
Immerhin, Vater und Mutter waren stolz auf sie. Und weil sie so gut war in Latein, Rechnen und Lesen, durfte sie manchmal mit Pfeil und Bogen üben. Den anderen Mädchen war das nicht erlaubt, und Vater und Mutter hatten ihr eingeschärft, es niemandem zu erzählen.
Das Gefährt bäumte sich wieder auf, Melisande krallte sich am Karrenrand fest und spürte einen harten Stoß im Steißbein. Wenn das so weiterging, würde sie eine Woche lang nicht sitzen können. Sie rutschte von der Truhe und schlug die Plane beiseite, die Vater gespannt hatte, um Mutter vor der Sonne zu schützen. Beata sah ulkig aus mit ihrem dicken Bauch und den großen Brüsten. Und ihr Gesicht war auch ganz rund. Alles an ihr war rund, seit das neue Geschwisterchen in ihr wuchs. Vater hatte gesagt, es würde bestimmt ein Junge werden, aber Mutter hatte nur stumm gelächelt.
Melisande blinzelte in die Sonne. Direkt vor ihr klapperte eine Rüstung. Vielfach spiegelte sich die Sonne in dem polierten Metall. Melisande kannte den Mann nicht. Er machte den Eindruck, jeden Gegner in den Staub treten zu können. Sein Ross war mächtig wie ein Zuchtbulle, schnaubte wie ein Drache und schien ständig nach irgendetwas Ausschau zu halten, das es angreifen konnte. In der Rechten hielt der Mann eine Lanze, an der linken Seite hing eine Armbrust und auf dem Rücken ein Bihänder, mit dem man mit einem einzigen Streich einen Mann von oben bis unten in zwei Teile spalten konnte. Sofern man die Kraft besaß, die schwere Waffe zu heben.
Einmal hatte Melisande ein solches Schwert anfassen dürfen. Mit Müh und Not hatte sie es vom Boden hochbekommen. Einen Hieb hatte sie damit nicht führen können. Der Onkel hatte es ihr vorgeführt: Wie einen Strohhalm hatte er die Waffe geschwungen und ein totes Schwein von oben bis unten gespalten. Mutter war puterrot geworden vor Wut und hatte dem Gatten ihrer Schwester alle Höllenqualen angedroht, wenn er solch einen Unfug noch einmal machen würde, aber Vater war ruhig geblieben. Er hatte Mutter auf die Seite genommen, gelächelt und leise mit ihr gesprochen. Sie hatte sich wohl durchgesetzt, denn Vater und Onkel waren danach einige Tage mürrisch und wortkarg durch die Gegend gelaufen. Vor zwei Jahren war das gewesen, und seitdem hatte sie nie wieder eine solche Waffe anfassen dürfen.
»Wenn ich dich mit einem Schwert erwische, dann stecke ich dich ins Kloster! Haben wir uns verstanden?«, hatte Mutter ihr mit dem Zeigefinger vor der Nase prophezeit.
Melisande hatte verstanden. Und sie hatte sich daran gehalten, denn Mutter pflegte ihre Drohungen wahr zu machen.
Die Rüstung schepperte. Der Söldner hatte sich im Sattel umgedreht und spähte in die Ferne. Von weit hinten im Zug rief Vater, es sei alles bestens. Der Mann drehte sich wieder um und entdeckte Melisande, die unter der Plane hervorgekrabbelt war und die Gelegenheit nutzte, ihn mit Fragen zu bestürmen.
»Wer seid Ihr? Ich habe Euch noch nie bei uns gesehen. Kommt Ihr von weit her? Seid Ihr so tapfer wie der edle Gawan? Habt Ihr schon viele Drachen getötet? Gibt es einen Krieger, den Ihr noch nicht herausgefordert habt?«
Der Söldner verzog keine Miene. »Ich bin Siegfried von Rabenstein. Meine Heimat liegt vierzehn Tagesreisen von hier. Nein, ich habe noch keinen Drachen getötet, weil es keine Drachen gibt. Und Krieger gibt es so viele, die kann man nicht alle herausfordern, geschweige denn töten.«
»Warum seid Ihr hier?«
»Euer Vater hat es so gewünscht.«
Melisande lehnte sich aus dem Karren, schaute nach vorn und nach hinten und zählte. Soweit sie sehen konnte, begleiteten zehn Berittene in voller Rüstung den Zug. So viele waren es noch nie gewesen. Außerdem liefen vorne und hinten noch jeweils zehn Lanzenträger, die sogar Schwerter an der Seite trugen. Der Weg war hier so eng, dass sie nur zu dritt nebeneinanderlaufen konnten, der dichte Wald erstreckte sich rechts und links über Meilen.
Melisande bewunderte Ritter. Auch wenn ihr Bruder Rudger ihr erzählt hatte, dass es auch solche gab, an denen nichts Bewundernswertes war. Verarmte Raufbolde, die reisende Kaufleute und arme Pilger überfielen und töteten, um deren Habe an sich zu bringen.
Rudger war drei Jahre älter als Melisande, gerade sechzehn geworden. Früher hatten sie gemeinsam auf dem Dachboden zwischen den Stoffballen gehockt, mit denen Vater handelte, und mit selbst geschnitzten Holzrittern gespielt, Strategien für Schlachten und Belagerungen ausgeheckt. Obwohl Rudger sie immer damit geneckt hatte, dass sie wohl ein Junge sei, der versehentlich als Mädchen auf die Welt gekommen war, hatte sie ihre Zeit am liebsten mit ihm verbracht. Inzwischen hatte er längst keine Muße mehr für solche Spiele, weil er von morgens bis abends dem Vater bei der Arbeit helfen musste. Manchmal waren die beiden auch wochenlang fort. Mit einem Händlertross auf Reisen. Was für wundersame Geschichten er jedes Mal bei seiner Rückkehr erzählte! In zwei oder drei Jahren sollte er eine Frau nehmen und mit ihr eine Niederlassung im hohen Norden leiten. Melisande wollte gar nicht daran denken. Rudger fort – furchtbar. Aber bis dahin dauerte es ja noch lange. Fast so lange wie diese langweilige Reise.
Bevor sie Siegfried noch mehr Fragen stellen konnte, rief Beata sie zur Ordnung. »Melisande! Komm zurück unter die Plane. Es schickt sich nicht für ein Mädchen, einen Ritter auszufragen.«
»Ja, Mutter.« Melisande fügte sich widerwillig und nahm ihren Platz auf der Truhe wieder ein.
***
Rudger lenkte sein Pferd neben das seines Vaters. »Wir kommen bald in den Hohlweg. Das wäre der einzige Ort, an dem er zuschlagen könnte.«
Konrad Wilhelmis nickte. »Es sei denn, er bietet zweihundert Berittene auf. Aber das kann sich sogar de Bruce nicht leisten.« Er schüttelte die rotbraunen Locken und lächelte. »Unsere Späher haben nichts entdeckt. Da oben ist niemand.« Er deutete mit seiner Hand auf die aufragenden Felsen vor ihnen.
Rudger runzelte die Stirn. »Ich habe so ein seltsames Gefühl. So als ob ich etwas nicht sehen könnte, das dennoch da ist.«
»Das ist die Angst vor der Gefahr.« Konrad legte ihm die Hand auf die Schulter. »Hier gibt es nichts, worum wir uns sorgen müssten, mein Sohn. Aber es ist gut, sich seiner Angst bewusst zu sein. Nur so kannst du im entscheidenden Moment richtig handeln.«
»Du hast sicher recht, Vater.« Rudger wendete sein Pferd und kehrte auf seine Position am Ende des Zuges zurück. Vater hatte seine Worte gut gewählt, aber zwischen seinen Schultern kribbelte es trotzdem. Genau wie damals, als er den Bären erlegt hatte, der sich lautlos angepirscht und dann erbarmungslos zugeschlagen hatte. Rudger hatte die Gefahr gespürt. So wie jetzt. Am liebsten hätte er seinen Vater zur Umkehr bewegt, aber das war aussichtslos. Er musste sich zusammennehmen. Die Späher hatten nichts gefunden, also war da auch nichts.
***
Melisande seufzte. Rudger hatte es gut, er durfte reiten, musste nicht hier in dem engen, harten Wagen die Zeit totschlagen.
»Warum reisen so viele Bewaffnete mit uns, Mutter?«, fragte sie, obwohl sie die Antwort kannte.
»Der Wald ist tief, es gibt Räuber, gegen die wir uns schützen müssen, das weißt du doch.«
Melisande setzte zum Sprechen an, aber rechtzeitig fiel ihr ein, dass sie besser schweigen sollte. Sonst hätte sie sich verraten. Sie hatte ihre Eltern vor zwei Tagen belauscht, rein zufällig.
Vater und Mutter hatten auf dem Flur gestanden und miteinander gesprochen. Sie bemühten sich zwar zu flüstern, doch Melisande konnte sie durch die angelehnte Tür gut verstehen. Ein Astloch ermöglichte ihr sogar den Blick auf den Flur.
»Ich traue ihm nicht«, hatte Vater gesagt und die Faust geballt.
Mutter hatte ihm widersprochen. »So etwas würde auch ein Ottmar de Bruce nicht wagen. Du siehst Gespenster. Außerdem muss ihm klar sein, dass wir keine Schuld tragen. Es war Notwehr. Jeder weiß das. Die Söldner kosten viel Geld, sehr viel Geld. Wie willst du das aufbringen? Du erschöpfst unsere ganzen Reserven für diesen Irrsinn. Wenn die Trockenheit anhält, brauchen wir das Geld für Lebensmittel und Viehfutter. Außerdem komme ich mir schon vor wie eine Gefangene. Nirgends kann ich hingehen ohne waffenstarrende Söldner an meiner Seite.« Mutter schüttelte den Kopf. »Das ist Verschwendung. Wir brauchen nicht so viele Männer. Er würde niemals wagen ...«
»Du hast ihn nicht erlebt. Ottmar de Bruce ist vollkommen wahnsinnig geworden. Niemand glaubt seine Anschuldigungen, das ist wahr. Das ist aber auch gar nicht nötig. Es reicht, wenn er sie selbst glaubt. Ich könnte es nicht ertragen, dich oder eins meiner Kinder zu verlieren. Ihr seid mehr wert als alles Geld der Welt. Sollte er wirklich so verrückt sein, uns anzugreifen – diese Männer sind hervorragende Kämpfer, die mit jedem Gegner fertig werden.« Vater nahm Mutter in die Arme.
Sie klammerte sich an ihn. »Niemand wird mit jedem Gegner fertig. Das weißt du genau«, flüsterte sie.
»Das mag sein. Aber de Bruce hat weder Moral noch Glauben. Das macht ihn schwach. Gott steht auf der Seite der Gerechten.«
Melisande kannte ihren Vater und wusste, wann er etwas meinte, wie er es sagte. Der letzte Satz bedeutete eindeutig: »Wenn es nur so wäre.«
»Er wird es nicht wagen, niemals ...« Mutters Stimme versickerte in den Wänden.
»De Bruce ist zu allem fähig. Er beschuldigt mich eines Verbrechens, das ich nicht begangen habe«, zischte Vater und löste sich von Mutter. »Seit Generationen sind unsere Familien verfeindet. Und warum? Weil die de Bruce gierige Betrüger sind.«
»Nicht alle, Konrad, nicht alle. Das weißt du genauso gut wie ich. Gernot hätte nicht sterben müssen. Er war doch noch ein dummer Junge.«
Melisande sah, wie sich die Augen ihres Vaters zu Schlitzen verengten. Bevor er richtig wütend werden konnte, legte ihre Mutter einen Finger auf seine Lippen. »Glaubst du, ich würde sein Leben gegen das deine tauschen wollen?« Sie lächelte, und Konrad entspannte sich.
»Aber denke an de Bruce’ Großvater«, fuhr die Mutter fort. »Er hat versucht, zwischen den Familien Frieden zu stiften. Und warum ist er gescheitert? Weil dein Vater sich nicht einen Schritt bewegt hat. Und wir alle müssen dafür büßen. Es ist furchtbar.«
Konrad Wilhelmis verzog das Gesicht. »Du magst richtigliegen, aber trotzdem sind nicht wir es gewesen, die die Fehde begonnen haben. Es ist, wie es ist, und solange Ottmar de Bruce lebt, werden wir keine Ruhe finden. Du weißt, wie grausam er ist, wie er seine Leute behandelt. Noch vor wenigen Wochen hat er einen Knecht totpeitschen lassen, der es gewagt hat, ihm zu widersprechen. Wir sind bereit. Soll er nur kommen, er wird es bitter bereuen. Und jetzt lass uns gehen. Das Fest beginnt.« Vater hatte gezögert, tief Luft geholt und Mutters Kopf zärtlich in seine großen Hände genommen. »Beata, du siehst wundervoll aus. Und ich liebe dich. Das ist alles, was zählt.«
Melisande hätte fast losgegickelt, als sich die beiden um den Hals fielen und abschleckten wie die Welpen. Aber noch lange nachdem sie fortgegangen waren, hinunter auf den Hof, wo das Hochzeitsfest in vollem Gange war, tanzten Beatas ängstlich geflüsterte Worte über den Flur.
***
De Bruce hatte sich vom Hohlweg zurückgezogen, vorher aber noch einmal kontrolliert, ob alle Spuren verwischt waren. Im Schatten eines Baumes wartete er geduldig wie eine Katze auf die Maus. Adam nutzte die Zeit, übte mit dem Kurzschwert und brachte seinem Herrn von Zeit zu Zeit etwas mit Quellwasser gemischten Wein.
Warten war eine ritterliche Tugend. Wenn der richtige Augenblick gekommen war, hieß es schnell und hart zuschlagen. Verpasste man ihn, hieß es wieder warten. Eine halbe Stunde konnte über den Ausgang einer Schlacht entscheiden, ein Wimpernschlag über Leben oder Tod im Zweikampf. Warten hieß, seine Gefühle zu beherrschen. Es war eine hohe Kunst, und de Bruce beherrschte sie meisterlich. Dafür war er seinem Vater dankbar. Er hatte ihm alles Weinerliche, Weibische und Schlaffe ausgetrieben. Anfangs war es hart gewesen, aber mit den Jahren hatte de Bruce den unbezahlbaren Vorteil erkannt, den ein Mensch hatte, der sich nicht von seinen Gefühlen kontrollieren ließ.
Elf Monate waren vergangen, seit Konrad Wilhelmis Gernot ermordet hatte, seinen einzigen Sohn. Dieser hinterhältige Mörder hatte dem Jungen keine Zeit für einen fairen Kampf gelassen. De Bruce war sich sicher, dass Wilhelmis die Zeugen gekauft hatte, die geschworen hatten, Gernot habe das Schwert zuerst gezogen. Das Gericht hatte Wilhelmis freigesprochen. De Bruce jedoch wusste, dass Gernot es nicht gewagt hätte, gegen seinen Befehl zu handeln, und der hatte gelautet: »Greif einen Wilhelmis niemals ohne einen zweiten Mann als Deckung an, niemals vor Zeugen und niemals von vorne.«
Konrad Wilhelmis war ein Feigling, der all seine Aufforderungen abgelehnt hatte, ihm Genugtuung zu leisten. Erbärmlich. Hätte er sich dem Zweikampf gestellt, hätte er seine Familie retten können. Vielleicht.
Ottmar de Bruce leckte sich die Lippen. Schon seit einiger Zeit hatte er einen ganz besonderen Leckerbissen im Auge, der ihm die Vorfreude auf die Schlacht zusätzlich versüßte: Wilhelmis’ Tochter Melisande. Alles war vorbereitet, bald würde die schmackhafte, aber noch unreife Beute in seinen Armen zappeln.
***
Die Langeweile brach wieder über Melisande herein. »Spät am Abend, wenn es dunkel wird«, wiederholte sie in Gedanken. Sie seufzte. Also würde sie noch viele Stunden ausharren müssen, denn es war Frühsommer, und die Tage waren lang. Gewöhnlich freute sie sich darüber, denn dann konnte sie länger draußen spielen, durch die Wälder streifen und mit dem Bogen Hasen jagen. Bisher hatte sie allerdings noch keinen erlegen können. Zu schnell sprangen die Tiere davon, und die Pfeile waren, wie verhext, jedes Mal danebengegangen. Rudger lachte immer nur, wenn sie ihm von ihren Misserfolgen erzählte. Er erlegte einen Hasen mit einem einzigen Schuss. Kein Wunder. Er übte ja viele Stunden am Tag, nutzte jeden freien Augenblick, in dem er nicht über den Büchern brüten musste oder mit Vater unterwegs war. Rudger hatte ein schönes Leben. Abenteuer. Reisen. Er hatte schon viele Städte gesehen: Köln, Trier, Lucca und Venedig. Zwei Monate waren sie beim letzten Mal fort gewesen, Melisande musste zu Hause bleiben und nähen lernen und kochen. Rudger war halt ein Mann. Er konnte gehen, wann und wohin er wollte, während sie immer eine Begleitung haben musste.
Eines Tages wollte Melisande auch so frei sein wie Rudger. Dabei hatte sie es ja noch ganz gut. Wenn sie da an Gerrit dachte, die Tochter des Gewürzhändlers Antonis. Die Arme! Die durfte nicht einmal reiten. Geschweige denn mit Pfeil und Bogen hantieren. Den ganzen Tag musste sie im Haus arbeiten, ihrer Mutter zur Hand gehen wie eine Magd.
Ein kräftiger Stoß ließ Melisande von der Truhe purzeln. Sie rollte sich auf dem Boden zusammen und rieb sich den schmerzenden Arm. Beata flog gegen die harten Planken und stöhnte, hielt sich den Bauch. Gertrud murmelte im Schlaf. Der Karren blieb ruckartig stehen.
Von draußen hörte Melisande ihren Vater fluchen. »Seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Habt ihr das Loch nicht gesehen? Wollt ihr meine Frau und mein Kind umbringen? Passt gefälligst auf, oder ihr könnt euch woanders Arbeit suchen!«
Die Plane flog zur Seite, Konrad sprang auf den Karren herauf, kniete vor seiner Frau nieder und schaute sie besorgt an. »Alles in Ordnung, mein Engel?«
Beata lächelte matt. »Du sollst nicht fluchen, und du sollst mich nicht Engel nennen. Du solltest vielmehr dafür sorgen, dass es bald weitergeht. Ich habe keine Lust, auch noch die Nacht auf diesem hölzernen Foltergerät zu verbringen.«
Konrad schickte sich nicht an, die Anordnungen seiner Frau auszuführen. Er legte seine Hand vorsichtig auf ihren Bauch. »Da drin alles in Ordnung?«
Beata schob die Hand zur Seite. »Ja. Geh jetzt, mach den Knechten Beine. Ich brauche ein Bad, mein Bett und viel Ruhe.«
Melisande hatte schweigend zugesehen und nutzte die Gunst des Augenblicks. »Vater, darf ich zu dir aufs Pferd? Ich bleibe auch ganz ruhig sitzen«, versicherte sie und setzte ihr süßestes Lächeln auf. Normalerweise reichte das aus, ihren Vater zu erweichen. Doch er blieb hart.
»Du«, er zeigte auf sie, »und deine kleine Schwester, ihr bleibt hier und passt auf Mutter auf. Ich kann euch Flöhe da draußen nicht gebrauchen.«
»Aber Vater ...« Melisande wechselte von zuckersüß auf Schmollmund.
Konrad holte tief Luft, gab ihr einen Kuss auf die Wange. »Wir müssen schnell weiter«, sagte er sanft. »Morgen reiten wir aus. Nur wir beide. Ist das ein Wort, Mel? Du bist doch meine Prinzessin.«
Melisande fiel ihrem Vater um den Hals und überschüttete ihn mit Küssen. Er lachte und machte sich vorsichtig los. Die Plane fiel, Vater war verschwunden, Melisande kauerte sich zu Füßen ihrer Mutter nieder und schloss die Augen. Sie dachte an die Hochzeitsfeier, an das viele gute Essen, die Musik und die ausgelassenen Tänze. Das Gesicht der Braut. Sie hatte eher verschreckt als fröhlich dreingeblickt. Vier Tage hatte das Fest gedauert. Wie wohl ihre eigene Hochzeit aussehen würde? Und ihr Bräutigam? Er müsste ein Ritter sein, so gut und schön wie der edle Gawan ...
Die Bilder begannen vor Melisandes Augen zu verschwimmen. Dann war sie eingeschlafen.
***
Konrad schwang sich auf sein Pferd. Nur noch eine halbe Meile bis zum Hohlweg. Aber er ließ den Zug noch nicht losfahren. Rasch winkte er von Rabenstein zu, er solle ihm folgen. Sie galoppierten an den Kopf des Zuges, vorbei an den mit dem Gepäck der Reisegesellschaft schwer beladenen Wagen und an den Fußsoldaten, deren vernarbte Gesichter Zeugnis davon ablegten, dass sie so manche Schlacht und so manche Krankheit überlebt hatten. Konrad hielt sein Pferd an. »Ich will mir die Schlucht noch einmal selbst anschauen.«
Rabenstein nickte. »Wie ihr meint. Aber die Späher haben jeden Stein umgedreht.«
»Dann drehe ich sie ein weiteres Mal um, damit ich mir sicher bin, dass sich keine Schlangen darunter verbergen. Kommt mit!« Konrad ließ sein Pferd im Schritt gehen und spähte nach allen Seiten.
Rabenstein schloss zu ihm auf. »Darf ich Euch eine Frage stellen?«
Konrad nickte, ließ seinen Blick aber weiterhin über die Wände der Schlucht gleiten.
»Ihr seid Händler, und dennoch kennt ihr Euch mit dem Kriegshandwerk gut aus. Euer Sohn ist bereits ein großer Kämpfer, und Ihr wisst mit dem Schwert umzugehen wie ein Soldat. Die kleine Armee, die ihr zusammengestellt habt, ist schlagkräftig, die Männer sind keine dahergelaufenen Söldner, sondern von gutem Ruf. Die Auswahl der Waffen und die Staffelung sind ebenfalls eines Hauptmanns würdig. Wie kommt Ihr dazu?«
Konrad lachte grimmig. »Seit Generationen liegen unsere Familie und die Familie de Bruce in Fehde. Mein Ururgroßvater war kein Händler, sondern Soldat. Er stammte nicht aus einem adligen Haus, also musste er durch Können wettmachen, was ihm das Schicksal verweigert hatte. Er brachte es bis zum Hauptmann, der von seinen Männern geachtet und geliebt wurde. Mit Richard Löwenherz zog er gegen Saladin und besiegte ihn in der Schlacht von Arsuf. Dennoch kehrte mein Ururgroßvater nicht aus dem Morgenland zurück. Ein de Bruce erschlug ihn von hinten im Streit um die Beute. Ihr könnt Euch vorstellen, dass die Fehde unausweichlich wurde. Damit wir uns verteidigen konnten, wurde das Kriegshandwerk fester Bestandteil der Erziehung eines jeden Wilhelmis. Außerdem bin ich Hauptmann der Zunftwehr der Tuchhändler. Manche kaufen sich vom Wehrdienst frei. Ich halte das für gotteslästerlich.«
Rabenstein nickte. »Ich verstehe.«
Sie ritten weiter durch die Schlucht. Steil ragten die Felswände auf. Beata hatte Konrad davon überzeugen wollen, die Schlucht zu meiden, aber das hätte einen Umweg und einen steilen Anstieg bedeutet, der mit den Karren und für die Schwangere gefährlich geworden wäre und de Bruce viel Zeit gegeben hätte, ihnen doch noch einen Hinterhalt zu legen.
Konrad hielt sein Pferd an, stieg ab und zeigte auf ein seltsames Muster im Sand. »Sieht aus, als hätte jemand Spuren verwischen wollen.«
Rabenstein begutachtete den Boden. »Ich glaube, ein Raubtier hat seine Beute in ein Versteck geschleift. Seht hier.« Er deutete auf einige runde Abdrücke im Sand. »Bärentatzen. Und dort. Blut.«
Konrad nickte. »Ich sehe schon Gespenster. Ihr habt recht. Lasst uns dennoch einmal hindurchreiten.«
Rabenstein trieb sein Pferd an, Konrad saß auf und folgte ihm. »Haltet Ihr mich für ängstlich, Rabenstein?«
Der Ritter grinste. »Nein. Mit Sicherheit nicht. Im Gegenteil. Ich muss zugeben, an Eurer Stelle wäre ich der Hochzeit ferngeblieben.«
Konrad schüttelte den Kopf. »Das hieße, sich de Bruce zu ergeben. Niemals. Er kann uns nichts anhaben. Seht Euch um. Irgendetwas Verdächtiges?«
»Ja.«
Konrad stutzte. »Und das wäre?«
»Dass es nichts Verdächtiges gibt. Wir sollten die Wachen auf der Höhe verdoppeln.«
»Das ist kein Problem«, erwiderte Konrad. »Ich werde es anordnen, drei Reiter sollen Ausschau halten. Aber Ihr selbst habt gesagt, dass wir die Schlucht passiert haben, bevor sich aus den Wäldern Gefahr nähern kann.«
»Richtig. Bis zum Waldsaum sind es gut sieben Bogenschüsse. Selbst im gestreckten Galopp bräuchte ich für diese Strecke genauso viel Zeit wie für die Durchquerung der Schlucht. Ich habe es mehrfach versucht.«
»Seht Ihr? Lasst uns zurückkehren und melden, dass keine Gefahr droht.«
***
Raimund pfiff ein fröhliches Liedchen vor sich hin. An heißen Tagen wie diesem würde er sich am liebsten von morgens bis abends in die Sonne legen und einfach nichts tun. Aber die Pflicht rief, er musste noch etwas Quendel finden. Huflattich und Garbenkraut hatte er schon zur Genüge beisammen.
Er trat zwischen den Bäumen hervor auf die kahle Höhe, beschattete seine Augen und erkundete die Gegend. Am Rande der Schlucht machte er drei Reiter aus, die mit dem Rücken zu ihm standen. Seine Augen waren scharf wie die eines Adlers, so manche Einzelheit konnte er auf diese Entfernung erkennen, die anderen verborgen blieb. Feldzeichen oder Wappen waren nicht darunter. Das verhieß nichts Gutes. Seit einiger Zeit wurde die Gegend von Raubrittern unsicher gemacht, die einen armen Schlucker wie ihn einfach so zum Spaß aufspießen würden, wenn sie ihn vor die Lanze bekämen.
Er trat zurück in den Schatten der Bäume, der ihn für die Reiter unsichtbar machte. Was immer sie dort suchten, sie waren nicht darauf gefasst, Gefahren zu begegnen, die sich von hinten näherten. Hätte Raimund Übles im Schilde geführt, hätte er sich durch das Gras anschleichen und die drei töten können, ohne dass sie eine Gelegenheit gehabt hätten, sich zu wehren. Den Ersten mit einem Axtwurf. Sobald die Axt geschleudert war, aufspringen und mit dem Bogen den Nächsten abschießen. Bevor der Dritte sein Schwert gezogen hätte, wäre Raimund über ihm gewesen und hätte ihm die Kehle durchgeschnitten.
Raimund bereute seine Zeit als Söldner nicht, er wäre wohl dabeigeblieben, hätte Gott ihm nicht eines Tages ein deutliches Zeichen gesandt, heimzukehren und das Handwerk seines Vaters zu übernehmen. Mit einer Handvoll Leute war er in einen Hinterhalt geraten, ihr Leben war keinen Heller mehr wert gewesen. Da hatte Raimund dem Herrgott den Schwur geleistet, auf der Stelle nach Esslingen zurückzukehren, wenn er sein Leben und das seiner Kameraden verschonte, und im selben Moment war unerwartet Verstärkung gekommen und hatte sie gerettet.
Viel gelernt hatte er in jenen Jahren über die Menschen. Nicht nur über ihre Seele, sondern auch über das, was unter der Haut steckte, im Kopf und im Bauch. Sehnen, Knochen, Blut, Adern, Eingeweide, Gehirn. Einigen hatte er das Leben gerettet, vielen mit seinen schmerzstillenden, betäubenden Tränken unnötiges Leiden erspart. Angeekelt hatten ihn die Männer, die über Dörfer herfielen, vergewaltigten, mordeten und brandschatzten. Daran wollte er sich nicht beteiligen, weshalb er bei vielen als Schwächling galt. Wenn sie dann aber verletzt und fiebernd auf ihrem Lager dem Tod schon in die Augen sahen, dann war Raimund der beste Kamerad, und Kameraden halfen einander bekanntlich.
Raimund schüttelte die Gedanken ab und überlegte, wie er am besten ungesehen an die Stelle kam, wo der Quendel wuchs. Er folgte dem Waldrand, schlug einen Bogen und gelangte zu einer kleinen Baumgruppe in der Nähe der Schlucht. Die Reiter standen immer noch mit dem Rücken zu ihm, keine sechshundert Fuß entfernt, aber sie konnten ihn weder hören noch sehen.
Raimund ließ sich auf alle viere nieder, kroch ein Stück näher und ließ sich fallen, als er das Geräusch eines Armbrustbolzens hörte. Die Männer fielen fast gleichzeitig, nur einen Moment später saßen wieder drei Reiter im Sattel, die den Gefallenen zum Verwechseln ähnlich sahen. Zwei davon kannte er: Schergen von Ottmar de Bruce. Raimund drückte sich noch tiefer in die Mulde. Würde er jetzt entdeckt, wäre das sein sicherer Tod.
Aus dem Boden wuchsen immer mehr Soldaten. Sie blieben dicht über der Erde, schoben ihre Armbrüste lautlos vor sich her. Einer der Reiter ritt nah an die Schlucht heran und machte ein Zeichen.
Was er da beobachtete, war ein Hinterhalt! Und der konnte nur der Familie Wilhelmis gelten. Raimund kannte die Geschichte, wusste, dass die de Bruce und die Wilhelmis Todfeinde waren. Zuletzt hatte Gernot de Bruce dran glauben müssen, ein junger Heißsporn, der schon mit acht Jahren in einem Wutanfall einen Mann getötet hatte, aber als Sohn des Grafen Ottmar de Bruce ohne gerechte Strafe davongekommen war. De Bruce machte seine eigenen Gesetze, setzte sie gnadenlos durch. Gernot war sein einziger Sohn gewesen, sein Tod ein harter Schlag für ihn, und er hatte Rache geschworen an dem Mann, der Gernot erschlagen hatte. Raimund hatte den Zweikampf nicht gesehen, aber er hatte gehört, dass Gernot zuerst gezogen und Konrad Wilhelmis nicht viel Federlesens mit ihm gemacht hatte. Konrad hatte nur zehn Hiebe gebraucht, dann hatte Gernot in seinem Blut gelegen, die toten Augen gen Himmel gerichtet. Es hatte einige Zeugen gegeben, die alle dasselbe ausgesagt hatten: »Ein gerechter Kampf. Notwehr, denn Konrad hatte sich schon halb abgewandt, als Gernot das Schwert zog.«
Raimund kannte Konrad Wilhelmis als einen strengen, gottesfürchtigen Mann, dessen Wort mehr wert war als eine Urkunde mit dem Siegel des Königs. Aber das mit Gernot war ein Fehler gewesen. Es hätte genügt, ihn zu entwaffnen und ihn damit zu demütigen.
Raimund tastete nach seinem Dolch und beobachtete die andere Seite der Schlucht. Auch dort waren die Späher ausgeschaltet und ersetzt worden, waren Armbrustschützen in Stellung gegangen. Raimund musste de Bruce widerwillig Respekt zollen. Die Schützen mussten Höhlen in die Erde gegraben und sich darin versteckt haben.
Vorsichtig kehrte er zurück. Diese Falle war makellos, und sie würde jeden Augenblick zuschnappen. Niemand, der jetzt in der Schlucht festsaß, würde lebend herauskommen. Raimund wusste genau, wie die Schützen vorgehen würden. Zuerst die gepanzerten Reiter ausschalten. Ein Leichtes mit Armbrüsten und starken Bögen. Dann das Fußvolk. Wer danach noch lebte, wurde von den Schwertkämpfern zerhackt.
Und Raimund konnte nichts dagegen tun. »Herr, du bist gerecht.« Er fasste seine Gebetsschnur. »Nimm dich der armen Seelen an, die in der Schlacht den Tod finden werden, und nimm sie auf in dein Reich.«
Die Schützen erhoben sich aus ihren Erdlöchern und begannen ihre blutige Arbeit. Raimund betete stumm, während die ersten Schreie durch die Schlucht hallten. Lautlos zog er sich an den Waldrand zurück. Er hatte genug gesehen und gehört. Die Lichtung, auf der er das Kraut vermutete, war nicht mehr weit. Vorsichtig eilte er von Deckung zu Deckung.
***
Ein Schrei riss Melisande aus dem Schlaf. Der Karren ruckte und blieb stehen. Schon wieder ein Loch?
Einen endlosen Augenblick lang war es totenstill, dann hörte sie ein vertrautes Geräusch. Ein Sirren, das schnell lauter wurde. Danach einen erstickten Laut. Die Plane rutschte zur Seite, Siegfried von Rabenstein begrub sie unter sich, als er auf den Karren stürzte. Fassungslos starrte Melisande ihn an. Ein Armbrustbolzen steckte in seiner Kehle, seine Augen waren weit aufgerissen. Blut gurgelte aus seinem Hals, seine Glieder zuckten, als wäre er von einem bösen Geist besessen. Ohne Warnung fiel er in sich zusammen und starb.
Überall setzte Geschrei ein. Ein Bolzen nach dem anderen ging nieder. Jemand brüllte Befehle, Pferde schnaubten unruhig. Melisande sah zu ihrer Mutter. Sie war leichenblass, presste Gertrud schützend an sich. Rasch kauerten sie sich zwischen die Truhe und ein Fass. Beata zitterte, Gertrud wimmerte verschlafen.
»Er wagt es tatsächlich«, flüsterte Beata. »Gott sei uns gnädig.« Sie faltete die Hände und betete.
Wieder schrie jemand. Gertrud fuhr hoch und heulte los. Bolzen schossen jetzt über den Karren hinweg, von rechts und links prasselten sie auf den Zug nieder. Melisande, Gertrud und Beata wurden nicht getroffen, wie durch ein Wunder verfehlten die Bolzen den Karren und ihre menschliche Fracht. Endlos schien das Sirren der Geschosse, die Schreie der Männer.
Schließlich hielt es Melisande nicht mehr aus. Vorsichtig lugte sie über den Rand des Fasses. Was sie sah, erschreckte sie zu Tode. Sie befanden sich im Hohlweg. Zu beiden Seiten ging es steil den Berg hoch. Die Ochsen waren tot, ebenso der Wagenknecht, der sie gelenkt hatte. Um den Wagen herum waren die Söldner in Deckung gegangen, schützten sich mit Schilden vor den Bolzen. Es mussten mindestens zwei Dutzend Schützen sein, die oberhalb des Weges im hohen Gras lauerten, so dicht regneten die tödlichen Geschosse auf sie herab.
Das Kampfgeschrei wurde lauter. Ängstlich blickte Melisande in alle Richtungen. Wo war Vater? Wo Rudger? Von beiden Seiten drangen jetzt Bewaffnete auf die Verteidiger ein. Melisande schluckte. Das Herz schlug so heftig in ihrer Brust, dass es schmerzte. Da war Vater! Er stand hinter seinen Männern und schickte Pfeil um Pfeil in die Gegner.
***
Rudger und Konrad hatten die Schilde hochgerissen und waren damit dem sofortigen Tod entgangen. Fast ein Drittel der Männer war gefallen, von den zehn Rittern lebten noch drei. Wer gerade im Gespräch gewesen war oder unaufmerksam, hatte Konrads Schrei »Schilde hoch!« nicht gehört. Die schwer gepanzerten Ritter fielen von den Pferden wie reifes Obst von den Bäumen. Mit einem solchen Angriff hatte niemand gerechnet. Die Wagen waren mit Eisenplatten gepanzert, Schilde waren in ausreichender Menge vorhanden, aber die Überrumpelung war perfekt. Dennoch machten sich Konrads Umsicht und das viele Geld bezahlt. Die Schilde hatte er verstärken lassen, damit sie dem Beschuss von Armbrüsten standhielten. Ohne diesen Panzer hätte keiner der Männer den ersten Angriff überlebt.
Als der Bolzenregen aufhörte, spähte Konrad vorsichtig nach oben. Die Schützen verzogen sich, aber schon brach der Angriff auf das Ende und den Anfang des Zuges los.
»Erste Reihe Schilde«, schrie Konrad. »Zweite Reihe Pfeile los!« Er selbst gab seinen Schild weiter, nahm den Bogen und schoss einen Pfeil nach dem anderen in die Reihen der anrückenden Fußsoldaten. Auch diese schützten sich mit Schilden, aber immer wieder schrie ein Mann auf, wenn ein Pfeil eine Schwachstelle in der Deckung fand.
Konrads Köcher war schnell leer, auch die Armbrustbolzen hielten nicht lange. Aus den Augenwinkeln beobachtete er seinen Sohn und konnte nicht umhin, trotz seiner Angst vor allem Stolz zu empfinden. Ruhig, fast kalt kämpfte Rudger. Auch er hatte seinen letzten Pfeil abgeschossen, warf den Bogen hin und griff zum Schwert.
Konrad hielt seinen Schwertarm fest. »Rudger, mein Sohn, du bist mein ganzer Stolz. Geh, und rette deine Mutter und deine Geschwister. Geh jetzt sofort. Ich komme nach.«
Rudger zögerte nicht und rannte los. Zwei Söldner füllten seine Lücke und ließen ihre Bihänder auf die Angreifer niedersausen. Schon wankte die Front der Angreifer, Hoffnung keimte auf.
***
Melisande jauchzte. Bald würde ihr Vater die Angreifer in den Staub treten und den Anstifter zur Rechenschaft ziehen.
Da setzte ein erneuter Pfeilhagel ein. Bogenschützen waren nachgerückt und schossen einen Verteidiger nach dem anderen ab. Die Männer konnten sich nicht mehr gegen die Pfeile schützen, die Schilde lagen unerreichbar hinter der Frontlinie. Wie im Traum sah Melisande das Schlachtfeld, als würde sie darüberschweben.
Beata versuchte, sie zu sich hinter die Truhe zu zerren, doch Melisande konnte ihren Blick nicht von dem abwenden, was draußen geschah. Warum kamen Vater und Rudger nicht hierher, damit sie fliehen konnten? Aber nein. Sie schalt sich selbst ein dummes Ding. Niemand konnte irgendwohin fliehen. Sie saßen in der Falle. Oft hatte sie mit Rudger genau diesen Ablauf durchgespielt: ein Hohlweg, der von vorne und hinten von Söldnern blockiert wird, die im Wald unter Laub, in Gräben und auf Bäumen versteckt gewartet haben. Die Späher werden getötet und durch eigene Männer ersetzt, die Täuschung ist nicht zu durchschauen.
Mit dem Kreuzfeuer der Bögen und Armbrüste konnten wenige Männer eine ganze Armee vernichten. Melisande schauderte, faltete die Hände und betete inbrünstig. »Bitte, bitte, lass meinen Vater, meine Mutter und meine Geschwister nicht sterben. Wir haben nichts Unrechtes getan. Bitte, bitte. Ich werde auch nie wieder die heilige Messe versäumen oder Böses über Pater Nikodemus denken.«
Die Schreie der verletzten Männer wurden immer lauter, immer gellender. Melisande konnte nicht anders. Sie musste wieder hinsehen. Der Pfeilhagel war versiegt, die Feinde hatten alles verschossen, was sie hatten. Immer mehr Männer drängten gegen die Verteidiger an. Vater und die überlebenden Söldner hatten eine Phalanx gebildet und hielten mit Piken und Bihändern die Gegner auf Distanz. Überall lagen Männer, die vor Schmerz schrien, Blut färbte die Erde rot. Melisande hätte nicht gedacht, dass in einem Menschen so viel Blut fließen konnte. Sie erkannte den Hausverwalter, einen alten Mann, der nicht mehr kämpfen konnte und ihr wie ein Großvater lieb war. Mehrere Pfeile ragten aus seiner Brust, aber er lebte noch. Seine Lippen bebten, die Hände hatte er zum Gebet gefaltet.
Ohne nachzudenken, sprang sie vom Wagen, achtete nicht auf die Angstschreie ihrer Mutter und lief zu ihm, kniete sich nieder, nahm seine Hand. Das Blut rann aus vielen Wunden. »Ich bin da, Meister Albrecht, habt keine Angst.«
Er schlug die Augen auf und lächelte. »Melisande.« Sein Blick wurde ernst. »Ihr müsst fliehen«, flüsterte er kraftlos. »Sofort. Nehmt Eure Mutter und Eure kleine Schwester, und flieht. In der großen Truhe auf dem Karren ist ein Beutel Goldmünzen. Nehmt ihn mit. Bindet ihn Euch um. Macht schnell. Sonst werden sie Euch alle umbringen.«
Melisande drückte seine Hand fester. »Aber wohin?«
Der Hausverwalter hustete, Blut lief ihm aus dem Mundwinkel. »Geht ein Stück dort entlang.« Er deutete mit einer schwachen Kopfbewegung zum Karren. »Da steht ein Wacholderbusch. Dahinter führt ein Weg auf die Höhe. Geht, Melisande, geht jetzt sofort!« Die Augen des Verwalters brachen, sein Kopf fiel nach hinten.
Tränen schossen Melisande in die Augen, aber sie hatte verstanden. Mit ein paar Sprüngen war sie am Wagen, fischte den Beutel aus der Truhe, band ihn unter ihr Kleid und zerrte die Mutter am Ärmel, die immer noch hinter dem Fass hockte, Gertrud fest an sich gepresst. »Wir müssen weg hier, sofort! Meister Albrecht ist tot. Er hat mir einen Fluchtweg gezeigt.«
Beata stöhnte und presste sich eine Hand auf den Bauch. »Nicht jetzt«, stöhnte sie. »Nicht jetzt.«
»Doch, Mutter. Bitte. Komm schon! Du musst leben! Denk an ihn!« Melisande zeigte auf ihren Bauch, vor Verzweiflung liefen ihr Tränen über die Wangen. Aus den Augenwinkeln wurde sie gewahr, wie einer der Verteidiger unter den Hieben von zwei Angreifern zu Boden ging und verzweifelt versuchte, den tödlichen Schlägen zu entgehen. Zuerst hackten sie ihm einen Arm ab, danach stießen sie ihm die Schwerter in den Bauch. Er zappelte, dann lag er plötzlich still.
Beata machte einen Versuch, sich aufzurichten, doch ihr versagten die Kräfte. Melisande versuchte sie zu stützen, aber sie schaffte es nicht. Hilfesuchend blickte sie sich um. Jeder war mit sich selbst beschäftigt. Die wenigen Männer, die noch kämpfen konnten, wehrten sich verbissen gegen die Übermacht, die anderen waren entweder tot oder lagen verletzt am Boden. Vater kämpfte immer noch am hinteren Ende des Zuges, aber er hatte schon einige Meter zurückweichen müssen. Vorne am Zug sah es nicht anders aus. Stück für Stück gaben die Verteidiger nach, obwohl die Verluste der Angreifer erheblich waren.
Melisande suchte nach Rudger. Er stand nicht mehr neben Vater. Er war überhaupt nicht zu sehen. War er tot? Der Gedanke warf sie fast um. Sie riss sich zusammen. Sie hatte eine Aufgabe, musste Mutter, Gertrud und das Ungeborene retten.
Sie wandte sich wieder ihrer Mutter zu, rüttelte sie verzweifelt an der Schulter, schrie sie an: »Wir müssen weg! Hast du nicht verstanden? Wir müssen weg. Sofort. Steh auf! Steh jetzt auf! Sofort!« Aber Beata reagierte nicht. Melisande zögerte eine Sekunde, dann schlug sie ihrer Mutter mit der flachen Hand ins Gesicht.
Es wirkte. Beata rappelte sich hoch, langsam, viel zu langsam, und auch Gertrud sprang auf.
Melisande half ihnen beim Aussteigen. Der Karren neigte sich nach rechts, Beata verlor den Halt und kippte nach vorne. Melisande versuchte, sie zu halten, aber sie wusste, dass sie es nicht schaffen konnte.
Da griffen zwei Hände zu. Melisandes Herz hüpfte vor Freude. Rudger! Er lebte! Sein Gesicht war blutverschmiert, an seinem linken Arm klaffte eine Fleischwunde, die ihn jedoch offensichtlich nicht behinderte.
»Wir müssen weg«, sagte er ruhig. »Vater wird die Feinde aufhalten, bis wir in Sicherheit sind, und dann nachkommen. Wir haben viele von ihnen getötet. Es sind gekaufte Feiglinge, die für Geld alles tun, aber den Schwanz einziehen, wenn es wirklich darauf ankommt. Nicht mehr lange, und sie werden die Flucht ergreifen.« Seine Miene strafte seine Worte Lügen.
Sie nahmen ihre Mutter in die Mitte, Rudger trug Gertrud, deren Weinen einem erbärmlichen Wimmern gewichen war. Sie hielt die Hände auf die Ohren gepresst und blickte mit furchterfüllten Augen auf das Geschehen um sie herum. Die Schlucht verstärkte die Geräusche, das Kampfgeschrei war zu einem Orkan angeschwollen, das Klirren der Schwerter schmerzte in den Ohren.
Nach wenigen Schritten erreichten sie den Wacholderbusch, schoben die Zweige auseinander. Tatsächlich. Ein schmaler Pfad führte den Steilhang hinauf. Melisande sah sich noch einmal um. Die Feinde waren bis auf wenige Fuß an den Karren herangekommen. Die vordere Kampflinie drohte zu brechen, die hintere hielt stand, Vater und die Söldner hatten sogar Boden gutgemacht. Aber das würde ihnen nichts nutzen. Wenn die vordere Linie brach, waren sie rettungslos verloren.
Ein Lichtblitz blendete Melisande, sie hob schützend die Hand und blickte hoch. Oben auf dem Felsen thronte ein Reiter auf einem pechschwarzen Pferd. Reglos beobachtete er das Kampfgetümmel. Sie erkannte das Wappen, die Rüstung und den Rappen: Ottmar de Bruce. Gut hundert Fuß hoch war der Abhang, der ihn von Melisande und ihrer Familie trennte. Er schien hämisch zu ihr hinabzusehen, so als hätte er alle Zeit der Welt, sie einzuholen. Ein eiskalter Schauer lief Melisande über den Rücken, als er gemächlich sein Pferd wendete und langsam losritt.
***
De Bruce ließ Diabolo im Schritt gehen. Es erfüllte ihn mit tiefer Befriedigung, dass sein Plan bis zur letzten Kleinigkeit aufgegangen war. Er hatte seinen Männern eingeschärft, weder Melisande noch ihre Mutter oder ihre Schwester zu töten. Dass Rudger oder Konrad oder ein anderer ihnen zu Hilfe eilen würde, damit hatte er ebenfalls gerechnet und am Ausgang des Pfades drei Wachen postiert, die die Weiber durchlassen, alles was nachfolgte, aber niedermachen sollten. De Bruce lächelte. Der Zug war nicht ohne Grund genau an dieser Stelle aufgehalten worden. Nur wenn seine Beute den Fluchtweg fand, machte die Jagd Spaß.
Gerade als er Diabolo die Sporen geben wollte, hörte er aufgeregte Schreie. Ein Scharführer rannte herbei, neigte das Haupt und berichtete atemlos: »Die hintere Linie droht zu brechen, Herr. Konrad Wilhelmis und zwei Ritter haben bereits zwölf Männer erschlagen.«
De Bruce konnte es nicht glauben. Wilhelmis musste mit dem Teufel im Bunde sein. Wie sonst konnte er dieser Übermacht standhalten? Aber de Bruce glaubte nicht an den Teufel. »Schickt die Schützen hinunter in die Schlucht«, befahl er. »Dann ruft meinen Hauptmann, Eberhard von Säckingen. Er soll dem Spiel ein Ende machen. Und merkt Euch: Am Ende werde ich allen Feiglingen die Haut abziehen.«
Er verscheuchte die aufkeimende Wut darüber, dass das Unmögliche doch eingetreten war und er ohne Pferdewechsel hinunter in die Schlucht musste. Mit einem Ruck wendete er Diabolo, verfluchte die Schwächlinge, die vor einem Pfeffersack zurückwichen, und preschte bergab. Gut, dass er und Diabolo durch harten Stahl geschützt waren!
Einige seiner Fußsoldaten kamen ihm entgegengerannt, Todesangst in den Augen. Dem ersten schlug er mit dem Schwert den Kopf ab. Entsetzt blieben die anderen stehen. De Bruce schwenkte sein blutiges Schwert und stieß einen Kampfschrei aus. Schon strömten die Schützen hinab in die Schlucht, sie hatten ihre Bögen durch Schilde und Schwerter ersetzt. Das Fußvolk wendete und warf sich ebenfalls wieder in die Schlacht.
De Bruce konnte nicht sagen, ob es aus Angst vor ihm geschah oder wegen der heraneilenden Verstärkung. Das spielte auch keine Rolle. Er hatte kostbare Zeit verloren. Zu viel Zeit. Seine Beute musste längst auf dem Kamm angekommen sein. Wenn er sich nicht beeilte, würde sie die baumlose Strecke schnell hinter sich bringen und sich in den Wäldern verstecken, wo er sie nur schwer finden konnte. Sie durfte ihm nicht entkommen!
***
De Bruce kennt den Pfad, schoss es Melisande durch den Kopf. Aber er ist weit genug entfernt. Er muss die Schlucht umgehen. Wir können es schaffen. Wir müssen es schaffen.
Sie stürmte los und drängte Rudger, schneller zu machen. »De Bruce will uns abfangen«, schrie sie ihm zu.
Im Laufschritt hetzten sie den steilen Pfad hinauf, Beata schiebend und zerrend. Jeder Schritt wurde zur Qual, Gertrud wimmerte unaufhörlich.
Endlich erreichten sie den Kamm der Schlucht, verschwitzt und bis auf Rudger benommen vor Erschöpfung. Er ging ein paar Schritte zurück und spähte hinab, kam wieder zu Melisande und reichte ihr einen Dolch. »Nimm. Wenn ich nicht mehr kämpfen kann, musst du es tun.«
»Aber du kommst doch mit uns, Rudger! Du kannst uns nicht hier alleinlassen.«
»Ich muss euch den Rücken frei halten. Die Linien sind zusammengebrochen, die Schlacht tobt jetzt um die Wagen. Uns sind drei Männer den Steilhang hinauf gefolgt. Vielleicht haben sie auch hier auf uns gewartet, ich weiß es nicht. Ich werde sie töten, dann komme ich nach. Geh jetzt, Schwester. Wir werden uns wiedersehen. Wenn nicht in dieser Welt, dann im Himmel.«
Beata umarmte ihren Sohn, Tränen flossen über ihre bleichen Wangen. Rudger machte sich frei und stieß sie weg. »Flieht endlich. Bringt euch in Sicherheit, sonst war alles vergebens!«
***
Rudger sah seiner Mutter und seinen Schwestern ein paar Wimpernschläge lang hinterher, dann kniete er nieder, faltete die Hände und betete. Die Waffen der Verfolger klirrten, die Männer schnauften. Rudger hatte die Augen nur einen Spalt geöffnet, gerade so weit, dass er sehen konnte, wie die Feinde den Weg hochstürmten. Er betete weiter. Die Männer blieben stehen, atmeten schwer.
Einer zeigte auf Rudger. »Wunderbar, er hat eingesehen, dass er sterben muss, und fleht bei Gott um Gnade.«
Die anderen lachten und hoben ihre Schwerter. Rudger ließ sie herankommen, dann rollte er sich blitzschnell nach vorne ab, mitten durch die Angreifer hindurch, die nicht rasch genug reagieren konnten. Er zog das Schwert, schnellte hoch und stieß es in der Drehung durch die Kehle des ersten Feindes. Der sackte röchelnd zusammen. Die beiden anderen sprangen zurück.
»Du miese kleine Ratte! Ich werde dich in Stücke hacken«, schrie einer von ihnen.
Wutentbrannt drangen sie auf Rudger ein, der die Angriffe Hieb um Hieb parierte, aber bald am Ende seiner Kräfte war. Sie trieben ihn ein Stück weit auf ein paar Büsche zu. Einer stolperte, Rudger machte einen Schritt nach vorne und trieb ihm das Schwert in den Leib. Als er es herausziehen wollte, steckte es fest. Er setzte den Fuß auf den Brustkorb, zerrte an dem Schwert und spürte zugleich, wie die Waffe seines Feindes ihm in die Seite fuhr. Mit einer Hand packte er die Klinge und hielt sie fest, mit der anderen schaffte er es noch, sein Schwert freizubekommen und es seinem Mörder unter das Wams zu stoßen.
Rudger schwankte. Er wusste, dass er sterben musste. Doch er starb nicht vergebens. Seine Mutter und seine Schwestern waren entkommen. Das allein zählte. Er ließ die Klinge los, sah noch, wie der Söldner schmerzverzerrt grinste, dann holte ihn der Tod.
***
Melisande, Beata und Gertrud flohen weiter über die kahle Ebene auf die schützenden Bäume zu und erreichten mit letzter Kraft den Waldrand. Keuchend und sich nach allen Seiten umschauend, kauerten sie zwischen den Stämmen.
Melisande versuchte, ruhiger zu atmen und zu horchen. Doch sie konnte nichts hören außer dem Rauschen ihres eigenen Blutes. Plötzlich fuhr ihr die Todesangst in die Glieder. Hufschlag und Schnauben. De Bruce! Sie griff den Dolch fester. Sie würde ihre Schwester und ihre Mutter mit ihrem Leben verteidigen.
Wenige Herzschläge ruhten sie aus, dann zog und zerrte Melisande ihre Mutter weiter. Diese hielt sich den Bauch und hörte nicht auf zu weinen. Gertrud hingegen war verstummt. Wie eine Puppe lief sie ihnen hinterher, ihr Blick ging ins Leere.
Der Wald nahm kein Ende, Vögel flogen von den Ästen auf und kreischten aufgeregt. Irgendwann – Melisande hatte jedes Gefühl für Zeit verloren – stolperten sie auf eine Lichtung. Und erstarrten. In der Mitte stand einer von de Bruce’ Männern, und er hielt ein blutverschmiertes Schwert in der Hand. Rudgers Schwert!
Der Mann kam näher, wog die Waffe in der Hand. »Er hat gut gekämpft, Euer Sohn, das muss man ihm lassen. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Wilhelmis auch nur einen Funken Mut im Leib hat. Ihr könnt mit in den Tod nehmen, dass er wie ein Krieger gestorben ist.« Er leckte sich die Lippen. »Wie dumm, dass Eure Töchter noch keine richtigen Weiber sind. Und Ihr seid schwanger. Wie abstoßend!« Er schüttelte sich und grinste. »Ich werde mich dennoch an Euch schadlos halten.«
Melisande hätte sich am liebsten auf den Boden geworfen und wäre nie wieder aufgestanden. Rudger war tot! Das konnte nicht sein. Das durfte nicht sein! Rudger war der mutigste und stärkste Kämpfer, den es gab. Abgesehen von Vater natürlich. Bestimmt log der fremde Ritter. Aber wieso hatte er dann Rudgers Schwert?
Ein Geräusch schreckte Melisande auf. Ein Stöhnen, tief und schmerzerfüllt. Neben ihr wankte Beata, hatte Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Rasch griff Melisande nach ihr und hielt sie fest. Sie musste sich zusammenreißen. Sie durfte nicht aufgeben, wenn nicht um ihretwillen, dann für Mutter, Gertrud und das ungeborene Geschwisterchen!
Tief atmete sie ein und aus. Sie musste klar denken. Der Mörder von Rudger musste sie im Wald überholt haben, um ihnen hier auf der Lichtung aufzulauern. Durch das dichte Laub hatten sie ihn nicht sehen können. Aber warum sprach er so merkwürdig? Als hätte er zu viel Wein getrunken ... Da sah sie es. Blut sickerte aus seinem Wams. Rudger musste ihn verletzt haben. Was tun? Ihn angreifen? Nein. Er schien immer noch Herr seiner Kräfte zu sein. Sie musste ihn kommen lassen und dann mit dem Dolch sein Herz treffen. Das war die einzige Möglichkeit.
»Ihr seid ein erbärmlicher Feigling«, rief sie mit zitternder Stimme. »Mit wie vielen Männern seid Ihr über meinen Bruder hergefallen? Mit zehn mindestens, sonst hätte er Euch alle in Stücke gehauen.« Sie deutete auf sich. »Und jetzt wollt Ihr gegen zwei Mädchen und eine Schwangere antreten. Bravo, edler Ritter! Ihr seid eine Zierde Eures Standes.«
Der Mann lief rot an. »Du kleines Stück Dreck, du widerliche Metze! Deiner Mutter werde ich das Kind aus dem Bauch schneiden, deine Schwester werde ich an einen Baum nageln, und dir werde ich bei lebendigem Leibe das Herz herausreißen und in dein Lästermaul stopfen.« Er schob sich ein paar Schritte näher, stockte. Seine Augen glänzten fiebrig, sein Schwertarm hing schlaff herunter.
Melisande traf eine Entscheidung. Sie rannte los, direkt auf ihn zu, schlug im letzten Moment einen Haken und sah, dass er wie betäubt reagierte. Langsam hob er das Schwert, aber bevor er zuschlagen konnte, war sie schon an ihm vorbei.
Sie drehte ihm eine Nase. »Mein Bruder hat auch dich in die Hölle geschickt. Du stirbst, du Aufschneider! Gott wird dich streng bestrafen. Im ewigen Feuer wirst du brennen, mit all den Gottlosen, die uns überfallen haben. Bete um dein Seelenheil, bete!«
Ihre Angst war grenzenloser Wut gewichen, sie nahm Anlauf, sprang vor dem Krieger hoch und rammte ihm den Dolch in die Brust. Wie vom Blitz gefällt stürzte er und riss Melisande mit sich.
Sie rollte sich zur Seite, kam wieder auf die Beine und rannte zu Mutter und Schwester zurück. Beata saß mit dem Rücken gegen einen Baum gelehnt, hatte die Augen geschlossen. Ihr Atem ging schwer und unregelmäßig. Gertrud hockte neben ihr und weinte lautlos.
»Lass uns weitergehen Mutter«, flehte Melisande. Aber Beata rührte sich nicht. Ihre Lider flatterten, langsam hoben sie sich. Ein feines Lächeln überzog ihr Gesicht, das von Schweiß glänzte. Sie streckte die Hand aus. Blut klebte an ihren Fingern.
»Mutter ...« Melisande konnte nicht weitersprechen.
Beatas Lippen öffneten sich einen Spalt. »Ein Armbrustbolzen. Schon auf dem Wagen ...« Sie stöhnte.
Eine eisige Hand griff nach Melisandes Herz.
Beata stöhnte. »Du musst mir versprechen ...« Sie atmete einige Male heftig. »Versprich mir etwas!«
Melisande nickte stumm.
»Lauf weiter. Lauf, so schnell du kannst. Bring deine Schwester in Sicherheit. Beschütze sie vor diesem Monster. Wirst du das tun?«
»Ja, Mutter. Das werde ich.« Melisande kniete sich vor Beata auf den Waldboden.
Beata nickte. »Und noch etwas, mein Kind. Noch etwas musst du mir versprechen. Bei deinem Leben.«
Melisande drückte die Hand ihrer Mutter. Sie war eiskalt.
»Ottmar de Bruce muss sterben. Versprich mir, dass du nicht ruhen wirst, bis er tot ist. Und du, du musst leben, du darfst nicht sterben.«
Melisande schluckte, ihr Hals war staubtrocken. »Ich verspreche es dir, Mutter. Ich schwöre es. Bei Gott. De Bruce wird sterben, und ich werde leben.«
Beata hatte nicht mehr die Kraft zu lächeln. »Braves Kind. Wir sehen uns wieder. Ich sehe schon die Himmelspforte. Es ist so, wie der Pater Nikodemus gesagt hat. Ein helles Licht, ein Licht ...« Beatas Kopf sackte zur Seite.
Melisande spürte ein leichtes Beben tief in ihrem Inneren. Und eine warme Welle, die ihr jeden Schmerz nahm. Die Welle erreichte ihren Kopf, plötzlich waren ihre Gedanken ganz klar. Gertrud. Sie musste ihre Schwester in Sicherheit bringen.
Sie schloss ihrer Mutter die Augen, nahm Gertrud an der Hand und zog sie weg. Aber das Mädchen sträubte sich, schrie und trat mit den Füßen nach ihr. »Ich gehe nicht mit dir! Ich bleibe hier! Lass mich los!«
Melisandes Hände begannen zu zittern. »Gertrud, Mutter ist tot! Du kannst nicht hierbleiben. Wir müssen weiter! Schnell!«
Gertrud schrie und strampelte noch wilder. »Nein! Nein! Lass mich!«
Ängstlich schaute Melisande sich um. Noch war alles still. Kein verräterisches Knacken im Unterholz. Kein Verfolger in Sicht. Behutsam strich sie ihrer Schwester über den Kopf. »Hast du nicht gehört, was Mutter gesagt hat?«, fragte sie sanft. »Wir sollen weiterlaufen. Sie ruht sich aus und kommt später nach. Aber wir dürfen nicht länger verharren. Du musst Mutter gehorchen, das weißt du doch.«
Gertrud blickte auf und sah Melisande in die Augen. Sie nickte. Langsam, unendlich langsam erhob sie sich, warf einen letzten unsicheren Blick auf ihre tote Mutter, dann ließ sie sich von Melisande weiterführen. Rasch liefen sie Hand in Hand über die Lichtung. Das feuchte Gras kühlte ihre schmerzenden Füße.
Melisande sah sich unruhig um. Auf der anderen Seite begann dichtes Unterholz, dort würde de Bruce sie nicht so einfach finden. Und er würde zu Fuß nach ihnen suchen müssen. Kein Reiter kam da hindurch. Nur noch ein paar Schritte, dann hatten sie es geschafft.
Sie hörte das Sirren zu spät. Gertruds Hand löste sich aus ihrer, entsetzt fuhr Melisande herum. Ihre Schwester lag im Gras. Ein Pfeil hatte ihren schmalen Rücken durchschlagen und ihr das Herz zerrissen.
Auf der anderen Seite der Lichtung ließ Ottmar de Bruce den Bogen sinken. Er rutschte von seinem Rappen, stellte sich breitbeinig hin und stemmte die Hände in die Hüften. Er lachte aus vollem Hals.
Melisande machte einen Sprung ins Unterholz.
De Bruce hörte abrupt auf zu lachen. »Versteck dich nur, kleines Hündchen. Glaubst du wirklich, dass du mir entkommen kannst? Niemand wird es wagen, dir zu helfen, denn es wäre sein sicherer Tod. Das Geschlecht der Wilhelmis wird am heutigen Tage für immer und alle Zeiten ausgelöscht. Willst du nicht herkommen und mit mir kämpfen? Nein? Dann sieh her. Sieh, welche Macht ich habe. Nicht einmal Gott kann mich von meinem Vorhaben abhalten.«
Er packte die tote Beata an den Fesseln und zerrte sie weg von dem Baum in die Lichtung hinein. Dort ließ er ihre Beine ins Gras fallen, zog das Schwert und schlitzte ihr den Bauch auf. Mit einem Griff zog er den Säugling heraus, durchschlug die Nabelschnur und hielt das blutige Bündel hoch, das zu atmen versuchte, einen glucksenden Laut von sich gab.
»Na? Wo ist Gott? Kein Blitz, keine Flut. Nichts. Die Macht hat derjenige, der sie sich nimmt.« De Bruce blickte dorthin, wo Melisande im Unterholz verschwunden war. »Ich gebe dir eine Chance. Du bist mutig. Ich habe gesehen, wie du diesen Trottel abgestochen hast.«
Er legte sein Schwert auf den Boden und zog sich an den Rand der Lichtung zurück. In aller Ruhe nahm er einen Pfeil, holte aus und nagelte den Säugling an einen Baum. Der wimmerte nicht einmal, lediglich ein Zucken lief durch seinen winzigen weißen Körper, bevor er starb.