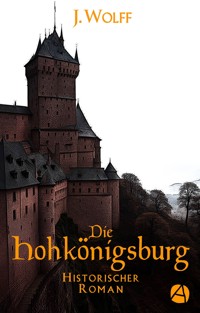
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wir schreiben das Jahr 1483. Graf Wilhelm von Thierstein, der neue Landvogt im Elsaß, wird von Teilen des Adels abgelehnt. Die allgemeine Unzufriedenheit möchte Burkhard von Rathsamhausen zu seinem eigenen Vorteil nutzen. Denn nur zu gerne würde er selbst der Herr über die gewaltige Hohkönigsburg werden. Und so ergreift er die günstige Gelegenheit und schürt eine Fehde gegen die Thiersteiner… “Die Hohkönigsburg” erzählt eine packende Geschichte von Fehden in der malerischen Umgebung des Wasgaus. Wolffs präziser und detaillierter Schreibstil schafft eine lebendige Atmosphäre, die die Leserinnen und Leser in vergangene Zeiten entführt. Die Darstellung der mittelalterlichen Konflikte bietet einen faszinierenden Einblick in die Geschichte und Kultur jener Ära.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
J. WOLFF
DIE HOHKÖNIGSBURG
HISTORISCHER ROMAN
DIE HOHKÖNIGSBURG wurde zuerst 1902 in Berlin veröffentlicht.
Diese Ausgabe wurde aufbereitet und herausgegeben von
© apebook Verlag, Essen (Germany)
www.apebook.de
2024
V 1.0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-96130-617-6
Buchgestaltung: SKRIPTART, www.skriptart.de
Books made in Germany with
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
Follow apebook!
ROMANE von JANE AUSTEN
im apebook Verlag
Verstand und Gefühl
Stolz und Vorurteil
Mansfield Park
Northanger Abbey
Emma
*
* *
HISTORISCHE ROMANREIHEN
im apebook Verlag
Der erste Band jeder Reihe ist kostenlos!
Die Geheimnisse von Paris. Band 1
Mit Feuer und Schwert. Band 1: Der Aufstand
Quo Vadis? Band 1
Bleak House. Band 1
Am Ende des Buches findest du weitere Buchtipps und kostenlose eBooks.
Und falls unsere Bücher mal nicht bei dem Online-Händler deiner Wahl verfügbar sein sollten: Auf unserer Website sind natürlich alle eBooks aus unserem Verlag (auch die kostenlosen) in den gängigen Formaten EPUB (Tolino etc.) und MOBI (Kindle) erhältlich!
Inhaltsverzeichnis
Die Hohkönigsburg
Impressum
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
Eine kleine Bitte
Buchtipps für dich
Kostenlose eBooks
A p e B o o k C l a s s i c s
N e w s l e t t e r
F l a r a t e
F o l l o w
A p e C l u b
Links
ApePoints sammeln
Zu guter Letzt
I.
Im Augustsonnenschein des Tages St. Bartholomäi 1483 wehte auf dem Bergfried der Hohkönigsburg des größten Schlosses im ganzen Elsass, eine Fahne in den Thierstein’schen Farben, gelb und rot, denn die Grafen dieses Namens führten in ihrem Wappenschilde sieben rote Rauten in goldenem Felde.
Die Burg lag auf einem von Osten nach Westen gestreckten Bergrücken, der aber nach der Ebene zu mit seiner Schmalseite als ein alle anderen sichtbaren Höhen übersteigender, spitzer Kegel erschien und, Mauern und Turme gleich einer zackigen Krone tragend, den Blick aus der Ferne schon auf sich zog und unwiderstehlich fesselte.
Die Umwallung der sehr ausgedehnten Werke bestand aus zwei, durch einen breiten Zwischenraum getrennten Ringmauern, deren äußere mit einer Anzahl vorspringender Rundtürme bewehrt war, und drei, in gemessenen Abständen aufwärts folgende Tore hatte zu durchschreiten, wer zum Hochschlosse hinan wollte. An jedem dieser Tore stand heut ein Doppelposten von geharnischten Knechten, die mit ihren Hellebarden in kerzengrader Haltung den nahenden Gästen des Burgherren salutierten. Hinter dem zweiten Tore gelangte man auf einen geräumigen Hof, wo sich die Stallungen, Sattel- und Geschirrkammern und die Schmiede befanden. Dort mussten die Berittenen vom Pferde steigen, denn von hier aus hatten sie den in mehreren Absätzen über Treppenstufen führenden Weg zum dritten und höchsten Tore zu Fuß zu machen. Es hieß das Löwentor, weil über seinem Bogen zu beiden Seiten eines stark beschädigten, nicht mehr erkennbaren Wappens — vermutlich das der Hohenstaufen — zwei in Stein gehauene Löwen ruhten. Hier stand außer den zwei Reisigen noch ein Herold mit dem Stab, in Federbarett und gesticktem Wappenrock, um die Ankommenden im Namen seines Herren zu empfangen und sie bis zum Eingange des Saalbaues zu geleiten.
Man erwartete heut viel Besuch, denn es galt, das nach seiner Erstürmung völlig ausgebrannte, jetzt aber mächtig und prächtig wieder aufgerichtete Schloss durch ein glänzendes Fest einzuweihen, zu dem Einladungen an die im weiteren Umkreis wohnende Ritterschaft ergangen waren.
Wechselvolle Schicksale hatten die Hohkönigsburg seit ihrer Entstehung heimgesucht.
Ursprünglich geschaffen war sie im zwölften Jahrhundert von den Hohenstaufen. Nach ihnen hatten die Herzöge von Lothringen die Lehenshoheit und belehnten nacheinander die Landgrafen von Werd, die Grafen von Öttingen und die Bischöfe von Straßburg mit der vielumworbenen Feste, die zeitweilig auch an die Rappoltstein, von Rathsamhausen und von Hohenstein als Afterlehen überging. Dann kam sie an das Habsburgische Kaiserhaus, in dessen Besitz sie lange verblieb. Um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts aber hatte sich eine Schar wüster Placker und Pracher, unter denen auch einige von Adel waren, dort widerrechtlich eingenistet und trieb als Wegelagerer und Buschklepper ihr freches Räuberhandwerk in einer für die ganze Umgegend so unerträglichen Weise, dass sich endlich der Bischof und der Rat von Straßburg, die Grafen von Rappoltstein und die Bürgerschaft von Schlettstadt zum Kampfe gegen die streitbaren Schnapphähne und ihre zahlreichen Spießgesellen verbündeten, die Burg belagerten und einnahmen, das Gesindel, das leider durch die Flucht entkam, verjagten und das zum Raubnest gewordene Schloss zerstörten.
Über ein halbes Menschenalter lang starrten die gewaltigen Trümmer öde und obdachlos auf dem hohen Bergrücken gen Himmel, bis 1479 Kaiser Friedrich III. die Grafen Oswald und Wilhelm von Thierstein mit der Burg belehnte und denen, die sie gebrochen hatten, dem Bischof und der Stadt Straßburg, gebot, sie zu Schutz und Trutz fest und wohnlich wieder herzustellen. Der Obermeister der im ganzen deutschen Reiche berühmten und entscheidenden Bauhütte des Münsters empfahl zu dem Zwecke einen tüchtigen, erfahrenen Mann, und der Erwählte, Meister Ebhardt, baute und besserte mit Straßburgischen Werkleuten und Straßburgischem Gelde Jahre lang, ehe die Grafen von Thierstein mit ihren Familien, einem auserlesenen Gesinde und einer ansehnlichen Besatzung in die herrlich wieder erstandene Hochburg einziehen konnten. Und heute, kaum zwei Wochen nach deren Übersiedelung von ihrem Herrenhofe zu Straßburg, waren die Tore des alten Hohenstaufenschlosses laubgeschmückt und gastlich geöffnet, um die Menge der Geladenen einzulassen.
Nur ein Thierstein’sches Familienglied fehlte bei dem heutigen Feste, Graf Oswalds einziger, noch unmündiger Sohn Heinrich, der als Edelknabe auf der Burg eines alten Adelsgeschlechtes in der Schweiz war, um dort, wie das so Brauch war, unter fremder Zucht und Obhut ritterliches Wesen und höfischen Dienst zu lernen.
Die beiden Reisigen, die am Löwentor die Ehrenwache hatten und reicher gekleidet und gewappnet waren als die Knechte an den unteren Toren, waren Dienstleute aus der nächsten Umgebung des Schlossherren, der eine, Marx, der Falkonier, der andere, Herni, der Armbrustspanner des Grafen Oswald, der als der ältere der zwei Brüder Thierstein der eigentliche machthabende Lehensträger war. Der Dritte hier an dem Tore, der in Heroldstracht, Ottfried Isinger, nahm als Stallmeister eine Vertrauensstellung auf der Burg ein und kannte viele der Herren, die nach und nach mit ihren Gemahlinnen, Söhnen und Töchtern oder auch allein die Treppen heraufkamen. Er nannte seinen Gesellen die Namen von Fleckenstein, Müllenheim, Andlau, Geroldseck, Dürkheim, Kageneck, Zorn von Bulach, und der eine und der andere der Herren hatte ein freundliches Wort für ihn, aber die meisten schritten ohne Gruß durch das Tor und würdigten den sich tief Verbeugenden keines Blickes.
Als nun wieder einmal eine Gesellschaft von Herren und Damen so achtlos eingetreten war, meinte Herni, der Armbrustspanner:
»Es will mich bedünken, als kämen unsere vornehmen Gäste nicht alle mit fröhlichen Gesichtern. Manche schauen fast mürrisch und unzufrieden darein.«
»Hab’ ich auch schon gemerkt«, stimmte der Falkonier ihm zu. »Und wisst Ihr, was ich glaube? — Sie gönnen uns die schöne, große Burg nicht; manch einer von ihnen hauste gern selber hier oben als hochmögender Herr und Landvogt im Wasigen.«
»Damit könntest du recht haben, Marx!« lachte Isinger. »Dieser und jener mag auf das Lehen gehofft haben, denn keine von allen ihren Burgen ist so groß und stark wie diese außer Girbaden vielleicht, das den Müllenheim gehört. Aber unser Herr hat beim Kaiser einen Stein im Brett, denn er hat dem Haus Österreich gute Dienste geleistet, und Bischof Albrecht von Straßburg Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Bayern, hat als sein Fürsprecher beim Habsburger eine gewichtige Stimme.«
»Wer waren denn die Letzten, die so hochnäsig vorübergingen?« fragte Herni.
»Der eine, der Gedrungene, Breitschultrige, sah dich ganz übermesslich an, Ottfried!«
»Ja, der kennt mich, und ich kenne ihn auch«, erwiderte der Stallmeister mit besonderem Nachdruck. »Es war Herr Burkhard von Rathsamhausen mit seiner Sippe, die auf den beiden Ottrotter Schlössern sitzen.«
»Aha!« machte Herni, »darum der böse Blick. Die haben auch einmal hier oben gesessen, vom Kaiser Wenzel mit der Burg belehnt. Es geht die Sage, ihrer sieben Rathsamhausen hätten sich einst, als sie hier die Herren waren, durch Handfeste untereinander gelobt und verpflichtet, dass kein einziger etwas von seinem Besitz veräußern sollte ohne Willfahren aller Übrigen.«
»So? Woher weißt du denn das?«
»Hat mir unser Graf einmal auf einem Pirschgang erzählt.«
»Ja, dann wird es sie wohl wurmen, dass sie nicht wieder die Belehnten sind«, meinte Isinger, »denn die Rathsamhausen sind das stolzeste Geschlecht im ganzen Wasgau.«
»Stolz! Graf Oswald ist auch stolz, und das wahrhaftig nicht wenig«, sagte Marx.
»Hat auch Ursach dazu als Schlossherr von Hohkönigsburg, aber so trotzig und starrköpfig wie Herr Burkhard ist er doch nicht. Das ist ein abenteuriger Mann und hat ein gar grimmig Gemüt; ich könnte euch mehr als ein verwegenes Stücklein von ihm erzählen.«
»O, unser Graf lässt nicht mit sich spaßen«, bemerkte Herni. »Wer ihm steifnackig entgegentritt, den weiß er zu ducken, wenn’s nötig ist.«
»Gewiss! Aber in diesen letzten Tagen, wo ich viel mit ihm zu beraten hatte, wollte er mir gar nicht gefallen. Er war unruhig, aufgeregt und schien sich auf das Bankett nicht recht zu freuen, als sorgte er um den Verlauf und das gute Gelingen.«
»Dann konnte er es ja unterlassen«, sagte Marx.
»Das ging nicht; er ist es sich und seiner Stellung schuldig, sich bei seinem Einzuge hier als Herr und Gebieter der mächtigsten Burg im Lande den anderen Edelleuten zu zeigen und ihnen seinen hohen Rang von vornherein klar zu machen. Begreifst du das?«
»Hm! Deshalb! Ja natürlich!«
Sie mussten das Gespräch abbrechen, denn jetzt nahte Seine Hochwürden der Abt von St. Pilt mit mehreren seiner Chorherren und einigen Chorknaben, die zur Weihe der Schlosskapelle geladen waren und von den Wachthabenden in schweigender Ehrfurcht gegrüßt wurden.
Es war Nachmittag. Die Sonne stand noch ziemlich hoch über dem Walde, der mit seinen alten, mächtigen Tannen, seinen Eichen und Buchen die Berge und Täler unabsehbar bedeckte und aus dem sich, hell beleuchtet, die benachbarten Burgen erhoben. Den schroffen Gipfel zur Rechten hielt Hohrappoltstein wie eine Wacht besetzt, zur Linken funkelte die Frankenburg und weiterhin am steilen Bergeshang die Scherweiler Schlösser Ortenberg und Ramstein. Tief unten aber, gradaus ergoss sich weit und breit mit Städten und Dörfern und Rebengeländen das Ried, die fruchtbare Ebene zum Rheine hin, dessen Spiegel man bei Breisach blitzen und blinken sah. Jenseits des Stromes lagerte deutlich das Kaiserstuhlgebirge, und im Hintergrunde schimmerten langgezogen und wolkenhoch die Umrisse des Schwarzwaldes. Aber die äußerste Ferne war dunstig, und die Alpen, die bei ganz klarem Wetter ihre schneeigen Häupter über den Horizont emporrecken, waren nicht sichtbar.
So bot der Ausblick von hier oben ein herrliches Bild, und einer der Herren, die sich samt ihren Damen soeben im Stallhof aus den Sätteln geschwungen hatten, schien es vom untersten Treppenabsatz über die Ringmauern hinweg so aufmerksam zu betrachten, als suchte er darin einen bestimmten Punkt. Es war der Graf Maximin, genannt Schmasman, von Rappoltstein, in dem Geschlecht der zweite seines Namens, der mit seiner Gemahlin Herzelande und seiner Tochter Isabella heraufgeritten war. Sie wohnten auf der St. Ulrichsburg über dem Städtchen Rappoltsweiler, und in ihrer Begleitung waren sein Bruder Kaspar und dessen noch junge Gemahlin Imagina, die von ihrem ganz nahe dabei befindlichen Felsenhorst Burg Giersberg den gleichen Weg mit ihnen hatten, während der dritte Bruder, der im Alter zwischen jenen beiden stand, Graf Wilhelm und seine Gemahlin von dem höher liegenden Hohrappoltstein noch fehlten oder vielleicht schon vor ihnen eingetroffen waren.
Gräfin Herzelande trat zu dem Umschauhaltenden heran und fragte:
»Wonach spähst Du, Schmasman?«
»Mich verdrießt es«, erwiderte der Graf, »dass von Egenolf noch immer nichts zu sehen ist; er hätte heute pünktlich sein sollen.«
»Unser lieber Sohn wird schon nachkommen«, suchte die Gattin den Grollenden zu beruhigen. »Ich habe ihm sein Festgewand bereitlegen lassen, dass er nur hineinzuschlüpfen braucht, wenn er vom Gejaide heimkehrt.«
»Schon den dritten Tag ist er von früh bis spät auf der Pirsch. Welches seltenen Wildes Fährte mag er so eifrig verfolgen, dass er alles darüber vergisst?«
»Ei, lass ihn doch pirschen, Schwager!« sprach mit anmutiger Gebärde Gräfin Imagina und streichelte dem Familienoberhaupte die bärtige Wange. »Das edle Waidwerk ist nun einmal Egenolfs größte Freude.«
»Die Freude gönn’ ich ihm«, sagte der Graf, »aber heute musste er Rücksicht nehmen. Die Thiersteiner werden denken, er früge nichts danach, bei dem Antrittsfest ihr Gast zu sein. Graf Oswald ist ohnehin misstrauisch und wittert bald hier, bald dort einen Gegner und Neider.«
»Es fehlt ihm auch wohl an solchen nicht«, fiel Graf Kaspar ein.
»Mag sein«, antwortete der ältere Bruder. »Er hat keinen leichten Stand und wird noch um Gunst werben müssen, ehe es ihm gelingt, sich unter uns Alteingesessenen hier heimisch und beliebt zu machen, falls ihm überhaupt etwas daran gelegen ist.«
»Die Thiersteiner sind selber ein altes Rittergeschlecht«, sprach Gräfin Herzelande.
»Aber Eingewanderte, Schweizer, aus dem Aargau und ehemals Lehensträger der Baseler Bischöfe. Der hohen Klerisei verdanken sie zumeist den kaiserlichen Lehensbrief.«
»Schmasman, du hast mit keinem Auge nach der Hohkönigsburg geschielt?« neckte ihn die allzeit muntere Imagina.
»Ich?! Nein, du fürwitziges Weiblein!« lachte der Graf hell auf, »aber ich glaube, ich hätte sie haben können, wenn ich ernsthaft danach getrachtet hätte.«
»Und du hättest keinen Neider gehabt«, fügte Herzelande mit einem innigen Blick auf ihren stattlichen, ritterlichen Gemahl hinzu.
»Wer weiß? Aber lasst uns hier nicht länger stehen bleiben«, mahnte Schmasman, »ich höre neue Gäste anreiten.«
Sie stiegen langsam die Stufen hinan, doch nach einer kleinen Weile sagte Schmasman zu der neben ihm gehenden Herzelande:
»Soll mich nur wundern, ob die Ottrotter heute kommen werden.«
»du zweifelst daran?« fragte sie, wie erschrocken wieder stehen bleibend.
»Sicher bin ich nicht. Burkhard war wenig geneigt dazu, und ich habe ihm stark zureden müssen. Er fühlt sich durch die Art der Einladung verletzt, weil es Graf Oswald nicht der Mühe wert gehalten, ihm seinen Besuch zu machen, sondern nur seinen jüngeren Bruder Wilhelm geschickt hat, der einen etwas kühlen Empfang aus Schloss Rathsamhausen gefunden haben mag, wie ich aus Burkhards Reden schließen muss.«
»Ist das sein einziger Grund, heut aus der Hohkönigsburg nicht erscheinen zu wollen? Da könnten wir uns ja gleichfalls beklagen, denn wenn auch Graf Oswald bei uns auf der Ulrichsburg war, seine Frau und Tochter haben sich mir und Isabella nicht präsentiert, so nahe wir ihnen auch wohnen. Wir kennen die Damen noch gar nicht.«
»Das schadet ja nichts, Mutter!« sprach hinter ihren Eltern Isabella. »Ich freue mich auf das Fest und werde mich mit der jungen Gräfin schon zu stellen wissen.«
»Sie haben auch in der kurzen Zeit, die sie hier sind, mehr zu tun gehabt als nach allen umliegenden Burgen zu reiten«, entschuldigte Herzelande selbst die ihr bisher noch Ferngebliebenen. »Wer wird denn unter diesen Umständen so empfindlich sein!«
»So denk’ ich auch«, sagte Schmasman, »aber du kennst doch unsern Freund Burkhard. Wenn der in übler Laune ist, ärgert ihn die Fliege an der Wand, dass ihm die Zornader schwillt. Ich bin sehr neugierig, ob er hier sein wird, und wenn nicht, so wird zwischen ihm und Thierstein wenig Liebe wachsen.«
Inzwischen waren sie, bald auf einem Treppenabsatz anhaltend, bald gemächlich weiterschreitend, an das Löwentor gekommen. Schmasman stutzte, als er des Heroldes dort ansichtig wurde, fasste ihn scharf ins Auge und begann:
»Bist du es wirklich, Ottfried Isinger, der in dem prächtigen Wappenrocke steckt?«
»Euer Gnaden zu dienen, Herr Graf!« antwortete Isinger, sich nochmals verneigend und hoch erfreut, dass ihn Schmasman erkannt und angeredet hatte.
»Ich habe dich lange nicht gesehen und wusste nicht, dass du mit hier oben bist. Was schaffst du denn hier? Spielst du bloß Herold?«
»Nein, Herr Graf! Ich bin Stallmeister auf der Hohkönigsburg.«
»Na sieh mal einer an!« lächelte Schmasman. »Dann sagt mir doch, Herr Stallmeister: Sind die Herren von Rathsamhausen schon eingetroffen?«
»Jawohl, Herr Graf!« erwiderte Isinger, »die Herren Burkhard und Philipp von Rathsamhausen mit dero Gemahlinnen und Junker Bruno sind bereits oben im Schloss.«
»Das freut mich zu hören«, sagte Schmasman, fast aufatmend, wie von einer Sorge befreit. »Hat der Trotzkopf doch noch Vernunft angenommen«, flüsterte er Herzelande zu.
Sie schritten, von Isinger geleitet, durch den Eingang in den von hohen Gebäuden eingeschlossenen inneren Burghof, und hier wandte sich Imagina mit einem schelmischen Lächeln zu dem führenden Herold:
»Herr Stallmeister, Euren Marstall müsst Ihr mir heute noch zeigen, ich habe so viel Pferdeverstand, dass ich einen Rappen von einem Schimmel unterscheiden kann.«
»Stehe jederzeit zu Befehl, gnädigste Frau Gräfin!« erwiderte Isinger ehrerbietig und begab sich zum Löwentor zurück.
Die Herrschaften aber stiegen über die in einem Turme befindliche Wendeltreppe zu den Festräumen des Palas empor.
II.
»Seid willkommen auf der Hohkönigsburg, Ihr Herren und Frauen von Rappoltstein! Ich grüße Euch als meine Standesgenossen und hoffe, dass ich mich guter Nachbarschaft von Euch zu versehen habe.«
Mit diesen erhobenen Hauptes und in lautem Tone gesprochenen Worten empfing Graf Oswald von Thierstein die Eintretenden und reichte jedem derselben leicht die Hand. Dann wandte er sich um, winkte und rief in das Gemach hinein:
»Margarethe! Leontine!«
Die Gerufenen, seine Gemahlin und seine Tochter, kamen herbei, und ihre Begrüßung der drei Rappoltstein’schen Damen war eine sehr herzliche. Sie drückten sich alle die Hände, schauten sich teilnahmsvoll prüfend in die Augen, und die Blicke von der einen wie von der anderen Seite bezeugten ein offenbares Wohlgefallen aneinander.
»Verzeiht, Frau Gräfin Rappoltstein«, begann Gräfin Margarethe, »dass ich mit meiner Tochter noch nicht bei Euch war, aber in diesen zwei Wochen wusste ich wahrlich nicht —«
»Nur keine Entschuldigung, Gräfin Margarethe!« unterbrach sie Herzelande in der gewinnendsten Weise, »auch eine Schlossherrin ist in erster Reihe Hausfrau.«
»Ich danke Euch für Eure Nachsicht und werde das Versäumte nachholen; bald, sehr bald komme ich zu Euch.«
»Und sollt auf der Ulrichsburg mit offenen Armen empfangen werden.«
»Und Ihr, Gräfin Imagina?« wandte sich die Wirtin zu der Gemahlin Kaspars, »mein Gott, wie jung noch! Ihr könntet ja meine Tochter sein.«
»Da überschätzt Ihr Euch und unterschätzt mich, Frau Gräfin«, lachte Imagina, »Euch wie eine Mutter zu verehren wäre eine Beleidigung Eurer eigenen Jugendlichkeit.«
»Eine Schmeichlerin seid Ihr also? Da muss man sich ja vor Euch hüten.«
Und sie lachten sich beide fröhlich ins Gesicht.
Zu Isabella hatte die Gräfin Tochter gesagt:
»Lasst uns versuchen, Freundschaft miteinander zu schließen. Leontine heiße ich und Ihr Isabella, ich weiß es schon und war sehr begierig, Euch zu sehen. Wir wollen zusammen reiten; ich weiß noch gar nicht Bescheid hier, habe mich neulich schon einmal im Walde verirrt, bis ich einen Jägerknecht traf, der mich zurechtwies. Da führt Ihr mich denn die schönsten, einsamen Waldpfade durch Täler und Schluchten, die ich so gern zu Pferde durchstreife.«
Auch Graf Wilhelm von Thierstein und seine Gemahlin waren zu den Rappoltsteinern herangetreten und hatten mit ihnen Bekanntschaft gemacht, indessen Graf Oswald mit Schmasman im Gespräch geblieben war, das sich in höflichen, aber gemessenen Formen bewegte. Jetzt aber erschienen neue Festgenossen, denen sich die Thiersteiner widmen mussten, und die Rappoltsteiner wandten sich den anderen Anwesenden zu und zerstreuten sich in den zur Verfügung stehenden Gemächern. Alle, die als Gäste hier erschienen waren, kannten sich untereinander. Neulinge für einige Herren und die meisten Damen waren nur die Wirte selber, die Thiersteiner, die sich unablässig durch die glänzende Gesellschaft bewegten, um mit jedem der Geladenen verbindliche Worte zu wechseln. Dabei befleißigten sich die Thierstein’schen Damen der größten Zuvorkommenheit, die überall Anklang fand und mit ungezwungener Freundlichkeit erwidert wurde.
Graf Oswald dagegen bewahrte in seinem Auftreten und Benehmen eine gewisse Zurückhaltung die ihm von vielen als Überhebung ausgelegt wurde, so dass sie hin und wieder verwunderte Blicke tauschten, wenn er durch ein strenges Wesen und durch hochfahrende Äußerungen ein allzu großes Selbstbewusstsein verriet. Doch konnte er auch von hingebender Liebenswürdigkeit sein, wenn er wollte, und immer war er dies schönen Frauen gegenüber ohne noch den Galan spielen zu wollen. Heute freilich, wo er so zu sagen eine Probe zu bestehen, vor seinen Gästen eine Prüfung abzulegen hatte, fühlte er sich ein wenig befangen, zumal er merkte, wie aller Blicke beobachtend auf ihm ruhten, und weil sein ganzes Gehaben von dem Wunsch und dem Bestreben geleitet wurde, nicht nur einen günstigen Eindruck auf die Geladenen zu machen, sondern sich auch mit einem Schlage eine hervorragende, maßgebende Stellung unter ihnen zu erobern, denn dies war ja, wie sein kluger Stallmeister wohl durchschaut hatte, der Hauptzweck des heutigen Festes.
Als Graf Oswald das Gespräch mit Schmasman beenden musste, war des Letzteren erster Gedanke: Wie mag wohl die Begrüßung zwischen Oswald und Burkhard ausgefallen sein? Schade, dass ich nicht früher kam, um dabei Zeuge und nötigenfalls Vermittler sein zu können!
Und er ging, um seinen alten Freund und Waffenbruder aus mancher kleinen und größeren Fehde aufzusuchen.
Die Gemächer durchschreitend ward er bald hier, bald da von einem Bekannten angehalten, der ihm die Hand entgegenstreckte, und unterließ auch nicht, die Damen zu begrüßen, an denen er vorüberkam. Endlich entdeckte er Burkhard im hintersten Zimmer, in lebhafter Unterhaltung mit Rudolf von Andlau begriffen. Schmasman schüttelte beiden die Hand, hielt aber die Burkhards länger in der seinigen fest und sagte:
»Freut mich, dass du gekommen bist, alter Brummbär!«
»Danken kann ich dir kaum dafür, dass du mich dazu beschwatzt hast«, erwiderte Burkhard mit leichtem Stirnrunzeln. »Aber nun bin ich einmal da im Gefolge des gnädigen Herren von der Hohkönigsburg und mache gute Miene zu dem törichten Spiel hier.«
»Die Miene, die du machst, könnte immer noch ein wenig besser sein«, meinte Schmasman.
Rudolf von Andlau lachte:
»Nehmt Euch mit ihm in Acht, Graf Rappoltstein! Er hat heute wieder den rauen Pelz an und knurrt. Sehet zu, wie Ihr ihn bändigt; ich hab’s nicht fertig gebracht und überlasse ihn Euch, um Eurer Frau die Hand zu küssen.«
»Tut das, Andlau! Sie wird sich freuen, Euch hier zu sehen«, rief der Graf dem Abgehenden nach.
»Nun, wie war der Willkomm, den du bei dem Thiersteiner fandest?« fragte Burkhard sofort, als die beiden, etwas abseits von den übrigen Gästen, miteinander allein standen.
»O — durchaus höflich und freundlich«, erwiderte Schmasman.
»Na, das dank’ ihm der Teufel!« brauste Burkhard auf. »Ist das alles, was du darüber zu sagen hast?«
»Freilich, ein wenig herablassend kam mir die Begrüßung vor.«
»Aha!« machte Burkhard, »willst du wissen, wie es mir vorkommt? Er empfängt seine Gäste wie ein Reichsfürst seine Vasallen empfängt. — Ja, ja!« fuhr er fort, als Schmasman darauf schwieg, »du bist wohl eben erst angelangt und hast noch nicht bemerkt, wie hoch der Herr Graf den Kopf trägt, als wollte er über uns alle hinwegsehen.«
»Er ist noch fremd hier und muss sich erst eingewöhnen unter uns, erst Fühlung mit uns gewinnen. Dabei müssen wir ihm behilflich sein, ihm entgegenkommen.«
»Ach was, entgegenkommen!« rief Burkhard ärgerlich. »Zahm und kirre machen müssen wir ihn und ihm die Zähne zeigen, wenn er sich ausspielen und großtun will! Gib mal Acht darauf, wie herausfordernd er hier in der strotzenden Pracht, die ihm von Rechts wegen gar nicht zukommt, unter seinen Gästen herumstolziert, Huld winkend, Gunst verheißend, Gnade spendend, als hätte er nur zu geben und wir von ihm zu empfangen.«
»Du hast eine vorgefasste Meinung gegen ihn, zu der dich nichts berechtigt. Ich möchte dich an seinem Platze sehen.«
»So hochmütig wäre ich nicht, Schmasman!«
»Nein, du Ausbund christlicher Demut und Duldsamkeit!« lachte Schmasman. »Grob wärst du, wenn dir die Nasen deiner Gäste nicht gefielen. Ruhig! Ich kann dir das sagen, Bruder! Aber ich sage dir auch: Habe nur den guten Willen, gib dir einmal Mühe, dich auf einen freundlichen Fuß mit dein Thiersteiner zu stellen, dann wird es schon gehen. Ich prophezeie Dir: Je öfter wir uns fortan mit Graf Oswald begegnen, je besser werden wir uns mit ihm verstehen und vertragen, denn er ist vom Scheitel bis zur Sohle ein Mann von makelloser Ehre.«
»Trage gar kein Verlangen nach öfterem Begegnen.«
»Wird schon von selber kommen; ich verlasse mich auf dein ehrliches, ritterliches Herz, denn das ist noch das Beste an Dir.«
Burkhard blinzelte den Freund erst etwas zweifelhaft an, dann gab er ihm die Hand und sagte:
»Jetzt bringe mich zu Deiner Frau, damit ich auf andere Gedanken komme. Ist das lustige Hexlein, die Imagina, auch hier?«
»Natürlich! Und wenn es einer versteht, dir den Kopf zurechtzusetzen, so ist sie es.«
»Das weiß ich, darum fragte ich ja.«
»So komm, aber erst zu meiner Frau!«
Sie schoben sich durch die Gruppen der plaudernden Gäste, die nicht müde wurden, die glänzende Einrichtung der Gemächer zu betrachten, die schönen, figurenreichen Teppiche an den Wänden, die geschnitzten Gestühle mit bunten Kissen und Polstern, die großen Ofen mit grünen Kacheln, die messingenen Leuchterkronen, die kunstvollen Glasfenster und mehr dergleichen, was ihre Bewunderung und ihr Begehren erregte, es auf ihren Schlössern auch so haben zu können. Die Mächtigsten und Reichsten unter ihnen, die auch in Behaglichkeit und Bequemlichkeit wohnten, mussten sich wohl oder übel gestehen: So prunkvoll und üppig wie hier sah es bei ihnen zu Hause nicht aus.
Während des Wiederaufbaues der Hohkönigsburg hatten sie mit fast ungläubigen Ohren schon manches von dem Aufwand, der dabei getrieben wurde, gehört und waren daher auf allerlei Neues und Sehenswertes gefasst, fanden aber ihre Erwartungen durch das hier, wie manche meinten, fast prahlerisch zur Schau Gestellte nun doch noch weit übertroffen.
Um in diese kostbar ausgestatteten Räume möglichst würdig mit ihrer äußeren Erscheinung hineinzupassen, hatten Männer wie Frauen ihre auserlesensten Festgewänder angelegt. Da war viel schillernde Farbenpracht zu sehen an den faltigen Kleidern mit langen Schleppen und großgemusterten Rücken, unter denen die spitzen Schnabelschuhe hervorlugten. Um die Nacken der Frauen ringelten sich goldene Ketten mit funkelnden Steinen, auf ihren Häuptern glitzerten gold- und silberdurchwirkte Hauben und Gebinde, und frische Blumenkränze krönten die Scheitel der jungen Mädchen. Die älteren Herren trugen dunkelsamtene oder brokatene Röcke, mit Pelz verbrämt oder mit bunten Borten umsäumt, die jüngeren aber kurze, seidene Wämser mit breitem, gesticktem Brustlatz und eng anliegende, gestreifte oder geschachtete Beinkleider, kleine Barette mit Federstutzen auf dem langen, gekräuselten Haar, und am schmelzverzierten Gürtel hing der Dolch in tauschierter Scheide.
Wer von allen Frauen und Jungfrauen hier war die Schönste? Niemand tat diese Frage laut, aber jeder legte sie sich im Stillen vor und beantwortete sie sich mit dem Namen Leontine. Sie war das leibhaftige Bild von Kraft und Gesundheit, mit jedem Liebreiz blühender Jugend geschmückt und von einer bestrickenden Anmut im Ausdruck ihrer Züge, in Haltung und Bewegung, in ihrem ganzen Wesen.
»Was habt Ihr für prachtvolles, rotblondes Haar!« sprach Imagina, als sie auf ihrem Rundgang durch die Gemächer der Thierstein’schen Tochter begegnete, die mit ihrem Wuchs die schlanke Gestalt der sie Anredenden noch eine halbe Spanne lang überragte.
»Sagt nur getrost feuerrote Mähne!« lachte Leontine und schüttelte die wallenden Locken, die sich in kein Netz und keine Haube zwingen ließen. »Man muss wohl schon bei meiner Geburt diesen Löwenkopfputz geahnt haben und hat mir darum den Namen Leontine gegeben, der mir oder dem ich die Rechtfertigung nun schuldig war.«
»Die übrigen Attribute sind auch nicht ausgeblieben«, scherzte Imagina und entschlüpfte der Geneckten durch das Gedränge der Gäste, wobei sie dem ihr entgegenkommenden Burkhard fast in die Arme lief.
»Halt, Frauchen Imagina!« rief er, »hier kommt Ihr nicht vorbei, und auf Euch fahnde ich gerade.«
»Auf mich? Was wollt Ihr von mir?« entgegnete sie schnippisch.
»Ihr sollt mir das kleine, weiche Pfötchen geben.«
Sie schlug ein:
»Da! Was nun noch?«
»Weiter nichts; ich hab’ Euch so lange nicht gesehen; habt Ihr mich auch noch ein bisschen lieb?«
»Ich Euch? Nein! Nicht im Mindesten, hab’ Euch in meinem Leben noch nicht lieb gehabt.«
»Ach! Warum denn nicht?«
»Ihr seid mir zu rau und stachlicht. Ich möchte nichts im Bösen mit Euch zu schaffen haben.«
»Im Bösen, da habt Ihr Recht; aufrichtig seid Ihr wenigstens, Gräfin Imagina!« sagte Burkhard mit einem stechenden Blick. »Aber es ist ja gar nicht Euer Ernst.«
»Mit Euch spaß’ ich nicht, denn ich traue Euch nicht, nicht über den Weg trau ich Euch; Ihr seid gefährlich, man muss sich mit Euch hüten und fürsehen, die tiefe Falte da zwischen Euren Brauen —«
»Streicht sie weg, wischt sie mir aus, Imagina!«
»Von der Stirn kann man sie verbannen, aber im Herzen bleibt sie Euch doch. Was habt Ihr wieder heute? Euch bohrt und bost etwas.«
»Soll ich’s Euch sagen? Euch in die kleinen, rosigen Mauseohren flüstern?«
»Wenn Ihr nicht beißen und nicht allzu sehr schreien wollt.«
»Könnt Ihr schweigen, Imagina?«
»Ich?! Oh! Herr Burkhard!«
»So kommt her! — Ich gönne dem Thiersteiner die stolze Burg nicht.«
Sie lachte:
»Und das soll ein Geheimnis sein? Das weiß ich schon lange.«
»So?« Er starrte sie verblüfft an, »woher denn?«
»Von Euch selbst, wenn Ihr’s mir auch nicht gesagt habt. Schon als sie noch daran bauten, ärgerte Euch jeder Stein, mit dem sie Mauern und Türme erhöhten. Ihr solltet Euch so gierigen Neides schämen, Herr Burkhard!«
Er stampfte mit dem Fuß.
»Dass dich das Wetter!« knirschte er. »Sagt das Schmasman auch?«
»Nein, der denkt viel zu gut von Euch.«
»Seht Ihr? Der kennt mich.«
»Nein, der kennt Euch leider nicht, aber ich, ich kenne Euch.«
»Und denkt schlecht von mir?«
»Ja! Ganz schlecht, grundschlecht, nun wisst Ihr’s. Empfehle mich Euer Gnaden!« und fort war sie.
»Racker!« brummte Burkhard, »verflucht schlaue Kröte, und dabei so hübsch, so niederträchtig hübsch!«
Die Gäste waren vollzählig versammelt bis aus Egenolf, nach dem schon dieser und jener gefragt hatte.
Junker Bruno von Rathsamhausen erhielt auf seine Erkundigung nach dem Freunde von dessen Vater den Bescheid:
»Ich wundere mich ebenso wie du über das lange Ausbleiben meines Sohnes. Er war in den letzten Tagen ganz versessen auf die Jagd, und ich fange allmählich an zu fürchten, dass ihm ein Unfall zugestoßen ist; sonst müsste er schon hier sein.«
»Nein, Herr Graf!« sagte Bruno, »das fürchte ich nicht, dazu ist Egenolf ein zu tüchtiger Waidmann.«
»Hast recht, Bruno!« erwiderte Schmasman, »also warten wir’s ab, bis es ihm gefällt, sich einzustellen.«
Jetzt ertönte der Klang einer Glocke zum Zeichen, dass die Messe, die der Abt von St. Pilt in der Schlosskapelle feiern wollte, ihren Anfang nehmen sollte, und die Gesellschaft schickte sich an, sich in das nahebei belegene Sanktuarium zu begeben. Da jedoch die Kapelle nicht sämtliche Anwesende aufnehmen konnte, blieben die jüngeren nebst einigen älteren Herren, die sich aus der Feierlichkeit nicht viel machten, in den Gemächern zurück, und bald hörten sie dort den Gesang der Chorherren, dem sie schweigsam und mehr oder weniger andächtig lauschten.
III.
Eine Stunde nach dem Ausbruch der Seinigen von der St. Ulrichsburg stieg auch der junge Graf Egenolf von Rappoltstein dort zu Pferde, um ihnen nach der Hohkönigsburg zu folgen. Seine Jagd war glücklich verlaufen; er hatte einen starken Wolf, dem er in den ausgedehnten Forsten drei Tage lang auf der Spur gewesen war, erlegt, ihn selbst abgehäutet und das Fell einem Kürschner in Rappoltsweiler zur Zubereitung übergeben — war also in frohester Stimmung.
Anfangs, so lange der Weg noch eben war, trabte er scharf zu, bald aber, als er in den Wald kam und es bergan ging, ritt er langsam und überließ sich träumenden Gedanken. Es war eine sehr ergötzliche Erinnerung, die ihn jetzt beschäftigte, die Erinnerung an ein liebliches Abenteuer, das er hier im Walde vor kurzem erlebt hatte.
Er pirschte eines Morgens auf allerlei Raubzeug und schlich spähend und lauschend durch das Dickicht, als er plötzlich dumpfen Hufschlag zu vernehmen glaubte. Er blieb stehen und horchte, aber setzt war alles wieder still. Mit einem Male rief eine helle, zweifellos eine weibliche Stimme: »Sankt Hippolyt!« und siehe da! Das Echo antwortete deutlich: »Sankt Hippolyt!« Dann wieder die Stimme in singendem Tone:
»Zeig’ mir den Weg!« und das Echo wiederholte: »Zeig’ mir den Weg!« Die Rufende, der das neckische Spiel offenbar Vergnügen machte: »Den Weg zu dir!« und das gefällige Echo: »Den Weg zu dir!« Jetzt rief Egenolf selbst, den Klang der Stimme so gut wie möglich nachahmend:
»Wart’, ich komme zu dir!«
Alles schwieg, auch das Echo, denn von des Rufers Standpunkt aus konnte es nach den natürlichen Gesetzen des Schalles nicht zu ihm zurücktönen.
Nun eilte er durch das Gebüsch in der Richtung, von der aus die Worte erklungen waren, und fand dort mitten im Walde eine junge Dame zu Pferde halten, die er nicht kannte. Sobald sie seiner ansichtig wurde, redete sie ihn, der in schlichtester Jägertracht und mit Spieß und Armbrust bewehrt war, zuerst an indem sie vom Pferde herab sprach:
»Ihr kommt zur rechten Zeit, guter Freund! Wisst Ihr den Weg nach Sankt Pilt?«
»O ja!« erwiderte er, »aber in dieser Gegend ist er nicht zu finden.«
»So zeigt ihn mir!« befahl sie.
Egenolf sah sich die Reiterin jetzt genauer an. Sie war eine vornehme Erscheinung in geschmackvoller Kleidung, saß sehr gut im Sattel und hielt in der Rechten eine wuchtige Reitgerte; am Gürtel hing ihr ein langes Waidmesser. Sie gefiel ihm ausnehmend, und eben, weil er sie nicht kannte, konnte sie niemand anders sein, als die junge Gräfin von Thierstein, die er noch nie gesehen hatte, weil sie erst kürzlich mit ihren Eltern nach der Hohkönigsburg gekommen war. Alle anderen adligen Fräulein in der ganzen Umgegend waren ihm von Ansehen bekannt.
So war er im Vorteil gegen die ihm vom Zufall Schutzbefohlene; er wusste, wer sie war, aber sie schien seine Abstammung von einem der edelsten Geschlechter des Landes nicht zu ahnen.
»Ihr seid hier falsch, Fräulein! Sankt Pilt liegt dort hinaus«, sprach er. »Euer Pferd muss auf Irrkraut getreten haben; dann verliert man den Weg und verirrt sich.«
»Jägerweisheit!« spottete sie. »Geht voraus und führt!«
Egenolf tat wie ihm geheißen und suchte die bequemsten Stellen zum Reiten zwischen den Bäumen aus.
Die Reiterin folgte ihm schweigend, denn sie hatte mit dem Lenken ihres Pferdes zu tun. Bald aber rief sie ihren Führer an:
»Hei Waidmann! Ihr steht wohl im Dienste der Grafen von Rappoltstein?«
Es belustigte ihn, dass sie ihn für einen Jägerknecht hielt, was in Anbetracht seines Äußeren in dem schon etwas abgetragenen Lederkoller mit Kragen und Kappe, deren großer Schirm ihr sein Gesicht vom Sattel aus halb verdeckte, nicht eben zu verwundern war. Und da es ihn reizte, sie in dem Wahne zu lassen, um sich bei seiner bevorstehenden Begegnung mit ihr auf der Hohkönigsburg an ihrer Verlegenheit weiden zu können, gab er ihr, sich zu ihr umwendend, in unterwürfigem Tone zur Antwort:
»Zu dienen, Fräulein! Ich bin des Herrn Grafen Maximin von Rappoltstein leibeigener Mann.«
»Maximin?« fragte sie, »ich denke, Schmasman heißt er.«
»Ja, so wird er gewöhnlich genannt, das ist dasselbe«, sagte er und schritt nun nicht mehr vor, sondern neben dem Pferde her.
»Soll ein sehr angesehener und holdseliger Herr sein, ein tapferer Ritter, aber von feinsinniger Art und mildem Gemüt, wie ich hörte. Ihr habt es gewiss nicht schlecht bei ihm, wie?«
»Ich kann über die Behandlung nicht klagen; er hält seine Leute gut, und wir dienen ihm gern«, erwiderte der vermeinte gräfliche Gefolgsmann. Um aber dem Gespräch, dessen Fortsetzung in diesem Gleise leicht zu einer Entdeckung seiner wahren Herkunft führen konnte, eine andere Wendung zu geben, fragte er:
»Ihr wollt nach Sankt Pilt?«
»Ja, wohin sonst bringt Ihr mich denn, Rappoltstein’scher Spießträger?« entgegnete sie launig. »Den Abt will ich sprechen.«
»Also hoch zu Rosse zum Beichtstuhl. Das lass ich mir gefallen, ist aber etwas ungewöhnlich.«
»Was geht es Euch an, Jäger!« verwies sie ihn herrisch, »und wer sagt Euch, dass ich beichten will? Sehe ich aus wie eine arme Sünderin, die ein schlechtes Gewissen hat?«
»Nichts für ungut, Fräulein! Hab’ Euch darauf noch nicht angeschaut«, entschuldigte er sich. »Aber«, fuhr er, wie missbilligend mit dem Kopfe schüttelnd fort, »so ganz allein und einsam hier im tiefen Walde, wo Ihr nicht einmal Bescheid wisst? Es ist hier nicht immer ganz geheuer, und Ihr seid eine verführerisch schöne — ich wollte sagen«, verbesserte er sich schnell, als ihn ein strenger Blick von ihr traf, »Ihr habt da sehr schöne Steine an Eurem Gürtel.«
»Wollt Ihr mir etwa Bange machen? Das wird Euch nicht glücken, mein Lieber!« lachte sie. »Ich bin, wie Ihr seht, nicht wehr- und waffenlos und fürchte mich nicht vor Euch, das will ich Euch beweisen.«
Und ehe er sich dessen versah, war sie aus dem Sattel zur Erde gesprungen, warf ihm den Zügel ihres Pferdes zu und sagte:
»Da! Führt meine Daphne! Ich will zu Fuß mit Euch wandern.«
Jetzt, als sie ihm zur Seite schritt, merkte er erst recht, wie hoch und kräftig ihre Gestalt war, nur wenig kleiner als er. Sie gingen schweigend dahin im stillen Walde, durch dessen sanft bewegtes Laub die Sonnenstrahlen blitzten, dass auf dem dichten Grün des Bodens goldene Lichter tanzten und flirrten. Die Drosseln und Finken schlugen, und die Bienen summten, und die zwei jungen, blühenden Menschenkinder hingen ihren Gedanken nach, die wohl sehr verschiedenen Inhalts sein mochten.
»Gebt einmal Eure Armbrust her!« gebot jetzt die abgesessene Reiterin. Er reichte sie ihr und beobachtete mit Freuden, wie leicht und sicher sie mit den richtigen Griffen den stählernen Bogen spannte. »Und einen Bolzen!« Dann blickte sie zu den hohen Wipfeln empor. »Nichts zu sehen, und einen Singvogel schieße ich nicht. Was soll ich treffen?«
»Den Mistelbusch dort oben im Wipfel der Birke.«
Sie zielte und schoss. Der Bolzen ging mitten durch die Mistel.
»Gut gemacht!« lobte er, »also Jägerin seid Ihr auch.«
»Ja, — auch!« sagte sie kurz und gab ihm die Armbrust zurück. »Nun zeigt Ihr Eure Kunst! — Den Tannzapfen dort!«
Er schoss und fehlte.
Da lachte sie:
»Nun, Jäger, wenn Ihr den hängenden Tannzapfen nicht trefft, ist wohl flüchtiges Wild ziemlich sicher vor Euch.«
»Der um meinen Arm geschlungene Zügel Eures Pferdes hinderte mich am ruhigen Zielen«, erwiderte er halb ärgerlich, halb beschämt.
»Daphne stand baumstill«, behauptete sie und fragte dann: »Wie weit ist es noch von hier bis Sankt Pilt?«
»Wir werden bald zu einem Wege gelangen, auf dem Ihr traben könnt, und dann seid Ihr in einer Viertelstunde an der Abtei. Aber wie wollt Ihr wieder in den Bügel kommen?«
Ein spöttischer Zug umspielte ihren Mund auf seine sie sehr töricht dünkende Frage, und ein Lachen verbeißend sprach sie:
»Das wird allerdings schwer halten, ich denke, von einem großen Steine kann ich wieder hinaufklettern, meint Ihr nicht?«
»Ja, wenn es nur hier große Steine gäbe!«
»Das ist Eure Sache, einen zu finden; gebt Acht darauf!« erwiderte sie und wandte sich dann seitwärts, um sich eine Glockenblume zu brechen. Sie pflückte sich im Gebüsch allmählich einen ganzen Strauß von-Waldblumen zusammen ohne sich um den Leiter ihres Rosses weiter zu kümmern.
Endlich kamen sie zu dem Wege.
»Hier ist der Weg«, rief er ihr zu, »von hieraus könnt Ihr nicht mehr fehlen, denn er führt Euch zur Abtei von Sankt Pilt.«
»Ja, der Weg ist gut zum Traben«, sprach sie, »aber wo ist der Stein, von dem ich aufs Pferd steigen könnte?«
Egenolf zuckte die Achseln. Sie stand schon neben dem Pferde.
»Soll ich Euch in den Sattel heben?« fragte er.
Sie sah ihn mit flammenden Augen durchdringend an, sagte aber nur kühl und gelassen:
»Dazu bin ich Euch zu schwer.«
Er lächelte:
»Wollen wir’s einmal versuchen?«
Ein hartes »Nein!« war ihre Antwort, — »das ist Ritterdienst.«
»Allerdings, Ritterdienst!« fuhr er, sich vergessend, auf, besann sich aber schnell und sagte: »Ja so! Nun, dann muss der Knecht das Knie beugen, damit die Herrin sich aufschwingt.«
Er kniete nieder, sie setzte den Fuß auf sein Knie und war mit behändem Schwunge im Sattel.
»Ich danke Euch«, sprach sie von oben, die Zügel ordnend.
»Wollt Ihr mir eine Gunst erweisen, Fräulein?« fragte er. — »Schenkt mir eine Blume aus Eurem Strauße.«
»Die habt Ihr verdient, Jägersmann!« sagte sie freundlich, suchte in dem Strauße und reichte ihm ein vierblättriges Kleeblatt: »Hier! Möge es Euch Glück bringen! Und nun — Waidmanns Heil!«
»Waidmanns Dank!« erwiderte er.
Sie trabte davon. Er blickte ihr nach, so lange er sie sehen konnte, und sprach dann lachend:
»Auf Wiedersehen, schöne Gräfin von Thierstein! Ihr werdet Augen machen, wenn Euch der Jägerknecht oben auf Eurem Schlosse entgegentritt.«
Dann schritt er in den Wald hinein. —
An diese Begegnung musste Egenolf, wie er es seitdem schon so oft getan hatte, auch jetzt wieder denken, als er nach der Hohkönigsburg zu dem Feste ritt, wo er die verirrte Reiterin zum ersten Male wiedersehen sollte.
Wie wird sie ihn empfangen?
Ehe noch die Messe in der Kapelle beendet war, erschien Egenolf auf der Schwelle des Zimmers, von wo er die Anwesenden mit raschem Blick überschaute. Dann schritt er schnurstracks auf Leontine zu, verneigte sich vor ihr und begann:
»Graf Egenolf von Rappoltstein bittet für seine Versäumnis um Verzeihung, edle Gräfin von Thierstein; ich habe mich auf der Jagd verspätet.«
»Ihr seid auch jetzt noch willkommen, Herr Graf«, erwiderte sie verbindlich. »Von meinen Eltern werdet Ihr dasselbe hören, sobald sie mit den übrigen Gästen aus der Kapelle zurückkommen.«
Plötzlich weiteten sich ihre Augen und richteten sich mit starrem Blick auf die Brust des vor ihr Stehenden, wo sie ein an sein Wams geheftetes vierblättriges Kleeblatt, schon etwas welk, entdeckt hatte.
»Was bedeutet das Vierblatt dort?« fragte sie erregt, ihm nun fest ins Gesicht sehend.
»Das soll mir Glück bringen«, lächelte er. »Ich habe es von einer holdseligen Waldfee, die beim Reiten den Weg verloren, weil ihr Ross auf Irrkraut getreten hatte, wie Jägerweisheit behauptet.«
»Ihr — Ihr waret der Jäger, der mich auf den Weg nach Sankt Pilt gebracht hat?« sagte sie bestürzt, bis an die Stirnlocken errötend.
»Ja, der war ich, gnädige Gräfin!«
»O mein Gott! Und wie hab’ ich Euch behandelt!«
»Ganz nach Stand und Gebühr eines solchen, der ich nach Eurer Schätzung war.«
»Geht Ihr immer in so bescheidener Tracht auf die Pirsch wie neulich?«
»Ich wüsste nicht, warum ich es nicht tun sollte«, erwiderte er.
»Habt Ihr heute etwas getroffen?« fragte sie weiter.
»Einen starken Wolf hab’ ich erlegt, dem ich drei Tage lang nachgestellt habe und den ich heute durchaus haben wollte«, gab er ihr ruhig zur Antwort.
»Ihr — einen Wolf geschossen?« sprach sie mit einem ungläubigen Lächeln. »Nun, Waidleute lieben es ja wohl, allerhand Märlein zu erzählen«, fügte sie schalkhaft hinzu.
Er verstand ihre Anspielung auf seinen vor ihren Augen getanen Fehlschuss, ließ sich aber nicht aus der Fassung bringen und erwiderte:
»Aber manchmal sprechen sie auch die Wahrheit.«
»Wirklich? Nun so sagt mir doch, warum Ihr Euch dort im Walde mir nicht zu erkennen gegeben habt.«
»Weil ich mir zu gut in der Rolle eines Rappoltstein’schen Knechtes gefiel, dem Ihr erlaubtet, das Knie vor Euch zu beugen, damit Ihr wieder in den Sattel kamet, gnädige Gräfin!«
»Glaubt Ihr im Ernst, Herr Graf, ich wäre nicht auch ohne Eure Hilfe vom Boden aus in den Sattel gekommen, wenn ich gewollt hätte? Mit leichtem Sprunge wäre es getan gewesen; ich bin geübt darin.«
»Und glaubt Ihr, ich hätte keinen Stein zum Aufsteigen für Euch gefunden, wenn ich einen hätte finden wollen?«
Nun lachten sie beide herzlich, und aus beider Augen blitzte etwas, das nicht aussah wie Hass und Verachtung.
Jetzt kamen die Wirte mit ihren Gästen aus der Kapelle zurück, und Egenolf hatte, nachdem er sich den Grafen Thierstein und ihren Gemahlinnen vorgestellt und sich bei ihnen wegen seines Ausbleibens entschuldigt hatte, eine Menge Bekannte zu begrüßen, ehe er seinem Freunde Bruno von seinem Pirschgang berichten konnte.
Bald meldete der Herold, dass das Festmahl bereit sei, und die Gesellschaft ordnete sich paarweise zum Zuge in den großen Rittersaal, wo zwei lange Tafeln gedeckt standen, mit blinkenden Kristall- und Silbergeräten besetzt und mit Blumen geschmückt. Der Abt von St. Pilt eröffnete den Reigen mit der Gräfin Margarethe und machte bei Tisch der immer noch schönen Frau von hohem, schlankem Wuchs mit weltmännischer Gewandtheit den Hof, soviel ihm dies sein geistliches Ordenskleid erlaubte. Graf Oswald hatte Gräfin Herzelande und Schmasman die Gemahlin des Grafen Wilhelm von Thierstein zu Tische geführt. Burkhard hatte sich Frau von Müllenheim erkoren, mit der er sich beständig zankte und doch vortrefflich unterhielt, weil sie seiner schnell auflodernden Heftigkeit mit schlagfertigem Witz begegnete. Graf Wilhelm von Rappoltstein hatte Frau Stephania von Rathsamhausen den Arm geboten, und Leontine hatte sich selber Egenolf als Tischherrn gewählt, — »um Euch zu versöhnen«, sagte sie. Ihnen gegenüber fanden Imagina und Isabella Platz, zwischen denen Bruno saß. Auch die übrigen Gäste reihten sich nach Wahl und Belieben.
Das Mahl verlief in ungetrübter Fröhlichkeit. Die Männer tranken sich fleißig gar edle Tropfen aus prächtigen Pokalen zu, die Frauen lächelten, man plauderte und scherzte und ließ es sich wohl sein an den reichversorgten Tischen der Hohkönigsburg, bis die vorgerückte Stunde zum Aufbruch der Gäste mahnte. Die meisten hatten keinen langen Weg zu ihren Schlössern und nahmen weiter Wohnende zur Nachtherberge mit sich; auch auf der Hohkönigsburg blieben einige in dazu bereit stehenden Gastzimmern.
»Auf Wiedersehen!« sagte Egenolf, als er Leontinen zum Abschied die Hand küsste, und »Auf Wiedersehen!« antwortete das Echo von ihrem lächelnden Munde.
Als das ältere Thierstein’sche Ehepaar in seinem Schlafgemach allein war, fragte Gräfin Margarethe ihren Gemahl:
»Wie bist du mit dem heutigen Tage zufrieden, Oswald?«
»Nicht übel«, erwiderte der Graf, »obwohl ich anfangs einige missvergnügte, um nicht zu sagen missgünstige Gesichter bemerkte. Nicht alle, Margarethe, die heute hier waren, sind uns hold und freundlich gesinnt; viele sind gewiss nur aus Neugier gekommen. Aber es war das erste Mal, dass wir uns mit den Leuten sahen; beim nächsten Zusammensein mit ihnen, wenn ich nicht den höflichen Wirt zu machen habe, sondern als Gast mich frei bewegen kann, werde ich schon leichter mit ihnen fertig werden. Am besten haben mir die Rappoltsteiner gefallen; was ist der Schmasman mit seiner würdevollen, hohen Gestalt und seiner vornehmen Erscheinung für ein ritterlicher Mann, außen und innen!«
»Und Gräfin Herzelande für eine kluge, liebenswürdige Frau mit ihren früh gebleichten Haaren! Sie ist von Geburt eine Gräfin Fürstenberg«, fügte Margarethe hinzu.
»Und Graf Egenolf? Was hältst du von dem?«
»Seines ritterlichen Vaters ritterlicher Sohn«, sagte der Graf. »Auch Graf Wilhelm von Rappoltstein ist ein Mann, den man für voll nehmen muss; er hat etwas Entschlossenes, Kriegerisches an sich, das einem Achtung einflößt. Das ist ein ganz anderer Schlag als die Rathsamhausen. Der Burkhard ist ein trotziger Gesell; mehr als einmal traf mich aus seinen unsteten Augen ein geradezu feindlicher, drohender Blick.«
»Seine Gattin, Frau Stephania, scheint mir eine liebe, herzensgute Frau zu sein. Ihres Geschlechts ist sie eine Gräfin Leiningen von der Dagsburg, wie ich von Imagina erfahren habe.«
»Du scheinst ja schon ziemlich genau über die Familienverhältnisse hier unterrichtet zu sein«, lachte der Graf. »Imagina, das ist die hübsche Blonde, die so munter plaudern und so silberhell lachen kann, die Gemahlin Kaspars, des jüngsten Rappoltstein? Richtig! Übrigens«, fuhr er fort, »hat uns der älteste, Schmasman, zum Pfeifertag nach Rappoltsweiler eingeladen.«
»Zum Pfeifertag? Was ist das?« fragte Margarethe.
»Die fahrenden Leute im ganzen Elsass«, erklärte ihr Graf Oswald, »haben schon vor mehr als hundert Jahren eine Bruderschaft unter sich geschlossen, die sich vom Hauenstein im Jura bis zum Hagenauer Forst und von den Firsten des Wasigen bis zum Rhein erstreckt. Sie haben ihre eigenen Privilegien und Satzungen, die ihnen Kaiser Karl IV. urkundlich bestätigt hat. Immer der älteste Graf von Rappoltstein ist ihr Schutz- und Lehnsherr, und sie haben einen Pfeiferkönig, der selber Spielmann sein muss und dem sie untertänig und unbedingt gehorsam sind. Jährlich am Tage von Mariä Geburt — denn die Jungfrau Maria vom Dusenbach ist ihre Schutzheilige — feiern sie in Rappoltsweiler ein großes Fest, bei dem sie sich alle versammeln und auch Gericht über sich halten. Dazu hat Schmasman uns und mehrere unserer heutigen Gäste eingeladen.«
»Du hast doch zugesagt?«
»Selbstverständlich und mit Freuden!« bestätigte Graf Oswald. »Das ist eine gute Gelegenheit, mich dem gemeinen Volke zu zeigen und auch unsern werten Standesgenossen meinen Rang und meine Stellung etwas deutlicher vor Augen zu führen, als ich dies heute vermochte.«
»Vorsichtig, Oswald!« riet Gräfin Margarethe, »wir sind noch neu unter ihnen, und du kennst sie noch zu wenig.«
»Mich leimen sie auch noch nicht; darum sollen sie mich nun ehestens kennenlernen«, erwiderte der Graf gereizt.
Danach sprachen beide kein Wort mehr, denn ein nach den Anstrengungen des Tages wohlverdienter Schlaf schloss ihnen Mund und Augen.
IV.
Es war September geworden, und ein wolkenloser Himmel spannte sich über den Bergen, deren Kuppen und Gipfel sich in der klaren Luft so scharf von dem tiefen Blau abgrenzten, dass oben an ihrem Rande die Laubkronen der einzelnen Bäume, wie einer den anderen um ein Weniges überragte, deutlich zu unterscheiden waren. Da schritten zu später Nachmittagsstunde durch das Tor des alten, hohen Metzgerturmes in Rappoltsweiler zwei Spielleute und wanderten selbander den Weg in das Strengbachtal hinein, wo zu ihrer Rechten sich braune Felsen erhoben, ihre Ecken und Spalten von kriechendem Eichengesträuch umgrünt und die Vorsprünge hie und da mit einer sturmzerzausten Kiefer bewachsen, die mit klammernden Wurzeln ihren hart erkämpften Stand behauptete.
Der eine der beiden Wanderer war von hohem, starkem Gliederbau, auf dem ein mächtiger Kopf saß mit grauem Langhaar und Langbart und buschigen Brauen über den gutmütig blickenden Augen. Das war der allem fahrenden Volk im Wasgau gebietende Pfeiferkönig Hans Loder, der Trumpeter. Der andere war ein alter, treuer Kumpan von ihm, namens Syfritz, einer der vier Weibel, die des Pfeiferkönigs Helfer und Berater in der Ausübung seiner Machtvollkommenheit und seine Beisitzer im Pfeifergericht waren. Er war von hagerer, aber sehniger Gestalt mit wettergebräuntem, bartlosem Gesicht, das einen entschiedenen und zugleich verschmitzten Ausdruck hatte. Ein Spielwerk, dessen sich der Trumpeter in seiner Königswürde nur noch bei besonderen Gelegenheiten bediente, hatte keiner von beiden mitgenommen, denn auf Musikmachen zogen sie nicht aus. Syfritz sollte zu der Kapelle am Dusenbach gehen und mit dem Messner die Vorbereitungen zu der nächstens dort stattfindenden kirchlichen Feierlichkeit verabreden, und Loder begleitete ihn nur ein Stück Weges, um ihm die Verhaltungsmaßregeln für den Sakristan noch einmal gehörig einzuschärfen, damit an dem Tage alles klippte und klappte, weil, wie ihm Graf Schmasman mitgeteilt hatte, dieses Mal mehr adlige Herrschaften als sonst bei dem Fest erscheinen würden.
Im gemächlichen Gehen hatten sie das Nötige zur Genüge miteinander beredet, und ihr Gespräch hatte sich im Anschluss daran auf einzelne Fälle gelenkt, die zur Entscheidung bei dem am dritten Tage des Festes abzuhaltenden Pfeifergericht vorläufig angemeldet waren. Diese Fälle bestanden zum größten Teil aus Streitigkeiten der Spielleute unter sich, die endgültig ausgetragen werden sollten. Aber es liefen auch stets aus anderen Kreisen Beschwerden über Fahrende wegen verübten Unfugs, zugefügten Schadens, nicht erfüllter Verpflichtungen und mehr dergleichen Vergehungen ein, die Sühne heischten und mit empfindlichen Strafen gebüßt werden mussten.
Bis jetzt waren nur wenig Klagen bei dem Rechtsprechenden und seinen Weibeln anhängig gemacht, denn die meisten wurden erst am Tage des Gerichts erhoben.
Über diese wenigen, ihnen schon bekannt gewordenen Fälle hatten die beiden hier im Strengbachtal ihre Meinungen ausgetauscht, und Loder sagte:
»Die Sache mit dem Muffel ist nicht eben schlimm. Er ist ein Speivogel und Nichtsnutz, und seine Prügel hat er als Abschlagszahlung für seinen Schelmenstreich weg; wir dürfen ihm daher die Saiten nicht mehr allzu straff spannen.«
»Überhaupt, wie wollen sie ihm denn beweisen, dass er’s mit Willen getan hat?« stimmte Syfritz ein.
»Das kommt auch noch dazu«, sagte Loder, »und wie mögen sie ihn gereizt und geärgert haben! Die anderen drei sind die besten Brüder auch nicht. Viel mehr gegen den Strich«, fuhr er fort, »geht mir die Geschichte mit dem Seppele, der sein loses Lästermaul nicht halten kann und mit seinem Spottliede wieder demselben Wirte Schimpf und Schande angehenkt hat. Er ist ein so kunstbewanderter Singer und Spieler, wie wir kaum einen zweiten unter uns haben, aber dabei ein durchtriebener Schalksnarr, und diesmal soll er nicht so leichten Kaufes von der Bank kommen wie bei der vorigen Klage gegen ihn.«
»Wenn er nur nicht geschworener Mann des Herrn von Rathsamhausen wäre!« gab Syfritz seinem Häuptling zu bedenken. »Bei dem gilt Seppele viel und hat einen starken Rückhalt an ihm.«
»Mir ist das keine rote Bohne wert«, erklärte Loder bestimmt, »darum lasse ich ihn nicht einen Tag weniger im Turme sitzen.«





























