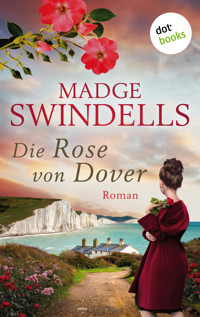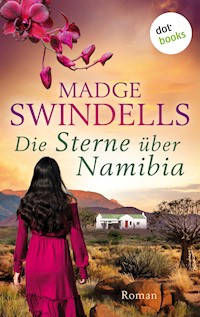6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Wenn ein Familiengeheimnis zur Gefahr wird: Der Schicksalsroman »Die Insel des Mistrals« von Erfolgsautorin Madge Swindells als eBook bei dotbooks. Wie lange kannst du aufrecht gehen, wenn das Schicksal dich in die Knie zwingen will? – Ihre Schönheit macht die Frauen des kleinen korsischen Dorfes neidisch, ihr Stolz die Männer wütend. Doch obwohl man die jung verwitwete Sybilia Rocca hinter ihrem Rücken »putana« nennt, eine Hure, wagt niemand, sie offen anzugreifen – bis zu jenem Tag, als sie auf den Marktplatz geht … und ihren Schwiegervater erschießt! Wie konnte es dazu kommen? Ganz Korsika fordert die Höchststrafe, Sybilias Lippen aber bleiben versiegelt. Nur einer glaubt nicht, dass sie eine kaltblütige Mörderin ist: der Amerikaner Jock Walters, der Sybilia schon lange heimlich liebt. Er beginnt, Nachforschungen anzustellen – und stößt auf ein dunkles Geheimnis in der Vergangenheit, das alles in den Schatten stellt, was er je für möglich gehalten hat … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der bewegende Frauenschicksals- und Familiengeheimnisroman »Die Insel des Mistrals« von Madge Swindells. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wie lange kannst du aufrecht gehen, wenn das Schicksal dich in die Knie zwingen will? – Ihre Schönheit macht die Frauen des kleinen korsischen Dorfes neidisch, ihr Stolz die Männer wütend. Doch obwohl man die jung verwitwete Sybilia Rocca hinter ihrem Rücken »putana« nennt, eine Hure, wagt niemand, sie offen anzugreifen – bis zu jenem Tag, als sie auf den Marktplatz geht … und ihren Schwiegervater erschießt! Wie konnte es dazu kommen? Ganz Korsika fordert die Höchststrafe, Sybilias Lippen aber bleiben versiegelt. Nur einer glaubt nicht, dass sie eine kaltblütige Mörderin ist: der Amerikaner Jock Walters, der Sybilia schon lange heimlich liebt. Er beginnt, Nachforschungen anzustellen – und stößt auf ein dunkles Geheimnis in der Vergangenheit, das alles in den Schatten stellt, was er je für möglich gehalten hat …
Über die Autorin:
Madge Swindells wuchs in England auf und zog für ihr Studium der Archäologie, Anthropologie und Wirtschaftswissenschaften nach Cape Town, Südafrika. Später gründete sie einen Verlag und brachte vier neue Zeitschriften heraus, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Bereits ihr erster Roman, »Ein Sommer in Afrika«, wurde ein internationaler Bestseller, dem viele weitere folgten.
Die Website der Autorin: www.madgeswindells.com
Bei dotbooks veröffentlichte Madge Swindells ihre großen Familien- und Schicksalsromane »Ein Sommer in Afrika«, »Die Sterne über Namibia«, »Die Rose von Dover«, »Liebe in Zeiten des Sturms«, »Das Geheimnis von Bourne-on-Sea« und »Die Löwin von Johannesburg« sowie ihre Spannungsromane »Zeit der Entscheidung«, »Im Schatten der Angst«, »Gegen alle Widerstände« und »Der kalte Glanz des Bösen«.
***
eBook-Neuausgabe Januar 2021, April 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1988 unter dem Originaltitel »The Corsican Woman« bei Macdonald, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1992 unter dem Titel »Die Frau aus Korsika« als Bastei Lübbe Taschenbuch. Eine Neuausgabe unter dem Titel »Eine Liebe auf Korsika« erschien 2020 bei dotbooks.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1988 by Madge Swindells
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1992 by Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2020, 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von shutterstock/Wirestock Images, me_slavka, KraisornLek, EvMedvedeva, Igor Meshkov
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-344-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Insel des Mistrals« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Madge Swindells
Die Insel des Mistrals
Roman
Aus dem Englischen von Eva Malsch
dotbooks.
Der Tod ist ein Seelenzustand aber die Sklaverei ist die Erniedrigung der Seele.Napoleon Bonaparte, ein Korse
Für einen Korsen ist es genauso demütigend, Verzeihung zu erlangen, wie Verzeihung zu gewähren.Dorothy Carrington
PROLOG
Taita, Korsika, 11. August 1960
Sybilia Rocca saß reglos auf einem Stuhl mit hoher Lehne. Nur ihre Finger, um die Tischkante geklammert, und die unnatürlich herabhängenden Schultern verrieten ihre innere Anspannung. Die Fensterläden waren geschlossen, aber durch die breiten Ritzen fiel gedämpftes Licht und verlieh der strengen Atmosphäre des Raums eine täuschend milde Aura. Sonnenstrahlen schienen auf den gelb lackierten Tisch und beleuchteten das emporgewandte Gesicht der Frau, so daß sie einer goldenen Madonnenstatue glich. Ihre starre Haltung verstärkte diesen Eindruck ebenso wie ihre klassischen Züge. Die tiefblauen Augen, sonst voller Wärme und Heiterkeit, waren glasig, die Lider geschwollen. Doch das beeinträchtigte ihre Schönheit nicht, eine verletzliche, sinnliche Schönheit, die männliche. Aggressionen und die Bitterkeit unerfüllter Begierde weckte.
Im Dorf war Sybilia als die putana bekannt, die Hure, und sie wurde verachtet, trug aber ihren schlechten Ruf mit Würde und einer gewissen Vornehmheit, die den Groll der Männer und den Neid der Frauen erregte. Doch hier, in der Einsamkeit ihres Zimmers, wo sie sich am Tisch festhielt und ein Schluchzen bekämpfte, war ihr die Würde abhanden gekommen.
Abrupt stand sie auf, öffnete die Fensterläden und beugte sich hinaus. Der strahlend blaue Mittagshimmel überwölbte zerklüftete Gipfel. Von Schneestreifen durchzogen, in Sonnenhitze gebadet, bildeten die Berge einen hellglänzenden Hintergrund vor violetten Schatten. Tiefer unten lag das dunkle, feuchte Grün alter Wälder – Kiefern, Kastanienbäume, Korkeichen – und erstreckte sich bis zum fernen azurfarbenen Meer. Sybilia kniff die Augen zusammen, um sie vor dem grellen Licht zu schützen, und suchte den Garten ab, doch er war verlassen. Sie sah nur kümmerliche Blumen, Unkraut, Schutt und einen baufälligen Schuppen.
Sie durchquerte den Raum und öffnete die Fensterläden an der Westseite, die einen Ausblick zum Dorfplatz bot. Taita, aus einer fast unzugänglichen Klippe zwischen dem Berg und dem See gehauen, bestand aus schmucklosen Granitfestungen rings um das Kopfsteinpflaster des Hauptplatzes. An einer Seite erhob sich die Kirche St. Augustin. Eine Statue des Schutzpatrons von Taita stand im Schatten eines dichten Hains aus Kastanienbäumen, neben einem Brunnen, wo Quellwasser in einen alten Steintrog rieselte.
Wie in Trance, einer Schlafwandlerin gleich, stieg Sybilia die Stufen zum Wohnzimmer hinab. Sie erschauerte, als sie das Gewehr vom Wandhaken nahm. Aber nach kurzem Zögern lud sie es und verließ das Haus.
Bewegungslos verharrten die Bäume in der drückenden Luft. Stille herrschte im Dorf. Sogar die Vögel schliefen in den schattigen Kastanienzweigen. Das Zirpen der Grillen und das Bimmeln der Kirchenglocke klangen gedämpft, fast unhörbar in der lastenden Hitze. Hunde lagen ausgestreckt auf dem Kopfsteinpflaster. Ein Mutterschwein mit sieben Ferkeln grunzte zufrieden in einem Schlammteich neben dem Trog, in dem kühles Quellwasser gurgelte und träge in tiefere, grasbewachsene Rinnen dahinfloß.
Auf einer Bank vor der Kirche saß ein träumender Mann, mit seinen über sechzig Jahren immer noch attraktiv. Er hatte dichtes weißes Haar. und der buschige weiße Schnurrbart kräuselte sich an den Enden, als würde er unentwegt grinsen. Ein breiter Brustkorb und ausgeprägte Oberarmmuskeln zeugten von beträchtlichen Körperkräften, und er besaß die stämmigen Beine eines Bergbewohners. Im Lauf der Zeiten war er arrogant geworden. Das zeigte sich in der Kurve seiner Lippen. in den glitzernden Augen.
Er hörte Schritte, gähnte und setzte sich blinzelnd auf. Beim Anblick seiner Schwiegertochter nahm sein Gesicht noch strengere Züge an.
Vater Andrews, der die Kirchentreppe hinaufstieg, blieb stehen und beobachtete Sybilia. Sie strahlte eine seltsame Nervosität aus, während sie den Platz überquerte und das Gewehr ungeschickt in der Hand hielt. Der Priester betrat die Kirche.
Zehn Schritte von dem Mann auf der Bank entfernt. schwang Sybilia das Gewehr an die Schulter und zielte, aber ihre Hände zitterten, und das Bild im Visier, schwankte von dem Mann zu den Bäumen, zu den Pflastersteinen. Sie sah, wie er die Stirn runzelte, die Augen öffnete, sich ruckartig vorneigte, und sie hielt den Atem an. drückte ab. Die Kugel zerschmetterte den Arm, den er gehoben hatte, um seinen Körper zu schützen. »O Gott!« stöhnte sie leise. »O Gott!«
Der Mann fiel seitwärts auf die Bank, dann stand er mühsam auf und wankte auf Sybilia zu. Schluchzend versuchte sie ihre bebenden Hände zu kontrollieren, fand den Mut, noch einmal abzudrücken.
Ein weiterer Schuß krachte, ein roter Fleck erschien auf dem schneeweißen Hemd des Mannes. Er taumelte, blieb aber auf den Beinen. Sein Gesicht spiegelte Entsetzen und Zorn wider.
»Nein, Sybilia, tun Sie es nicht!« Vater Andrews rannte aus der Kirche, die Treppe hinab, auf den Platz. Er fühlte sich wie in einem Alptraum und glaubte kaum voranzukommen, als er zu der Frau eilte – zu spät. Immer wieder drückte sie ab. Bei jedem ohrenbetäubenden Knall zuckte der Körper des Opfers wie eine Marionette an den Fäden eines dilettantischen Puppenspielers, bis es schließlich zusammenbrach.
Der Priester erreichte Sybilia und packte sie, und sie leistete keinen Widerstand. »Heilige Mutter Gottes!« stieß er in seiner irischen Muttersprache hervor, ohne es zu merken. Sie starrte auf die Leiche, das Blut und rang nach Luft. Ihr Arm war eiskalt unter der Hand des Priesters. Plötzlich warf sie das Gewehr weg, riß sich los und lief schluchzend in die Kirche.
Vater Andrews beugte sich über den Mann am Boden, um ihm die Absolution zu erteilen – zu spät, das wußte er. Xavier Rocca befand sich bereits in den Händen Gottes – oder des Teufels.
TEIL I
Kapitel 1
August 1960
Im Rückblick fällt mir die Erinnerung an die Ereignisse, die mich mit dem Schicksal der Roccas verbanden, sehr schwer. Ich glaube, es begann schon vor vielen Jahren an der Bostoner Universität – damals, als ich dem Leiter der anthropologischen Fakultät, Professor Don Miller, meine Ideen vortrug. Archäologie war ein neuer Studienzweig an dieser Hochschule, und ich wurde mit einiger Skepsis betrachtet. Ich wollte die beiden Wissenschaften in einem unorthodoxen und deshalb verdächtigen Projekt vereinen.
Geduldig argumentierte ich wochenlang: »Was wissen wir schon über den europäischen Steinzeitmenschen? Wir kennen seine Werkzeuge, seine Behausungen, seine Grabstätten, sein Geschirr aber über ihn selbst, seinen Glauben, seine Politik, seine Ideale wissen wir nur sehr wenig. Wir leiten Daten von gegenwärtigen primitiven Gesellschaften ab, die im Busch leben. Es wäre eine viel bessere Methode, eine isolierte europäische Gruppe zu finden, die jahrhundertelang durch geographische Barrieren von ihren Mitmenschen abgeschnitten war, und ihre Wurzeln anhand einer Ausgrabung zu studieren.«
»Das sind alles nur Spekulationen, Dr. Walters«, pflegte Miller zu antworten.
Doch ich verfolgte zielstrebig meine Interessen. Eines Abends fand ich in der Universitätsbibliothek ein altes staubiges Buch: »Britische Essays zugunsten der tapferen Korsen« von James Boswell, 1768. Die Lektüre überzeugte mich – Korsika eignete sich hervorragend für meine Pläne. Während vieler Generationen isoliert, hatten die Inselbewohner eine einzigartige Kultur entwickelt. Dazu gab es in Europa keine Parallelen: In Legenden und Aberglauben müßte ich Spuren des Steinzeitmenschen finden, ein lebendiges Erbe, das es zu erkunden galt. Jetzt, wo ich meiner Sache sicherer war, wurden mir Wege geebnet und Türen geöffnet. Wenige Monate später erhielt ich die Zusage, daß man mein Projekt fünf Jahre lang finanzieren würde.
Und ich sollte recht behalten. Die Forschungen verliefen sogar noch erfolgreicher, als ich es erhofft hatte. Meine Wahl fiel auf Taita, das aus widerstandsfähigen uralten Steinhäusern bestand, erbaut auf einem Felsvorsprung. Auf den Berghängen über dem Dorf fand ich einen idealen Aussichtspunkt, einen Granitblock, auf dessen konkaver Oberfläche ich bequem sitzen konnte, hoch genug, um über das dichte Unterholz hinwegzublicken. Übersichtlich lag das Dorf unter mir. Der Platz mit dem Kopfsteinpflaster bildete Taitas Herz, die Kirche seine Seele, und als sein Gewissen fungierte der unbeugsame irische Priester, Vater Andrews.
Das Projekt war nun beendet, und meine inzwischen veröffentlichten Theorien hatten mir internationale Anerkennung und finanzielle Unabhängigkeit eingetragen. Bald mußte ich abreisen, denn man hatte mir den Bostoner Lehrstuhl für Anthropologie angeboten, nachdem Don Miller vorzeitig in den Ruhestand getreten war. Aber als ich an diesem Sommermorgen auf Taita hinabschaute, empfand ich ein tiefes Bedauern. Eigentlich wollte ich das Dorf nicht verlassen. Doch ich verdrängte die vage Sehnsucht nach Dingen, die vielleicht hätten geschehen können, und konzentrierte mich auf die Zukunft.
Professor Jacklyn Walters! (Jock für meine Freunde.) Das klang großartig, und ich hatte hart dafür gearbeitet. Wie würde ich damit zurechtkommen, Anzüge und Krawatten zu tragen? In den letzten Jahren hatte ich nur Shorts, Hemden, Wanderschuhe und eine Uhr gebraucht, die auch als Kompaß diente. Diesen lässigen Lebensstil würde ich vermissen, auch Taita und seine Bewohner – vor allem aber Sybilia Rocca. Seit einem Jahr waren wir gute Freunde, und ich verdankte ihr sehr viel. Ohne ihre Hilfe hätte ich die alten Ruinen nie entdeckt, verborgen von der Macchia, dem Dickicht aus Myrte, Lavendel, Thymian, Zistrosen und wilden Feigenbäumen, das die halbe Insel bedeckt und die träge Luft mit bittersüßem Duft erfüllt.
Ich wußte, daß auch Sybilia traurig war. Bedauerte sie meine Abreise? Am letzten Abend, bei unserem Gespräch über meine Professur, hatte sie nur wenig gesagt. An diesem Morgen war sie wie üblich mit dem Proviant zu unserer Ausgrabung gekommen, hatte fast den ganzen Vormittag in der Höhle gearbeitet und sich kurz vor dem Mittagessen verabschiedet. Mir war aufgefallen, wie angespannt sie wirkte. Was hatte sie gesagt, ehe sie den Hang hinabgeeilt war? »Ich wünschte, ich hätte dich mehr geliebt ... Es tut mir leid, daß ich so lange gewartet und so viel Zeit vergeudet habe
Seltsame Worte. Sie hatten wie ein Versprechen geklungen, das zu spät erfolgt war. Fünf Jahre lang hatte ich Sybilia begehrt, aber trotz unserer Freundschaft kein Gehör gefunden.
Dem monotonen Klang der Spaten auf dem felsenharten Kies entnahm ich, wie die Arbeiter in der Ausgrabung ihr Tempo verlangsamten, angesichts der bevorstehenden Mittagspause. Wie heiß es war ... Wären die Arbeiter nicht da, würde ich mir den Nachmittag freinehmen und fischen. Genau das richtige Wetter dafür ... In der Ferne sah ich den Golf von Galeria funkeln und erinnerte mich lächelnd an den Vortag, wo ich einem gigantischen Rochen nachgejagt war. Bevor ich ihn endlich erlegt hatte. war er wie eine groteske, häßliche Krähe in der ganzen Bucht herumgewirbelt.
Die Geräusche an der Ausgrabungsstelle verstummten, die Siesta begann. Ich sah auf meine Uhr. Mittag. Die Männer öffneten ihre Picknickkörbe. Auch ich war hungrig. Ich kletterte vom Felsblock hinab und ging zur Höhle. wo ich mir eine Ecke als kleines Büro eingerichtet hatte. Am Eingang blieb ich stehen und schaute zu den Zeugnissen der Vergangenheit, die ich so mühsam gesucht hatte. schwelgte im Anblick der Statuen – überlebensgroß, aus Granit gehauen, die Gesichtszüge teilweise zerstört. die Augen eng beisammen. Unheimlich starrten sie mich an.
Als der erste Schuß krachte, aß ich mein Sandwich. Der Lärm überraschte mich nicht sonderlich. Auf Korsika konnten fast alle Männer, Frauen und Kinder mit Gewehren umgehen, und die Jagd war ein nationaler Zeitvertreib. Der zweite Schuß schien von den Hausmauern am Dorfplatz widerzuhallen. Dann hörte ich Schreie. Ich lief zu meinem Aussichtspunkt zurück und spähte durch das Fernglas. In rascher Folge knallten drei weitere Schüsse. Durch eine Lücke zwischen den Zweigen richtete ich das Teleskop auf das Kopfsteinpflaster und sah das Opfer am Boden liegen. Wer mochte es sein? Unschlüssig zögerte ich. Dies war meine letzte Chance, eine traditionelle Vendetta mitzuerleben. Die Bäume versperrten mir die Sicht, aber wenn ich hinunterrannte, würde ich die wichtigen Ereignisse der nächsten zehn Minuten versäumen.
Der Priester eilte die Kirchenstufen herab, die Dorfbewohner versammelten sich. Dann lief eine Frau über den Platz zur Kirche. Als ich sie zu erkennen glaubte, hämmerte mein Herz schmerzhaft gegen die Rippen. Konnte es sein? Nein! Unmöglich! Nicht sie!
Sie stolperte auf der Treppe und stürzte, dann drehte sie sich um. Ja, tatsächlich – Sybilia. »O Gott«, flüsterte ich, und meine Gedanken überschlugen sich. So etwas konnte nicht geschehen, konnte einem Menschen, den ich so gut kannte, nicht zustoßen. Aber Sybilia war Korsin.
Warum hatte sie etwas so Schreckliches getan?
Ich ließ das Fernglas fallen, raste durch die Macchia den schlüpfrigen Hang hinab. Trotz meiner Panik registrierte ich ironischerweise, daß die jahrelang geübte Disziplin nüchterner wissenschaftlicher Beobachtung in diesem Moment äußerst gefährdet war.
Kapitel 2
Ich erreichte den Platz zu spät, um irgend jemandem zu helfen. Vater Andrews hatte Sybilia in der Kirche versteckt und kehrte nun zurück, um die Leiche mit einem Altartuch zu bedecken.
Die Dorfbewohner schrien wüste Beschimpfungen zur Kirche hinüber. Gestaute Emotionen brachen sich Bahn, mit einer Heftigkeit, die – wie ich aus Erfahrung wußte – diese Leute innerhalb weniger Minuten in einen grausamen Lynchmob verwandeln konnte. »Diese Hure ... die schamlose Nutte ... Möge sie einen qualvollen Tod erleiden ...«
Vater Andrews kam zu mir und murmelte: »Ich habe Sybilia in der Sakristei eingesperrt«, murmelte er. »Oh, ich weiß nicht, was wir tun sollen ...« Er eilte zu dem toten Xavier zurück. »Gott sei ihm gnädig. Heilige Maria, bitte für ihn ...« Seine Stimme mischte sich in den Engelsgesang der voceri, der professionellen Klageweiber, die inzwischen begonnen hatten, ihre Pflicht zu erfüllen. Eifrig bewiesen sie ihre Talente, rauften sich die Haare, rissen an ihren Kleidern. Bald würde man Xavier Rocca in sein Haus tragen. Dort würde die Trauerfeier die ganze Nacht dauern und bis in den nächsten Tag hinein.
Ich starrte in sein wächsernes Gesicht. Er war ein Held gewesen, der Führer der nationalistischen Partei, die wichtigste Persönlichkeit des Dorfes, für die Behörden allerdings ein gesuchter Mörder. Er hatte sich in der Macchia versteckt, wann immer Polizeitrupps aufgetaucht waren. Die Einheimischen sahen einen »Banditen der Ehre« in ihm, ein Vorbild, das die Würde der Korsen verteidigt hatte.
»Gott sei ihm gnädig ... Heilige Maria, bitte für ihn ...« In die Gebete mischte sich zorniges Rachegeschrei, Gewehrkolben trommelten auf das Kopfsteinpflaster.
Plötzlich wurde mein Arm umklammert. Vater Andrews sah ziemlich niedergeschlagen aus, seine Augen verrieten kalte Angst. »Die Polizei kann frühestens in zwei Tagen hier sein. Was sollen wir tun? Nachts werden sie über Sybilia herfallen. Wenn sie in der Kirche bleibt, wird sie das Licht des nächsten Tages nicht sehen.«
»Jemand muß sie verstecken.«
Ärgerlich schüttelte er den Kopf. »Wer in Taita würde die putana beschützen?«
Ich konnte kaum einen klaren Gedanken fassen und fühlte mich wie betäubt. Hatte ich mich dermaßen in Sybilia getäuscht. Mir war sie stets wie ein warmherziger, empfindsamer Mensch erschienen. Monatelang hatten wir zusammengearbeitet. Ich kannte sie also gut genug. Trotzdem mußte ich dem Zeugnis meiner eigenen Augen glauben. Panik stieg in mir auf. Mit ihrer grauenvollen Tat hatte sie sich in eine Lage gebracht, wo ihr niemand zu helfen vermochte. Wie würden die Dorfbewohner oder die französischen Behörden mit ihr verfahren?
»Man wird diese Vendetta zum Vorwand nehmen, um sie zu töten«, wisperte der Priester. »In diesem Dorf würden viele Leute ruhiger schlafen, wenn sie unter der Erde läge. Armes Mädchen ...«
»Und wenn ich versuche, sie von hier wegzubringen?« schlug ich vor, machte mir aber keine Hoffnungen. Jeder Dorfbewohner war ein hervorragender Schütze und kannte das Terrain ringsum wie seine Westentasche. Wider besseres Wissen versprach ich: »Nach Einbruch der Dunkelheit, um neun, komme ich zur Tür an der Friedhofsseite. Halten Sie den Esel bereit. Bis dahin muß Sybilia hinter Schloß und Riegel bleiben.«
Noch acht Stunden. Mein wissenschaftliches Interesse ließ zu wünschen übrig, obwohl ich mir einzureden versuchte: Dies ist das echte Korsika. Ich bin Zeuge eines heidnischen Rechtswesens, das so alt ist wie die Menschheit ... Schließlich siegte mein wissenschaftliches Pflichtbewußtsein, und ich machte mir Notizen. »Eine Vendetta gibt den voceri reichlich Gelegenheit, ihre Kunst zu demonstrieren. Sie steigern sich in Trance hinein, klagen den Mörder an und beleidigen ihn, fordern die Verwandten des Opfers auf, Rache zu üben. Dieses alte Ritual ...«
Ich brachte es nicht fertig, weiterzuschreiben. Wie konnten Worte jener geisterhaften Szene gerecht werden, dem fast greifbaren Zorn, dem wilden Gesang, dem ohrenbetäubenden Geschrei, dem rhythmischen Trommeln der Gewehrkolben auf dem Pflaster, dem Klang der Kirchenglocken, den Frauen, die ihre Kleider zerrissen und sich zur Leiche vorgedrängt hatten, um sie zu berühren? Waren das überhaupt Frauen – oder geifernde, blutrünstige Geier?
Nach einiger Zeit befolgte ich den Rat des Priesters, wartete im Presbyterium und vertrieb mir die Zeit, indem ich seine Aufzeichnungen über die regionale Vendetta las.
»Die letzte aktenkundige Vendetta begann mit einem Streit um einen entlaufenen Esel und führte zu drei Gefängnisstrafen, fünf Morden und wilden Straßenkämpfen. Für einen Korsen ist eine Vendetta ein unabwendbares Schicksal, eine heilige Pflicht, die von der Familie des Opfers erfüllt werden muß. Ein Mann, der sich dieser Pflicht entzieht, wird geächtet und verstoßen. Er muß töten oder im Exil leben. Wenn kein Mann zur Verfügung steht, muß eine Frau die Rolle des Henkers übernehmen und die Ehre der Familie verteidigen.«
War das eine Vendetta? Hatte Sybilia einen Mord begangen, um ein reales oder imaginäres Unrecht zu rächen? Absurd. Ich verstand das alles nicht. Dummerweise war ich überzeugt gewesen, sie hätte ihre korsischen Traditionen zusammen mit den häßlichen schwarzen Kleidern abgelegt. Ich hatte sie veranlaßt, diese Sachen in ihrem Garten zu verbrennen ... Bis jetzt kannte ich nur ihre guten Seiten – eine sanftmütige, großzügige Frau, die ihre niedrige Position würdevoll und geduldig ertrug. Sie war intelligent, kultiviert und freundlich, aber auch eine Korsin, und in ihren Adern floß das leidenschaftliche Blut ihres Volkes.
In diesen langen Stunden erwog ich alle möglichen Konsequenzen ihrer Tat. Wie würde man sie bestrafen? Wider alle Vernunft entwickelte ich ein instinktives Gefühl für Sybilias Rechte. Irgendwie mußte ich sie über die Berge in Sicherheit bringen. Sie verdiente eine faire Gerichtsverhandlung, und ich beschloß, ihr dazu zu verhelfen.
Kapitel 3
Nie werde ich den schrecklichen Abend vergessen, da ich auf Sybilia wartete und zwischen Grabsteinen und Wachsblumen in Glasbehältern auf dem Marmorrand einer Gruft kauerte. Es wurde neun, dann zehn und halb elf, und meine Angst wuchs. Immerhin wollte ich die Dorfhure, jetzt außerdem noch eine Mörderin, auf dem Esel des Priesters durch die Macchia wegbringen, vor einem rachsüchtigen, bis an die Zähne bewaffneten Mob schützen. Um Himmels willen, es hätte komisch sein müssen. Statt dessen war es tragisch.
Warum hatte sie es getan? Diese Frage quälte mich, und in meinen Ohren dröhnten immer noch die unheimlichen Worte der Klageweiber.
Vom Friedhof aus beobachtete ich, wie der tote Xavier hochgehoben und zu seinem Haus am Ende des Platzes getragen wurde, begleitet von den Klageweibern und den Trauernden. Endlich waren sie gegangen, friedliche Stille senkte sich auf das Dorf herab, und ich hörte die Vögel singen. Eine sanfte Brise wehte den Salzgeruch des Meeres heran, vermischt mit dem starken Aroma der Macchia, und verscheuchte den Blutgestank. Aus einem nahen Haus drang der verlockende Duft einer in Olivenöl gebratenen gewürzten Hammelkeule und erinnerte mich daran, daß ich seit dem Morgen nichts mehr gegessen hatte.
Der Vollmond stieg auf. Vor dem hellen Nachthimmel zeichneten sich die Silhouetten der Granitgipfel ab. Der Mond würde uns nicht helfen. In tiefer Sorge sah ich der Reise entgegen. Aber wo blieb Sybilia so lange? Die Zeit wurde knapp. Ich beschloß sie aus der Sakristei zu holen. stand auf und ging zur Kirchentür. Dort hielt ich zögernd inne. In diesem Moment flog ein Ziegelstein an meinem Kopf vorbei und prallte gegen die Mauer. Hastig floh ich in das Gebäude.
Nur wenige Schritte entfernt, kämpfte eine bleiche. sichtlich verängstigte Sybilia mit dem Priester. Schweiß glänzte auf ihrer Stirn. Das lange braune Haar hatte sich aus den Spangen gelöst und fiel zerzaust auf die Schultern. »Gott sei Dank. daß Sie da sind«, keuchte Vater Andrews. »Sie will da hinausgehen auf die Vordertreppe. Man würde sie sofort töten, und das weiß sie.«
Sybilia klammerte sich an eine Kirchenbank und versuchte seine Hände abzuschütteln.
»Um Himmels willen, helfen Sie mir, sie durch die Sakristei hinauszubringen. Der Esel wartet. Wir haben keine Zeit mehr. Bald werden sie kommen ...« Er unterbrach sich, als ein Ziegelstein ein buntes Kirchenfenster zerschmetterte. Zornige Stimmen drangen herein, begleitet von lauten Schritten und dem rhythmischen Hämmern der Gewehre.
»Lassen Sie mich los!« jammerte sie. »Ich will nicht gerettet werden, denn es gibt keinen Ort, wo ich hingehen könnte.«
»Ich rette dich nicht«, erwiderte ich leise, »ich bringe dich zum nächsten Polizeirevier.« Da sah ich die Panik in ihren Augen und erkannte, was in ihr vorging. Sie bevorzugte ein rasches Ende, von der korsischen Gerichtsbarkeit herbeigeführt. Die Aussicht auf das Gefängnis, einen öffentlichen Prozeß und die Guillotine erschreckte sie. Mitleid erfaßte mich, und ich nahm ihr Gesicht in beide Hände, zwang sie, mich anzuschauen. »Sybilia, du hast einen Mord auf dem Gewissen. Und es wird ein zweiter geschehen, wenn du jetzt nicht mit mir kommst.«
Zu spät ... Krachend flog die vordere Kirchentür auf. Während der Mob hereinstürmte, schob ich Sybilia mit Vater Andrews' Hilfe durch die Sakristei nach draußen und hob sie auf den Esel. Ich hörte einen Eulenruf, und für ein paar Sekunden trat geisterhafte Stille ein. Sogar die Frösche und Grillen verstummten. Dann krachten Schüsse. Der Esel bäumte sich auf und raste durch den Friedhof in die Macchia.
Kapitel 4
Schwankend saß Sybilia auf dem galoppierenden Esel, in Mondlicht getaucht, eine deutlich sichtbare Zielscheibe. Auf dem taufeuchten Weg stolperte ich hinter ihr her, rutschte immer wieder aus. Unsere Flucht verursachte viel zuviel Lärm. Der Esel wieherte vor Angst, seine Hufe trommelten auf knackende Zweige und Steine, gefolgt von meinen schweren Schritten. Die Salven, die alle paar Minuten auf uns abgefeuert wurden, erschienen mir wie Fausthiebe.
Bei einer scharfen Biegung des Pfades fiel Sybilia vom Esel, und für einen gräßlichen Augenblick glaubte ich, eine Kugel hätte sie getroffen. Ich warf mich neben ihr zu Boden, suchte nach Blut, aber sie war nur leicht benommen. Ich zerrte sie in dichtere Macchia und preßte meine Hand auf ihren Mund. Wenig später rannten die Dorfbewohner vorbei, jagten dem fliehenden Esel nach, der glücklicherweise nicht mehr zu sehen war.
Ich wartete und lauschte. Niemand war in der Nähe, und ich schmiedete einen Plan. Wir würden die Leute täuschen, indem wir die einzige Straße mieden, die von Taita wegführte, und den Berghang hinaufstiegen, zum Wald. Später würden wir den Paß nach Osten überqueren. Zehn Meilen dahinter erstreckte sich eine neue Straße, und wir konnten per Anhalter nach Bastia fahren.
Wenn mein Plan fehlschlug ... Der Gedanke war beängstigend, aber es gab noch einen allerletzten Ausweg.
Ich zog Sybilia auf die Beine, und wir kämpften uns durch das dichte Unterholz. Zunächst kamen wir gut voran, denn wir folgten der Richtung, die ich bei meinen ersten experimentellen Grabungsarbeiten eingeschlagen hatte und die sich in einem weiten Kreis um das Dorf und den See zog. Auf höherem Terrain wuchs fast undurchdringliches Gestrüpp. Wir mußten große Felsblöcke umrunden und durchs Gebüsch kriechen. Das dauerte länger, als ich gedacht hatte. Sicher würden die Dorfbewohner bald aufs Geratewohl in die Macchia schießen. Nach einer Weile knallten tatsächlich Schüsse immer lauter und lauter. Vermutlich hatte man den Esel gefunden und meinen Plan erraten.
Aber nach einer Stunde sahen wir tief unter uns die Lichter von Taita und stellten fest, welch großen Vorsprung wir hatten. Ermutigt eilte ich weiter und zerrte Sybilia hinter mir her.
Gegen Mitternacht hörte ich Schritte auf dem Weg tiefer unten am Hang. Die Verfolger waren viel zu nahe an uns herangekommen. Ich warf mich zu Boden und zog Sybilia mit mir hinab. Ärgerliche Stimmen und Pfiffe hallten durch den Wald. Niemand schien zu wissen, wo wir uns befanden, und nach einiger Zeit kletterten wir wieder bergauf.
Um zwei Uhr morgens zog eine Kaltfront vom Meer heran, dicke Wolken bedeckten den westlichen Himmel. Es würde noch eine Weile dauern, bis sie den Mond verhüllten. Dann würde sich die Gefahr verringern, in der wir schwebten.
Trotz des schwachen Mondlichts bemerkte ich, wie erschöpft Sybilia aussah. Ihre Wangen waren voller Schmutzflecken, ihre Arme und Beine zerkratzt. Ein langer Riß klaffte in ihrem Rock, und sie hatte den Absatz einer Sandale verloren. Kleine Zweige und Blätter hingen in ihrem Haar. Obwohl ich wußte, daß wir uns nicht aufhalten durften, nahm ich sie in die Arme und versuchte sie zu besänftigen. Ich zupfte die Zweige und Blätter aus ihren Haaren, rieb ihr die kalten Hände und flüsterte ihr aufmunternde Worte ins Ohr. Doch ich hatte keinen Erfolg. Nichts vermochte sie zu trösten, und auch ich fürchtete die nächsten Stunden.
Ich schob sie in den Schatten eines großen Felsblocks und stieg hinauf, um die Lage zu sondieren. Durch die Macchia unterhalb meines Standorts zog sich ein Halbkreis aus hellen Lichtern. Lautes Knacken verriet mir, wie entschlossen sich die Dorfbewohner einen Weg durch das Dickicht bahnten. Über uns war alles dunkel, also würden wir dort sicher sein. Wie lange noch?
Ich glitt am Felsen hinab, packte Sybilias Arm, und wir hasteten weiter. Trotz ihrer Müdigkeit zeigte ihr Gesicht keine Angst, nur Resignation. Offenbar fand sie sich mit ihrem nahen Tod ab. Das erschreckte mich, und ich umklammerte ihren Arm so fest, daß sie stöhnte. »Schneller!« murmelte ich.
Eine Stunde später erreichten wir die obere Grenze der Macchia, die von nackten Granitbrocken abgelöst wurde. Sybilia wollte sich ausruhen, doch das wäre Selbstmord gewesen. Ich wollte sie gerade vorantreiben, als ich hinter einem Felsblock eine Fackel flackern sah.
Ich schob Sybilia hinter einen Busch und hörte den leisen Ruf einer Eule. Keine Vogelstimme klang so melodisch. Ein Schauer rann mir über den Rücken. Hatten sie uns entdeckt? Wo waren sie? Vielleicht Schäfer? Nein, in dieser Höhe gab es kein Weideland. Unbehaglich schaute ich Sybilia an und merkte, daß ihr die Fackel nicht entgangen war. »Anscheinend wissen sie, welche Richtung wir einschlagen.«
Hilflos zuckte sie die Achseln und schlug die Hände vors Gesicht.
»Wir gehen zurück – tiefer in die Macchia hinein. Da werden sie uns nicht aufstöbern.«
Sybilia griff nach meinem Arm. »Rette dich, Jock. Bitte, lauf voraus. Tu's für mich, ich flehe dich an. Ich werde mich diesen Leuten stellen. Das ist am besten. Ich will nicht ins Gefängnis. Außerdem können wir ihnen gar nicht entrinnen, und du bist unschuldig ...«
»Du verschwendest nur Zeit. Komm!« Energisch zog ich sie mit mir, den Hang hinauf.
Es war fast drei Uhr. Zahllose dornige Büsche hatten unsere Kleidung zerfetzt. Wenn wir den Paß in der Nacht nicht erreichten. würde Sybilia am Morgen völlig erschöpft sein. Seit ich die Lichter gesehen hatte. war viel Zeit verstrichen. und ich beschloß. mich noch einmal umzuschauen. Ich kletterte auf den nächsten Felsblock.
Der erste Schuß glich einem Donnerhall. Staub wirbelte aus dem Gestein neben mir hoch. Ein zweiter Schuß folgte. Sekundenlang war ich wie gelähmt vor Entsetzen, dann rutschte ich hastig den Felsen hinab. Sybilia schrie auf, und ich bemerkte das Blut an meinem Hemd. »Es ist nur ein Kratzer«. keuchte ich und preßte eine Hand auf meinen Arm. Selbst wenn die Wunde nur geringfügig war – sie schmerzte höllisch. »Sie rücken immer näher, wir sind beinahe umzingelt. Deshalb müssen wir zurück.«
Stolpernd rannten wir bergab. ringsum krachten Schüsse, schrille Pfiffe ertönten. Ich verlor jedes Zeitgefühl, konnte nur noch an den Ort denken, wo ich uns in Sicherheit zu bringen hoffte.
Irgendwann verdeckten gewaltige Gewitterwolken den Mond, und wir konnten unsere Schritte endlich verlangsamen. In dieser Finsternis würde es den Schützen unmöglich sein, genau zu zielen. Nun hatten sich unsere Chancen erheblich verbessert.
Plötzlich erhellte ein Blitz den Wald, und in dieser Sekunde sah ich meine Ausgrabung. Die hochaufragenden alten Steinkrieger starrten auf mich herab, lebensecht und bedrohlich im bläulichen Schimmer. Vielleicht war die Höhle unsere Rettung. Die primitiven Ureinwohner hatten diesen Ort gewählt, um Belagerungen standzuhalten, und warum sollte ich an ihren Überlebensinstinkten zweifeln?
In der Höhle verwahrte ich ein Gewehr und Munition, für den Fall, daß mir einmal ein wilder Eber über den Weg laufen sollte. Wenn wir die Ruinen erreichten, konnte ich Sybilia tagelang beschützen, bis zur Ankunft der Polizei.
So nahe lag unser Ziel. Aber wir mußten erst einmal den Fluß durchqueren, und da gab es keine Deckung. Wehrlos würden wir den Schützen ausgeliefert sein, wenn neue Blitze das Terrain beleuchteten. Dieser Gedanke beschleunigte meinen Herzschlag, und im selben Augenblick hörte ich hämmernde Schritte, dicht hinter uns. Sybilia blieb stehen, und ich zerrte an ihrem Arm, aber sie rührte sich nicht vom Fleck.
Kurz entschlossen hob ich sie hoch, schwang sie über meine Schulter und sprang in den eiskalten Fluß. Zweimal rutschte ich auf den glitschigen Kieseln aus, und ich schaffte es nur mühsam, in der starken Strömung mein Gleichgewicht zu wahren.
Wie verwundbar wir in diesen Sekunden waren ... Wieder hörte ich einen Schuß, der diesmal von unterhalb kam. Geduckt trug ich Sybilia durch das Wasser, das immer tiefer wurde. Auf einmal stach ein heftiger Schmerz in meinen Schenkel. Beinahe wäre ich zusammengebrochen, aber wenn ich jetzt stürzte, würden wir sterben. Sollte ich von den Menschen, über die ich zwei Bücher geschrieben hatte, gejagt und getötet werden? Das war Wahnsinn. Wilder Zorn spornte mich an, und ich taumelte weiter durch den rauschenden Fluß.
Die Vorsehung – oder ein Zufall – rettete uns. Als wir das Ufer erreichten, begann es zu regnen. Wassermassen fielen auf uns herab, trommelten auf Büsche und Steine, verwandelten den Boden nach wenigen Sekunden in Morast.
Die Dorfbewohner feuerten jetzt wild drauflos. Man sah fast nichts, aber ich fand den Weg zur Höhle blindlings. Dort ließ ich Sybilia zu Boden gleiten, ergriff mein Gewehr und schoß in die Macchia, lud nach, drückte wieder ab. Endlich begannen sich die Lichter zu entfernen.
Sybilia hatte einen Schock erlitten, war aber unverletzt, und ich war mit Fleischwunden davongekommen, die aber gräßlich schmerzten.
Während ich meine Wunden bandagierte, ging mir ein bestürzender Gedanke durch den Sinn. Nun sah ich die Insel mit anderen Augen – ein hartes, unversöhnliches Land, das man nicht unterschätzen durfte. Und ich hatte seine geheimen, verborgenen Stätten entweiht. Zur Vergeltung wurde ich in die Gefahren und emotionalen Wirren einer korsischen Vendetta hineingezogen.
Kapitel 5
Die Totenmesse wurde in der überfüllten Kirche abgehalten, die Hälfte der Trauergäste drängte sich draußen auf dem Platz. Danach führte Vater Andrews den Trauerzug an, als der Sarg auf den Friedhof getragen wurde. Er sah aus wie ein völlig gebrochener Mann, und ich wußte, warum. Viele Dorfbewohner hatte er getauft, getraut und begraben, ihre Beichten gehört, ihre Streitigkeiten geschlichtet. Er war sicher gewesen, alle würden ihm vertrauen. Aber Sybilia, die er wie eine Tochter liebte, hatte einen Mord verübt und mit ihrer Weigerung, zu beichten und zu sühnen, die Gnade der göttlichen Vergebung verwirkt.
Von der Menge mitgerissen, trat ich aus den wispernden Alkoven ins Sonnenlicht. Unzählige Tautropfen glitzerten im Gras, Blumen öffneten ihre Blütenblätter, um die Bienen willkommen zu heißen. Erleichtert, wieder im Freien zu sein, atmete ich die frische Luft ein. Plötzlich überwältigte mich Trauer um Sybilia. Sie hatte mich diese sinnliche Liebe zur Natur gelehrt, zur fruchtbaren Mutter Erde, die verschwenderisch die Saat aller Lebewesen nährte und zu Gestalten und Formen von unendlicher Schönheit heranwachsen ließ. Sybilia liebte das Leben. Sie konnte kein Lebewesen töten, nicht einmal Raupen oder Ameisen. War das alles nur Lug und Trug gewesen? Verband sich hinter diesem sanftmütigen Gesicht die Seele einer Mörderin? Gewiß nicht.
»Die Gebeine, die im Staub liegen, werden vor dem Herrn frohlocken«, deklamierte der Priester auf dem Weg zum Grab. Ich trat zur Seite und beobachtete die Dorfbewohner, die an mir vorbeizogen schwarzgekleidet, mit steinernen Mienen und zornigen Augen. Alle wissen, warum sie Rocca getötet hat, dachte ich. Deshalb wünschen sie ihr den Tod.
Während sie das leere Grab umstellten, betrachtete ich sie der Reihe nach. Maria Rocca, Xaviers bleiche Witwe, schluchzte in ihr Taschentuch. Am Morgen hatte sie mir erklärt, sie verachte Sybilia, die Schande und Kummer über die Familie gebracht habe.
Die Sargträger setzten ihre Last neben dem Grab ab, empörtes Gemurmel erklang. Die professionellen Klageweiber stimmten einen schrillen Gesang von Rache und Blut an, aber Vater Andrews warf ihnen einen vernichtenden Blick zu, und da verstummten sie. Ich bewunderte ihn. Seine Herde bestand aus eigensinnigen Schäfchen, die hartnäckig an ihrem uralten Aberglauben und ihrer traditionellen grausamen Gerichtsbarkeit festhielten. Alle waren Christen, aber auch Korsen.
Bevor der Sarg geschlossen wurde, schaute ich ein letztes Mal auf Xavier Rocca. Er hatte das Dorf seinen Traditionen gemäß regiert. Männer wie er gestalteten die Arbeit der katholischen Kirche und der Polizei auf dieser Insel zu einem Alptraum.
Als der Priester die Grabrede hielt, musterte ich die Leute noch einmal. Kein Gewehr, kein Messer, soweit ich es feststellen konnte. Vater Andrews hatte sich geweigert, die Bestattungsriten durchzuführen, falls auch nur ein einziger Bewaffneter auf dem Friedhof erscheinen sollte. Widerstrebend achtete man seinen Wunsch.
»Wir bitten Dich, o Herr, Deinem verstorbenen Diener Gnade zu erweisen. Laß ihn nicht leiden für das Unrecht, das er vielleicht begangen hat, denn er wollte stets Deinen Willen erfüllen ...«
Vater Andrews zuckte nicht mit der Wimper, während Inspektor Hiller den Platz überquerte. Er kam rechtzeitig, so wie vereinbart, begleitet von sechs bewaffneten Polizisten. Er pflegte nichts zu riskieren. Die Einheimischen kehrten ihm den Rücken zu, ihre Gesichter zeigten Verachtung. Keiner in Taita zog vor Rene Hiller den Hut. Doch er tat so, als bemerkte er die subtile Beleidigung nicht, als er hinter den Trauergästen Stellung bezog.
Rebellisches Gemurmel klang auf, aber Vater Andrews brachte die Leute mit einer knappen Geste zum Schweigen. »O Herr, wenn wir den Abschied von diesem Deinem Diener auch beklagen, so wissen wir, daß wir ihm eines Tages folgen werden ...«
Über den Blumenberg hinweg beobachtete ich Sybilias Sohn, Jules Rocca, der düster auf seine Füße starrte. An diesem Morgen war er aus Ajaccio eingetroffen und außer mir der einzige, der kein Schwarz trug, sondern nur einen Trauerflor am Ärmel. So wie ich. Der hübsche Junge preßte die Lippen zusammen und wirkte völlig verzweifelt. Er hatte seinen Großvater vergöttert. Seine Halbschwester Ursuline ließ sich nicht blicken. Sie war Novizin in einem französischen Kloster und wußte wahrscheinlich noch nichts von Roccas Tod.
»O Herr, sei uns gnädig, denn Du bist reich an Gnade. Lösche in der Überfülle Deines Mitleids unsere Sünden aus. Reinige uns von unserer Schuld ...«
Vater Andrews beendete die Zeremonie. aber die Trauernden blieben am Grab stehen, als spürten sie, daß die . Dramatik des Vormittags eine Fortsetzung finden sollte. Plötzlich herrschte tiefe Stille. Alle Augenpaare wandten sich zu Sybilia. die zwischen den Bäumen auftauchte. Ich trat näher zu dem Gewehr. daß ich am Morgen zwischen den Pflanzen des Nachbargrabs versteckt hatte, und hielt nach einer verdächtigen Bewegung in der Menge Ausschau.
Sybilia wischte die Blätter aus ihrem Haar und ging langsam, aber ohne Zögern durch das hohe Gras auf Hiller zu. Sie trug dieselbe Bluse. denselben Rock wie bei unserer Flucht. Trotz ihrer derangierten äußeren Erscheinung bewahrte sie eine würdevolle Haltung.
Widerwillig machten ihr die Trauergäste Platz. Die sichtlich nervösen Polizisten legten ihre Hände auf die Revolvergriffe. »Hier bin ich«, sagte sie zu Hiller. »Ich stelle mich der französischen Justiz.«
Wieder ertönte ärgerliches Gemurmel, Haß blitzte in vielen Augen, und die Stimme eines Klageweibs gellte: »Tod der Hure!«
Hiller erklärte Sybilia für verhaftet. sprach aber so leise, daß wir kein Wort verstanden. Um so klarer hörten wir ihre Antwort: »Ich habe Xavier Rocca nicht ermordet, sondern hingerichtet.« Stolz und kompromißlos wie immer straffte sie die Schultern. Ehe sie abgeführt wurde. warf sie einen letzten flehenden Blick auf ihre Familie.
Nachdem sich die Menge zerstreut hatte, lehnten Vater Andrews und ich an der Steinmauer. die den Dorfplatz umgab. Wir schauten der Staubwolke des Streifenwagens nach. Sybilia wurde nach Ajaccio gebracht.
»Ich muß wissen. warum sie es getan hat«. sagte ich.
Der Priester schüttelte den Kopf. »Jock, mein Freund ...« Er legte eine Hand auf meinen Arm. »Ein Beichtgeheimnis darf ich nicht preisgeben.«
»Ohne Verteidigung hat sie keine Chance«, stieß ich erbost hervor. »Es ist Ihre Pflicht, ihr zu helfen. Verstehen Sie das nicht?«
»Ich werde tun, was ich kann. Armes Mädchen ...« Unglücklich strich er sich über die Stirn. »Sie hat ohnehin keine Chance, zumindest nach Hillers Meinung.«
Ich versuchte eine Entscheidung zu treffen. Meine Arbeit in Taita war beendet, vor mir lag der Lohn für fünf mühsame Jahre. Sollte ich meine Karriere gefährden, um einer Frau beizustehen, die nur eine gute Freundin war?
»Sybilia wird ein Exempel statuieren, um die Inselbewohner von ihrem uralten Vergeltungssystem abzubringen«, erklärte Vater Andrews. »Hiller erwähnte, die Staatsanwaltschaft würde ein Todesurteil anstreben.«
Wie kann ich nach Boston zurückkehren und Sybilia ihrem Schicksal überlassen? fragte ich mich. Nur meinetwegen ist sie noch am Leben. Als ich sie überredete, sich der Polizei zu stellen, versprach ich, ihr nach besten Kräften zu helfen. Aber wie? Indem ich falsche Hoffnungen in ihr weckte, während die Mühlen der französischen Justiz sie unweigerlich zur Guillotine trieben? »Ich könnte meine Abreise verschieben«, sagte ich langsam. »Aber ich weiß nicht, wie ich ihr helfen soll.«
Er lächelte listig. »Oh, Sie müssen die Vergangenheit erforschen. Das ist doch Ihr Beruf? Seltsam, auf welche Weise manchmal Erinnerungen erwachen ... Als Hiller sie abführte, sah sie trotzig und hochmütig aus, aber auch verängstigt – genauso wie damals, als ich sie als junge, verschreckte Braut in Taita willkommen hieß.« Bevor er sich abwandte, hörte ich ihn murmeln: »O himmlischer Vater, wann darf eine Vergangenheit, die zwanzig Jahre zurückliegt, endlich sterben?«
TEIL II
Kapitel 6
Taita, 13. Juli 1939
Sybilia fühlte sich leicht benommen an dem Morgen, wo sie von ihrem Heimatort Chiornia nach Taita ritt. Nicht traurig, nicht furchtsam, tröstete sie sich. Warum sollte sie auch Angst empfinden? Nicht sie, nicht Sybilia Silvani, der Liebling der Nonnen in der Klosterschule, Solistin im Chor, Klassenbeste in Englisch, sechzehn Jahre und zwei Monate alt. O nein, diese alptraumhafte Reise auf dem Rücken eines störrischen Maultiers konnte nicht Wirklichkeit sein. Im Kokon dieser Irrealität wähnte sie sich sicher.
Während sie den Tetti-Wald durchquerte, schaute sie von einer Seite zur anderen. Bilder glitten vorbei, von Sybilias Schleier verwischt. Kastanienbäume warfen dunkle Schatten auf die Straße – eine fette Schweinefamilie verschlang Nüsse und Beeren und wälzte sich in einer Pfütze.
Gelächter drang zu ihr, und sie hörte die Stimme ihres Vaters, der anscheinend nichts Besseres zu tun hatte, als mit seinen Freunden zu scherzen. »Hilf mir, heilige Maria«, betete sie. »Laß das alles nicht geschehen ...«
Vor einer Woche hatte sie noch nicht geahnt, daß ihre ganze Welt einstürzen würde, und sich auf ein weiteres Schuljahr gefreut. Und dann war sie von Papa über seinen Plan informiert worden. Mama weinte, aber Sybilias Augen blieben trocken. Sie war zu schockiert, um Tränen zu vergießen. Bis zu jenem Augenblick hatte sie geglaubt, der Vater würde sie lieben. Nun gelobte sie sich, nie wieder ein Wort mit ihm zu sprechen.
Sie wußte nicht einmal, wie Michel, ihr Bräutigam, aussah. Bei der ersten Begegnung an diesem Morgen war sie zu verzweifelt und zu scheu gewesen, um ihn anzuschauen. Jetzt ging er hinter ihr in dieser lächerlichen Hochzeitsprozession, an der ihre Eltern, ihre vier Brüder, sechs Tanten, deren Ehemänner und Kinder teilnahmen. Jeder beförderte einen Teil der Aussteuer.
Ich darf nicht weinen, sagte sie sich. Das alles passiert nicht wirklich. Es ist nur ein böser Traum, aus dem ich bald erwachen werde.
Die gewundene Kiesstraße führte aus dem Wald hinaus und im Zickzack steil bergauf. Es wurde immer heißer, die Scherzworte verstummten. Nur mehr keuchende Atemzüge waren zu hören – und gelegentlich ein Fluch, wenn ein Fuß im schlüpfrigen Geröll ausrutschte. Die Frauen stöhnten in ihrem sonntäglichen Schwarz, die Blicke auf den Weg geheftet. Ihre feinsten Schuhe waren nicht für solche beschwerlichen Wanderungen gemacht.
Für die in Frankreich geborene und aufgewachsene Madame Silvani war der lange Weg eine einzige Qual. Sie ertrug es kaum, ihre Tochter anzusehen, die auf dem Rücken dieses widerlichen Maultiers schwankte. Sybilias zarter Körperbau wurde von ihren Kräften Lügen gestraft.
Bis zum Vorjahr war sie dünn wie eine Bohnenstange gewesen, dann hatten sich ihre Brüste entwickelt und die Hüften gerundet. So stolz war Madame Silvani auf die Tochter gewesen. Und der Vater hatte deren Schönheit nur ausgenutzt, um sich bei Xavier Rocca, dem mächtigen Führer der Nationalpartei einzuschmeicheln. Wie unfair ... Nie hätte sie einen Korsen heiraten dürfen. Korsika war eine Männerwelt, die sie mit Haß erfüllte. Stets hatte sie die Demütigungen und Einschränkungen ihres Frauenlebens ertragen, aber trotzdem einen gewissen rebellischen Geist entwickelt und Sybilia ermutigt, eigenständig zu denken und vom Leben nicht weniger zu erwarten als die vier Brüder. Die waren alle unabhängig, stolz, willensstark und tapfer – lauter Tugenden bei einem Jungen und bei einem Mädchen eine Katastrophe.
Tagelang hatte sie nicht mit Claude, ihrem Mann gesprochen – nicht, seit er betrunken nach Hause gekommen war, um seinen schrecklichen Plan zu verkünden. Ohne sie zu fragen, hatte er mit seinen Jagdkumpanen das Schicksal der Tochter besiegelt. Stundenlang flehte sie ihn an, doch er gab nicht nach. Er hatte es versprochen, und dabei mußte es bleiben. »Es ist eine gute Partie. Xavier Rocca besitzt sehr viel Land. In seinem Dorf ist er der Anführer, und in der nationalistischen Bewegung wird er hoch geschätzt. Er hat nur einen Sohn, und deshalb will er sich mit unserer Familie verbünden.« Selbstzufrieden lächelte er. »Reich an Männern« – diesen Ausdruck fand man oft in korsischen Dokumenten, und Gott wußte, daß die Silvanis mit den wunderbarsten vier Söhnen von Chiornia gesegnet waren.
»Du hast kein Recht, sie wegzuschicken«, erwiderte sie. »Wo sie doch noch so jung ist – und völlig unvorbereitet.«
»Und worauf wurde sie während dieser sechs Jahre in der Klosterschule vorbereitet?«
»Sie möchte Lehrerin werden ...«
»Den Jungen bezahle ich eine gute Ausbildung – Sybilia bekommt eine Aussteuer.«
Es hatte keinen Sinn, noch länger zu protestieren. Korsische Männer führten ein autoritäres Regiment in ihren Familien. Persönliche Neigungen spielten keine Rolle, wenn Ehen geschlossen wurden. Oft mußten junge Leute ihre Gefühle den familiären Interessen opfern.
Auf einer Granitklippe über einem gähnenden Abgrund sah Madame Silvani das Dorf Taita. Ein glitzernder Wasserfall stürzte in einen mondförmigen See hinab. Unterhalb des Dorfes waren Terrassen aus dem Stein gehauen, durch dicke, von Unkraut und Büschen bewachsene Mauern getrennt, teilweise mit Oliven- und Zitronenbäumen bepflanzt. Zwischen den Terrassen wand sich die Straße hinauf. Plötzlich ballten sich Nebelschwaden zusammen, und Taita verschwand. Die Hochzeitsgesellschaft rieb sich die Augen und überlegte, ob ein Trugbild sie genarrt hatte. Alle fühlten sich müde und durstig.. Doch da rief Xavier Rocca, der einige Schritte vorausgeeilt war: »Da sind wir – Taita, das schönste Dorf von Korsika! Heute ist es schüchtern und verbirgt sich hinter einem weißen Schleier, so wie die junge Braut. Mit dieser Geste will es sie willkommen heißen.«
Sybilia erschauerte. Als sie in ihrem bräutlichen Staat auf das Maultier gesetzt worden war, hatte sie darum gebetet, unterwegs zu sterben, das verhaßte Dorf nie zu erreichen, den Bräutigam nie zu sehen, die kommende Nacht nie zu erleben. Während des Ritts hatte sie sich mit dem Gedanken getröstet, alles sei nur ein böser Traum. Nun mußte sie der grausigen Wirklichkeit ins Auge blicken. Das Kleid saß viel zu eng und machte die Hitze noch unerträglicher. Eine Wolke aus Bremsen umschwirrte sie, stach in ihre nackten Beine. Die rauhe Decke, auf der sie saß, hatte die Innenseiten ihrer Schenkel wund gescheuert.
Xavier kehrte zur Braut zurück und zog das Maultier mit sich. Er war ein breitschultriger Riese und stark wie ein Bulle, der beste Jäger weit und breit, und was sein Durchhaltevermögen betraf, konnte ihm niemand das Wasser reichen. In seiner Jugend war er zur französischen Marine gegangen. Sehr rasch hatte er die Wirkung seiner kristallklaren blauen Augen und seiner schwarzen Lockenpracht auf die Frauen erkannt. Jetzt, mit dreiundvierzig, war er leicht ergraut, sah aber so gut aus wie eh und je. Zumindest glaubte er das. Voller Genugtuung zwirbelte er seinen Schnurrbart. In seinem Leben hatte es viel Spaß und viele Frauen gegeben, aber vor Maria hütete er seine Geheimnisse. Stets war Taita vor Skandalen verschont geblieben.
Glücklich schaute er in die Runde. Am liebsten hätte er die ganze Hochzeitsgesellschaft umarmt. Da war ihm wirklich ein besonderer Coup gelungen. Die Silvanis besaßen ein langgestrecktes Stück Land neben seinem eigenen, höher oben in den Bergen, wo im Sommer ihre Herde weidete. Es grenzte an einen kleinen See, auf den Xavier schon vor Jahren ein begehrliches Auge geworfen hatte. Es war nicht schwierig gewesen, Silvani diesen See als Teil der Mitgift abzuschwatzen. Nur zu gern hatte sich der Brautvater mit den mächtigen Roccas verbündet. Und das Mädchen war genau die Richtige für Xaviers Sohn – gebildet und eine echte Schönheit. Sicher würde sie einen Mann aus Michel machen.
Beim Gedanken an den Jungen erlosch Xaviers Lächeln. Schlechtes Blut ... Bei der Hochzeit hatte er gewußt, daß Maria nicht ganz richtig im Kopf war. Mazzeri wurde sie im Dorf genannt – die Todesbotin. Abergläubischer Unsinn ... Xavier hielt nichts von Hexenkünsten, vom Zweiten Gesicht, von den endlosen Gesprächen seiner Frau mit den Toten. Seit zwanzig Jahren ertrug er geduldig ihr Gefasel. In voller Kenntnis der Tatsachen hatte er sie geheiratet und sich nur zu gern ihr beträchtliches Erbe angeeignet.
Nun verdrängte er diese unangenehmen Überlegungen und beschleunigte seine Schritte. Dies war kein Tag für düstere Gedanken, und Xavier wurde von wachsendem Durst gequält. Gleich nach der kirchlichen Trauung sollte das Fest beginnen. Er wußte, wie erstaunt die Dorfbewohner waren, weil er diesen ernsthaften ausländischen jungen Priester, der so wenig von korsischer Lebensart wußte, ins Dorf geholt hatte. Nun, das war mit gutem Grund geschehen, doch davon verriet Xavier nichts.
Die Sonne brach wieder durch den Nebel. Üppig wuchernde Blumen und Kastanienbäume säumten den Weg. Es gab keinen schöneren Ort auf dieser Welt als Korsika. Er mußte es schließlich wissen, denn er war weit gereist.
Kapitel 7
Die Kirche St. Augustin war erst zweihundert Jahre alt, ein Baby angesichts der normalen korsischen Architektur. Sie bestand aus mächtigen gelblichen Granitblöcken und enthielt keine berühmten Kunstwerke, aber schöne alte Schnitzereien und Statuen, in Weiß, Blau und Gold bemalt. Die schönste stellte den heiligen Augustin von Hippo dar, in imposanter Bischofsrobe, mit kalkweißem Gesicht. Für die Hochzeit war die Kirche mit Blumen geschmückt worden, und Vater Andrews trug sein goldenes Meßhemd mit passendem Chormantel und Stola. Die Farbe des Gewands bildete einen krassen Kontrast zu seinem schwarzen Haar und der dunklen Haut. Die ernsten Augen schimmerten in einem undefinierbaren bräunlichen Grün, das sich mit dem Licht zu verändern schien. Manchmal wirkte er jung und scheu, aber diese Augen konnten auch zornig blitzen, und dann sah er viel älter und sogar bedrohlich aus.
Erst seit sieben Monaten lebte er in Taita. Im ganzen sollte er achtzehn Monate bleiben, zu Forschungszwecken, und währenddessen den Gemeindepriester von Taita unterstützen, Vater Delon. Dieser hatte vor vier Monaten einen Schlaganfall erlitten, und nun mußte der junge Ire alle kirchlichen Pflichten allein erfüllen. Für die Forschung blieb kaum noch Zeit. Doch er war ein Idealist und hielt die praktischen Erfahrungen, die er im Dorf sammeln konnte, für unschätzbar. Vielleicht fand er hier seine einzige Gelegenheit, für Menschen aus Fleisch und Blut zu arbeiten, denn als brillanter Gelehrter war er für eine Forschungstätigkeit im Vatikan vorgesehen.
Nun mußte er seine erste Trauung vornehmen, der er ziemlich nervös entgegenblickte. Es war ein Uhr, und schon zum fünftenmal an diesem Tag stieg er die steinerne Wendeltreppe des Glockenturms hinauf, der eine meilenweite Aussicht bot. Der Nebel löste sich auf, und er sah Staubwolken am Fuß des Hangs. »Das müssen sie sein«, flüsterte er erleichtert und bekreuzigte sich. Er hatte nicht gedacht, daß die Hochzeit tatsächlich stattfinden würde. In Taita hatte er bald gelernt, wie wichtig und einflußreich Xavier Rocca war, mächtiger als die Kirche und die französischen Behörden. Seit dem Begräbnis seiner Mutter hatte Rocca die Kirche nicht mehr besucht und auch beabsichtigt, seinen Sohn auf die traditionelle korsische Weise zu verheiraten. Die Braut küßte den Bräutigam in ihrem Elternhaus, vor den Augen der Verwandten und reichte ihm einen Teller mit fritelli (Fettgebackenes aus Kastanienmehl). Während die Hochzeitsgäste fritelli aßen, führte der Bräutigam die Braut in ihr Zimmer, und die Ehe wurde sofort vollzogen.
Diese kaltblütige heidnische Methode beleidigte Vater Andrews' sentimentales irisches Herz. Deshalb hatte er Rocca eines Nachmittags in sicherer Entfernung von Taita aufgelauert und ihn angefleht, dem jungen Paar eine kirchliche Hochzeit zu gönnen. Unerklärlicherweise hatte Xavier nicht protestiert, und so war die Trauung vorbereitet worden.
Als Vater Andrews die Treppe hinabgeeilt war, sah er Xaviers Frau in die Kirche kommen, die Arme voller Zweige, von denen Rinde und welke Blätter auf die makellos sauberen Fliesen fielen. Wie das absonderliche Geschwätz ihrer wöchentlichen Beichten verriet, war sie geistesgestört, aber sie hatte auch ihre lichten Momente. Dieser zählte offensichtlich nicht dazu. Der Priester beauftragte einen Ministranten, den Schmutz zu entfernen, und nahm der Frau das Bündel ab. »Das ist sehr freundlich von Ihnen, Madame«, sagte er in seinem bedächtigen Französisch mit dem starken irischen Akzent und musterte sie. Die durchdringenden hellblauen Augen waren das einzig Schöne an ihrem fahlen Gesicht.
»Wilde Blumen – viel schöner als Gartenblumen«, stammelte sie. »So natürlich – anders als das da ...« Verächtlich zeigte sie auf die üppigen Blumenarrangements, um die er sich persönlich gekümmert hatte.
»Das ist ein großer Tag für Sie, Madame Rocca«, bemerkte er jovial.
»In einer Stunde werden sie da sein.«
In einer Stunde ... Dieser Gedanke erschreckte Maria. Würde alles gutgehen? Und die Katze? Warum hatte sie die Katze vergessen? O Gott, die Hochzeitsbuffets ... Tagelang hatte sie hart gearbeitet. Es gab keine Töchter, die ihr halfen. Und in letzter Zeit war sie so vergeßlich, ihr Geist flatterte umher wie ein Schmetterling, hielt sich nirgends lange auf. Auch ihre Mutter hatte darüber geklagt, aber damals war sie schon achtzig gewesen und ein so hohes Alter entschuldigte natürlich eine wachsende Vergeßlichkeit. Maria erinnerte sich an den Tag, da die Mutter in den Garten gegangen war, um Zwiebeln zu holen, und statt dessen Lavendel in die Küche gebracht hatte. Sie war ausgelacht worden, hatte aber so getan, als wollte sie mit dem Lavendel die Fliegen fernhalten. Und das hatte sogar funktioniert.
»Mit Lavendel kann man Fliegen verscheuchen«, erklärte sie dem jungen Priester. »Das weiß ich aus Erfahrung. Aber nun habe ich schon wieder die Katze vergessen.«
Sie eilte davon. und Vater Andrews beobachtete von der Kirchentür aus. wie sie den Platz überquerte. Er runzelte die Stirn. Wie würde sie mit einer Schwiegertochter im Haus zurechtkommen? War sie wirklich so verrückt, wie es aussah. oder nur schüchtern und geistesabwesend?
Das Rocca-Haus war eine imposante Granitfestung. Drei Stockwerke hoch. ragte es auf einem Felsvorsprung über dem See empor, wie alle anderen Häuser in Taita vor fünfhundert Jahren von fleißigen Genuesern erbaut, mit dicken Mauern, massiven Türen und Fensterläden.
Von außen wirkte es verfallen, mit abblätternder Tünche und morschem Holz. Aber um die Außenseite kümmerte sich Maria nicht, nur um die makellos sauberen Innenräume, die glänzend polierten Holzböden, die frischgestrichenen Wände, die handbestickten Musselinvorhänge, die schönen Möbel. Voller Stolz schaute sie sich um. Vor dem Fest fand sie noch Zeit für eine letzte Inspektion.
Im Keller. der im hinteren Trakt ins Erdgeschoß überging, stand ein Holzofen. wo Wasser erhitzt wurde. Hier wusch sich die Familie und badete in einer großen Kupferwanne. Direkt darüber lag die Küche. zu der eine breite Steintreppe hinaufführte. Im Salon neben der Küche prangte ein langer Tisch aus Kirschbaumholz mit zwölf Stühlen, alles Erbstücke von Marias Mutter. Die Kissen auf den Stühlen und der blauen Couch waren von der Hausherrin eigenhändig bestickt. An den Wänden hingen gerahmte Familienfotos und die Reproduktion eines Gemäldes von Edward Lear, das den Monte Cinto zeigte. Sie hatte es in Ajaccio in einem Antiquitätengeschäft entdeckt und gekauft, weil es dem Ausblick aus ihrem Schlafzimmerfenster glich. Auf dem Kaminsims stand eine Marienstatue, neben der Tür ein altes Klavier. das ebenfalls ihrer Mutter gehört hatte. Nun füllten mehrere Buffettische den Raum, mit Speisen beladen.
Im Stockwerk über dem Salon befanden sich das große Schlafzimmer und Xaviers Privatraum, darüber zwei Zimmer, wo Sybilia und Michel wohnen sollten. Sämtliche Deckenbalken des Hauses bestanden aus gelbem Holz, das abends im Schein der Öllampen golden schimmerte.
Maria ging in die Wohnung des jungen Paars hinauf und blickte sich liebevoll um. Das Schlafgemach hatte sie mit den Möbeln aus Michels Zimmer eingerichtet, abgesehen von dem breiten Doppelbett aus Messing, und der Braut ihren eigenen Toilettentisch zur Verfügung gestellt. Natürlich würde Sybilia Bettwäsche mitbringen, aber Maria hatte ihr welche geliehen und das Bett gemacht. Duftende Kräuter aus der Macchia schmückten die Vasen.
Würde das Mädchen hier glücklich und gut zu Michel sein? Maria wußte nur sehr wenig über Sybilia, denn Xavier schwärmte immer nur von den Feldern, die sie dem Familienvermögen hinzufügen würde.
Nun, sie hatte wahrlich keinen Grund, sich über arrangierte Ehen zu beklagen. Plötzlich schien sich die Zeit zurückzudrehen, und Maria war wieder ein achtzehnjähriges Mädchen, fest entschlossen, ins Kloster zu gehen. An einem schönen Frühlingstag wurde sie von Xavier Rocca gepackt – gerade auf Urlaub daheim und sehr schneidig in seiner Marineuniform – und auf der Kirchentreppe geküßt, vor den Augen des ganzen Dorfes. Diese Tat, in der korsischen Gesellschaft unverzeihlich, kompromittierte sie rettungslos und hätte ihn das Leben kosten müssen. Aber er gab vor, die Sitten und Gebräuche nicht mehr zu kennen, weil er so lange im Ausland gewesen sei. Und sekundenlang habe er vergessen, daß er sich in Korsika befinde. Sie wurden sofort verheiratet. Die Mutter weinte, der Vater tobte vor Zorn über die Mitgift, die der unverschämte Xavier verlangte. Natürlich fand sie später heraus, daß er an jenem Tag gelogen hatte und niemals Fehler beging. Aber sie bedauerte die Eheschließung nicht.
Wenn bloß ihr Kopf nicht so schmerzen würde ... Diese Qualen jagten ihr Angst ein, denn meistens führten sie zu Alpträumen. O Gott – nicht heute ... Sie mußte sich zusammenreißen.
Abrupt erinnerte sie sich an das Essen und eilte die Stufen hinab. Natürlich – ein Brathuhn fehlte, und bald fand sie die fettige Spur, wo die Katze ihre Beute in den Garten geschleift hatte. Glücklicherweise waren die Buffets immer noch reichlich gedeckt, aber wenn der Beweis für den Diebstahl vor Xaviers Ankunft nicht beseitigt wurde, würde es die Katze den Kopf kosten.
Maria lief in den Garten, um die Hühnerknochen in sicherer Entfernung vom Haus zu verscharren. Aber die fauchende Katze floh damit in die Brennesseln, und ihre Herrin zuckte die Achseln und machte kehrt.
Gerade wollte sie den Platz vor der Kirche überqueren, als sie stechende Schmerzen in den Schläfen spürte. Das grelle Sonnenlicht blendete, und sie legte die Hände über ihre Augen. Stöhnend ging sie weiter und betete: »Heilige Maria, Mutter Jesu, hilf mir! Nicht heute! Nicht am Hochzeitstag meines Sohnes!« Am Brunnen sank sie auf die kalte Steinbank. Trommeln dröhnten in ihren Ohren. »Allmächtiger, hilf mir ...« Aber es gab keine Hilfe. Die Geister riefen nach ihr, und sie mußte den Trommeln, den Boten des Todes, gehorchen. Seufzend stand sie auf und taumelte zum Rand des Platzes. Der unheimliche graue Nebel, der ihre Träume stets begleitete, wehte von den Berghängen, und bald erkannte sie die verschwommenen Gestalten, die langsam durch die Schwaden wanderten.
Sie sah Xavier vor den bewaffneten Dorfältesten, die einen Sarg trugen, die Mienen nicht traurig, sondern voller Zorn. Warum? Sie mußte es wissen. Sie sahen müde aus, waren unrasiert und ungekämmt, als hätten sie mehrere Nächte in der Macchia verbracht. Wer war gestorben? Sie ging hin, spähte in den Sarg, über dessen Ecke eine Trikolore hing. Ihr Sohn Michel lag darin, und sie schrie lautlos. Er war schrecklich verstümmelt, das Gesicht geschwollen und entstellt. Schwankend trat sie zurück und erblickte seine Witwe, eine schöne junge Frau in einem Männeranzug aus Khaki, ein Gewehr in der Hand, tränenüberströmt. Ihr Schluchzen war das letzte, was Maria hörte, ehe die Vision verschwand.
Sie wankte zum Brunnen zurück und hielt den Kopf unter den eiskalten Quellwasserstrahl. »Ein Traum, sonst nichts«, wisperte sie. »Nur die Phantasien einer verrückten alten Frau ...« Angstvoll schaute sie zur Kirche hinüber.
Kapitel 8
Es war nach zwei, als sich die erschöpften Verwandten aus Chiornia am Brunnen erfrischt hatten und die Kirche betraten. Wenig später wurde die Braut von ihren Eltern und Brüdern über den Platz geführt. Auf der letzten Stufe zögerte sie und schaute nach Westen, als wollte sie ein letztes Mal die heimatlichen Wälder und Täler sehen. Dann senkte sie den Kopf und ging über die Schwelle.
Vater Andrews empfand großes Mitleid mit dem zitternden Mädchen im zu engen Brautkleid. Sybilia war ungewöhnlich groß, mit breiten Schultern, die nun mutlos nach vorn hingen, zierlicher Taille und schmalen Hüften. Nervös zupfte sie an ihrem Blumenstrauß. Ein dichter Schleier verbarg ihr Gesicht. Immer wieder schob sie eine Hand darunter, um Tränen wegzuwischen.