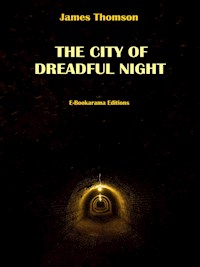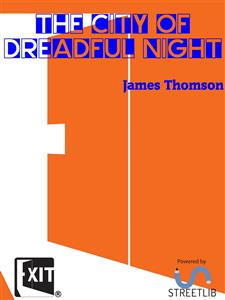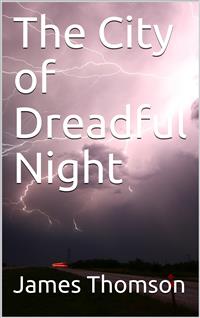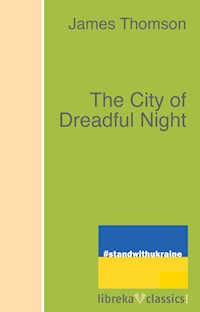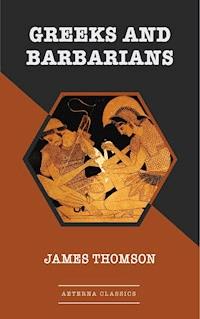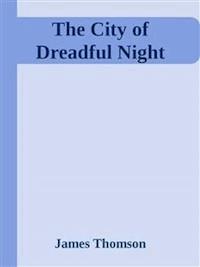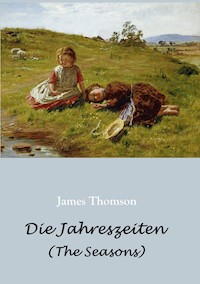
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
James Thomsons "Jahreszeiten" ist eines der berühmtesten Langgedichte der englischen Literatur. 1730 erstmals erschienen, erfreute es sich rasch enormer Beliebtheit und wurde bald darauf in verschiedene Sprachen übersetzt. Das Gedicht ist in Blankversen verfasst und nach antiken Vorbild nicht gereimt, um nicht banal zu wirken. Sprachgewaltig und mitreißend werden darin die vier Jahreszeiten, Naturbeobachtungen, ländliches Idyll und bäurischer Alltag beschrieben, zudem enthält es Gedanken philosophischer Natur.
Von "Die Jahreszeiten" existieren mehrere Übersetzungen ins Deutsche, die vorliegende von Heinrich Harries dürfte eine der akkuratesten - und dabei in Form und Stil auch eine der ansprechendsten sein. Die vorliegende Ausgabe enthält ferner eine kurze Biographie des Autors, eine von William Collins zu Ehren des Autors geschriebene Ode sowie, zum Abschluss der Jahreszeiten, einen angehängten "Hymnus". Die Verszählung des Originals wurde beibehalten, somit ist die Ausgabe auch zu Studienzwecken geeignet.
Das E-Book Die Jahreszeiten - in deutschen Jamben (The Seasons) wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Mary Shelley,Thompson,milton,Ann Radcliffe,Castle of Indolence
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt.
Thomsons Leben
Ode auf Thomsons Tod (von William Collins)
Vorrede des Übersetzers
Jahreszeiten
Frühling
Sommer
Herbst
Winter
Hymnus
Dem edlen Toten ist kein Anwalt not,
ihm, dessen Sache jeder übernimmt
Nicht Sekte noch Partei beschränkte je
sein Herz voll Liebe, das der Menschheit schlug
So war der Mensch – den Dichter kennt ihr wohl,
der euer Herz so oft in Wehmut schmolz:
denn seine keusche Leier hauchte nur
die edelsten Gefühle; nie entglitt
ein üppiger, entweihender Gedanke
dem Himmelssänger, keine Zeile, die
er sterbend auszulöschen wünschen durfte –
Prolog zum Coriolan.
Der edle Königssitz, am welchem Du
sanft wie der holde Stern der Liebe strahlst –
obgleich er zu den übrigen Europens
sich wie der häusliche Familienkreis
zum bunten Chaos eines Karnevals
verhalten mag – bleibt immer doch – ein Hof,
ein fremdes Etwas, das so manches Sehnen
in Deinem schönen Menschenbusen nicht
zu sättigen vermag, und das, Natur!
wo anders als in Deines Tempels Hallen?
gestillet wird – Hier, wo das Herz sich erst,
um Brauch und Form und Regel unbekümmert,
in vollern, freiern Schlägen dehnen darf;
Hier seh’ ich Dich, wie einst am Schleigestade –
entkleidet alles königlichen Prunks,
doch immer noch ein königliches Weib –
den reinen, süßen Frieden der Natur
auf Deiner Stirn, und ihre Huldigung
im Tränenschimmer Deines Wonneblicks,
der auf der Schöpfung höhern Szenen bald
alliebend ruht, mit gleicher Inbrunst jetzt
zum kleinen Veilchen lächelnd niedersinkt –
und nun – o schöner günstiger Moment!
und nun erkühn’ ich mich, hervorzutreten,
und diesen Strauß von überpflanzten Blumen,
mit lautem Busenschlag, Dir anzubieten.
Der stolze Platz, wo Sträuße oft verdüften,
ist nicht für ihn – wenn Deine Huld ihm nur
ein bessres Los gewährt, als – auf den
Wellen des ersten besten Stromes fortzuschwimmen.
Thomsons Leben.
JAMES (Jacob) Thomson war den 22. Sept. 1700, zu Ednam, in der Grafschaft Roxburghshire, in Schottland, geboren. Sein Vater war Geistlicher daselbst, und, obgleich über den engen Zirkel seiner Amtskollegen hinaus, wenig bekannt, doch von allen, die seine Rechtschaffenheit und Amtstreue kannten, verehrt und geachtet. Seine Mutter war ein Weib von ungewöhnlichen Naturtalenten, einer glühenden Einbildungskraft, wohlerzogen, geschmückt mit jeder häuslichen und seligen Tugend, und eine Christin bis zum Enthusiasmus.
Was unserm Thomson von solchen Eltern angestammt sein mochte, das ward durch die sorgfältigste Erziehung entwickelt und ausgebildet. Die frühe Bekanntschaft mit den älteren Urkunden der Offenbarung weckte und nährte in ihm einen erhabenen, orientalischen Geist, der seine Dichtungen auf immer auszeichnen wird, und der schon so ganz sein erstes Werk, die Jahreszeiten, belebt, in welchen wir Kühnheit mit Gefühl, Originalität mit Natur, und Majestät mit Grazie so eigentümlich gepaart sehen. Die äußeren Gegenstände wirkten nicht minder vorteilhaft auf Thomsons dichterische Bestimmung. Es war unter den pittoresken, schäferlichen Gefilden von Teviotdale, in denen die Elemente der Naturschönheiten, Walder, Seen, Anhöhen und Felsen, mit Untermischung reicher schöner Wiesen, sich so freundlich begegnen wo seine Jugend aufblühte; Cheviot, das Land des Gesanges und heroischer Großtaten, grenzte seinen Horizont, und in seiner Nähe lagen die ehrwürdigen Ruinen von Jedburgh, Dryburgh, Kelso und Melrose, die über das Ganze eine Art von schauerlicher Feier verbreiteten.
Die erste Aufmerksamkeit bewies ihm, als Knaben, die Jerviswoodsche Familie, mit der er von Mutterseite verwandt war, und die ihn oft und gern in ihrem Zirkel hatte. Sie wird noch ein Gedichtchen von ihm, worin er ein Buch geliehen wünscht, als Denkmal seiner jugendlichsten Muse, aufbehalten haben. Hauptsächlich aber waren es ein paar talentvolle, vermögende Männer in der Nachbarschaft, die um die frühere Bildung des Thomsonschen Geistes sich verdient machten. Der einen ein gewisser Geistlicher, Riccarton, der, nachher der schützende Genius der verwaisten Familie, in den rohen, kindischen Aufsätzen Thomsons einen Fond von Genius entdeckte, der so sehr entwickelt zu werden verdiente, übernahm, mit Bewilligung des Vaters, die Hauptleitung seiner Studien, versah ihn mit Büchern, besserte seine Arbeiten aus, und sah in den glücklichsten Fortschritten desselben seine Mühe mit jedem Tage schöner belohnt. Hierzu kam nun noch der Umgang mit Sir William Bennet zu Chester, einem Mann voll heiterer Laune und allzeitfertiger Einfälle, der mit ungewöhnlicher Sympathie zu unserem Dichter hingezogen, ihn häufig einzuladen pflegte, die Sommerferien auf seinem Landsitz zuzubringen. Der leichte, glückliche Wurf, mit dem er hier, unter so begünstigenden Umständen, jeden interessanten Gegenstand zu einem Gedicht erhob, kontrastierte nicht wenig mit seiner nachherigen richterlichen Strenge. Er hatte nämlich die so seltene Gewohnheit, an jedem Neujahrsabend alle seine vorjährigen Poetereien zusammenzubringen, und sie, begleitet mit einem launigen Gedicht, das die Verdammungsurteile derselben enthielt, dem Feuer zu übergeben. Nach der gewöhnlichen Schulkarriere zu Jedburgh ging er auf die Universität zu Edinburgh, wo seine Studien im zweiten Jahr durch den Tod seines Vaters unterbrochen wurden, der so plötzlich erfolgte, daß er bei der schleunigsten Eile dennoch seinen letzten Segen nicht erhielt, ein Umstand, der auf viele Jahre den wehmütigsten Gram in seiner Seele zurückließ.
Um diese Zeit begann das Studium der Dichtkunst in Schottland allgemeiner zu werden; die besten englischen Schriften wurden überall gelesen und nachgeahmt. Addison hatte neulich die Schönheiten des Miltonschen Paradieses entwickelt, und seine Bemerkungen darüber, verbunden mit Popes berühmtem Essay, hatten den Weg zur Bekanntschaft mit den besten Dichtern und Kritikern geöffnet.
Aber der gelehrteste Kritiker ist nicht immer der beste Beurteiler dichterischer Werke, Geschmack ist eine Gabe der Natur, dessen Mangel weder Aristoteles noch Bossu, noch auch das Studium der besten Originale ersetzen kann, wenn nicht die Seelenkräfte des Lesers mit denen des Dichters in einem gewissen harmonischen Einklang stehen; dies war der Fall bei mehreren gelehrten Herrn, denen Thomsons erste Versuche in die Hände fielen. Einige Nachlässigkeiten des Stils, und ein gewisser üppiger Schwung, den junge Schriftsteller so schwerlich vermeiden, waren ihrer hohnneckenden Kritik nicht entgangen; aber für das wahre Feuer, für die natürliche, warme, originelle Darstellung des Dichters hatten sie keinen Sinn. Er aber, im Gefühl seiner Kraft, ließ sich dadurch um so weniger entmutigen, da die Urteile seiner geschmackvolleren Freunde ganz anders entschieden.
Der gelehrte Hamilton war damals Professor der Theologie zu Edinburgh. Thomson hatte dessen Vorlesungen ungefähr ein Jahr lang beigewohnt, als ihm, in einem praktischen Collegio, die Bearbeitung eines Psalms aufgegeben ward, dessen Inhalt die Größe der Gottheit enthielt, worüber er eine Umschreibung lieferte, deren hoher, poetischer Stil das ganze Auditorium in Erstaunen setzte. Hamilton sagte dem Redner über seine Arbeit viel schmeichelhaftes, und machte seine Mithörer auf einzelne meisterhafte Stellen aufmerksam; dann wandte er sich wieder zu Thomson, und sagte ihm lächelnd: „Wenn Sie einst als Prediger Nutzen stiften wollen, so wird es nötig sein, ihre Phantasie etwas strenger zu beherrschen, und sich einer, den Bedürfnissen gemischter Volksversammlungen mehr zusagenden Sprache zu befleißigen.“ Thomson nahm dies als einen Wink, daß seine Erwartungen von der Theologie, wenn diese auch weit mehr seine freie Wahl gewesen wäre, als sie es vermutlich war, einen sehr prekären Erfolg haben möchten. In dieser Stimmung bedachte er sich nicht lange, den Zuredungen der Lady Grizel Baillie, einer damals in London lebenden Freundin seiner Mutter, zu folgen, sich im Herbst 1725 zu Leith einzuschiffen, und auf gut Glück auf die Hauptstadt loszusteuern.
So höchst unbedeutend anfangs der Erfolg jener Einladung war, so diente sie ihm doch vor der Hand statt eines Vorwandes, um die Unbesonnenheit einigermaßen zu beschönigen, mit der er sich, ohne Geld, ohne Freund, ohne Gönner, in die weite Welt hineingeworfen hatte.1
Aber ein Mann von Thomsons Gehalt konnte hier nicht lange unbekannt bleiben. Der berühmte Lord Forbes, der schon in Schottland Proben seiner Muse gesehen hatte, nahm ihn zuerst sehr gütig auf, und empfahl ihn mehreren seiner Freunde, besonders Herrn Aikmann, der mit vielen, durch Rang und Verdienst sich auszeichnenden Personen in vertraulicher Verbindung stand; dieser Mann war aus einem Liebhaber der Malerei ein professionierter Maler geworden, und da sein Geschmack in der verwandten Kunst der beschreibenden Poesie nicht weniger fein und richtig war, als in seiner eigenen, so sieht man leicht, wie eine solche Harmonie zwei Seelen, wie Aikmanns und Thomsons, zusammenziehen konnte.
Die ehrenvolle Aufnahme, die Thomson überall fand, wo er eingeführt wurde, flößte ihm einen großen Teil des Mutes ein, den man zu der Ausstellung eines ersten Kunstversuchs so nötig hat. Es war sein Winter, womit er debütieren wollte. Er hatte nämlich seit geraumer Zeit, und, wie man sagt, zum Teil unter nicht sehr begeisternden Einflüssen eines herben Winters, einzelne Bruchstücke über diese Jahreszeit ausgearbeitet, die den höchsten Beifall seiner Freunde erhalten hatten. Jene zerstreuten Teile schmolz er nun zu einem Ganzen zusammen, und so entstand sein Winter, dem nun weiter nichts als ein Verleger fehlte. Da er zur Zeit weder bekannt war noch Erfahrung hatte, seiner Geistesware vorteilhaft anzupreisen, so kam ihm in dieser Verlegenheit die Freundschaft des Herrn Mallet, Hofmeisters bei dem Herzog von Melrose sehr zustatten.2 Dieser fand einen Buchhändler, Millan, in Charing Cross, der mehr aus Freundschaft gegen ihn, als in der Hoffnung einiger Ausbeute, den Winter im Jahr 1726 verlegte, und drucken ließ.
Was man auch von der ersten Kälte gegen dies Gedicht, und von dem Eifer eines gewissen Whatley sagen mag, der den Wert desselben zuerst in allen Kaffeehäusern und Tavernen ausposaunt, und das Publikum zuerst auf diesen unbekannten Schatz aufmerksam gemacht haben soll, so bleibt soviel gewiß, daß, so wie der Winter nur erschien, er allgemein bewundert ward, nur freilich nicht von denen, die in der Poesie nichts schön fanden, als satirische Züge, epigrammatische Witzeleien, grelle Gegensätze, den Schimmer prächtig aufgestutzter Reime, oder die Weichheit elegischer Klagen. Für diese hatte Thomsons männlicher, klassischer Geist wenig empfehlendes. Nur ein ernsthaftes Studium desselben war im Stande, sie von ihren Vorurteilen zu heilen, und sie jenem bessern Geschmack huldigen zu machen, den sie entweder wirklich annahmen, oder es doch zumindest vorgaben. Einige wenige standen befremdend von fern, bloß weil sie lange vorher die Artikel ihres poetischen Credo festgesetzt, und durchaus die Hoffnung aufgegeben hatten, jemals wieder etwas neues und originelles zu sehen. Es war für sie eine Art von Demütigung, ihre Prinzipien durch die Erscheinung eines Dichters fallen zu sehen, der der Natur und seinem eigenen Genius alles zu verdanken schien. Unterdessen ward sein Beifall mit jedem Tage allgemeiner, und jeder wunderte sich, wie so viele, und noch dazu so gewöhnliche Gegenstände, die in der Natur nicht sowohl, als in den bisherigen Gemälden davon, einen so schwachen Eindruck gemacht hatten, in Thomsons Schilderungen ein so neues, lebendiges Interesse erhielten; selbst seine Abschweifungen, gewöhnlich die Ergüsse eines zarten liebevollen Herzens, bezauberten den Leser, und machten ihn zweifelhaft, ob er mehr den Dichter bewundern oder den Menschen lieben sollte.
Jetzt begann für ihn die glorreiche Epoche, wo alles ihm zu huldigen, und seiner Sphäre sich zu nähern strebte. Männer der ersten Größe wurden seine Gönner, und Damen vom Stande (die Gräfin Hertfort, Miss Drelincourt, nachher die Gräfin Primrose, Mrs. Stanley, usw.) wurden seine erklärten Beschützerinnen. Das vorzüglichste aber, was er seinen Winter verdankte, war die Bekanntschaft des Dr. Rundle, nachherigen Lordbischofs zu Derry. Dieser, der im nähern Umgang mit Thomson Eigenschaften und Talente entdeckte, die selbst seine dichterischen überwogen, würdigte ihn seiner vertrauteren Freundschaft, war bei jeder Gelegenheit der Herold seines edlen Charakters, führte ihn bei seinem großen Freunde, dem Kanzler Talbot ein, und empfahl ihn, einige Jahre nachher, als der älteste Sohn dieses Lords auf Reisen gehen sollte, zum Begleiter desselben.
Unser Dichter, in dem vollen Gefühl der Verpflichtungen, die der Beifall des Publikums ihm auflegte, arbeitete indessen mit allem Eifer an der Vollendung des Plans, wozu die öffentlichen Wünsche ihn aufgefordert hatten, und befriedigte in den übrigen Jahreszeiten, wovon der Sommer im Jahr 1728, der Frühling im Anfang des folgenden, und der Herbst, in der Quartausgabe seiner Werke, 1730 erschien, alle die Erwartungen, die sein Winter erregt hatte.
Eine feine Würdigung der Thomsonschen Muse, und seiner Jahreszeiten insbesondere, die in dem „Versuch über die Schriften und den Genius Popens“, enthalten ist, steht hier wohl nicht am unrechten Orte. „Es wäre“, heißt es, „unverzeihlich, bei den Bemerkungen über die beschreibende Poesie, des Dichters der Jahreszeiten zu vergessen, der für diese Art der Komposition so wundervolle Talente besitzt. Ausgestattet mit der kühnsten, üppigsten Phantasie, bereicherte er die Dichtkunst mit einer Menge neuer, origineller Bilder, die er nach der Natur und seinen eigenen unmittelbaren Beobachtungen zeichnete. Seine Gemälde haben daher eine Wahrheit und eine Genauigkeit, die man umsonst bei jenen Dichtern sucht, die nur einer dem andern nachkopieren, ohne je um sich her die Gegenstände selbst studiert zu haben. Thomson pflegte ganze Tage und Wochen unter den mancherlei Szenen der ländlichen Natur umherzuirren, aufmerksam auf jeden Gegenstand, jeden Laut; während hundert Poeten, die jahrelang am Strande wohnten, sich in Bildern von Fluren und Rieselbächen abarbeiteten, die denn freilich strandartig genug ausfielen. Daher die ekelhafte Wiederholung derselben Umstände, die widerliche Unschicklichkeit, seinen Vorrat angeerbter Bilder, ohne Rücksicht auf das Zeitalter, das Klima, die Umstände, wo sie eigentlich hingehören, auszuschütten – Obgleich die Diktion in den Jahreszeiten bisweilen rauh und unharmonisch, bisweilen schwülstig und dunkel ist, obgleich hier und da, um die Kadenz des Verses abwechselnder zu machen, zu wenige Pausen angebracht sind, so ist dies Gedicht doch im Ganzen, schon wegen der zahllosen Züge der Natur, die es enthält, eins der reizendsten und entzückendsten in unserer Sprache: ein Werk, dessen Schönheiten, da sie nicht von flüchtig reizender Art sind, und nicht auf konventionellen Sitten und Gewohnheiten beruhen, ewig gefallen werden, wie die Natur selbst. Die Szenen beim Thomson sind oft so wild und romantisch, als die von Salvator Rosa, und wechseln lieblich mit Jähen, Waldströmen, Casteelklippen, Taltiefen, Riesengebirgen und nächtlichen Klüften. Unzählig sind die kleinen Details in seinen Malereien, die seine Vorgänger so ganz übersahen. Welcher Dichter hat je auf die Blätter geachtet, die gegen das Ende des Herbstes niederfallen:
„– unaufhörlich rasselt jetzt das Laub
vom Klagehain, macht oft den Waller stutzen,
der seinen Pfad gedankenvoll verfolgt,
und kreiset langsam durch die walln’de Luft.“
Wer hat, bei Darstellung eines Sommerabends, des Wachtelmännchens erwähnt, das „sein schwärmend Liebchen heimzukehren lockt.“
Wer ist auf folgendes sommerliches Naturbild gefallen:
– „gaukelnd flutet, wenn der West sich hebt,
weit übers Distelfeld ein weißer Schauer
von Pflanzenflaum dahin – “
Welche Fülle, welche Bestimmtheit, welche Malerei in der Beschreibung der Umstände beim scharfen Frost in einer Winternacht:
„Laut klingt im Frost die Erde; schärfer prallt
ein klarer Doppelhall von ihr zurück;
der Dorfhund scheucht, auf seiner Abendwache,
den leisen Dieb; es brüllt die junge Kuh.“
Im Windhauch schwillt der ferne Wasserfall;
hohl und von weiten tönt, vom schnellen Schritt
des Wandrers, das erschütterte Gefild.“
Von keinem Gegenstande fällt die Beschreibung gewöhnlicher Dichter leerer und frostiger aus, als von Bächen und Flüssen, die man nur immer sich schlängeln und murmeln läßt; ohne ihren Lauf und ihre Eigenheiten weiter zu bezeichnen. Man betrachte die Genauigkeit folgender Beschreibung:
„Rings um den Bach, der durch den Sanghain rieselt,
dann vom Geklippe zürnend niederschäumt,
in leiser Wallung jetzt den Schilf durchschleicht,
dann schnell empor zum hohen Strome schwillt,
dann sanft verströmt in eine klare Fläche –
hier bilden Schaf’ und Rinder heitre Gruppen:
ein ländliches Gewirr!“
Eine Gruppe, würdig des Pinsels eines Jacob Bassano, und mit solchem Detail gezeichnet, daß er nach dieser Skizze hätte malen können.
– „da liegen manche
am Ufer, wiederkäuend; andre stehn
halb im Gewässer, beugen oft sich nieder,
und schlürfen von der wall’nden Oberfläche.“
Er fügt hinzu, daß der Ochs, in ihrer Mitte,
– „das lästige,
stets wiederkehrende Insektenvolk
mit schlankem Schweif sich von der Hüfte wedelt“,
ein Umstand, der, so viel ich weiß, selbst dem Naturmaler Theokrit entgangen ist. Nicht weniger, wie seine Neuheit und Natur, verdient jene Kunst unser Lob, womit er, durch die Wirkungen einer dargestellten Szene, unsre Seele nicht minder lebhaft zu rühren weiß, als ob wir selbst sie sähen oder hörten. Nachdem er das Gebrüll der wilden Tiere in den Wüsten Afrikas geschildert hatte, führt er einen Gefangenen auf, der, obgleich so eben der marokkischen Tyrannenklau entgangen,
„sich halb in seine Fesseln doch zurücke wünscht.“
Nachdem er eine Karawane beschrieben, die unter einem Sandwirbel begraben worden, redet er so:
„Vergebens staunt und harrt, voll Ungeduld,
der Kaufmann in Kairos schwülen Gassen,
und Mekka klagt umsonst des langen Zögerns.“
So bedient er sich in der Beschreibung des Elends, welches die Pest auf jenen Schiffen verbreitete, die Carthagena belagert hielten, eines höchst lebhaften, malerischen Zuges: der Admiral, sagt er, vernahm nicht nur das Gestöhn, das von Schiff zu Schiff hallte; sondern auch:
– „er hörte jedesmal,
in stiller Nacht, mit dumpfigem Geplätscher,
die Leichen fallen in die schwarze Flut.“
Diesen klassischen Stellen ließen sich noch so manche andere hinzufügen, z. E. die Liebe der Vögel, im Frühling, der Blick auf die heiße Zone, im Sommer, die Entstehung der Quellen und Bäche, im Herbst, ein Mann, der im Schnee umkommt, im Winter, ein Blick auf den Winter des Polarkreises, ebendaselbst.
Dieser Kunstrichter findet unter den Jahreszeiten den Winter am vorzüglichsten, und unser Lessing war derselben Meinung; daß indessen die Urteile hierüber sehr verschieden ausfallen müssen, ist großenteils in eben dem Umstande gegründet, und eben so natürlich, als warum unter den Jahreszeiten in der Natur die eine diesem, die andere jenem mehr gefällt. Übrigens scheinen die Materialien, die jede Jahreszeit an die Hand gibt, von unserm Thomson gleich meisterhaft bearbeitet. „Jede stellt eine Landschaft im großen dar, deren Charakter die Jahreszeit im allgemeinen ist“, und der Leser fühlt sich bei jeder eigentümlich gerührt: „Wir zittern bei seinem Donner im Sommer, wir frieren bei der Kälte seines Winters, wir werden erquickt, wenn sich die Natur bei ihm erneuert, und der Frühling allbegeisternd niederschwebt“: der beste Beweis, wie wahr und schön er jede besungen habe!
Im Jahr 1729 erschien sein Gedicht auf Newton, der soeben gestorben war, in welchem er mit der höchsten Begeisterung, und zugleich mit mathematischer Genauigkeit, die Verdienste und Entdeckungen dieses erhabenen Sterblichen beschreibt, daß der Graf Algarotti eine Zeile daraus zu seinem Text machte, um darüber in seinem Neutonianismo per le dame zu kommentieren.
Zwei Jahre darauf erschien sein erstes tragisches Werk: Sophonisbe, eine karthagische Geschichte, die durch Meißners Bearbeitung auch auf unsern deutschen Bühnen bekannt geworden ist. Thomson hatte sich, bei der ersten Vorstellung, mit all den ängstlichen, unruhigen Gefühlen eines debütierenden Schriftstellers, auf die oberste Galerie geschlichen, um unerkannt das Ganze zu beurteilen. Aber er war sich seiner zu wenig mächtig, um nicht, bald den Schauspielern ihre Rollen vorzusprechen, bald bei sich selbst zu murmeln, daß nun diese Szene, nun jener Umstand folgen müsse, wodurch er von einem Mann von Stande, der des Gedränges wegen auf die Gallerie geflüchtet war, als Verfasser erkannt wurde. So sehr übrigens das Stück gefiel, so sehr Wilk als Masinissa, und Mrs. Oldfield als Sophonisbe, Publikum und Dichter befriedigten, so mischte doch, für den letzteren, folgender Umstand einen sehr bitteren Tropfen in den schönen Genuß dieses Abends, wozu eine einzige Zeile in dem Stücke selbst die Veranlassung gab. Kaum ist nämlich folgender Stoßseufzer erschollen:
O Sophonisbe! Sophonisbe, o!
so replicirt eine Stimme aus dem Parterre:
O Jacob Thomson! Jacob Thomson, o!
eine Sottise, die, falls sie überhaupt gegründet ist, durch das lächerliche Pathos jener Stelle so ziemlich entschuldigt wird.
Vier Jahre darauf erschien sein, Agamemnon, dessen erste Vorstellung Pope, der seit lange nicht mehr das Schauspiel besucht hatte, mit seiner Gegenwart beehrte, und 1739 sein Eduard und Eleonore, dessen Aufführung aber verboten ward.
Seine poetischen Studien wurden jetzt, auf eine sehr angenehme, wohltätige Art, durch eine Reise unterbrochen, die er an der Seite des jungen, liebenswürdigen Talbot machte, mit dem er fast alle Höfe und Hauptstädte Europas besuchte. Wie sehr er, auf dieser Reise, den eindringenden, überschauenden, beurteilenden Beobachter in seiner Person vereinigt habe, mit welcher Ausbeute, mit welchen erweiterten Ansichten und Begriffen, nicht nur über sichtbare Natur und Werke der Kunst, sondern hauptsächlich über Lebensart und Sitten der Menschen, über Constitution und bürgerliche Verfassung verschiedener Staaten, ihre Verhältnisse, ihre religiösen Einrichtungen, usw. er zurück gekehrt sei, beweist sein Gedicht über die Freiheit, das in mehreren Gesängen, bald nach seiner Rückkunft, herauskam: ein Meisterwerk, das ihn zwei Jahre beschäftigte, und worauf er selbst, mehr noch des erhabenen Gegenstandes, als der Bearbeitung wegen, einen vorzüglichen Wert legte. Er beschreibt darin (wie der Graf Buchan in seinen Skizzen über Thomson sagt) eine Freiheit, die England gar nicht kennt, so wie er dadurch seinem Andenken einen eignen Lorbeer gewunden hat, daß er den Grundriß einer vollkommenen Regierung so richtig zeichnete, so wie Milton den eines vollkommenen Gartens: der eine, mitten unter gotischen Institutionen, feudalischen Ursprungs, und der andere, mitten unter geschnitztem Taxus und spritzenden Löwen.3
Thomson arbeitete eben an dem zweiten Teil seiner Freiheit, als sein edler Freund und Reisebegleiter starb: ein schmerzhafter Verlust, dem ein noch herberer folgte: der Tod des Lord Talbot selbst, der, außerdem, daß Thomson ihn als Nationalverlust beweinte, zugleich einen sehr ungünstigen Einfluß auf seine Glücksumstände haben mußte. Gleich nach vollendeter Reise hatte ihn der dankbare Kanzler zu seinem Privatsekretär gemacht; diese Funktion, die nur grade soviel Geschäftssinn erforderte, als der indolente Thomson davon besaß, hörte mit dem Tode dieses Gönners auf. Der Nachfolger Talbots ließ diesen Posten zwar eine Zeitlang unbesetzt: vermutlich in der Voraussetzung, daß Thomson ihn suchen würde; er aber war, teils zu sehr geschlagen, teils zu sorglos in Angelegenheiten dieser Art, als daß er auch nur Einen Schritt in dieser Sache getan hätte: eine Gleichgültigkeit, die selbst seine besten Freunde ihm verwiesen, und die sein folgendes Leben einer ziemlich prekären Abhängigkeit aussetzte, bis auf die zwei letzten Jahre desselben, in welchen er die Stelle eines Hauptkontrolleurs über die Lewards Inseln bekleidete, die er der großmütigen Verwendung Lytteltons verdankte. Doch vermochte jener Glückswechsel so wenig, sein Genie zu unterdrücken, als seine Laune auf lange Zeit zu verstimmen. Nach und nach kehrte seine vorige Heiterkeit zurück, und seine Art zu leben, die zwar immer einfach, aber doch genialisch und elegant gewesen war, blieb nach wie vor auf diesem Fuß. Seine Schriften wurden gut bezahlt; sein Agamemnon brachte ihm ein ansehnliches; Herr Miller kam seinen Wünschen mehr zuvor als entgegen; und dann hatte er stets einen oder mehrere Freunde, deren Herzen immer größer blieben als ihr Vermögen, und die auf jeden Fall zu seinen Diensten waren. In diesem langen Zeitraum war die gütige Protektion Friederichs, Prinzen von Wallis, seine Hauptstütze, der, auf Lytteltons Empfehlung, ihm ein ganz artiges Jahresgehalt aussetzte, und ihn nachher mit manchen Beweisen besonderer Gunst und Zutraulichkeit beehrte. Es war auf dessen Befehl, daß er, vereint mit Mr. Mallet, seine Maske des Alfred schrieb.
Im Jahr 1745 kam sein Trauerspiel, Tancred und Sigismunde heraus, dessen rührende Fabel aus dem Gil Blas entlehnt ist, und das, als sein vorzüglichstes Stück, noch immer gern gesehen wird. Garrik und Mrs. Cibber taten bei der ersten Vorstellung alles, um das Glück desselben auf immer zu sichern.
Um diese Zeit vollendete er seine Burg der Trägheit (Castle of Indolence), ein allegorisches Gedicht, in der Versart und dem Stil des Spencers.4 Es war anfangs wenig mehr, als Bruchstück einiger isolierten Stanzen, worin er sich über die, von seinen Freunden ihm vorgeworfene, Indolenz lustig machte, und mehrere von ihnen in seiner Burg eine, ihrem Humor angemessene, Rolle spielen läßt, in welcher sie, jenen Vorwurf betreffend, ebenso schuldig erscheinen, als er selbst. Aber er sah bald, daß dieser Gegenstand eine ernsthaftere Behandlung verdiene, und so eine der reichsten moralischen Lektionen darbiete. Diesen Gedanken führte er so sinnreich, so genialisch und mit so feiner poetischer Beurteilungskraft aus, daß Lessing es, in dieser Hinsicht, allen seinen übrigen Werken vorzog.
Dies war denn auch die letzte Arbeit, die er herausgab, denn sein Coriolan war noch nicht vollendet, als ein trauriger Zufall der Welt einen ihrer ersten Menschen und Dichter entzog.
Er war immer ängstlich zu Pferde gewesen, besonders auf Landstraßen, wo unaufhörlich ganze Scharen toller, ungeschickter Reiter hin und her kreuzen. Er pflegte daher, wenn das Wetter sich nicht zu einer Wasserfahrt eignete, den Weg zwischen London und Richmond zu Fuß zu machen, und sich unterwegs irgendeinem Bekannten anzuschließen, mit dem er plaudern, niedersitzen, oder auch eine Erfrischung teilen könnte. Da er einst, an einem Sommerabend, den Weg alleine ging, erhitzte er sich, von London nach Hammersmith hinaus, und nahm in diesem Zustande höchstunbedachtsamer Weise ein Boot, um nach Kew zu segeln. Die kalte Luft schien anfangs keine merklich nachteilige Wirkung auf ihn zu machen: er fühlte noch immer nichts, da er ausstieg, und mit starken Schritten seiner Wohnung, am andern Ende von Kew Lane, zueilte; aber hier überfiel ihn die Kälte so gewaltig, daß er sich den folgenden Tag im heftigsten Fieber befand, welches, bei seinem starken Körper nicht wenige Besorgnisse erregte, dennoch aber durch schleunige Mittel glücklich gehoben ward. Man hielt ihn nun außer aller Gefahr; aber ein schönes Wetter verführte ihn, sich dem Abendtau noch einmal auszusetzen; das Fieber kam mit einer Heftigkeit zurück, und von Symptomen begleitet, die keine Hoffnung übrig ließen. Zwei Tage vergingen, ehe dieser Rückfall in der Stadt bekannt ward. Nun eilten Mr. Mitchell und Mr. Reid, mit dem Doktor Armstrong , um Mitternacht nach Richmond hinaus; aber – ach! sie kamen nur, um den traurigsten Anblick in der Natur, die letzten Kämpfe ihres geliebten Freundes zu sehen. Dieser allgemein bejammerte Tod erfolgte den 17. August 1748.
Die Exekutoren seines Testaments waren Lord Lyttelton und Mr. Mitchell; diese beiden brachten das verwaiste Trauerspiel, Coriolan, auf die Bühne, dessen Einnahme, nebst dem, was der Verkauf seiner Manuskripte und anderer Effecten betrug, so ansehnlich ausfiel, daß nicht nur jede Schuldforderung damit beglichen, sondern noch ein beträchtlicher Überschuß an seine Schwestern geschickt werden konnte. Lytteltons Prolog zum Coriolan gilt für ein Meisterstück, das von Quin, dem Busenfreund Thomsons, mit einer Vollkommenheit und Wirkung gesprochen wurde, wie sie sich nur durch die innigste Verschmelzung von Kunst und Natur erreichen läßt. Wahre Tränen flossen dem Künstler über die Wangen, als er an die Stelle kam:
„Er liebte seine Freunde – o! verzeiht
die roll’nde Trän’ – ich fühl’ es, ach! ich bin
nicht Spieler mehr! er liebte seine Freunde
mit solcher Großmut, solcher Herzenswärme,
so fern von Kunst, sowie von Eigennutz,
so unerschüttert, daß die Sprache selbst
an ihm verarmt und nur die Träne spricht – “
Quin schien nie größerer Künstler, als in dem Augenblick,
da er von sich selbst gestand, er sei es nicht.
Thomsons heilige Überreste wurden in der Kirche zu Richmond beigesetzt, und mit einem schlichten, namenlosen Stein bedeckt. Fast alle großen Dichter schwiegen bei seinem Tode. Nur ein gewisser Collins, der eine Zeitlang zu Richmond gelebt hatte, es aber verließ, als Thomson starb, schrieb seinem Andenken eine sehr geschätzte Ode, die ich in einer Übersetzung beifüge.
Wenn der Verehrer der Thomsonschen Muse an seinem Begräbnisort sich umsonst nach einem Stein umsieht, der ihm auch nur sagte: Hier liegt Thomson! so wird er desto angenehmer überrascht, unter den Gräbern der Könige und großen Geister Englands in der Westminster Abbey sein Denkmal zu finden. Es steht in dem sogenannten Dichterwinkel, und stellt den Dichter dar, mit seinem Werk, über die Freiheit, in der Hand, worauf die Freiheitsmütze liegt; seine Rechte ruht auf einer Stumpfsäule, auf welchem in Basrelief die Jahreszeiten gearbeitet sind. Ein Genius zeigt dahin, und reicht ihm einen Lorbeerkranz; die tragische Maske mit einer Leier liegt zu seinen Füßen.
Vor wenigen Jahren wurde seinem Andenken in Schottland ein Fest gestiftet, das zu Ednam, an seinem Geburtstag, jährlich gefeiert werden soll; die erste Feier geschah 1790: Graf Buchan saß als Präses auf demselben Stuhl, worin der Dichter seine Burg der Trägheit geschrieben hatte. Auch wurde eine Subskription eröffnet, um ihm, auf einem benachbarten Hügel, Ednamhill, ein Denkmal zu errichten, das aber nicht zustande kam. Für das folgende Jahr ward ein Abguß von der Thomsonschen Büste in Westminster Abbey veranstaltet, die bei der Feierlichkeit gekrönt werden sollte. Aber er zerbrach unglücklicherweise, und Buchan begnügte sich, einen Lorbeerkranz auf ein Exemplar der Jahreszeiten, in Quart, von 1730, als die erste vollständige Ausgabe derselben, niederzulegen, wobei von William Thomson folgende Anrede an den Schatten Thomsons gehalten ward:
Heil dir! dem Dichter der Natur!
dem sie, vor allen, ihrer Werke Pracht,
in Harmonien, gleich den ihrigen,
zu singen lehrte: lieblich wie im Tal
die Drossel wirbelt, zart wie Philomelens
weichflötend Lied – Ihm lieh sie ihren Pinsel,
voll wunderbarer Macht, den Regenbogen
kühn nachzubilden, und den Blumenflor
in aller Farbenherrlichkeit, zu malen –
Und nun nachdem sie ihres Lieblings Stirn
mit Lorbeerreis umschlungen, sprach sie lächelnd:
„Dies holde Völkchen, das, so schön es glänzt,
in meinen Jahreszeiten stirbt,
soll leben in den deinigen!“ –
Wie in den folgenden Jahren Thomsons Andenken gefeiert worden, was für Umstände es ausgezeichnet haben, ob ein Denkmal zu Stande gekommen usw., darüber ist, meines Wissens, noch nichts in Deutschland bekannt geworden.
Ein höchst edles Denkmal würde das sein, was Buchan in seinen Skizzen angibt, wo von Thomsons Neigung für Einsamkeit und Natur die Rede ist: in welcher Rücksicht er einen bescheidenen Portico vorschlägt, an einer Hütte grenzend, die mit den besten Büchern über die Naturgeschichte versehen wäre, über welche immer einer von des Dichters armen Verwandten, mit einem jährlichen Gehalt, die Aufsicht haben müßte.
So viel zur Geschichte Thomsons, seiner poetischen Laufbahn und seines Lebensganges überhaupt, dem ich nur noch einiges über das Eigentümliche seiner Person und seines Charakters beifügen will.
Was das Äußere unseres Dichters betrifft, so gibt er selbst, irgendwo in seinen Werken, zu verstehen, daß es nicht sehr ansprechend gewesen sei. Die Schönheit und Grazie seiner ersten Jugend verlor sich nachher in der ungeschmeidigen Hülle seines männlichen Körpers. Den schlimmsten Eindruck machte er, wenn man ihn allein, und in nachdenkender Stellung sah; aber sobald ein Freund ihn anredete, und näher mit ihm sich einließ, so gingen mit einemmal jene finsteren Züge in die lieblichste Anmut über, und sein Auge blitzte von dem seelenvollsten Feuer. In gemischten, zahlreichen Gesellschaften spielte er nicht selten die unbedeutendste Rolle.5 Aber im erlesenen Freundeszirkel war er offen, heiter und unterhaltend; frei und treffend strömte dann sein Witz, war aber zahm genug, zu Zeiten inne zu halten, und andern Raum zu lassen für den Ihrigen. Seine Fühlbarkeit war so fein, und das Spiel seiner Organe mit den Empfindungen seiner Seele so harmonisch, daß seine Blicke, oft bis zur Hälfte des Ausdrucks, ankündigten, was er sagen wollte. Diese Reizbarkeit hatte die Inkonvenienz, daß sie ihn zu einem sehr schlechten Leser guter Gedichte machte. Ein Sonettchen, oder sonst einen nüchternen Vers, las er trefflich, und deklamierte ihn nicht selten zur Mittelmäßigkeit hinauf. Aber gewisse Stellen, aus Virgil, Milton, Shakespeare u. a., konnten ihn so überwältigen, daß man oft nur einzelne, halb artikulierte Töne hörte, die wie aus der Tiefe seines Busens sich hervordrängten.