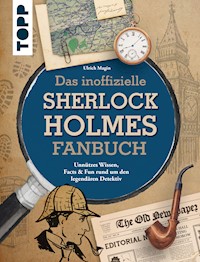8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Explosiv: Eine Vulkan-Katastrophe in der Eifel.
Im 2. Weltkrieg ist ein britischer Bomber in den Laacher See in der Eifel gestürzt. An Bord: Bomben mit einem Bakterium, das sich bei hohen Temperaturen vermehrt und absolut tödlich ist. Jeder Versuch, die Bomben zu bergen, ist bislang gescheitert. Nun droht der Vulkan unter dem See wieder aktiv zu werden. Joe Hutter, ein britischer Experte, arbeitet mit der Vulkanologin Franziska Jansen fieberhaft an der Lokalisierung der Bomben. Das Projekt läuft unter strengster Geheimhaltung, doch noch eine andere Macht ist an den Waffen interessiert ...
Ein Thriller über eine Katastrophe, die schnell zur Wirklichkeit werden könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Ulrich Magin
Die Lava
Thriller
Impressum
ISBN 978-3-8412-0714-2
Aufbau Digital, veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, Juli 2013
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die Originalausgabe erschien 2010 bei Aufbau Taschenbuch, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung Mediabureau Di Stefano, Berlin unter Verwendung eines Motivs von © Bradley Mason / iStockphoto.com und eines Motivs von © Patrizia Di Stefano
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH,
www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Erneut
für Susanne
und meine Eltern
in Liebe
Was ist aus der Leiche geworden,
die du letztes Jahr gepflanzt hast?
Blüht sie schon?
(Thomas Sterne Eliot: The Waste Land)
Inhaltsübersicht
Cover
Impressum
August 1942
Teil I
1
2
3
4
Teil II
1
2
3
4
5
Teil III
1
2
3
4
Morgen
Nachbearbeitung: Fakten und Fiktionen
Die Halifax
Die Suche nach dem Wrack
Der Vulkan
Gruinard Island
Danksagung
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne ...
August 1942
Die Wogen des Atlantiks rollten träge heran und brachen sich mit lautem Donnern an den schwarzen, mit Seetang überwucherten und mit kleinen Muscheln verkrusteten Klippen der Insel. Das Tosen der Brecher war noch auf dem Festland zu hören, es klang wie lauter Kanonendonner des Krieges. Seemöwen kreisten und schrien, und zwischen den Donnerschlägen hörte man das Blöken der achtzig Schafe.
Wind zog auf, eine starke Brise, und fegte den Morgennebel fort. Die Insel war nicht eben groß, man konnte sie in etwa einer Stunde bequem zu Fuß umrunden, sie hob sich auch kaum über die See. Ein paar wenige verkrüppelte, von den heftigen Böen gebeugte Bäume und Sträucher krallten sich in den Moorboden zwischen Gneis- und Granitfelsen, auf denen Flechten wucherten, graublau und feucht. Die Rinde der Bäume war noch ganz schwarz von der Nässe des Nebels. Gras bedeckte den Boden, und auf dem Gras weideten die Schafe.
Ein winziges Eiland, aber es lag dennoch ideal: weitab von größeren Städten, es gab nicht einmal ein Dorf in der Nähe, hier, so weit oben im Norden. Den Einheimischen galt es seit Jahrhunderten als verwunschen. Es sollte dort spuken, der einbeinige Seemann ging um und der große schwarze Hund mit den Augen, die glühten, als wären sie aus feurigen Kohlestücken. Einer wollte sogar den Todesengel gesehen haben, wie er in einer stürmischen Nacht seine Schwingen über die Insel breitete, aber das war ein Säufer gewesen.
Selten verirrte sich ein Fischer auf das Eiland, um eine Robbe zu schlagen oder Schutz vor einem plötzlichen Sturm zu suchen. Zwei Wochen zuvor war ein Hütehund, der Collie des alten Patrick Grant, zur Insel geschwommen und nicht wieder zurückgekehrt. Dann reisten zwei Leute an, Uniformierte, aus London, wie man hörte, und die Regierung hatte Grant entschädigt; die beiden redeten lange mit ihm, worüber, dazu schwieg er. Und dann waren die Warntafeln aufgestellt worden. Nun standen Schilder in regelmäßigen Abständen am Ufer, die das Betreten verboten. Ein Wachposten ging den immer gleichen Kreis entlang der Küste, um aufzupassen.
Gruinard Island lag inmitten der sanften gleichnamigen Bucht, ein schwarzer, mit grünen Tupfern bedeckter Fleck in der See. Am Festlandufer saßen ebenfalls Wachposten, die Maschinengewehre im Arm, und entlang der Küste wusste man, dass man sich besser nicht näherte oder nachfragte, was auf der Insel geschah. Es war wichtig, und das musste reichen. Wichtig war vieles jetzt im Krieg, und auch in Schottland fürchtete man deutsche Angriffe oder eine Invasion der Hunnen, und wenn der kleine Fleck Erde dazu beitrug, den wahnsinnigen Diktator von Schottland fernzuhalten, dann war das besser so.
Die Männer nahmen das Donnern der Brandung und das Rauschen der Wogen längst nicht mehr wahr, wie das Möwengekreische stellte es die gewohnte Kulisse dar. Aber ihre feinen Ohren bemerkten sofort, wenn ein Schaf nicht mehr blökte. Darauf achteten sie. In ihren schweren Schutzanzügen bewegten sie sich langsam und gebeugt wie vorsintflutliche Ungeheuer über das von der Sonne ausgedorrte Gras der Insel, das noch feucht vom Morgennebel war. Sie gingen vorbei an den Holzpflöcken, an denen die Reste der zerborstenen Metallhülsen baumelten. Mit einer großen Zange griff einer von ihnen nach einem Schafskadaver, hob ihn an und legte ihn vorsichtig zu den anderen auf den kleinen Holzkarren, den sein Hintermann zog. Ein dritter nahm ein Notizheft und trug fein säuberlich die Nummer des Schafs und den mutmaßlichen Todeszeitpunkt ein. Man konnte nicht immer anwesend sein, wenn es passierte, selbst wenn man wusste, dass es passierte. Manche tote Schafe fand man zufällig, weil sie sich zum Sterben hinter einen Felsen zurückgezogen hatten oder weil man nicht erkannt hatte, dass es bald soweit sein könnte. Es gab über achtzig Schafe.
Aber die sorgsamen Notizen waren wichtig. Jedes Schaf musste eingetragen werden, denn nicht alle erhielten dieselbe Dosis.
Es stank grässlich nach verbranntem Fleisch. Die drei Männer näherten sich schweigend dem Scheiterhaufen, der seit mehreren Tagen in einer Mulde neben der höchsten Erhebung der Insel brannte wie ein Signalfeuer für Seeleute, die den Kurs verloren haben. Sie kippten mit gemeinsamen Kräften den Karren um; ein eingeübter, oft erledigter Arbeitsgang. Die Ladung aus Tierkadavern ergoss sich in die Flammen. Eine Möwe ließ sich auf einem der toten Schafe nieder und begann, in eine frische, offene Wunde zu picken, stob aber auf und flog davon, als ihr das Feuer zu nahe kam. Sie gesellte sich zu den anderen ihrer Schar, die kreischend weite Kreise über dem Meer zogen.
Der erste Mann gab den anderen ein Signal, und alle drei drehten der Qualmsäule den Rücken zu.
Wenn das so weitergeht, wird es Zeit, dachte der Mann mit dem Notizblock, dass unsere Spezialanfertigungen endlich eintreffen. Wir brauchen bald die Verbrennungsöfen.
Die Männer gingen bedächtig bis zu der Seite der Insel, die dem Festland zugewandt war, und luden dort ein weiteres verendetes Tier auf den Karren. Es blickte sie seltsam gläsern an, es musste eben gerade gestorben sein. So viele waren es an einem einzigen Tag noch nie gewesen! Der eine Mann schüttelte verwundert den Kopf, zog seinen Block hervor, schrieb die Nummer ab, die mit blauer Farbe auf das Schaffell gemalt worden war, und trug das Sterbedatum und die Uhrzeit ein. Wieder wandten die Arbeiter sich der Säule aus Feuer und Rauch zu, die wie ein Wegweiser über ihnen stand. Die Räder des Karrens versanken in einem Schlammloch, doch zu dritt schafften sie es, das Fuhrwerk wieder flott zu machen und zum Inselberg zu ziehen, zum Scheiterhaufen.
Sie kippten das Schaf auf den brennenden Holzstapel. Es fing Feuer, sein Kopf trennte sich vom Körper und rollte den Haufen hinab. Einer der Männer trat ihn mit dem linken Fuß in die Flammen zurück.
Er spähte nach oben in den Himmel und meinte, heute könne trotz des Nieselregens doch noch ein schöner Tag werden, gut, um abends angeln zu gehen, da sah er, dass die beiden anderen entsetzt in die bleckenden Flammen starrten.
»What’s that?«
Der Mann im Schutzanzug prallte förmlich zurück vor dem, was er sah.
Etwas geschah, was ihre schon ungewöhnliche Arbeit noch ungewöhnlicher machte.
Das Schaf verfärbte sich, nicht schwarz, wie die anderen Schafe, nicht aschgrau, nein, es durchlief alle Regenbogenfarben; die Sehnen und Muskeln, das Fell und der Kopf schäumten auf und vernichteten sich in einem Augenblick selbst. Es sah so aus, als stülpe sich das tote Tier von innen nach außen, als explodiere es und als würde gleichzeitig das Äußere nach innen gezogen.
Derjenige der Männer, der zuvor alle Tode in sein Notizbuch eingetragen hatte, holte mühsam eine Kamera mit Farbfilm aus seinem Umhang, um die Szene zu dokumentieren. Die Kamera schnurrte wie eine Katze, die sich auf dem Kaminsims ausruht, und fing die Bilder ein, die sich vor ihr abspielten. Möwen lachten.
»Wir müssen hier weg!«
»Wir müssen Vollum verständigen!«
»Was geschieht hier?«
Was immer sich vor ihren Augen abspielte – es war kein Milzbrand.
Der Mann mit der Kamera eilte, so schnell er konnte, auf einen kleinen Schuppen zu, um zum Feldtelefon zu gelangen. Doch er kam dort nicht an.
Er röchelte, er stolperte, er fiel auf den Moorboden, mitten in eine Pfütze, zuckte noch, aber eher automatisch, nicht so, als sei noch Leben in ihm, dann sackte sein Schutzanzug in sich zusammen.
Als einer der wachhabenden Soldaten ihn wenig später fand, konnte er die flachen Überreste der beiden anderen sehen, auf dem Boden ausgestreckt, nicht weit von dem ersten Mann entfernt. Dann begann auch er zu husten, er krümmte sich, hielt sich den Bauch, stürzte zu Boden und schlug auf einem Gneisbrocken auf. Der war scharfkantig genug, um seinen Schutzanzug zu zerreißen, doch da war längst nichts mehr im Schutzanzug, was auf den Soldaten hingedeutet hätte, und auch der Schutzanzug zerfraß sich wie von selbst.
Am Horizont bauschten sich große, graue Wolkenberge auf, eine Wand aus triefend nasser Wolle, ein weiterer Ausläufer eines Atlantiktiefs, das seine Fluten auf die Insel entladen sollte. Die Möwen zogen aufs offene Meer, und weiter draußen sprang ein Delfin aus den Wogen, bis er ganz über dem Wasser war, drehte sich dann und glitt in die Meerestiefen zurück. Die Schafe spürten das aufziehende Unwetter und drängten sich dichter zusammen. Sie blökten ängstlich, als der erste Blitz durch den schwarzen Himmel fuhr.
Die Ablösung der Mannschaft kam, als der Regen aufhörte.
TEIL I
Die Erde wirft Blasen wie das Wasser.
(William Shakespeare: Macbeth)
1
Heute
Der Laacher See, ein stilles Gewässer am östlichen Rande der nördlichen Eifel, imponiert nicht durch seine Größe, wie etwa der Bodensee oder der Genfer See, er beeindruckt auch nicht durch grandiose, steil ins Wasser abfallende Klippen oder schroffe Berge wie der Gardasee oder der Comer See – dennoch weisen seine fast kreisrunde Form und die ihn sanft und grün umringenden Hügel eine ganz eigene Magie auf, und die malerisch an seinem Ufer gelegene mittelalterliche Benediktinerabtei zieht wie ein Magnet jeden Tag zahllose Ausflugstouristen an.
Vor rund eintausend Jahren wurde das Kloster gegründet, von Mönchen, die hier Abgeschiedenheit und Ruhe suchten. Einsamkeit und Stille herrschen noch heute, vor allem spät am Abend und früh am Morgen – kein Dorf säumt die Ufer, und am Rand des Sees führt nur ein Fußweg, keine Straße entlang.
Eigentlich der perfekte Ort, um gestresste Manager zu entspannen – und doch: Dieses stille Wasser trog tatsächlich, und in der Tiefe lauerte ein Ungeheuer, gefährlicher als eine Atombombe, unberechenbar wie ein Steppenbrand.
Genauer betrachtet: zwei Ungeheuer. Von beiden ahnten die Menschen nichts, die verträumt den Uferweg entlang spazierten, das romanische Gebäude besichtigten oder sich darüber aufregten, dass es von Amts wegen verboten wurde, auf dem See Tretboot zu fahren.
Gott würfelt nicht, hatte Albert Einstein einmal so treffend bemerkt. Aber er spielt gern mit Feuer: Der Erdboden, auf dem wir stehen, ist nur eine dünne Kruste, die zerbrechlich auf einem glutflüssigen Kern schwimmt. Und an manchen Stellen wallt das geschmolzene Gestein nach oben, mit verheerenden Folgen.
Einer dieser Orte war der Laacher See.
Seit zehn Jahrtausenden füllte Wasser den Trichter, den ein explodierter Berg hinterlassen hatte. Seit zehn Jahrtausenden sammelte sich Sediment im See.
Sand, den der Regen in den See schwemmte, Asche von Waldbränden, Blüten, Blätter und Zweige rieselten zu Boden. Wenn im Frühling das Eis schmolz, das im Winter die Oberfläche des Sees überzog, fiel ein Regen aus feinem Staub zum Seegrund herab. Mal verlor ein Mönch seinen Angelhaken, mal ein Besucher einen Knopf. Der See bewahrte alles auf.
Der Regen aus Staub, Sand, Ton und organischem Material bildete feine Schichten, die sich wie die Ringe eines Baumes eine nach der anderen auf dem Seegrund ablagerten. Anhand der Blütenpollen zeigten sie selbst die Jahreszeiten an, in denen sie entstanden waren. Den Boden des Sees stellte so eine im Verlauf von Jahrtausenden gewachsene unebene, graue und einförmige Fläche dar.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!