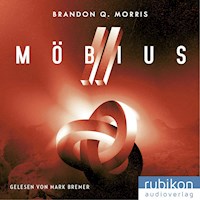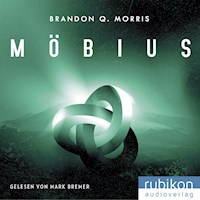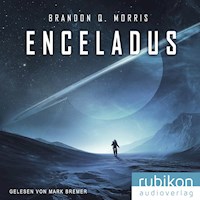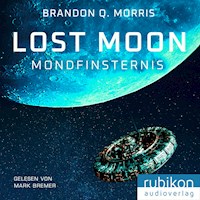14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
"Die letzte Kosmonautin" ist der neue Science-Fiction-Thriller von Brandon Q. Morris. Wir schreiben das Jahr 2029, und die DDR feiert ihren 80. Jahrestag. Die Kosmonautin Mandy Neumann befindet sich seit mehreren Wochen an Bord der Raumstation "Völkerfreundschaft". Eigentlich wartet sie auf ihre Ablösung, doch als die ersten unerklärlichen Unfälle passieren, beschleicht sie der Verdacht, dass jemand ihre Mission sabotiert. Kurz darauf bricht der Kontakt zur Bodenstation ab, und sie muss um ihr Leben kämpfen. Der einzige Mensch, der ihr dabei helfen kann, ist Tobias Wagner, ein Leutnant der Volkspolizei in Dresden. Er ist auf der Suche nach einem verschwundenen Physiker, der am Bau der Raumstation beteiligt war, und die Spur führt ihn in ein militärisches Sperrgebiet in der Lausitz. Schon bald gerät er in Konflikt mit seinen Vorgesetzten. Harte Science Fiction für Fans von Andy Weir, Andreas Brandhorst, Andreas Eschbach, Cixin Liu oder "The Man in the High Castle".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Brandon Q. Morris
Die letzte Kosmonautin
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
5. Oktober 2029Erdorbit
Sie verankert ihre Stiefel in den Fußrasten und legt den Kopf in den Nacken, damit ihr die Lüftung den Schweiß nicht mehr direkt in die Augen treibt. Schon beim Training hat sie es Heiner gesagt: Es war ein Konstruktionsfehler, den Ventilator im Helm oberhalb der Hutlinie anzubringen. Wehe, die Missionskontrolle macht ihr deshalb Ärger. Die haben gut reden! Sollen sie doch selbst weniger heiße Luft absondern, statt ihr vorschreiben zu wollen, wie sie Ressourcen zu sparen hat. Mandy atmet absichtlich mehrmals tief ein und aus, bis ihr schwummrig wird.
Pause. Sie lässt das Kabel mit den elektrischen Kerzen los. Eine leichte Bewegung geht durch die schlangenförmige Kette, die in der Schleuse der RS Völkerfreundschaft endet. Dadurch wirkt sie fast lebendig, wie ein überdimensionaler Zitteraal. Das Tier hatte ihre Zwillinge sehr beeindruckt. Sie sieht sich mit den beiden Mädchen an der Hand durch den Leipziger Zoo spazieren.
Noch zwei Wochen, dann kommt die Ablösung. Sie muss sich auf die Realität konzentrieren. Tief unter ihr versetzt gerade der Stiefel des italienischen Festlands der Insel Sizilien einen Tritt. Ihre Stirnhaut spannt sich. Mandy würde sich gern kratzen. Sie versucht, den Kopf so weit nach unten zu drücken, dass der Flüssigkeitsspender die Stirn erreicht, damit sie sich daran reiben kann. Aber dafür ist der Helm nicht groß genug.
»Geht es dir gut?«
Das ist Bummi, der Roboter, ihr einziger Begleiter. Der Name, der von dem Bärenmaskottchen der Kinderzeitschrift stammt, passt überhaupt nicht zu ihm. Bummi sieht aus wie eine vierbeinige Spinne, weil sein Körper im Vergleich zu seinen fast zwei Meter langen Gliedern klein ist. Aus den Augenwinkeln sieht Mandy, wie er zu ihr gekrochen kommt. Er benutzt abwechselnd seine Arme und Beine, um sich über die Außenhaut der Völkerfreundschaft zu bewegen.
»Ja, ich lege nur eine kleine Pause ein«, sagt Mandy.
»Du solltest die Außenbordaktivität so kurz wie möglich halten.«
»Ich weiß, Bummi, ich soll Sauerstoff sparen.«
»Genau, aber mir geht es auch um dich. Jede Minute hier draußen vergrößert dein Unfallrisiko.«
»Ich weiß, du willst nur mein Bestes.«
Bummi antwortet nicht. Er antwortet nie auf Sätze, die nur das Offensichtliche feststellen. Manchmal traut ihm Mandy zu, dass er sich insgeheim für viel schlauer hält und von oben auf sie herabsieht, aber äußern würde sich der Roboter so nie. Sie löst den Blick von der Erdkugel, die ihr inzwischen den Atlantik zeigt. Als sie ihren Rumpf nach vorn beugt, um die Sicherungsleine an einer anderen Querstrebe einzuhaken, wird ihr kurz übel. Sie hat ihrem Körper zu lange das Gefühl gegeben, mit dem Kopf nach unten zu hängen, obwohl Raumrichtungen in der Mikrogravitation keine Rolle spielen.
»Du musst um den Bug herum«, sagt Bummi. »Oder soll ich das lieber übernehmen?«
»Nein danke, das schaffe ich schon.«
Mandy stößt sich ab und arbeitet sich in Richtung Bug voran, wo die Raumstation sich deutlich verjüngt. Daran merkt man am deutlichsten, dass sie aus einer ehemaligen Raketenoberstufe gebaut wurde. Das hatte sich als kostengünstigster Weg erwiesen, die im Rahmen des vierzehnten Fünfjahrplans zu errichtende erste Raumstation der DDR in den Erdorbit zu bekommen. Die Einweihung ist nun fünfzehn Jahre her. Damals hatte Mandy gerade die Kinder- und Jugendsportschule abgeschlossen. Die Offiziersausbildung bei den Luftstreitkräften war ihr als einziger Weg erschienen, selbst einmal als Kosmonautin ins All fliegen zu können.
Hätte ihr damals jemand erzählt, sie würde heute als schwebender Elektriker eine Festbeleuchtung installieren, hätte sie nur laut gelacht oder diesen unverschämten Menschen als Republikfeind gemeldet.
»Vorsicht bei der Antenne«, sagt Bummi.
Mandy hakt die Sicherung ein, dreht sich um – und erschrickt. Der Roboter ist direkt hinter ihr. Er hat den linken Arm erhoben und hält seine Klaue über sie, als wolle er gleich zuschlagen.
»Was tust du da?«, fragt sie.
»Ich sichere dich. Dein Herzschlag hat sich beschleunigt, so dass ich von zunehmender Erschöpfung ausgehen muss.«
»Das ist nicht nötig. Es geht mir sehr gut.«
»Ich glaube, ich weiß besser …«
»Ich befehle dir, diese unnötige Verschwendung von Ressourcen einzustellen.«
Der Roboter nimmt seinen Arm herunter.
»Was soll das?«, fragt Mandy. »Deine ganze Anwesenheit hier draußen ist überflüssig.«
»Jawohl.«
Bummi dreht sich um. Sein eiförmiger Körper schwingt durch, während er neben ihr her über die Außenhaut kriecht. Mandy bekommt eine Gänsehaut. Sie hat Spinnen noch nie gemocht. Sie traut dem Roboter nicht. Er hat zu oft seinen eigenen Kopf. Angeblich verfügt er über ein gewisses Maß an autonomer Intelligenz, etwa auf dem Niveau eines Schimpansen. Aber er erscheint ihr oft deutlich klüger. Bummi erinnert sie ein bisschen an den Stasihauptmann in ihrer Ausbildungseinheit. So wie der Zugriff auf alle Personalakten hatte, kontrolliert der Roboter sämtliche Systemdaten, darunter auch die Sensoren in ihrem Raumanzug.
Am Bug der Raumstation befindet sich eine große, drehbar gelagerte Antenne. Mandy verlegt die Kette mit den Leuchtkerzen in ausreichendem Abstand zu ihr, denn sie ist ihre einzige Verbindung zur Erde. In ein paar Stunden müsste sie wieder in Reichweite der Kontrollstation auf dem Brocken kommen. Dann kann sie endlich länger mit Susanne und Sabine sprechen. Drei Monate ohne ihre Süßen sind doch eine verdammt lange Zeit.
Mandy setzt ihren Weg um die Station fort. Wie eine seltsame Schnecke hinterlässt sie dabei eine Spur aus einem dunkelgrünen Kabel, an dem etwa alle hundert Zentimeter eine kerzenförmige elektrische Lampe hängt. Dass sie die Kabeltrommel über den Rücken geschnallt hat, trägt sicher zu diesem Eindruck bei. Tatsächlich kommt sie nur im Schneckentempo voran. Jeder Schritt in der Schwerelosigkeit stellt eine Herausforderung dar. Es gibt nur totales Schwarz und blendende Helligkeit, und wenn sie einen einzigen Schritt ohne Sicherungsleine wagte, würde sie damit ihr Leben riskieren.
Aber vermutlich kann sie das gar nicht. Sie musste die Abläufe im Wasserbecken des Sternenstädtchens so oft trainieren, dass sie ohne bewusstes Überlegen ablaufen. Zu gehen heißt, sich zu bücken und sich wieder aufzurichten, ohne darüber nachzudenken. Mandy lacht. Das könnte das Motto für ihr ganzes Leben in ihrem Heimatland sein.
Sie wischt den Gedanken beiseite. Er ist nicht hilfreich. Bummi streckt ihr einen Arm entgegen. Sie greift nach der Klaue, dem Universalwerkzeug am Ende des Arms, das sich auch prima als Waffe eignen würde. Sie muss aufpassen, dass sie mit dem Handschuh nicht die scharfe Schneide erwischt.
»Keine Sorge«, hört sie den Roboter im Helmfunk. »Ich habe den kleinen Finger über die Schneide gelegt. Dir kann nichts passieren. Vertrau mir.«
Kann man einer Maschine vertrauen? Unbedingt, und sie hat Übung darin. Mandy musste ihr ganzes Leben lang Maschinen vertrauen. Erst dem Motorrad, das sie sich als ehemalige Turnerin von den Prämien für ihre Siege bei DDR- und Europameisterschaften geleistet hat. Dann dem Trainingsflugzeug aus tschechischer Produktion, später kurz dem russischen und denn dem saudi-arabischen Kampfjet, den die NVA angeschafft hat, und schließlich der von DDR-Ingenieuren entwickelten dreistufigen Rakete, die sie vom Weltraumbahnhof Peenemünde in den Erdorbit und schließlich zur Raumstation Völkerfreundschaft gebracht hatte.
Also greift sie herzhaft zu. Bummis Klaue schließt sich um ihre Hand.
»Ich habe dich«, sagt der Roboter. »Du kannst die Sicherungsleine jetzt ausklinken.«
Sie öffnet erst den Karabiner der einen, dann den der anderen Leine. Die beiden Seile tanzen um sie herum. Der Schwung, den sie dem Karabiner an ihrem Ende verliehen hat, bewegt sich als stehende Welle auf der Dederonschnur hin und her. Dann fliegt sie. Bummis langer Arm beschreibt einen großen Bogen. Sie entfernt sich einen, dann zwei Meter vom Schiff.
Mandy jauchzt. So hat es sich angefühlt, wenn ihr Vater sie in die Luft geworfen hat, als sie klein war. Ließe Bummi jetzt los, würde sie die Raumstation nie wieder erreichen. Ganz kurz gelingt es ihr, die Station komplett in ihr Blickfeld zu bekommen. Bummi muss mit einem anderen seiner Glieder das Kabel der Festbeleuchtung angeschlossen haben, denn die Völkerfreundschaft blinkt nun mit allen achtzig Kerzen wie ein Weihnachtsbaum. Eine Träne wird vom Impuls der Bewegung durch den Helm geschleudert. Es ist wunderschön.
Von der Erde aus wird diese Festbeleuchtung natürlich nicht zu sehen sein. Ihre Aufgabe ist es, morgen eine fliegende Kamera abzuschießen, die die Völkerfreundschaft mehrmals aus allen Richtungen filmen wird. Die Bilder sollen dann bei der zentralen Festveranstaltung in Berlin auf riesigen Projektionsschirmen gezeigt werden. Mandy Neumann, Heldin der DDR. Die Mädchen werden sich daran gewöhnen müssen, dass ihre Mutter berühmt ist. Hoffentlich müssen sie nicht darunter leiden.
»Ich setze dich jetzt in der Schleuse ab«, sagt der Roboter.
»Könntest du vorher etwas für mich tun?«
»Natürlich. Ich warte auf deine Befehle.«
»Schwenk mich noch einmal, wie du es gerade getan hast. Ich möchte die Wirkung der achtzig Kerzen prüfen.«
»Ich messe ihren Stromverbrauch und kann dir versichern, dass keine ausgefallen ist.«
»Es geht um die Wirkung. Das ist etwas Persönliches, das Maschinen nicht zugänglich ist.«
»Natürlich, Mandy. Ich schwenke dich noch einmal in drei – zwei – eins – jetzt.«
6. Oktober 2029Dresden
»Nicht im Angebot«, meldet der Automat.
Tobias nimmt die Bierflasche heraus und legt sie dann wieder in die dunkle schwarze Öffnung. Es wird hell in der Röhre, und die Flasche dreht sich.
»Nicht im Angebot«, erscheint erneut auf dem Anzeigefeld.
Er zieht die Flasche heraus. Diesmal schiebt er sie mit der Öffnung voraus in den Automaten. Übelkeit überkommt ihn. Es kommt ihm vor, als würde er seine Pfandflaschen einem Metallorganismus in den Darm schieben.
Erneut wird die Öffnung hell. Die Bierflasche rotiert, dann saugt sie der Automat in sich hinein.
»Pfandbetrag 48 Pfennig. Bon drucken oder für antiimperialistische Solidarität spenden?«
Tobias dreht sich um, aber hinter ihm ist niemand. Hätte er Zuschauer, müsste er Vorbild sein. Also tippt er »Bon drucken« an, und kurze Zeit später erscheint sein Wertbon in dem schmalen Schlitz unter dem Bildschirm. Er steckt den nun leeren Dederonbeutel in die Jackentasche und will das Portemonnaie herausholen, um den Bon darin zu verstauen, da rempelt ihn jemand an.
»Was soll …?«
Ein junger Mann mit langen Haaren sprintet an ihm vorbei. Er prallt gegen die gläserne Außentür der Kaufhalle, die sich nicht schnell genug geöffnet hat. Tobias überlegt noch, was das zu bedeuten hat. Er ist nicht im Dienst, also kann er sich mit dem Nachdenken Zeit lassen. Doch die Bäckereiverkäuferin sieht das nicht so.
»Herr Wagner, Herr Wagner!«, schreit sie. »Ein Dieb!«
Ihr Gesicht ist verzerrt vor Wut, sie ist vollkommen außer sich. Tobias entscheidet sich. Er ist der lange Arm des Gesetzes, auch am Wochenende. Den Typen kauft er sich.
»Bleib stehen, Bürschchen!«, ruft er und stürzt ihm hinterher.
Nach drei Schritten fällt ihm ein, dass sein Bon noch im Automaten steckt. Hoffentlich nimmt ihn niemand an sich. Für achtundvierzig Pfennig kann er immerhin neun halbe Semmeln kaufen!
Der Halbstarke ist schnell. Er fegt schon über den Platz vor der Kaufhalle, während Tobias noch im Schatten ihres dreieckigen Vorbaus ist. Er gibt alles, und schon ist das Seitenstechen da, genau wie damals in der Schule beim Dreitausendmeterlauf. Tobias ignoriert es. Der Jugendliche hat sich etwas angeeignet, das ihm nicht gehört, und er muss lernen, dass das Konsequenzen hat. Schneller, schneller. Er kürzt den Weg über den trockengelegten Springbrunnen ab.
»Beiseite! Aus dem Weg!«, ruft er, als ihm drei Mütter nebeneinander entgegenkommen und mit ihren Kinderwagen den Fußweg blockieren. Der Dieb rennt eindeutig in Richtung Straßenbahnhaltestelle. Ein lautes Quietschen von links zeigt, dass die 12 schon unterwegs ist. Das Bürschchen hat genug Vorsprung, um in aller Seelenruhe an der Haltestelle zusteigen und ihm eine Nase drehen zu können. Aber nicht mit ihm! Sein Herz pocht, doch Tobias wird nicht langsamer. Er muss die Haltestelle vor der Straßenbahn erreichen. Aber er kann nicht schneller als die Bahn rennen. Also wechselt er die Richtung und läuft dem Zug der Linie 12 entgegen. Ächzend erreicht er die neben der Straße verlaufenden Gleise. Eine Warnglocke klingelt, Bremsen quietschen auf stählernen Rädern. Der Straßenbahnfahrer verflucht bestimmt gerade den Verrückten, der vor seinem Zug auf die Schienen gesprungen ist.
So erreicht Tobias die erhöhte Plattform der Haltestelle doch noch vor der Straßenbahn. Der Dieb geht langsam rückwärts. Jetzt sitzt er in der Falle. Von einer Seite naht sein Häscher, an der anderen Seite schützt ein mannshoher Zaun die Straße davor, dass plötzlich Fahrgäste vor Autos treten.
»Hab ich dich!«, sagt Tobias.
Er packt den jungen Mann am Arm und reißt ihn herum.
»Ich nehme Sie hiermit in Gewahrsam.«
Er drückt den Mann, der die Sinnlosigkeit seiner Flucht eingesehen zu haben scheint und sich nicht mehr wehrt, mit einer Hand gegen den Zaun. Ein lautes Keuchen übertönt das Klingeln der Straßenbahn. Es ist Tobias’ Keuchen, aber der Dieb zittert auch, das ist jetzt deutlich zu spüren. Mit der anderen Hand zieht er den Dederonbeutel aus der Hosentasche, dreht ihn zum Strick und bindet seinem Gefangenen damit die Handgelenke zusammen. Die Handgriffe des Beutels eignen sich wunderbar dazu, den jungen Mann hinter sich herzuziehen.
Die Menschen, an denen er mit dem Dieb im Schlepptau vorbeikommt, sehen ihn entweder mürrisch an oder schauen bewusst an ihm vorbei. Hat da gerade jemand ausgespuckt? Er trägt keine Uniform, also halten sie ihn wohl für jemanden von der Firma, einen Angehörigen des Ministeriums für Staatssicherheit. Aber niemand fragt ihn nach einem Ausweis. Nicht einmal der Bursche selbst will wissen, wer ihn da geschnappt hat. Hoffentlich hat er jetzt schon ein schlechtes Gewissen.
Noch schöner wäre es, sie würden vielleicht Verwandten oder Lehrern begegnen, die ihn kennen. Die Peinlichkeit, gefesselt einem Staatsvertreter hinterherlaufen zu müssen, wirkt als Lektion oft stärker als irgendeine Strafe, die in diesem Fall sowieso zur Bewährung ausgesetzt wird. Tobias Wagner ist seit mehr als zwanzig Jahren beim Ministerium des Inneren, und er kennt seine Schäfchen mittlerweile recht gut. Deshalb lässt er sich besonders viel Zeit.
»Wie heißt du?«, fragt er den Dieb.
»Mario.«
»Und weiter?«
»Schuster.«
»Wohnhaft?«, fragt Tobias.
»In der 12 da vorn.«
Wie praktisch – das Haus beherbergt auch seine Dienststelle.
»Arbeitsstelle?«
»Ich bin …« Der Mann druckst herum. »Bin grad bei der Fahne.«
»Oh, Mann, wie bekloppt kann man denn sein!«
Da hat dieser Mario doch tatsächlich um das Wochenende des Republikgeburtstags herum Urlaub bekommen, und dann versaut er es so. Tobias braucht bloß den Kommandantendienst anzurufen, und schwupp, sitzt Schuster in seiner Kaserne im Arrest.
»Ich wollte für meine Verlobte Semmeln holen, und dann hatte ich das Portemonnaie vergessen. Sie wartet doch mit dem Frühstück auf mich.«
Der weinerliche Ton und der gesenkte Kopf des Jungen sprechen dafür, dass er die Wahrheit sagt. Aber vielleicht hat er es auch faustdick hinter den Ohren.
Als sie an der Kaufhalle vorbeikommen, wartet die Bäckereiverkäuferin schon im Eingang. An ihrer Theke hat sich eine Schlange gebildet, während die breite Automatiktür immer wieder versucht, sich zu schließen.
»Ich wusste doch, dass Sie ihn schnappen, Herr Wagner.«
»Genosse Abschnittsbevollmächtigter«, korrigiert er sie. »Auch wenn ich keine Uniform trage, bin ich doch immer im Dienst.«
Er kauft hier jeden Tag seine Semmeln, exakt zwei Stück. An den Namen der Verkäuferin erinnert er sich trotzdem nicht. Er versucht, ihn auf dem Schildchen zu lesen, das sie an der blauen Schürze trägt, erkennt aber nur ein »M« am Anfang und ein »er« am Ende.
»Danke, Frau Meier«, sagt er.
»Frau Müller.«
»Oh, natürlich.«
»Und, wo hat der Verbrecher seine Beute gelassen?«, fragt Frau Müller.
»Ich würde vorschlagen, Sie überlassen die Befragung des Verdächtigen mir, Frau Müller, und Sie kümmern sich wieder um Ihre Kundschaft.«
»Natürlich, Herr, ähm, Genosse Abschnittsbevollmächtigter.«
Vor dem Haupteingang des siebzehngeschossigen Wohnhauses mit der Nummer zwölf bleibt der Dieb stehen. Tobias’ Dienststelle befindet sich im Erdgeschoss, hat aber einen separaten Eingang.
»Was ist?«, fragt Tobias. »Willst du noch mehr Schwierigkeiten machen?«
»Nein, das will ich nicht. Da oben wartet meine Verlobte auf mich. Sie hat noch geschlafen, als ich losgegangen bin. Jetzt macht sie sich bestimmt Sorgen.«
»Und daran bin ich schuld, oder was?«
»Nein, ich hätte nicht …«
»Jetzt komm weiter, Mario. Das klären wir alles in der Dienststelle.«
Er zerrt den Mann weiter hinter sich her. Der schmale Weg neben dem Hochhaus ist von Abfall übersät. Manche Hausbewohner werfen ihren Müll einfach vom Balkon. Er muss den Hausmeister anrufen. Hier muss vor dem Republikgeburtstag unbedingt noch gekehrt werden.
»Da sind wir«, sagt Tobias und drückt mit Schwung die Eingangstür auf.
Gegenüber des Eingangs steht ein Schreibtisch. Dahinter sitzt ein Uniformierter, der jetzt aufspringt. Dabei stürzt das Kartenhaus ein, an dem er gerade gearbeitet hat.
»Oberwachtmeister Schulte, Sie sind ja immer noch hier!«, sagt Tobias drohend.
Er sieht auf die Uhr, die unter dem Porträt des Partei- und Staatsratsvorsitzenden Krenz hängt. Es ist viertel neun. Schulte müsste längst auf seinem ersten Rundgang im Revier sein. Stattdessen baut er hier Kartenhäuser!
»Ich … ich dachte …«
»Denken Sie nicht, erfüllen Sie Ihre Pflicht, wie es Partei und Volk von Ihnen verlangen.«
Schulte hat vermutlich gehofft, heute eine ruhige Kugel schieben zu können, aber daraus wird nichts.
»Natürlich, Genosse Leutnant«, sagt der Hauptwachtmeister und schiebt die Ruinen seines Hausbaus zusammen.
»Lassen Sie das, raus mit Ihnen an die frische Luft!«
»Jawohl.«
Schulte kommt mit offener Jacke um den Tisch herum und greift nach der Türklinke.
»Mann, Ihre Uniform!«
Schulte zuckt zusammen. Hektisch versuchen seine Finger, die Knöpfe der grünen Uniformjacke in die Knopflöcher zu pfriemeln. Sie rutschen aber immer wieder ab.
»Machen Sie das draußen und vergessen Sie Ihre Mütze nicht!«
»Danke, Genosse Leutnant.«
Schulte greift nach seiner Schirmmütze und verlässt fluchtartig die Dienststelle.
»So, und was machen wir jetzt mit dir, mein Junge?«, fragt Tobias.
Er nimmt Mario Schuster die Fesseln ab. Zum Glück knittert so ein Dederonbeutel nicht. Er faltet ihn sorgfältig und steckt ihn dann in die Gesäßtasche seiner Jeanshose. Dann läuft er um den Schreibtisch herum und setzt sich auf seinen Stuhl. Die Sitzfläche ist noch ganz warm, das ist ihm unangenehm. Hätte Schulte sich nicht einen eigenen Stuhl mitbringen können? Aber er darf sich nicht beschweren. Heute wäre er ja eigentlich zu Hause. Normalerweise würde er jetzt die beiden Semmeln mit Butter beschmieren und mit Wurst belegen und sich dann auf seinen Balkon im zehnten Stock des Nachbarhauses setzen und gemütlich über das spätsommerliche Dresden blicken.
Daraus wird nun nichts. Semmeln hat er nicht gekauft, und inzwischen wird es keine mehr geben. Er hat sogar seinen Bon eingebüßt. Alles wegen dieses Bürschchens, das zu faul war, sein vergessenes Portemonnaie zu holen.
»Warum hast du nicht gefragt, ob du später zahlen kannst?«
»Habe ich doch, aber die Verkäuferin wollte mir die Tüte wieder abnehmen.«
Schuster sieht ihn an wie ein kleiner Junge, der bei einem Streich erwischt wurde. Das war aber kein Streich!
»Und dann hast du dich einfach losgerissen und bist abgehauen?«
»Ja, das war ein Impuls, es ist einfach so passiert.«
Schuster scharrt mit dem linken Fuß.
»Genosse ABV.«
»Was?«
»Es heißt, ›Wie bitte?‹, und es heißt, ›Es ist einfach so passiert, Genosse ABV‹.«
»Schuldigung. Es ist einfach so passiert, Genosse ABV.«
Tobias seufzt. Der junge Mann verdreht die Schultern. Wahrscheinlich knetet er seine Hände. So eine Dederonfessel drückt ordentlich das Blut ab. Das geschieht ihm ganz recht. Was soll Tobias nur mit ihm machen?
»Und deine Beute?«, fragt er.
»Weggeworfen, Genosse ABV.«
Auch das noch. Dann ist der Schaden nicht mehr gutzumachen. Tobias ist drauf und dran gewesen, dem jungen Mann den fehlenden Betrag auszulegen.
»Das ist schlecht«, sagt er.
Er steht auf und läuft ein paar Schritte hin und her. Der Mann ist Soldat der Nationalen Volksarmee. Also geht er Tobias eigentlich gar nichts an. Er nimmt sein Handtelefon aus der Hosentasche und scrollt die Kontaktliste nach unten. Da ist sie, die Nummer des Kommandantendienstes. Er braucht dort nur anzurufen, und eine halbe Stunde später ist er das Problem los.
Aber die Verlobte tut ihm leid. Sie kann nichts dafür. Er stellt sich vor, wie sie aufwacht, erst im Bett nach ihrem Mario tastet, dann nach ihm ruft.
»Hast du Kinder?«, fragt er.
»Noch nicht. Wir wollten gerade anfangen. Haben uns die Wohnung mit dem Ehekredit schön eingerichtet, und jetzt wollen wir den Kredit abkindern.«
»Ich fürchte, daraus wird erst einmal nichts«, sagt Tobias. »Die Streife wird dich zurück in die Kaserne bringen.«
»Bitte nicht, Genosse ABV. Da muss es doch auch einen anderen Weg geben?«
Schuster geht in die Hocke und fleht ihn an. Aber Tobias kann doch gar nichts für ihn tun!
»Ich kehre auch den gesamten Weg um das Haus und auch um das Nachbarhaus.«
Der junge Mann muss bemerkt haben, wie sehr ihm der Müll auf dem Weg missfallen hat. Sehr aufmerksam. Tobias schüttelt den Kopf.
»Jeden Tag!«, fügt Schuster hinzu.
Aber auch der Klassenfeind ist aufmerksam. Wenn er seine Pflicht nicht erfüllt und den Mann laufenlässt, wird sich das herumsprechen. Irgendwer quatscht immer, und wenn es die Bäckereiverkäuferin ist, Frau Meier. Er steht kurz vor der Beförderung zum Oberleutnant. Da darf er sich nicht so einen Patzer leisten.
»Es tut mir leid, Schuster. Aber um den Kommandantendienst führt kein Weg herum. Sie sind kein Zivilist. Sie vertreten die bewaffneten Organe unseres Arbeiter- und Bauernstaates. Da tragen Sie eine ganz besondere Verantwortung. Wie schon unser Genosse Egon Krenz sagt …«
»Scheiß auf den Polit-Uropa.«
»Wie bitte?«
Wenn das jemand gehört hat! Tobias sieht sich um. Ob seine Dienststelle überwacht wird? Er hofft es nicht. Er hat sich noch nie etwas zuschulden kommen lassen.
»Schei…«
»Nein, wiederholen Sie es nicht, Schuster. Es ist besser für Sie. Ich werde jetzt den Kommandantendienst anrufen.«
»Bitte nicht, Herr Wagner.«
»Genosse ABV! Wie oft soll ich es Ihnen noch sagen! Ich habe gar keine andere Wahl.«
»Aber dann werde ich Martina in den nächsten drei Monaten nicht wiedersehen! Und sie weiß nicht einmal, was mit mir los ist!«
»Das hättest du dir eher überlegen müssen.«
Der Junge fängt an zu weinen. Auch das noch! Er kann doch niemanden weinen sehen. Tobias dreht sich zur Seite.
»Jetzt hör auf zu heulen. Wie heißt sie denn genau, deine Verlobte? Ich werde ihr sagen, wo du bist.«
»Martina Frommann, mit zwei ›m‹.«
Schuster beißt sich auf die Unterlippe. Sie blutet schon. Tobias ärgert sich. Wäre er doch bloß nicht so ehrgeizig gewesen. Er hätte ihn nur entkommen lassen müssen. Niemand hätte ihm einen Vorwurf gemacht, wenn ein Achtzehnjähriger einem über Vierzigjährigen davonrennt. Jetzt hat er auch noch diese Verlobte am Hals.
Eine halbe Stunde später hält die Streife vor seiner Dienststelle. Tobias begleitet seinen Fang nach draußen und übergibt ihn zwei Soldaten und einem Unteroffizier mit weißem Koppelzeug. Sie verabschieden sich mit militärischem Gruß und fahren in ihrem Trabant-901-Pick-up davon.
Hauptwachtmeister Schulte ist noch nicht wieder zurück. Tobias schließt die Dienststelle ab und läuft zum Haupteingang des Hochhauses. Schulte hat hoffentlich seinen Schlüssel mitgenommen. Er ist immer noch in Zivil. Soll er schnell in die Uniform schlüpfen? Aber die Frau muss ihn kennen, selbst wenn er sich nicht an ihren Namen erinnern kann. Er führt auch das Hausbuch dieses Gebäudes und des benachbarten. Jeder Neubewohner muss sich bei ihm vorstellen, und natürlich jeder Besuch.
Tobias findet den Namen an einem der Klingelschilder, etwa in der Mitte. Frommann, Martina wohnt im sechsten Stockwerk. Er hat Glück. Einer der beiden Fahrstühle wartet leer im Erdgeschoss. Tobias steigt ein und drückt den Knopf mit der 6. Die Zahl ist kaum noch zu erkennen. Klappernd und quietschend bewegt sich der Aufzug nach oben. Im sechsten Stock steigt er aus. Vor ihm liegt ein langer Gang, von dem Türen nach links und nach rechts abgehen. Es riecht nach Putzmittel, nach Urin und nach verbranntem Essen.
Vor jeder Tür bleibt Tobias kurz stehen, um den Namen zu lesen. Kurz vor Ende, wo sich der Gang etwas weitet, findet er sein Ziel. Er klingelt.
»Komme!«, ruft eine weibliche Stimme von innen. »Hast du etwa schon Semmeln geholt?«
Die Tür öffnet sich. Vor ihm steht eine junge Frau mit strubbelig-nassen blonden Haaren, die sich in ein Handtuch gewickelt hat. Erschrocken tritt sie ein paar Schritte zurück, vergisst aber, die Tür zu schließen. Vielleicht hat sie auch gemerkt, dass Tobias einen Fuß hineingestellt hat. Das ist ein Reflex. Vor allem wenn er in Uniform klingelt, schlagen ihm die Menschen oft im ersten Moment die Tür vor der Nase zu. Er nimmt das nicht persönlich. Vermutlich würde er es selbst nicht anders machen. Auch er fühlt sich bei jeder Kontrolle vom Reichsbahnschaffner erwischt, obwohl er eine Fahrkarte auf dem Handtelefon hat.
»Guten Morgen, Frau Frommann«, sagt er. »Ich bin Tobias Wagner, Ihr Abschnittsbevollmächtigter. Sie müssten mich kennen.«
Die Frau tritt wieder einen Schritt nach vorn.
»Das stimmt, ich erkenne Sie«, sagt sie. »Entschuldigen Sie meine Reaktion, aber ich warte eigentlich auf meinen Verlobten.«
»Auf Herrn Schuster? Wohnt er schon länger hier?«
»Nein, nein, er ist nur zu Besuch. Er ist erst heute Morgen eingetroffen. Selbstverständlich wird er sich gleich noch bei Ihnen anmelden und ins Hausbuch eintragen. Wir wollten nur erst frühstücken.«
»Ich fürchte, daraus wird nichts, Frau Frommann.«
Die Frau reißt die Augen auf.
»Oh, ist ihm etwas passiert? Hatte er einen Unfall? Ich habe noch geschlafen, als er losgegangen ist. Ich glaube, er wollte Semmeln kaufen.«
»Ich denke, er ist heute Morgen erst angekommen?«
»Ja, das ist er, mit dem Nachtzug aus Eisenhüttenstadt. Wir haben uns … begrüßt, und dann bin ich noch einmal eingeschlafen.«
Tobias bemerkt, wie ihre Wangen leicht erröten.
»Verstehe. Nun, er hatte keinen Unfall. Er musste allerdings dringend wieder abreisen.«
»Ohne sein Gepäck?«
»Ja, leider. Ich vermute, Sie können ihm sein Gepäck in die Erich-Honecker-Kaserne in der Neustadt hinterherbringen. Man wird Sie anrufen und Ihnen Näheres sagen. Er bat mich nur, Sie kurz zu informieren.«
Die Frau sieht aus, als bräche sie ebenfalls gleich in Tränen aus. Rasch verabschiedet sich Tobias mit einem militärischen Gruß, was ein technischer Fehler ist, da er keine Uniform trägt. Dann dreht er sich um und läuft Richtung Fahrstuhl.
Das Geräusch nackter Füße auf Linoleum verfolgt ihn, und eine Hand legt sich auf seine Schulter.
»Vielen Dank, Genosse ABV, dass Sie meinem Mario diesen Wunsch erfüllt haben. Sie sind ein guter Mensch«, sagt die Frau.
»Hab nur meine Pflicht getan«, sagt Tobias.
Das ist nicht gelogen, aber trotzdem kann er sie dabei nicht ansehen. Sie ahnt ja nicht, dass ihr Mario seinetwegen vom KD abgeholt wurde.
6. Oktober 2029Erdorbit
Mandy schwitzt. Das Mifa-Rad quält sie heute ganz besonders. Es ist, als ahnte es, welcher Tag morgen bevorsteht, und als wolle es den letzten Rest Leistung aus der Kosmonautin herauskitzeln. Am liebsten würde sie das nasse Nicki ausziehen, doch aus irgendeinem Grund schämt sie sich vor dem Roboter, der sie beobachtet. Mandy wischt sich immer wieder den Schweiß vom Gesicht, kann aber trotzdem nicht verhindern, dass zahllose Tropfen durch die Kabine treiben.
Das ist nicht ganz ungefährlich. Das Innere der Raumstation ist ein einziger großer Raum. Die höchstgelegene Einraumwohnung der DDR, scherzt sie manchmal mit ihrer Mutter. Das bedeutet aber auch, dass hier sämtliche Mikroelektronik verbaut ist, die auf ein Übermaß an Feuchtigkeit mit Fehlern reagiert. Die Klimaanlage arbeitet leider nicht so effizient, als dass sie das vor der Außenbordaktivität obligatorisch ausgiebige Training kompensieren könnte.
»Deine Blutwerte sind jetzt gut«, sagt Bummi. »Du kannst aufhören.«
»Danke.«
Mandy versucht, ein paar der größeren Tropfen mit dem Handtuch einzufangen. Aber sie reagieren scheinbar intelligent wie Mücken auf ihre Attacken und weichen immer im letzten Moment aus. Natürlich ist es in Wirklichkeit der vom beschleunigten Handtuch aufgebaute Luftdruck, der die Tröpfchen aus dem Weg schiebt. Mandy behilft sich, indem sie ein zweites Handtuch an der Wand aufhängt und die Schweißtropfen dann mit dem ersten in die Enge treibt, bis sie gar nicht mehr anders können, als in den Fasern des Malimo-Gewebes zu verschwinden.
»Was tust du da?«, fragt Bummi.
Mandy weiß nie so recht, wo seine Stimme herkommt. Er scheint Lautsprecher in jeder der vier Klauen und in seinem eiförmigen Bauch zu haben, und natürlich kann er auch über die in der Raumstation verteilten Lautsprecher kommunizieren. Vermutlich hört er sie rund um die Uhr ab, aber das beruhigt Mandy eher. Eine ihrer wenigen Ängste ist, dass sie im Schlaf von einer Katastrophe überrascht werden könnte. Bummi schläft nie, muss sich aber etwa alle acht Stunden für dreißig Minuten an die Steckdose begeben.
»Ich fange Schweißtropfen ein.«
»Das ist nicht nötig.«
»Zu viel Feuchtigkeit ist schlecht für die Elektronik. Das müsstest gerade du doch wissen.«
»Wenn die Luft zu feucht wird, können wir sie immer noch komplett ablassen.«
»Und wer erzählt mir immer etwas darüber, dass wir Ressourcen sparen müssen?«
»Wir sollten jetzt mit der Erfüllung des Tagesplans beginnen.«
Bummi treibt sie manchmal zum Wahnsinn. Genau so hat ihr Exmann auch reagiert: Wenn ihm etwas unangenehm war, hat er einfach das Thema gewechselt. Aber es ist sicher unfair, eine Maschine mit ihrem Exmann zu vergleichen. Bummi hat sie immerhin nicht mit zwei Kindern sitzengelassen, nur weil sie Kinder und Karriere verbinden wollte. Dass es nach achtzig Jahren real existierendem Sozialismus noch solch archaische Einstellungen gibt, hatte sie sich nicht vorstellen können.
»Also?«, fragt Bummi.
»Ich komme ja schon.«
»In der Schleuse liegt alles bereit.«
»Sehr gut, Bummi.«
So hat sie sich das aber nicht vorgestellt. Die Schleuse ist komplett vollgestopft. Sie findet kaum den Platz, um alle Schichten des Raumanzugs vorschriftsmäßig überzuziehen. Kurz überlegt sie, auf die Heiz- und Kühlunterwäsche zu verzichten. Aber wenn Bummi das bemerkt, schimpft er und lässt sie nicht von Bord. Sie wüsste zwar nicht, wie er es bemerken sollte, aber wenn es passiert, bedeutet das nur mehr Zeit in dem sowieso noch von gestern stinkenden Raumanzug.
Sie schiebt also all die Bauelemente, die der Roboter in der Schleuse platziert hat, so gut wie möglich beiseite und kleidet sich an.
»Bin fertig«, sagt sie schließlich.
»Gut, ich höre dich«, sagt Bummi. »Lass mich ein paar Tests durchführen.«
Der Ventilator im Helm heult auf. Ein Heizelement am Oberschenkel erhitzt sich, ein Kühlelement am Bauch kühlt herunter.
»Sieht gut aus«, sagt Bummi. »Der Anzug funktioniert.«
Angesichts dessen, dass die DDR alte, von russischen Kosmonauten auf der ISS genutzte Anzüge gekauft hat, ist das keine Selbstverständlichkeit. Aber Mandy will sich nicht beschweren. Die Anzüge erfüllen ihren Zweck und sind auch mit Bordmitteln gut reparierbar. Das ist wichtig, denn schnelle Hilfe vom Boden kann sie nicht erwarten. Hinter der Schleuse führt ein Schott in die erste je von der DDR-Industrie gebaute Raumkapsel. Sie ist nach dem Vorbild der Sojuskapsel entstanden, in der schon der DDR-Kosmonaut Sigmund Jähn geflogen ist. Böse Zungen behaupten, die Kapsel wäre seitdem aus dem Museum verschwunden, in dem sie für lange Zeit ausgestellt worden war, bis irgendein Parteitag der SED es plötzlich für erstrebenswert befunden hatte, dass die DDR über eine eigene Raumstation verfügt.
»Denkst du an deine Kinder?«, fragt Bummi.
Mandy schüttelt den Kopf. Der Roboter hat recht. Sie sollte besser an ihre Kinder denken als an Zeiten, die lange vorbei sind.
»Bringen wir es hinter uns«, sagt sie.
Dass Bummi die Schotten geöffnet haben muss, bemerkt sie an der Bewegung, die plötzlich in die Bauteile kommt, die die Schleuse blockieren.
»Ich gehe raus, und du reichst mir die Teile«, sagt Bummi.
Sollte sie nicht die Befehle geben? Aber sie widerspricht nicht. Es ist ja sinnvoll. Der Roboter kann sich besser verankern und die Teile entgegennehmen. Sie beginnt mit dem ersten. Die Bauelemente sind nicht sonderlich schwer. Das merkt sie auch in der Schwerelosigkeit, weil sie sich leicht in Bewegung setzen lassen. Die träge Masse wird von der Mikrogravitation ja nicht außer Kraft gesetzt. Eines nach dem anderen reicht sie die Elemente durch das schwarze Loch in der Decke. Der Roboter wird wohl wissen, wie sie sie zusammensetzen müssen.
Als der Raum komplett leer ist, verlässt Mandy die Schleuse. Dafür sieht es auf der Außenhaut der Völkerfreundschaft chaotisch aus. Der Roboter hat eine Lampe aufgestellt, die ihr Arbeitsfeld beleuchtet. Sonst wäre es zu dunkel, denn die Sonne verbirgt sich noch hinter der Erdkugel.
Sie müssen die Elemente nun verbinden. Bummi zeigt ihr jeweils, welche Flächen an welche anderen geknöpft werden müssen. Seine Klauen sind für das Knöpfen ungeeignet. Die Elemente bestehen aus einem mit einer Metallfolie bedampften Stoff über einem stabilen, aber biegsamen Kern. An den Rändern ist der Stoff abgenäht. Dort befinden sich die Knöpfe und die zugehörigen Löcher, immer abwechselnd. Es erweist sich schnell, dass diese Art der Verbindung ziemlich praktisch ist. Das hätte sie gar nicht vermutet.
»Welches Material steckt denn darin?«, fragt sie. »Plaste?«
»Nein, ganz normale Pappe«, antwortet Bummi.
Mandy sieht im Schein ihrer Helmlampe genauer hin und entdeckt an jedem Element das aufgedruckte Logo des VEB Sachsenring Zwickau. Vermutlich hat eine Brigade des Trabant-Herstellers diese Teile in Sonderschichten gefertigt.
Mit der Zeit entsteht eine Figur, die sie an eine Rose erinnert. Durch die geschickte Verknüpfung, die eine innere Spannung erzeugt, ist sie zur Unterseite hin gewölbt. Die Blüte wird das Sonnenlicht bündeln. Schon vor Tagen hat die Raumstation ihren Orbit so angepasst, dass sie am 7. Oktober um die Mittagszeit von Berlin, Hauptstadt der DDR, aus zu sehen sein wird. Die silbern glänzende Blüte soll, von der Sonne erleuchtet, als Stern der Völkerfreundschaft über der großen Parade so erscheinen. So stellt es sich die Partei- und Staatsführung vor.
Die Sonne geht auf. Mandy hält inne. Sie sieht das Schauspiel nicht zum ersten Mal, doch es ist immer noch beeindruckend. In diesem Moment zeigt sich besonders deutlich, wie dünn die Sphäre des Lebens auf der Erde eigentlich ist. Solange ihre Strahlen durch die Lufthülle scheinen, wirkt die Sonne golden. Mandy kann zusehen, wie aus einem warmen, weichen Stern ein streng umrissener, kalter weißer Stern wird, der mitten im schwarzen Himmel steht. Das geschieht, sobald die Sonne ein paar Grad über die Erdkugel hinaus steigt. Der Unterschied, den sie binnen Minuten erlebt, könnte nicht augenfälliger sein. Hier der zerbrechliche, eng begrenzte Bereich des Lebens, dort die tote, unendliche Sphäre des Universums, das nicht einmal das Licht von Billionen Sternen aus seiner Schwärze holen kann.
»Mandy? Ich brauche dich jetzt«, sagt der Roboter.
Sie reißt sich vom Anblick der Erde los. Bummi erklärt ihr, was zu tun ist. Mandy stellt sich auf und löst eine der beiden Sicherungen. Dann hebt sie die Blüte an und trägt sie zwei Meter weiter. Sie wechselt die Sicherungsleine, dann geht es noch einmal zwei Meter um das Schiff herum, bis sie kopfüber zu stehen scheint, mit dem blauen Erdball unter ihr.
»Danke, das müsste die richtige Position sein«, sagt Bummi. »Ich verankere den Schirm.«
Mandy lässt das dünne Material los. Manchmal hat sie das Gefühl, dass nicht sie, sondern der Roboter das Schiff kommandiert. Die Einzelheiten der Vorbereitung auf den Republikgeburtstag hat die Missionskontrolle auf dem Brocken zum Beispiel direkt an Bummi übermittelt. Sie wurde nur für die Knöpfe gebraucht, weil die menschliche Hand für solche Feinarbeiten noch unübertroffen ist, selbst wenn sie in einem Raumanzug steckt.
Vorsichtig bewegt sie sich wieder zur Schleuse. Sie will vor dem Roboter dort sein. Irgendwann wird Bummi noch vergessen, dass es sie gibt, und ihr die Schleuse vor der Nase zusperren.
»Hallo, meine Lieblinge, wie geht es euch?«
Sabine und Susanne versuchen, sich den besten Platz zu sichern.
»Nicht drängeln, ihr zwei!«, ist die mahnende Stimme der Oma aus dem Hintergrund zu hören.
Die beiden lachen. Sie sind eineiige Zwillinge, aber Mandy hatte noch nie Schwierigkeiten, sie auseinanderzuhalten. Es ist etwas in ihrem Blick. Susanne war immer die Ruhigere, Zurückhaltendere, und das ist sie auch mit fünf Jahren geblieben.
»Gut, Mutti!«, ruft Sabine.
»Wann kommst du denn wieder?«, fragt Susanne.
»Morgen früh holt uns Vati ab, und wir gehen zum Umzug!«, ruft Sabine.
Ihr Exmann hatte ihr schon angekündigt, dass er die zwei zum Republikgeburtstag mitnehmen würde. Nach der Demonstration wird es ein großes Volksfest geben. Die Republik feiert ihren achtzigsten Jahrestag mit großem Aufwand.
»Da wünsche ich euch ganz viel Spaß!«, sagt sie. »Es wird bestimmt toll.«
Es tut weh, dass sie nicht bei ihnen sein kann, aber sie lässt sich nichts anmerken.
»Bekommen wir Zuckerwatte?«, fragt Sabine.
»Das müsst ihr Vati fragen.«
»Aber der sagt dann, du hättest es verboten. Verbietest du es?«
»Nein, Bine, ich erlaube es.«
»Danke, Mutti!«
»Mutti, wann kommst du denn nun wieder?«, fragt Susanne.
»Noch dreizehnmal schlafen«, sagt Mandy. »So oft wie alle Finger und drei Zehen.«
»Ich weiß, wie viel dreizehn ist«, sagt Susanne. »Wir kommen doch nächstes Jahr in die Schule!«
»Ich weiß auch, was dreizehn ist«, sagt Sabine.
»Weißt du nicht.«
»Doch.«
»Nicht streiten«, sagt die Oma aus dem Off.
»Kannst du denn da oben auch feiern?«, fragt Susanne.
»Ja, natürlich.«
»Aber du bist doch ganz allein!«
»Bummi ist hier, der Roboter, von dem ich euch erzählt habe.«
»Bummi ist gruselig«, sagt Sabine. »Er sieht aus wie eine Spinne.«
»Es ist ein automomer Laufroboter«, widerspricht Susanne. »Keine Spinne.«
»Autonom«, sagt Mandy.
»Ja, ein automomer Roboter«, sagt Susanne. »Wenn ich groß bin, will ich auch Roboter bauen.«
»Ich werde Kosmonautin«, sagt Sabine.
»Ich finde Kosmonautin sein doof«, sagt Susanne. »Da ist man so weit von seinen Kindern weg.«
»Das stimmt«, sagt Mandy, »das ist ein großer Nachteil.« Ihre Stimme stockt kurz, denn Susanne hat viel mehr recht, als sie ahnt. »Aber von hier oben sieht man so viel, das würde dir gefallen, Sanne.«
»Mehr als vom Brocken?«, fragt Susanne.
»Viel mehr.«
»Auch das nichtsoziale Wirtschaftsbiet?«, fragt Sabine.
»Auch das nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet.«
»Kannst du uns auch sehen?«, fragt Susanne.
»Ich sehe euch gerade und freue mich darüber. Ihr seid so gewachsen, seit wir das letzte Mal gesprochen haben.«
Das Bild flackert, und ein leichtes Grieseln erscheint. Wahrscheinlich verlässt die Völkerfreundschaft bald den Sendebereich der Brockenstation. Danach könnte Mandy zwar über Zwischenstationen kommunizieren, aber die befinden sich im Ausland, also kostet es Devisen. Persönliche Gespräche sind deshalb nur über die Brockenstation erlaubt.
»Ich meine, einfach so, ob du uns auch sehen kannst, wenn wir nicht telefonieren«, sagt Susanne.
»Das wäre möglich«, sagt Mandy. »Ihr habt doch von der MKF-8 gehört, von der Multispektralkamera?«
»Ich glaube schon«, sagt Susanne.
»Damit könnte ich euch sehen, wenn ihr das Haus verlasst.«
»Auch, ob wir die Haare gekämmt haben?«, fragt Sabine.
»Das nicht, aber welche Farbe dein Kleid hat.«
»Und welche Farbe hat …«, Sabine sieht sich um, »… Omis Pullover?«
»Das kann ich nur sehen, wenn Omi vor die Tür geht. Im Haus sehe ich euch nicht.«
Das Bild der Zwillinge grieselt immer stärker.
»Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß morgen!«, sagt Mandy. »Das wird bestimmt ein toller Tag.«
»Das wünsche ich dir auch, Mutti«, sagt Susanne.
»Du kannst uns ja von oben zugucken«, sagt Sabine.
»Wir winken dir ab und zu«, sagt Susanne.
»Um zwölf werde ich für euch einen kleinen Stern anschalten. Wo das Licht herkommt, da bin ich«, sagt Mandy.
»Das ist ja toll, Mutti«, sagt Sabine.
»Tschüss«, sagt Susanne, dann bricht die Verbindung zusammen.
7. Oktober 2029Dresden
Es ist kalt in seiner Dienststelle. Tobias fröstelt und reibt sich die Schultern. Die Stadtwerke haben die Fernheizung noch nicht wieder eingeschaltet, schließlich steigen die Temperaturen tagsüber ja noch auf mindestens fünfzehn Grad. Eigentlich hat er sonntags frei. Aber zum Republikgeburtstag sind alle Kräfte im Einsatz. Schulte, der ihn sonst hier vertritt, ist in der Innenstadt im Einsatz.
Tobias ist froh, dass ihm das erspart bleibt. Seine Aufgabe ist es, im Viertel für Ordnung zu sorgen, aber da fast alle Menschen an der Kundgebung und am Volksfest danach teilnehmen werden, wird es ein ruhiger Tag werden. Bei der Lagebesprechung hat der MfS-Vertreter keine Erkenntnisse melden können, die darauf schließen lassen würden, dass es zu irgendwelchen Provokationen feindlich gesinnter Kräfte kommen könnte.
Er schüttet etwas Pulver aus der Rondo-Tüte in den Filter, füllt Wasser in die Kaffeemaschine und schaltet sie ein. Während sie glucksend den herrlichen Duft verbreitet, den Tobias so liebt wie sprichwörtlich jeder Sachse, schaltet er den Fernseher ein und setzt sich auf seinen Stuhl. Der Moderator versucht, Vorfreude zu verbreiten, und weist immer wieder auf die wichtigsten Programmpunkte hin. Dazu gehört natürlich die große Parade der Nationalen Volksarmee auf der Karl-Marx-Allee in Berlin, aber auch das Konzert vor dem Brandenburger Tor, bei dem unter anderem Karat, die Puhdys, Udo Lindenberg und Depeche Mode auftreten sollen. Vier Rentnerbands, aber immer noch jünger als der Genosse Krenz.
Auf den Programmhinweis folgt eine Dokumentation über die Geschichte der DDR. Tobias erfährt nichts Neues, wie auch? Schließlich hat er all das schon in der Schule gelernt, und es wird in jeder politischen Fortbildung wiederholt. 1949 die Republikgründung als Reaktion auf den Alleingang des Westens, dann der unaufhaltsame Aufstieg, ermöglicht durch den antifaschistischen Schutzwall. 1987 dann die Entdeckung der riesigen Ölvorkommen in der Lausitz, die die DDR in eine Liga mit den Arabischen Emiraten brachte.
1989 – der Niedergang des Sowjetreichs, eingeleitet durch den Revisionisten Gorbatschow, schließlich die DDR als einer der letzten Stützpfeiler des Sozialismus auf der Welt, gemeinsam mit China, Kuba, Nordkorea und Vietnam. In der Doku folgt ein Blick in die Zukunft. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Die allseits gebildete sozialistische Persönlichkeit. So wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben.
Alles schön und gut, aber manchmal fragt er sich doch, wo sie ist, die sozialistische Persönlichkeit. Klar, die Abwanderung in den Westen ist gestoppt, seit Ikea, H&M, Boss oder Zara ihre Waren auch in der DDR verkaufen. Dass jeder Bürger ein Viertel seines Gehalts in konvertierbaren Mark, kurz K-Mark, ausgezahlt bekommt, sorgt für ein Lebensniveau, das mit dem des Westens vergleichbar ist, denn zugleich garantieren die Kaufhallen von HO und Konsum subventionierte Preise für Waren des täglichen Bedarfs. Die Städte mögen nicht so geschniegelt sein wie drüben, doch dafür sind auch die Mieten auf dem Niveau von 1987 festgeschrieben. Für die wenigsten lohnt es sich deshalb noch rüberzumachen.
Aber Bewusstsein ist Mangelware. Er braucht nur einmal um das Haus herumzulaufen, um das zu sehen. Der Hausmeister hat gestern erst gekehrt, doch schon wieder liegt Müll herum. Dieses Haus ist Volkseigentum, aber seine Bewohner behandeln es, als gehörte es irgendeinem anonymen Staat und nicht ihnen selbst. Tobias seufzt.
Sein Handtelefon vibriert. Das ist die Erinnerung, die er sich eingestellt hat. Auch heute gibt es einiges zu tun, und er kennt sich selbst gut genug, um zu wissen, dass er gern mal alle fünfe gerade sein lässt. Erst einmal der Kaffee. Er nimmt eine Tasse aus der kleinen Spüle. Der Wasserhahn tropft. Er nimmt sich vor, ihn heute noch zu reparieren. Wasserverschwendung ist schlecht. Aber der Kaffee ist gut. Er hält die Tasse immer erst vor die Nase und saugt den Duft tief ein. Dann setzt er sie an die Lippen, pustet kurz und nimmt vorsichtig einen kleinen Schluck. Kaffee muss heiß und stark und bitter sein.
Er setzt die Tasse erst ab, als sie halb geleert ist. Den Rest schüttet er in die Kanne zurück. So bleibt er länger warm. Dann holt er den Tragrechner aus der Schublade. Er wirft einen kurzen Blick in seine private Kybernetz-Post. Jede Menge Werbung. Der Konsum lädt ihn ein, seine gesammelten Marken digital zu verwalten. Der Intershop bietet besonders günstige Wechselkurse für Rubel und kubanische Peso. Aber auch ein Brief von seinem indischen Freund Raghunath. Tobias hat ihn schon Ende der 1980er Jahre kennengelernt. Erst haben sie sich Briefe geschrieben, später dann Kybernetz-Post, und sie haben sich besucht. Tobias hat Raghunath seinen ersten Flug in die DDR bezahlt. Sie nennen sich sogar gegenseitig Bruder. Sein Freund hat sich seitdem kontinuierlich hochgearbeitet, vom Lehrer zum Direktor einer Privatschule. Er verdient inzwischen mehr als Tobias, ist aber sonst ganz der Alte geblieben. Nein, den Brief liest er heute Abend in Ruhe.
Tobias schließt das Postfach und meldet sich bei der Hausverwaltung an. Das Gerät läuft unter FDCP, was für Fenster-DCP steht, und besteht aus einer riesigen REDABAS-Datenbank auf einem Großrechner von Robotron. Es dauert eine Weile, bis die Benutzerschnittstelle geladen ist. Dann braucht das Programm noch einmal fünf Minuten, um die Verbindung zur Datenbank herzustellen.
Miltner, Miltner. Der junge, alleinstehende Mann aus der sechsten Etage des Nachbarhauses muss schon wieder Pornos konsumiert haben. 35,6 Gigabyte gehen allein auf sein Konto! Damit ist er im Vierundzwanzig-Stunden-Mittel einsame Spitze bei der Kybernetz-Nutzung. Eigentlich ist jeder Bürger angehalten, sich auf ein Gigabyte pro Tag zu beschränken. Die Grenze soll zum heutigen Feiertag angeblich verdoppelt werden, aber das hat Tobias bisher nur gerüchteweise gehört. Er wird mit Miltner auf jeden Fall ein ernstes Gespräch führen müssen.
Den zweiten Platz belegt mit großem Abstand dahinter die Familie Garhammer. Sie wohnt fast direkt über ihm und hat vier pubertierende Kinder. Für kinderreiche Familien wie die Garhammers gelten zwar sowieso Ausnahmen, aber bei ihnen würde er auch ein Auge zudrücken. Er hat selbst eine pubertierende Tochter, Marie, die bei ihrer Mutter lebt. Sein Sohn Jonathan wurde gerade zum Wehrdienst eingezogen.
Tobias lässt sich die Kyberadressen ausgeben, die Miltner genutzt hat. Der junge Mann treibt sich wie erwartet vor allem auf Seiten mit Beischlafangeboten herum. Die Datenbank gibt allerdings weitgehend Entwarnung, denn es handelt sich um solche, die eine Spezialabteilung des Ministeriums für Außenhandel im Kybernetz aufgebaut hat. Die K-Mark, die Miltner dort ausgibt, landen also im Volksportemonnaie.
Aber es gibt auch ein paar Verbindungen, deren Einträge rot markiert sind. In diesen Fällen lassen sich die Zieladressen nicht entschlüsseln. Miltner muss also ein Aufgesetztes Privates Kybernetz benutzt haben, ein AKP. Die entsprechende Software kommt oft aus dem Westen und wird gern dazu eingesetzt, persönlichkeitszersetzende Angebote wie Google Plus oder Facebook zu nutzen. Tobias schreibt sich einen Termin in seinen Kyberkalender. Miltner wohnt nicht mehr bei den Eltern, die braucht Tobias also gar nicht erst einzubeziehen. Am Montag um zehn Uhr morgens wird er Miltner an seiner Arbeitsstelle aufsuchen. Wenn die Produktionsbrigade beim Frühstück versammelt ist, hat Tobias’ Besuch noch nie seine Wirkung verfehlt, zumal wenn er droht, auf einer Eintragung ins Brigadetagebuch zu bestehen.
Er blättert etwas weiter nach unten, bis er auf »Schulze, Ralf« trifft. Sehr schön. Schulze hat sich vor einem Jahr von seiner Frau getrennt und war danach in die Kybernetz-Sümpfe abgetaucht. Tobias hat zweimal mit ihm gesprochen und ihm einen Therapieplatz besorgt. Jetzt hat Schulze es geschafft. Gestern hat er nur gerade einmal zwei Megabyte Datenkapazität gebraucht.
Wieder vibriert sein Handtelefon. Es ist Zeit für den ersten Rundgang.
Schnell, schnell. Es ist schon 11:58 Uhr. Er schließt die Tür, legt die Uniformjacke über den Stuhl, öffnet den obersten Knopf des Uniformhemds und schaltet den Fernseher ein. Auf seinem Rundgang hat er einen alten Bekannten getroffen und sich zu lange mit ihm unterhalten. Auf dem Bildschirm läuft gerade noch ein Countdown: ein DDR-Wappen, das im Sekundentakt blinkt.
Dann schaltet das Programm um. Der Zuschauer schwebt im All. Im unteren Bildschirmdrittel ist die Erde zu sehen. Darüber ist nur Schwärze. Oder ist da ein Schemen? Tobias kommt es so vor, als versperre ein schwarzer Umriss den Blick auf die Sterne im Hintergrund.
Tatsächlich. Plötzlich leuchtet eine nach links hin abgeschrägte Dose auf. Das ist die Raumstation Völkerfreundschaft, eine Spitzenleistung von Wissenschaft und Technik der einzigen sozialistischen Nation auf deutschem Territorium. Der Fernsehsender spielt Klatschen und Ah- und Oh-Laute ein. Dann schaltet das Bild auf die Tribüne um, die in der Mitte der Karl-Marx-Allee platziert ist. Eine Person spricht. Tobias erkennt ihn erst gar nicht, aber es ist natürlich der Partei- und Staatsratsvorsitzende Egon Krenz. Er ist deutlich über neunzig, und es sieht so aus, als würden die Personenschützer um ihn herum ihn nicht nur schützen, sondern auch festhalten, damit er nicht umkippt.
Das war ein schlechter Gedanke, dieses Feiertags unwürdig. Wenn Egon Krenz sich in seinem Alter heldenhaft auf die Bühne begibt, sollte er sich nicht über ihn lustig machen. Krenz sagt ein paar Worte, dann schaltet die Kamera um. Diesmal sieht Tobias blauen Himmel. In Berlin scheint herrliches Wetter zu sein. Hier in Dresden ist es heiter bis wolkig.
Am Himmel erscheint ein heller Stern. Ein kollektives Raunen geht durch die Massen. Die grau gekleideten Soldaten, die gerade noch im Stechschritt an der Tribüne vorbeimarschiert sind, bleiben auf Kommando stehen und heben den Blick zum Himmel. Hunderte Schirmmützen rotieren um exakt vierzig Grad, als wären sie fest zwischen den Ohren der Männer angebracht. In der nachfolgenden Kompanie, wohl von einer anderen Waffengattung, drehen sich ebenso viele Stahlhelme auf identische Weise. Es ist ein perfektes Schauspiel.
Kurz darauf fallen Schüsse. Es ist die Ehrengarde, die feuert. Eine Staffel Jagdflieger hetzt über den Bildschirm. Sie fliegen so, dass sie auch über Westberlin hinwegrasen müssen. Danach wird der Westen förmlich protestieren. Immer das gleiche alte Spiel. Der Überschallknall, der folgt, ist sowieso auch hinter dem antifaschistischen Schutzwall zu hören. Die Soldaten ziehen weiter. Es folgen modernste russische Raketenwerfer, Panzer aus chinesischer Produktion, Geschütze aus türkischen Fabriken.
Tobias lässt den Fernseher eingeschaltet, nimmt seine Uniformjacke und geht nach draußen. Er hat Glück. Die Wolken haben sich verzogen. Sie haben dem neuen Stern Platz gemacht, der Völkerfreundschaft. Langsam zieht sie über den Himmel. Tobias verfolgt den leuchtenden Punkt, bis er hinter einer Wolke verschwindet. Er ist stolz auf sein Land, das es geschafft hat, eine eigene Raumstation ins All zu bringen. Die Chinesen haben ebenfalls eine, aber in dem Land leben auch mehr als eine Milliarde Menschen. Die Amerikaner betreiben eine gemeinsam mit den Russen, mit denen sie zusammengerechnet auf eine halbe Milliarde Einwohner kommen. Sechzehn Millionen DDR-Bürger haben das Gleiche geschafft.
7. Oktober 2029Erdorbit
Die fliegende Kamera sieht aus wie ein aufgemotzter Feuerlöscher, und tatsächlich handelt es sich auch um einen. Die Stahlflasche, die den Treibstoff enthält, ist rot. »VEB Feuerlöschgerätewerk Neuruppin« ist in weißen Buchstaben darauf gedruckt. Erfunden haben das Gerät Neuerer aus diesem volkseigenen Betrieb. Zum einen haben sie den Ausströmkanal umgebaut. Er ist nicht abgeknickt, sondern gerade, und das Rad, das den Flascheninhalt ausströmen lässt, ist nun seitlich platziert.
Die Kamera, ein günstiges Digitalmodell des Dresdner Herstellers Practica, ist an den Rumpf montiert, und zwar so, dass sie der Flugrichtung entgegensieht. Über ein Funkmodul überträgt die Kamera ihre Bilder an die Raumstation, die diese mit Hilfe der Antenne zur Empfangsstation Brocken weiterleitet.
Lenken lässt sich die Kamera nicht. Sie fliegt an einer im All praktisch unsichtbaren zehn Meter langen Dederonleine. Wenn sie deren Ende erreicht, kurvt sie chaotisch hin und her, bis Bummi oder Mandy sie zurück zur Station ziehen. Die Regie hofft, dass ein einziger Einsatz der Kamera genügt. Das Publikum auf der Erde soll lediglich ein Gefühl dafür bekommen, welch große Tat dem kleinen Volk hier draußen gelungen ist. Anschließend ist es an Mandy, den Stern der Völkerfreundschaft leuchten zu lassen.
»Jetzt«, sagt Mandy.
Der Roboter, der auf der Außenhülle der Raumstation sitzt, dreht den Hahn der Gasflasche auf und lässt die fliegende Kamera los. Sie entfernt sich. Mandy verfolgt, was die Kamera sieht, auf dem Kontrollschirm im Inneren der Station. Das sieht gut aus. Erst kommt die Erde ins Bild. Sie wartet eine Sekunde, dann schaltet sie die Beleuchtung ein. Die Raumstation hebt sich mit ihren achtzig Lichtern vom schwarzen Hintergrund des Universums ab.
»Bodenkontrolle an Völkerfreundschaft«, meldet sich Werner, ihr Kontaktmann.
»Ich höre?«
»Das war nicht schlecht, aber etwas zu hektisch. Bitte für jede Einstellung mehr Zeit lassen.«
»Verstanden, Bodenkontrolle«, sagt Mandy. »Bummi, hast du das verstanden? Wir müssen die Flasche zurückziehen und neu starten, und zwar mit geringerem Druck.«
»Verstanden, Mandy.«
Auf dem Monitor kommt die Raumstation wieder näher. Dann wackelt das Bild kurz. Jetzt dreht der Roboter am Hahn. Mandy schaltet die Beleuchtung aus.
»Zweiter Versuch, jetzt!«, befiehlt sie.
Wieder kommt erst die Erdkugel ins Bild. Dann leuchtet die Raumstation auf.
»Bodenkontrolle an Völkerfreundschaft.«
»Ja?«
»Habt ihr noch ein paar zusätzliche Lampen?«
»Nein, es sind genau achtzig.«
»Es sieht aber so aus, als wären es weniger.«
»Dafür ist es nun zu spät.«
»Na gut, dann ein letzter Versuch. Wir erhöhen den Kontrast.«
»Bummi? Ein letzter Versuch.«
Die Kamera nähert sich wieder. Sie gerät ins Torkeln, dann hängt sie still im Vakuum.
»Bodenkontrolle! Ihr gebt den Startbefehl, wenn ihr so weit seid?«
»Wir sind so weit.«
»Bummi, es geht los.«
Erdkugel, warten, Startbefehl. Wenn sie das Prozedere noch zweimal übt, kann sie es im Schlaf.
»Perfekt, jetzt haben wir es im Kasten«, meldet sich die Bodenkontrolle.
»Sehr schön. Wir sprechen uns in neunzig Minuten wieder.«
»Bestätigt.«
Die neunzig Minuten sind vorbei. Mandy reibt sich die Hände. Jetzt hängt alles von ihrem Befehl ab. Vorhin, das war eine Aufzeichnung. Aber der neue Stern erscheint live über Berlin, Hauptstadt der DDR. Damit er aufleuchtet, muss sie im richtigen Moment einen Knopf drücken. Und nicht nur das, sie muss ebenso im richtigen Moment auch noch einen zweiten Knopf betätigen.
»Bummi, ich bin aufgeregt.«
»Mach dir keine Sorgen. Es kann überhaupt nichts passieren«, sagt der Roboter.
»Das stimmt doch gar nicht. Wenn ich den Moment verpasse, wird die ganze Republik es mitbekommen.«
»99,9 Prozent der Bevölkerung wissen gar nicht, was sie erwartet.«
»Aber die, die es wissen, sind besonders wichtig.«
Wenn sie alles gut macht, steht ihr nach der Rückkehr eine großartige Karriere bevor. Sie wird im Land herumfahren und von ihrer Reise erzählen, und sie wird die DDR international vertreten. Man hat ihr versprochen, dass sie ihre Kinder mitnehmen kann.
»Es geht bloß um einen Knopf, Mandy.«
Sie seufzt. Unerbittlich bewegt sich der Uhrzeiger voran. Er erreicht die Zwölf. Auf der Riesenleinwand an der Karl-Marx-Allee und im DDR-Fernsehen wird gerade ihr Video abgespielt. Es läuft eine Minute lang. Nach vierzig Sekunden muss sie den Knopf drücken. Sie hält den Zeigefinger darüber.
»Bummi, Countdown.«
Der Roboter zählt mit. Dreißig, zwanzig, zehn. Schon sind sie bei fünf, vier, drei, zwei, eins, Start. Sie bewegt den Finger. Er gehorcht und drückt den Knopf. Eines der Steuertriebwerke gibt einen kurzen Impuls ab. Die Raumstation dreht sich. Sie muss exakt sechzehn Sekunden lang warten. Sie sucht den anderen Knopf. Wo ist er bloß? Sie hat das doch tausendmal geübt! Ihr Herzschlag beschleunigt sich. Da! Er befindet sich auf der anderen Seite des Pultes. Bummi zählt erneut nach unten. Drei, zwei, eins, Start. Wieder gehorcht ihr Finger. Ein winziger Impuls, und die Bewegung der Station hört auf.
»Perfekt«, sagt die Bodenkontrolle. »Die revolutionären Massen sind begeistert. Du hast einen Stern am Himmel entzündet. Das wird dir einen Platz in den Geschichtsbüchern verschaffen.«
Sie atmet durch. Aber der Hauch der Geschichte bleibt aus. Da ist nur trockene Luft. Geschichtsbücher werden allzu oft umgeschrieben. Ein schönes Leben mit ihren Kindern würde vollkommen ausreichen. Wobei … Die Vorstellung, dass jeder Jungpionier irgendwann ihren Namen kennt wie den von Sigmund Jähn, die hat schon etwas.
»Es tut mir leid, aber bei deiner Mutter ist niemand zu erreichen«, sagt Werner.
Wahrscheinlich sind die Mädchen noch bei ihrem Vater, und Mandys Mutter ist ausgegangen. Es ist ja erst später Nachmittag in Erfurt, wo ihre Mutter mit den Kindern wohnt. Schade, sie hätte trotzdem gern mit ihnen gesprochen.
»Sei nicht traurig, da ist bestimmt eine Menge los«, sagt Werner. »Deine Kinder haben gerade ganz viel Spaß.«
»Bestimmt. Und du Armer musst den Feiertag meinetwegen auf dem Brocken verbringen?«
»Bei uns ist großes Familientreffen, da bin ich froh, hier meine Ruhe zu haben.«
»Dann hast du ja Glück.«
»Du müsstest in knapp achtzig Minuten wieder in Reichweite sein. Wir können es dann ja noch mal bei deinen Kindern probieren, choroscho?«
»Einverstanden, Werner.«
»Bodenkontrolle Ende.«
Mandy lehnt sich zurück. Wenn sie schon keine aktive Verbindung bekommt, kann sie ja vielleicht einfach nur zusehen? Sie schnallt sich los und schwebt zu dem kleinen Ausguck in der Mitte der Raumstation. Von außen sieht er aus wie eine gläserne Warze. Von innen ist es eine Minikuppel. Allerdings kann Mandy sie nicht benutzen, um die Erde zu betrachten, weil der Platz besetzt ist. Dort ist die MKF-8 befestigt, die Hochleistungsmultispektralkamera vom VEB Carl Zeiss Jena, das bisher einzige Exemplar. Der Vorgänger des Hightechgeräts verkauft sich sogar im nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet, dem NSW, prima. In der Internationalen Raumstation gibt es zwei davon und im Lunaren Gateway der NASA sogar drei. Ein Exemplar ist für die Japaner zur Venus unterwegs, ein anderes fliegt für die ESA zu den Eismonden des Jupiter.
Die Besonderheit der MKF-8, das verrät schon ihr Name, ist die Tatsache, dass sie in mehreren Wellenlängen gleichzeitig Aufnahmen anfertigen kann. Das ist für die Erdbeobachtung immens wichtig, weil bei jeder Wellenlänge ganz bestimmte Details sichtbar werden. Fertigt man solche Aufnahmen zeitlich nacheinander an, um sie dann übereinanderzulegen, haben sich die Phänomene, um die es geht, in der Zwischenzeit schon weiterbewegt.
Mandy interessiert sich momentan allerdings nur für den optischen Bereich. Sie richtet die Kamera auf die Koordinaten des Reihenhauses, in dem ihre Mutter wohnt. Es ist nicht das erste Mal, dass sie das tut, deshalb ist der exakte Ort schon in der Kamera gespeichert. Das erste Bild zeigt bloß eine Wolke. Mandy wartet einen Moment, dann versucht sie es erneut. Sie landet auf dem ziegelroten Dach und erschrickt. Eine ganze Reihe Ziegel hat sich verschoben. Das muss bei dem Herbststurm letztens passiert sein. Ob ihre Mutter das noch nicht bemerkt hat? Sie muss ihr beim nächsten Anruf Bescheid sagen.
Aber erst einmal bewegt sie den Kamerafokus um einen winzigen Hauch nach Osten. Da ist der Garten. Er ist in zwei Teile gegliedert. Direkt hinter dem Haus gibt es Blumen, eine kleine Wiese und eine Terrasse. Danach folgt ein Bauerngarten, in dem ihre Mutter Gemüse anbaut. Mandy lässt die Kamera mehrere Bilder anfertigen. Zwischen den Fotos vergehen immer ein paar Sekunden, in denen die Kamera ihre Optik nachführt. Die geringe zeitliche Auflösung der MKF-8 ist ihre größte Schwäche. Dann legt Mandy die Bilder übereinander, um sie wie in einem Daumenkino zu animieren.
Zwischen den Beeten bewegt sich etwas. Das muss ihre Mutter sein, die sich mit Gartenarbeit befasst. Wahrscheinlich hat sie das Standtelefon einfach nicht gehört. Ihr Handtelefon nimmt sie nie mit in den Garten. Sie hält wenig von moderner Technik. Vermutlich ist sie der einzige Mensch in Erfurt ohne Kybernetz-Anschluss. Zu dumm, also kann Mandy sie nicht bitten, den Anruf anzunehmen.
Sie schlägt die Koordinaten ihres Exmanns nach. Er wohnt auf der anderen Seite der Stadt, so dass die Kamera eine ganze Minute braucht, um sich neu auszurichten. Das Dach des Mietshauses ist schwarz. Dahinter gibt es einen Hof mit einem kleinen Spielplatz. Von der Straße aus ist er nicht zu sehen. Da, auf der Rutsche, das könnten Susanne oder Sabine sein. Wieder macht Mandy mehrere Aufnahmen. Die MKF-8 sieht fast exakt von oben auf das Motiv. Dadurch – und wegen der etwas verringerten Auflösung, die sie wegen der Aufnahmegeschwindigkeit gewählt hat – ist manchmal schwer zu erkennen, worum es sich handelt. Ein roter Fleck kann ein Luftballon sein oder ein Mädchen im roten Kleid. Aber beide bewegen sich unterschiedlich. Sie muss also zwei Farbflecken finden, die das gleiche Spektrum aufweisen – die beiden Zwillinge kleiden sich gern identisch – und die sich scheinbar chaotisch auf dem Spielplatz bewegen.
Da. Es ist eindeutig. Mandy vergrößert die Aufnahmen. Das sind sie, ihre beiden Lieblinge. Ihr Herz schlägt schneller. Sie vermisst die beiden so sehr. Sie zoomt etwas aus der Darstellung heraus. Jetzt nimmt der Spielplatz die ganze Bildschirmfläche ein. Aber was ist das? Im Sandkasten ist ein Muster zu erkennen. Es erinnert sie an zwei Eier, die nahe nebeneinanderliegen. Irgendjemand muss es mit den Füßen in den Sand gestampft haben. Dass sie es selbst von hier oben aus sieht, zeigt, wie mächtig die MKF 8