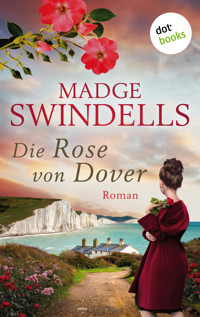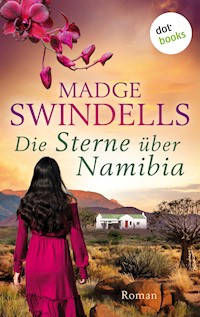6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Die tiefen Schatten Südafrikas: Der Schicksalsroman »Die Löwin von Johannesburg« von Erfolgsautorin Madge Swindells als eBook bei dotbooks. Wenn die Farbe der Haut wichtiger zu sein scheint als die Größe des Herzens … Der Schock sitzt tief: Gerade noch dachte Liza, sie wäre wie alle anderen weißen Mädchen in der Schule am Fuße der Lebombo-Berge – doch weil sich immer mehr Eltern über das »Mischlingskind« beschwert haben, wurde sie vom Staat »reklassifiziert«. Bald schon wird man sie ihrer geliebten Pflegemutter wegnehmen und weit entfernt in ein Waisenhaus sperren. Voller Angst läuft Liza davon. Auf den Straßen von Johannesburg wächst sie mit einer Gruppe anderer Kinder auf, die niemand will – nicht die »Weißen«, nicht die »Schwarzen«. Aber auch, wenn sie alles verloren zu haben scheint, gibt Liza ihren Traum niemals auf: eines Tages ein glückliches Leben zu führen! Ein ebenso bewegender wie erschütternder Roman aus der Zeit der Apartheit in Südafrika – das flammende Plädoyer gegen jede Art von Ausgrenzung, verwoben mit der schicksalshaften Geschichte einer Frau, die für ihr Glück kämpft. Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Die Löwin von Johannesburg« von Madge Swindells. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 931
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wenn die Farbe der Haut wichtiger zu sein scheint als die Größe des Herzens … Der Schock sitzt tief: Gerade noch dachte Liza, sie wäre wie alle anderen weißen Mädchen in der Schule am Fuße der Lebombo-Berge – doch weil sich immer mehr Eltern über das »Mischlingskind« beschwert haben, wurde sie vom Staat »reklassifiziert«. Bald schon wird man sie ihrer geliebten Pflegemutter wegnehmen und weit entfernt in ein Waisenhaus sperren. Voller Angst läuft Liza davon. Auf den Straßen von Johannesburg wächst sie mit einer Gruppe anderer Kinder auf, die niemand will – nicht die »Weißen«, nicht die »Schwarzen«. Aber auch, wenn sie alles verloren zu haben scheint, gibt Liza ihren Traum niemals auf: eines Tages ein glückliches Leben zu führen!
Ein ebenso bewegender wie erschütternder Roman aus der Zeit der Apartheit in Südafrika – das flammende Plädoyer gegen jede Art von Ausgrenzung, verwoben mit der schicksalshaften Geschichte einer Frau, die für ihr Glück kämpft.
Über die Autorin:
Madge Swindells wuchs in England auf und zog für ihr Studium der Archäologie, Anthropologie und Wirtschaftswissenschaften nach Cape Town, Südafrika. Später gründete sie einen Verlag und brachte vier neue Zeitschriften heraus, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Bereits ihr erster Roman, »Ein Sommer in Afrika«, wurde ein internationaler Bestseller, dem viele weitere folgten.
Die Website der Autorin: www.madgeswindells.com
Bei dotbooks veröffentlichte Madge Swindells ihre großen Familien- und Schicksalsromane »Ein Sommer in Afrika«, »Die Sterne über Namibia«, »Eine Liebe auf Korsika«, »Die Rose von Dover«, »Liebe in Zeiten des Sturms«, »Das Erbe der Lady Godiva« sowie ihre Spannungsromane »Zeit der Entscheidung«, »Im Schatten der Angst«, »Gegen alle Widerstände« und »Der kalte Glanz des Bösen«.
***
eBook-Neuausgabe Juli 2020
Die britische Originalausgabe erschien erstmals 1994 unter dem Originaltitel »The Sentinel« bei Little, Brown and Company, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 2007 unter dem Titel »Die Tränen der Leopardin« bei Bastei Lübbe.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1994 by Madge Swindells
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2007 by Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von shutterstock/Simon Dannhauer, Maxim Khyka, PICHET NINVANIT, Andrzej Kubik
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-265-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Löwin von Johannesburg« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Madge Swindells
Die Löwin von Johannesburg
Roman
Aus dem von Michaela Link
dotbooks.
Für Peter de Beerin Liebe
Wenn aber jemand Hass trägt wider seinen Nächsten und lauert auf ihn und macht sich über ihn her und schlägt ihn tot und flieht … so sollen die Ältesten seiner Stadt hinschicken und ihn von da holen lassen und ihn in die Hände des Bluträchers geben, dass er sterbe. Deine Augen sollen ihn nicht verschonen, und du sollst das unschuldig vergossene Blut aus Israel wegtun, dass dir’s wohlergehe.5. Buch Mose 19,11-13
Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde … denn der Tod ist der Sünde Sold.Römer 6,7.23
TEIL 1September 1982 – Dezember 1985
Kapitel 1
Sie war nicht viel älter als zwölf Jahre, aber unter der heißen afrikanischen Sonne war sie früh erblüht, und wie die Flammenlilien, die in roter und gelber Fülle auf dem Buschveld wuchsen, entwickelte sie Liebreiz und Lebenslust. Leidenschaftlich und scheu, erbebte sie unter der Wucht ihrer erotischen Sehnsüchte, errötete häufig ohne jeden Grund und versuchte, ihre Hoffnungen und Träume zu verbergen.
Sie beugte sich über den Brunnen und blickte in das Wasser hinab, sah dabei jedoch Pieter. Bei der Erinnerung daran, wie er sie angesehen hatte, zitterte sie vor Glück, und ihr Haar strich über ihre Schultern wie eine Liebkosung, während ihr Körper sich mit Gänsehaut überzog.
»Sehr eigenartig«, flüsterte sie. In letzter Zeit sah sie oft eine neue Eindringlichkeit in seinem Blick. Manchmal ertappte sie ihn dabei, dass er ihre Brüste oder Oberschenkel anstarrte, und dann errötete er und lachte. So war es auch an diesem Morgen gewesen. »Du bist wirklich hübsch, Liza«, hatte er gesagt, und in seinen Augen hatten Stolz und Verlangen aufgeleuchtet. Er war der Beste von allen – dieser Kindmann, der zu ihr gehörte … Er war der beste Schütze, der beste Jäger, der Stärkste und der Tapferste, und er war obendrein klug, gleichzeitig aber auch ein Rebell, der in der Schule dauernd Probleme hatte. Obwohl er aus armen Verhältnissen stammte, waren die Mädchen ganz verrückt nach ihm, wegen seiner Größe und seiner Stärke, wegen seiner schwarzen, gelockten Haare, seiner grünen Augen und seines Humors.
Ihre Tagträume wurden jäh von den Eseln unterbrochen, die Durst hatten, die armen Tiere. Sie zogen rastlos an ihren Geschirren, während sie Liza aufmerksam beobachteten. Mit schlechtem Gewissen drehte sie an der Kurbel, an der, tief unten am Ende der Kette, der schwere Eimer baumelte. Oh, was für eine langweilige Arbeit. Das Holz schürfte ihre Hände auf, und die Arme taten ihr weh. Eine Wolke quälender Fliegen erschien wie aus dem Nichts, und der Schweiß rann ihr in die Augen und brannte wie verrückt. Man musste die Kurbel genau fünfunddreißig Mal drehen, um den schweren Eimer an die Oberfläche zu holen. Sieben Umdrehungen fehlten noch. Würde sie es denn niemals schaffen? Wenn doch nur Pieter da gewesen wäre, um ihr zu helfen.
»Einunddreißig, zweiunddreißig«, murmelte sie. Dann spähte sie über den Rand des Brunnens und blickte angestrengt in die Dunkelheit hinab. Das Wasser war zu weit unten. Es hatte seit acht Monaten nicht geregnet, und sie wusste, welch furchtbare Sorgen Granny sich machte, dass die Quelle austrocknen würde. Dieses kostbare Wasser war für sie lebenswichtig, und sie verschwendeten niemals einen Tropfen davon. Gespeist wurde der Brunnen von einem unterirdischen Fluss, der die felsigen Hügel auf dem kahlen Land ihres Nachbarn de Vries zum nahegelegenen Fluss Komati entwässerte.
Die Augen gegen das grelle Sonnenlicht zusammengekniffen, blickte sie auf und hielt Ausschau nach einer Wolke, aber der Himmel war von einem unbarmherzigen Blau, denn es war Frühling – September –, und zumindest für einen weiteren Monat bestand nur geringe Aussicht auf Regen. Um sie herum lagen die Beweise für den langen, trockenen Winter und die ungewöhnliche Dürre des vergangenen Sommers. Die Erde war gelb und verkrustet, und das Veld roch stark nach gerösteten, wilden Kräutern. Das Pampasgras war braun geworden, und die Apfelminze, die an der Tür wucherte, zu einem elenden Häufchen verwelkt. Grans Farm mit ihren bescheidenen zwanzig Morgen lag an der südafrikanischen Grenze. Dahinter erstreckte sich noch ein schmaler Streifen Land, das zum Homeland KaNgwane gehörte, und vier Meilen weiter östlich lagen die Lebombo-Berge, die Grenze zwischen dem östlichen Transvaal und Mosambik.
Heute stand ihnen ein weiterer sengend heißer Tag bevor. Es war erst neun Uhr, aber die Sonne brannte Liza bereits durch ihre Baumwollbluse auf den Rücken. Die Hühner flatterten, die Ziegen schwitzten und meckerten, und die Esel warteten unruhig darauf, aus dem Kraal in den Schatten gelassen zu werden. Sie spürte, wie sich die trockene Erde zwischen ihre Zehen bohrte, als sie die nackten Füße in den Boden drückte, um den Eimer über den Rand zu ziehen. »Vorsicht«, flüsterte sie. Sie kippte das brackige Wasser in den Trog und kehrte zum Brunnen zurück. Es war ein Gefühl, als sei sie in der Erde verwurzelt; seltsame Vibrationen durchfluteten sie, bis ihr ganzer Körper von einem Kribbeln erfasst wurde.
Eine Ameise kroch über den Rand des Brunnens; ihr großer roter Kopf zuckte, weil sie Wasser witterte. Dann blitzte plötzlich etwas Gelbes auf, ein Webervogel, der Steppengras im Schnabel hatte. Liza beobachtete, wie er den Halm in das Nest in dem Akazienbaum mit den leuchtend gelben Blüten einwob.
Schwitzend und müde kippte sie gerade den vierten Eimer in den Trog, als sie das Brummen eines näherkommenden Wagens hörte. In diesem Moment trat die alte Mrs du Toit mit blendend weißer Schürze aus dem Cottage, während sie sich die Hände an einem Tuch abwischte.
»Habe ich da einen Wagen gehört, Liza?«
Das Mädchen blickte zur Hauptstraße hinüber und runzelte die Stirn. »Da kommt jemand. Sieh nur.« Über dem Weg zu ihrer Farm schlängelte sich eine gelbe Staubwolke wie eine Natter auf sie zu.
»Heute ist Montag. Der Priester kann es nicht sein.« Gran klang beklommen, und Liza spürte, wie sich Grans Sorge sofort auf sie übertrug. Unerwartetes bedeutete normalerweise etwas Schlechtes. Liza warf den Eimer zurück in den Brunnen und kurbelte, bis ihre Schultern schmerzten und ihr Rücken zu bersten schien. Pieter hatte versprochen, Gran etwas Besonderes zum Essen zu bringen. Ob es eine Hasenpastete geben würde? Oder gegrilltes Wildbret? Oder ihr Lieblingsessen, langsam am Spieß geröstetes Wildschwein? Niemand konnte Fleisch so gut grillen wie Pieter. Es war schon eigenartig, dass ihre Gedanken in jedem freien Augenblick um ihn kreisten. War das Liebe?
Der Wagen, der sich auf ihrer schwer befahrbaren Zufahrt näherte, war mit feinem gelbem Staub bedeckt. Er schlitterte immer wieder von einer Seite zur anderen – offensichtlich war der Fahrer ein Städter – und kam nur wenige Zentimeter von der Wand des Kraals entfernt zum Stehen. Da auch die Fenster mit Staub bedeckt waren, konnte man unmöglich erkennen, wer im Wagen saß, aber wenige Sekunden später wurde die Tür geöffnet, und eine Frau stieg aus und stand einen Moment lang vollkommen reglos da. Sie sah sehr blass aus.
Liza bemühte sich, die Fremde nicht allzu offenkundig anzustarren, denn Gran hatte sie gelehrt, dass ein solches Verhalten unhöflich war. Die Frau, die in ihrem hellblauen Leinenkostüm recht elegant wirkte, war ziemlich klein und rundlich. Mit ihren dunkelblauen Augen und den leuchtend roten Lippen war sie nicht unattraktiv, sah jedoch furchtbar traurig aus, und Liza fragte sich, warum. Wenn sie Augen wie diese Frau hätte, wäre sie niemals traurig. Lizas Augen waren dunkelbraun, und sie wünschte, sie wären blau oder grün. Selbst grau wäre besser als braun.
»Du musst Liza sein«, sagte die Frau. »Liza Frank. Ich bin hergekommen, um mit deiner Granny zu sprechen, Mrs du Toit.«
Sie schien eine Menge über sie zu wissen. Lizas Neugier wuchs. Granny schien die Frau zu kennen, denn sie gab ihr ohne jedes Zögern die Hand und führte sie dann ins Haus, wobei sie sich für einen flüchtigen Moment mit einem Blick zu Liza umdrehte, der eindeutig besagte: »Bleib draußen.«
Was konnte diese elegante Städterin von ihnen wollen? Liza setzte sich auf einen Felsbrocken, starrte auf die geschlossene Tür und wünschte, sie hätte die Ohren eines Pavians. Pieter hatte ihr nämlich erklärt, die Tiere könnten schon von weiter Ferne hören, wenn sich jemand anschlich.
Starr vor Nervosität beobachtete sie, wie der Webervogel sich mit seinem Weibchen stritt, das wütend mit dem Schnabel das Nest auseinanderriss. Es war wohl nicht gut genug, und das Männchen würde noch einmal ganz von vorn beginnen müssen. Armer Vogel!
Was wollte diese fremde Frau nur hier? Liza konnte den unangenehmen Verdacht nicht abschütteln, dass im Haus über sie gesprochen wurde. In letzter Zeit tuschelten die Leute immerzu hinter ihrem Rücken, ohne dass sie den Grund auch nur erahnen konnte. Die Mädchen in der Schule kicherten und schwiegen abrupt, sobald sie den Raum betrat. Auch die Jungen waren ihr gegenüber nicht mehr so freundlich wie sonst. Die traurige Wahrheit war, dass es ihr in der Schule nicht mehr gefiel. Gestern hatte Amy sie verspottet … »Ich wette, du hast deine richtige Mutter nie zu Gesicht bekommen. Du bist nur die Ziehtochter der alten Mrs du Toit. Du weißt nicht mal, wer du bist …«
Sie hatte die törichte Häme der anderen Mädchen erfolgreich ignoriert. Warum also war sie jetzt so ängstlich? Sie schlang die Arme um den Bauch, weil sie plötzlich Seitenstiche quälten. Als Grannie die Tür hinter sich geschlossen hatte, hatte sie sich mit einem so merkwürdigen Gesichtsausdruck zu ihr umgedreht … So hatte sie auch ausgesehen, als Pieter ihren Lieblingsesel, Mavis, erschießen musste, nachdem ihm der letzte Zahn ausgefallen war und er nicht länger kauen konnte … bedauernd und traurig. Warum?
Liza, die ihre Nervosität und Neugier kaum zügeln konnte, lief ums Haus herum und hockte sich unter das Wohnzimmerfenster. Obwohl sie die Wange gegen die weiß getünchten Ziegelsteine presste, konnte sie nur Bruchstücke des Gesprächs verstehen.
»… natürlich ist das Kind schrecklich gern draußen in der Sonne… Ihre Haut ist dadurch beinahe schwarz geworden …« Grannys Stimme. »Ich sage ihr immer wieder … Kinder hören einfach nicht zu!«
War es ein Verbrechen, sonnenverbrannt zu sein? Das hatte ihr niemand gesagt. Granny bat sie ständig, ein Häubchen zu tragen. Niemand beklagte sich über Pieter, und dabei war seine Haut noch dunkler als ihre.
»Es tut mir leid …« Die Stimme der Fremden war leiser und schwerer zu verstehen. »… ausgesetzt worden … wir wussten nicht… bitte verstehen Sie, das ist sehr schmerzlich für mich.« Die letzten Worte kamen lauter, deutlicher. »Ich halte nichts von diesen schrecklichen Gesetzen … Aber die Wahrheit ist die, sie scheint farbig zu sein, deshalb darf sie nicht in einem weißen Haus leben.«
Farbig? Aber das war Unsinn! Liza ballte die Fäuste, während Angst sie wie ein heißer Stich durchzuckte.
»… es wird immer offenkundiger. Man kann es nicht länger ignorieren«, fuhr die leise, nunmehr verhasste Stimme unbarmherzig fort. »In letzter Zeit – nun, es ist Ihnen gewiss auch aufgefallen … Trotzdem ist sie auf eine eigenartige Weise schön. Es hat jedoch Beschwerden gegeben … zu viele … die Kinder in der Schule … ihre Eltern … und natürlich die Lehrer …« Die beiden Frauen mussten näher ans Fenster getreten sein, denn Liza konnte sie jetzt besser hören.
»Also, was soll jetzt weiter geschehen?« Gran schien den Tränen nahe zu sein, und Liza spürte Entsetzen und Scham in sich aufsteigen. Würde Granny sie denn nicht verteidigen?
»Wir haben Lizas Reklassifizierung beantragt. Danach werden wir sie von hier fortholen. Ich verspreche Ihnen, dass ich mein Bestes für sie tun werde.«
»Aber was wäre, wenn sie hierbliebe?« Grans Stimme verlor sich, als sei ihr selbst klar, wie sinnlos ein solcher Vorschlag war.
»Ach, meine liebe Mrs du Toit. Sie kann nicht im selben Haus leben wie Weiße – Sie kennen das Gesetz. In dieser Stadt gibt es keine Einrichtungen für Farbige. Nicht einmal eine Schule. Sie darf nicht ins Kino gehen oder mit Ihnen oder ihren Freunden ein Restaurant besuchen. Sie wäre eine Ausgestoßene.«
»Sie betritt solche Orte doch gar nicht. Wir können es uns nicht leisten …«
»Sie wird bei ihren eigenen Leuten glücklicher sein.«
»Sie ist ein liebes Mädchen. Das muss ich ihr lassen.« Grans Stimme war heiser, und sie räusperte sich.
Liza hielt sich die Ohren zu. Sie konnte es nicht ertragen, sich diese Lügen länger anzuhören. Der Schmerz in ihrem Magen verursachte ihr Übelkeit. Ihr Mund war trocken geworden, ihre Hände feucht, und ihr Atem ging in kurzen, scharfen Stößen, während ihr das Herz in der Brust hämmerte.
Was meinte sie damit… glücklicher bei ihren eigenen Leuten? Würden sie sie zu den Gammats stecken? Den Mischlingen? Das war unmöglich! Wahnsinnig! Es gab nur eine einzige farbige Familie in Nelfontein, und die vegetierte in einem heruntergekommenen Stall in der Nähe des Bahnhofs vor sich hin. Die Mutter war immer betrunken. Die rotznasigen, ständig unter Krätze leidenden Kinder stanken schlimmer als Schweine; sie bettelten in der Stadt und verteilten ihre Läuse, wo immer sie hingingen. Man würde sie bald fortbringen, hatte die Lehrerin der Klasse erklärt. »Haltet euch von ihnen fern«, hatte sie hinzugefügt. »In Nelfontein gibt es keinen Platz für solche Leute.«
Oh Gott! Was sollte nur aus ihr werden?
Liza wurde schwindelig. Alle erzählten so böse Lügen hinter ihrem Rücken. Das Getuschel und die hinterhältigen Spottworte ergaben plötzlich einen Sinn. Nichts war armseliger als ein Farbiger. Selbst die Schwarzen verabscheuten die Farbigen. Selbst Gott verabscheute sie. Aber natürlich war es nicht wahr. Sie war keine Farbige. Nein, niemals! Sie war weiß. Zusammengekauert wie ein Igel, duckte sie sich noch tiefer unter das Fenster, und während ein Beben der Scham und der Angst ihren Körper schüttelte, hatte sie nur noch den einen Wunsch, im Erdboden zu versinken.
Kapitel 2
Gefesselt von der Pracht des Velds beachtete Pieter seinen ein Stück weit vorauseilenden Freund Dan kaum. Sie gingen schon seit Jahren miteinander auf die Jagd. Dan war wie ein Teil seiner selbst; er spürte Dans Gedanken und Stimmungen, und er hatte eine intuitive Verbindung zu ihm, sodass Worte nur selten notwendig waren. Eine schwache Bewegung des Zeigefingers war genug Warnung, um auf einen todbringenden Rinkhals – eine giftige Speikobra – hinzuweisen, ein Nicken machte auf einen Affen aufmerksam, der sich in den Zweigen über ihnen verborgen hielt. Mit langen, federnden Schritten liefen sie über weite Ebenen vertrockneten Grases, auf denen Gerbera und Käferblumen rote und gelbe Flecken bildeten. Hier und da stand ein Farbkätzchenstrauch, eine Akazie oder ein hoher Marulabaum, und ab und zu stießen sie auf einen dichten Hain von Maulbeerfeigen und Fieberbäumen. Blinzelnd in dem grellen Sonnenlicht, wachsam und heftig schwitzend blieben sie gelegentlich stehen, um einen Schluck aus den Wasserschläuchen zu trinken, die sie über der Schulter trugen. Dann nahmen sie ihren Weg in östlicher Richtung wieder auf. Sie waren barfuß und trugen Khakishorts und weiße Hemden. Wasser, Mas Büchse und ihre Jagdmesser waren alles, was sie bei sich trugen, und dazu einen zusammengerollten, an ihren Gürteln befestigten Sack, in dem sie die Beute später nach Hause brachten.
Es war außergewöhnlich heiß für den Frühling, jeder Atemzug versengte die Lungen und dörrte den Mund aus – und erfüllte Pieter mit tiefem Glück. Das Buschveld war seine größte Leidenschaft, und er war auf intuitive Weise mit ihm verbunden, mit seinen Launen, seinen Gefahren und seiner quälenden Schönheit.
Gegen Mittag sahen sie eine Antilopenherde und einen jungen Kap-Greisbock, der reglos und beinahe verborgen zwischen den hohen Gräsern stand, alle Muskeln zur Flucht angespannt. Über ihnen fiel in taumelndem Flug eine Gabelracke vom Himmel und ließ sich auf den Ast eines Nyalabaums nieder, des höchsten und schönsten Baums, den es in der Umgebung gab. Ais sie sich einem See näherten, erschreckten sie eine Kolonie brütender Blutschnabelweber, die daraufhin zu Zehntausenden aufflogen, mit ihrem Geschwirre und Gezänk das Trommelfell der Jungen fast zum Platzen brachten und dann wie eine langgestreckte Rauchfahne nach Osten abzogen.
Am Rand eines Wasserlochs setzten sie sich in den Schatten und nahmen noch einige Schlucke aus ihren Wassersäcken, vollauf zufrieden damit, zu beobachten, wie das Wild schweigend aus dem Dickicht auftauchte und sich vorsichtig dem Ufer näherte. Keiner von ihnen griff nach seinem Gewehr. Sie wussten beide, dass der bittersüße Höhepunkt der Jagd stets bis zum letztmöglichen Augenblick hinausgezögert werden musste und dass es galt, dem Tag jeden Tropfen Glück abzupressen. Das eigentliche Töten der Tiere nämlich diente einzig und allein dazu, Nahrung zu beschaffen. Niemals der Freude.
Dan wetzte sein Messer an einem Stein. Es war bereits so scharf wie eine Rasierklinge, aber für ihn konnte es nicht scharf genug sein. Die beiden Jungen verdankten ihr Geschick beim Jagen Dans Großvater mütterlicherseits, der zu seiner Zeit ein berühmter Fährtensucher gewesen war. Pieter hatte Dan dafür das Schießen beigebracht, aber das war ein Luxus, denn sie beide konnten, wenn nötig, auch ohne Gewehre dem Land genug zum Leben abringen.
Pieter erhob sich träge, schlenderte zum nächstgelegenen Baum und pinkelte lässig an den Stamm. Plötzlich hörte er direkt neben sich ein Zischen, dann einen dumpfen Aufprall, als ein Messer sich in den Ast über seinem Kopf bohrte. Ein Schwanz peitschte über seine Wange, und als er aufblickte, sah er eine elegante, aber tödliche Grüne Mamba, die sich, aufgespießt von Dans Klinge, wild hin und her wand. Seine Unbedachtheit ließ ihn erröten, und er riss das Messer aus dem Holz, wischte es an der Erde ab und gab es Dan mit einigen gemurmelten Worten des Danks zurück. Dan klopfte ihm auf die Schulter.
Als die ersten Kumuluswolken über den Bäumen erschienen, machten sie sich im Laufschritt auf den Weg. Pieter ließ sich automatisch hinter Dan zurückfallen, weil dieser der bessere Fährtensucher war. Sie folgten der Spur einer Familie von Warzenschweinen, und Dan brannte darauf, den ersten Schuss abzugeben. Er griff nach dem Gewehr, zielte und feuerte. Das Ferkel taumelte und fiel zu Boden, sprang jedoch nur eine Sekunde später wieder auf und schaffte es, den Schutz dichten Buschwerks an einem Wasserlauf zu erreichen. Pieter fluchte leise. »Dein Baby«, murmelte er und wünschte, Dan hätte gewartet.
Dan ging, das Messer zum entscheidenden Stoß in der Hand, auf das Buschwerk zu. Pieter beobachtete ihn und sog mit einem Gefühl des Unbehagens, bei dem ihn eine Gänsehaut überlief, die warme Luft ein. Dan war außer Sicht, aber Pieter spürte Gefahr. Plötzlich hörte er ein gewaltiges Zornesbrüllen. Die Erde erzitterte unter hämmernden Hufschlägen, und Sträucher und Äste wurden auseinandergerissen, als Dan aus dem Dickicht auf den erstbesten Baum zurannte.
Eine riesige Büffelkuh kam in einer Staubwolke wutschnaubend aus dem Busch gestürzt, den Kopf gesenkt, den Schwanz hoch in die Luft gereckt. Etwa dreißig Meter von ihnen entfernt blieb sie stehen, warf den Kopf in den Nacken und schlug sich mit dem Schwanz auf die Flanken. Dann griff sie an.
Dan würde es niemals bis zu dem Baum schaffen – dafür blieb keine Zeit mehr. Pieter riss sein Gewehr hoch, zielte und schoss. Er sah, wie die Kugel ihr Ziel traf, aber das Tier schüttelte nur heftig den Kopf, ohne das Tempo zu verlangsamen. Pieter feuerte abermals, und die Büffelkuh stolperte – jedoch nur für einen Augenblick. Sie näherte sich Dan unaufhaltsam. In seiner Verzweiflung stürzte Pieter schreiend und mit den Armen rudernd auf das erzürnte Tier zu. Die Kuh wandte den Kopf, kam leicht von ihrem Kurs ab und hielt mit zornigen Blicken Ausschau nach dieser neuen Bedrohung. Dan sprang kopfüber in das lange Gras und blieb still liegen, während die Kuh verwirrt innehielt. Da sie Dan nicht mehr sehen konnte, schwenkte sie nach rechts und kam direkt auf Pieter zu.
Das Hämmern ihrer Hufe klang wie Donnerschläge; er konnte ihr Schnauben hören, ihre Ausdünstungen riechen und ihre blutunterlaufenen Augen sehen, während zwei Tonnen aufgebrachten Zorns sich ihm mit einer Geschwindigkeit von über sechzig Stundenkilometern näherten. Er legte den Finger fester um den Abzug, wartete jedoch noch immer. Jetzt war die Kuh nur noch wenige Schritte von ihm entfernt. In dem kurzen Augenblick, bevor sie den Kopf senkte, um ihren Gegner mit den Hörnern aufzuspießen, feuerte Pieter ihr eine Gewehrsalve in die Brust. Das wütende Tier änderte die Richtung, und Pieter traf es mit einer zweiten Salve direkt hinter der Schulter. Jetzt war die Kuh tödlich verletzt, aber es gelang ihr trotzdem, sich umzudrehen und im Dickicht Zuflucht zu suchen.
Dan kam aus dem hohen Gras hervor. »Danke«, sagte er, immer noch mit angsterfüllter Miene. Er hielt Pieter die Hand hin, und der schlug ein, wie sie es häufig zu tun pflegten, mit nach oben gereckten Daumen.
»Zwei Mal sind wir mit knapper Not davongekommen. Ein drittes Mal brauchen wir nicht«, murmelte Pieter.
Trotz ihrer Angst wussten sie, dass sie in das Dickicht gehen und die verwundete Büffelkuh töten mussten. Nach nur einigen wenigen Sekunden des Zögerns folgten sie der Blutspur. Während sie sich durch die Bresche kämpften, die das Tier geschlagen hatte, waren sie sich nur allzu deutlich bewusst, dass es im Kreis um sie herumlaufen und sich von hinten anschleichen konnte. Sie waren noch nicht sehr weit gegangen, als sie die Kuh verendet auf dem Boden liegen sahen. Ihr Kalb, das erst ein oder zwei Tage alt war, stand neben dem Kadaver, blinzelte mit seinen riesigen Augen und betrachtete jämmerlich blökend seine tote Mutter. Keiner von ihnen wollte das Kalb töten, aber sie wussten, dass sie es tun mussten.
»Es ist meine Schuld«, sagte Dan. »Ich werde es tun.« Er griff nach seinem Messer und schlitzte dem Kalb die Kehle auf. Während das Blut noch immer aus der Wunde strömte, brach ein Schakal aus seiner Deckung, um sich den Kadavern zu nähern.
Die Notwendigkeit, das Kalb zu töten, hatte ihnen den Tag verdorben. Sie brauchten mehrere Stunden, um das Büffelfleisch von den Knochen zu schneiden und es zum Trocknen in die Akazien zu hängen. Sie würden es später abholen. Schweigend verrichteten sie ihre Arbeit und packten die besten Fleischstücke ein, um sie mit nach Hause zu nehmen. Als sie sich gerade auf den Rückweg machen wollten, kam ein Rudel wilder Hunde in ihre Richtung gestürmt und entdeckte sie erst im letzten Augenblick. Heulend vor Angst machten die Hunde kehrt und verschwanden im Dickicht.
Während die blutrote Sonne hinter den Bäumen versank, sahen die beiden Jungen den ersten Geier über sich kreisen. Der Himmel war von einem noch dunkleren Rotton als die Sonne, und das wunderschöne, ätherische Zwielicht gab dem Veld ein ganz neues Antlitz. Während sie sich vom Schauplatz der Tötung entfernten, hörten sie Hyänen und Schakale, die sich über die Reste des Kadavers hermachten. Wenn die Jungen zurückkamen, um das Biltong abzuholen, das zwischen den Dornen der Akazien hing, würden am Boden zweifelsfrei nur noch die Hörner und vielleicht noch einige Schädelknochen liegen, aber kaum mehr.
***
Es war beinahe dunkel, als die beiden Mrs du Toits Cottage erreichten. Es erfüllte Pieter immer wieder mit Kummer, dass Liza unter so ärmlichen Verhältnissen lebte. Die Mauern des Hauses waren dreißig Zentimeter dick – Steine und gestampfter Lehm –, das Dach bestand aus Wellblech, und nichts an dem ganzen Bau war wirklich gerade. Aber wundersamerweise hatte das Cottage dennoch drei Jahrhunderte überstanden. Mit einem frischen Anstrich würde es vielleicht gar nicht so übel aussehen. Pieter beschloss, sich freiwillig für diese Arbeit zu melden. Der spärliche Innenraum wurde grob von Steinmauern mit alten Holztüren in drei Räume unterteilt, wobei die Küche gleichzeitig auch als Wohnzimmer diente.
Sie sortierten das Fleisch auf einem Malertisch draußen vor dem Hintereingang, und Pieter gab Gran neben dem kleinen Warzenschwein auch einen großzügigen Anteil von dem übrigen Fleisch.
Wo ist Liza?, fragte er sich. Gran wirkte niedergeschlagen. »Ist etwas passiert?«, wollte er wissen.
Mrs du Toit presste ihre zahnlosen Kiefer zusammen, sodass ihre Adlernase beinahe auf gleicher Höhe war wie ihr spitzes Kinn. Sie hatte eine Warze unter dem Mund, auf der ein dickes Haar spross, und ihre Haut sah so ausgedörrt und durchscheinend aus wie Gras vor den Regenfällen; nur dass Gras sich erholen würde, Mrs du Toit jedoch nicht, dachte Pieter.
Er überlegte, wie alt sie wohl war. Vielleicht hundert Jahre. Liza liebte sie, und aus diesem Grund liebte er sie ebenfalls, aber er musste zugeben, dass ein Fremder sie hässlich finden musste. Aber wenn man nur genau genug hinschaute, dann konnte man eine im Inneren verborgene Schönheit sehen. Ihre dunkelbraunen Augen leuchteten manchmal wie die eines jungen Mädchens, und an den meisten Tagen stand ein mitfühlendes Funkeln darin. Sie hatte dickes weißes, gewelltes Haar, das sie jedoch stets zu einem straffen Knoten zusammengebunden trug. Außerdem waren ihre Hände wunderschön, und es machte immer Spaß, ihr zuzusehen, wie sie Blumen arrangierte, auch wenn es nicht oft vorkam, dass sie welche hatte.
Dan hatte das Warzenschwein gesäubert. Jetzt legte er es auf den Tapeziertisch und stand einen Moment lang zaudernd da, bis Pieter ihm half, seinen Anteil an dem Fleisch in einen Sack zu packen. Mit einem Winken und einem kurzen Grinsen machte Dan sich davon.
»Du verwöhnst diesen Kaffer«, brummte Granny durch das Küchenfenster.
Pieter runzelte die Stirn. Sein Gesicht nahm einen hochmütigen Ausdruck an, als er Gran anfunkelte.
»Nennen Sie ihn nicht so. Er ist mein Freund«, erklärte er hitzig. Mein Blutsbruder, hätte er gern hinzugefügt, denn er und Dan waren beide von Dans Mutter gestillt worden, sie waren zusammen aufgewachsen und spielten miteinander, seit er denken konnte. Später hatte Sam ihnen beiden beigebracht, Fährten zu suchen und im Busch zu überleben. Sie hatten einander so oft gerettet, dass es zu einer Gewohnheit geworden war. Pieter hatte ein sonniges Naturell, und seine Wut hielt sich niemals lange. Schon wenige Sekunden später grinste er Gran wieder an, was ihr ein Lächeln entlockte. »Wir waren zusammen auf der Jagd, Gran. Also steht ihm die Hälfte der Beute zu. Außerdem teilt er es mit anderen. Wo steckt Liza?«
Granny schüttelte den Kopf und blickte beklommen drein. »Sie muss hier irgendwo sein«, murmelte sie.
»Dann gehe ich sie suchen.«
Tief versunken in ihre Furcht und ihren Zorn, hatte Liza Pieters Schritte nicht gehört. Sie blickte in den Spiegel, den sie in den hinteren Teil des Kraals getragen hatte, und befingerte ihr glattes schwarzes Haar. Gammats hatten krauses Haar, oder nicht? Als sie eine Hand auf ihrer Schulter spürte, zuckte sie zusammen, dann blickte sie in Pieters geliebtes Gesicht, das so rund wie ein Apfel war. Er blickte mit einem besorgten Funkeln in den grünen Augen auf sie hinunter. Einen Moment lang vergaß sie ihren Schmerz und sah ihn liebevoll an.
»Oh, Pieter, du bist so spät dran«, sagte sie. Sie stand auf und schlang ihm die Arme um den Hals. Er roch gut, eine Mischung aus seinem ganz besonderen, nach Moschus duftenden Schweiß, Tabak und dem würzigen Geruch von Veldkräutern. Sie strich ihm über den schwarzen Flaum, der vor einiger Zeit auf seinen Wangen und seinem Kinn erschienen war.
»Jeder Mann würde sich über eine solche Begrüßung freuen.« Er legte die Arme um sie und griff nach dem Spiegel. »Findest du nicht, dass ich göttlich aussehe, Darling?«, fragte er mit Fistelstimme, klimperte mit den Wimpern und strich sich übers Haar.
Sie lachte, aber dann brach ihr Elend mit einer Wucht über sie herein, die ihr den Atem nahm. Wenn sie farbig war, konnte sie Pieter für alle Zeit vergessen! Aber das war Wahnsinn. Es war nicht wahr. Sie war weiß!
»Ach, Pieter…« Als sie ihm von ihrer schrecklichen Not erzählen wollte, konnte sie sich jedoch nicht dazu überwinden, etwas derart Schändliches auszusprechen, auch wenn es eine Lüge war.
»Ach, ich wünschte, ich wüsste, wer ich bin«, stieß sie hervor und kämpfte mit den Tränen. »Ich wünschte, ich wüsste meinen Namen. Ich sehne mich so danach, meine wahre Familie zu finden.«
Pieter wirkte erheitert. »Eines Tages werde ich dir dabei helfen. Habe ich dir das nicht versprochen? Komm und sieh dir an, was ich mitgebracht habe … etwas ganz Besonderes.«
Er grinste und griff nach ihrer Hand. Da sie Gran jedoch nicht gegenübertreten wollte, machte sie einen Schritt rückwärts. Plötzlich zerrten sie aneinander – ein altes, vertrautes Spiel. Nur dass Liza heute nichts Kämpferisches hatte; sie war im innersten Mark getroffen. Schließlich ließ sie sich in die Küche ziehen, wo Gran bereits über dem Holzofen Leber briet. Ach, Pieter, wirst du mich auch noch lieben, wenn du die bösen Lügen hörst, die man sich über mich erzählt? Sie schloss ihren Kummer in sich ein, bis ihr ganzer Körper bebte und zitterte.
Granny warf einen schnellen, durchdringenden Blick in ihre Richtung. Sie weiß, dass ich gelauscht habe. Liza wandte sich nervös ab. Alles sah noch genauso aus wie immer, und doch war es völlig verändert, denn sie selbst fühlte sich den Dingen mit einem Mal entfremdet. Sie betrachtete die vertrauten Bilder an den Wänden: Die Kabinettsminister, die in ihren dünnen schwarzen Rahmen ernst und herablassend wirkten, das Bild von Grans bärtigem Großvater, einem Kommandanten im Burenkrieg. Grans Vater, bleich und ausgezehrt, der im Ersten Weltkrieg in Flandern verwundet worden war, und ihr Mann, der im Zweiten Weltkrieg in Tobruk gefallen war. Liza hatte sie alle adoptiert, denn eigene Verwandte besaß sie nicht, aber heute schienen die Augen all dieser Menschen zu sagen: »Was hast du hier zu suchen, Liza? Dies ist ein ordentliches weißes Haus.«
Auf dem Zementstein an der Spüle lag ein Warzenschweinferkel von etwa vier Monaten, den Mund zu einem lautlosen Schrei geöffnet, die Augen in abgrundtiefer Verzweiflung verdreht. Liza, die der Anblick eines säugenden Schweins stets begeistert hatte, erschauerte. Die eigenartigsten Gefühle wirbelten durch ihren Kopf und verursachten ihr eine Gänsehaut. Sie hätte dieses Schwein sein können. Da sie keine Ahnung hatte, wer sie war, hätte sie ebenso gut alles Mögliche sein können. Die Geburt war ein reiner Zufall. Sie fühlte sich eins mit allen Opfern, denn war sie nicht ebenfalls ein Opfer? Noch vor wenigen Stunden hatte sie sich so sicher gefühlt. Sie mochten arm sein, aber sie waren die Aristokraten der Natur, weil sie weiß waren! Und jetzt sagten die Leute, sie sei eine Gammat? Sie blickte sich beschämt um. Konnten sie ihre Gedanken hören? Gran rührte in der Soße, und Pieter beobachtete sie. Er sah hungrig aus. Wenn Gran doch nur irgendetwas sagen würde.
Während sich die Fragen in ihrem Kopf überschlugen, ging Liza in ihr Zimmer und legte ihren Spiegel wieder auf den Schrank, konnte jedoch den Drang nicht bezähmen, noch einmal hineinzuschauen. Sie sah ein erschrockenes Mädchen mit gehetztem Gesichtsausdruck und Augen ähnlich denen einer verängstigten Antilope, das Haar so schwarz und glatt wie die Mähne eines Löwen und mit Nasenlöchern, auf die nur ein Nilpferd hätte stolz sein können. Während sie voller Abscheu ihre Haut begutachtete, stellte sie fest, dass sie die gleiche Farbe hatte wie Pieters altes Armeehemd, ein Erbstück seines verstorbenen Großvaters. Warum hatte sie sich nur je für hübsch gehalten? Vielleicht, weil so viele Jungen in der Schule es gesagt hatten.
»Das bin ich«, flüsterte sie. »Du bist ich. Aber wer bin ich wirklich?« In ihrem Kopf begann es erschreckend zu hämmern, und ihr ganzer Körper brannte. Dann rief Gran sie an den Tisch.
Nicht einmal die saftige Leber, zu der es gebratene Tomaten und Zwiebelsoße gab, konnte ihre Stimmung heben. Während Pieter die hinter ihm liegende Jagd in allen Einzelheiten beschrieb, hörte Liza nur stumm zu. Ihr Magen hatte sich zusammengekrampft, und sie konnte nicht schlucken. Sie saß am Tisch, blickte auf ihre Hände hinab und drehte sie bald in diese, bald in jene Richtung, um sie in dem schwächer werdenden Licht besser betrachten zu können. Warum war ihr niemals aufgefallen, wie blassgelb ihre Haut war? Warum gab Gran ihr nicht die Sicherheit, die sie jetzt so dringend brauchte? Sie hatte kein einziges Wort über den Besuch der fremden Frau verloren. Schließlich sagte sie: »Gran, wer war diese Frau, die heute hergekommen ist?«
»Mrs Frank von der Abteilung für Sozialfürsorge.«
Frank? Aber genauso hieß sie auch. »Was wollte sie?«
»Es ging um meine Pension.« Gran versuchte zu lächeln, brachte jedoch nur eine schiefe Grimasse zustande. Warum log sie?
Liza stand auf, rannte in ihr Zimmer und schlug die Tür hinter sich zu. Nach einer Weile hörte sie Pieter ans Fenster klopfen.
»Ein Mann kann ohne seinen Gutenachtkuss nicht schlafen gehen«, flüsterte er durch die Ritze.
»Ich bin müde«, zischte sie.
Er drückte Nase und Lippen gegen das Glas, schielte ausgiebig und drückte einen lauten, schmatzenden Kuss auf die Scheibe. »Oh! Kein Kuss?« Als er keine Antwort bekam, runzelte er verwirrt die Stirn. Dann sprang die Katze auf das Fenstersims, und Pieter packte sie und tänzelte mit ihr durch den Garten. »Zumindest das Kätzchen liebt mich«, rief er. »Schlaf gut.«
Wenn sie doch nur hätte schlafen können! Aber die schreckliche Wirklichkeit ließ ihr keine ruhige Minute. Sie wünschte sich verzweifelt, an ihre richtige Familie denken zu können, aber sie besaß nichts anderes als eine vage Erinnerung an Augen, die so blau waren wie der Himmel, an Haar von der Farbe von Weizen und an jemanden, der sie auf dem Arm getragen hatte. Sie wusste, dass man sie in der Nähe des Polizeireviers von Nelfontein ausgesetzt und dass der Beamte von der Sozialfürsorge sie in Grannys Obhut gegeben hatte, als sie vier Jahre alt gewesen war. Das hatte Granny ihr erzählt. Aber ihr kam es so vor, als hätte sie ihr ganzes Leben bei Gran in diesem winzigen Cottage gelebt.
Gran wurde für ihren Unterhalt bezahlt. Sie gingen oft zusammen zum Postamt, um das Geld abzuholen. Sie war ein Mündel des Staats, das hatte sie oft genug gelesen, aber bedeutete das, dass der Staat das Recht hatte, sie aus ihrem Zuhause fortzureißen und zu den Gammats zu stecken? Immer wieder stellte sie sich vor, wie die Mädchen in der Schule spotten würden, wenn sie davon erfuhren. Sie begrub den Kopf in ihrem Kissen, um ihr Schluchzen zu ersticken. Mit tränenüberströmten Wangen schlief sie schließlich ein.
Kapitel 3
Unter einem sternenübersäten Himmel war das Buschveld noch in Dunkelheit gehüllt, aber im Osten leuchtete bereits das erste schwache Grau auf. Unter einem Lavendelbaum auf einem Felsvorsprung nicht weit von Grans Cottage entfernt erbebte ein Sack, der sich kurz darauf wand und krümmte. Aus dem Sack kam ein schriller, erschreckender Laut von durchdringender Klarheit. Wie zur Antwort darauf stieß ein Frankolin sein Kroah-kroah aus, um die Morgendämmerung anzukündigen. Im selben Moment stimmten dann auch die Vögel ihren Morgengesang an, bis die ganze Luft von ihrem lärmenden Gezwitscher erfüllt war. Über den Bergen wurde das Grau zu einem blutroten Flecken und überzog das Land mit einem eigenartigen, rätselhaften Schimmer.
Von einem Moment auf den anderen öffnete sich der Sack, und Dans Kopf, so schwarz wie die Nacht, lugte daraus hervor. Ein Nashornvogel kam herabgeflattert und betrachtete den Jungen, der sein Freund war, mit wacher Aufmerksamkeit. Dan grinste den Vogel an, dass seine weißen Zähne im Zwielicht blitzten, dann lehnte er sich wieder an den silbrigen, glatten Baumstamm, angelte seine Blechflöte aus der Tasche und stimmte einen Freudengesang auf den herrlichen Morgen an, auf die Vögel, die ihm zuzwitscherten, auf den Nashornvogel, den er gezähmt hatte, und auf die wilde Melone, die ihm die Füße wärmte. Schließlich verdrängte der Hunger das Glück. Dan schob die Flöte zurück in die Tasche, brach die Melone auf, warf dem Nashornvogel die Kerne hin und schob sich das bittersüße Fruchtfleisch in den Mund. Der Saft lief ihm kitzelnd übers Kinn und dann am Hals hinunter.
Er stand auf, reckte sich und schlenderte zu dem Cottage, in dem Liza lebte. Mrs du Toit war früher auf den Beinen als gewöhnlich, was ärgerlich war, da er die Absicht gehabt hatte, ein Ei zu stehlen.
»Guten Morgen, Dan«, rief sie ihm zu. »Hol mir etwas Holz aus dem Schuppen. Nimm so viel, wie du mit einem Mal tragen kannst.«
Dan holte widerstrebend und mit grollender Miene das Holz.
»Hier ist noch etwas Maisbrei, der vom Abendessen übriggeblieben ist«, sagte sie und löffelte eine große Portion Brei auf einen Zinnteller, als wolle sie damit seine Arbeit bezahlen.
»Nein, danke, Mrs du Toit, ich möchte lieber nichts essen«, sagte Dan so höflich, wie er nur konnte. In seinem Innern brodelte es. Er arbeitete nicht für sie, warum also gab sie ihm immer wieder Aufträge? Die Weißen waren alle gleich, sie hielten jeden Schwarzen für ihren Diener. Er trollte sich, bevor sie noch weitere Arbeit für ihn fand.
Während Aletta du Toit beobachtete, wie Dan zum Kraal hinüberschlenderte, stieg Arger in ihr auf, wie immer geschah, wenn er in der Nähe war. Es hatte etwas mit seinen riesigen, glänzenden Augen zu tun, die sie kritisch zu mustern schienen, und mit seinen Lippen, die für gewöhnlich zu einem schwachen Lächeln verzogen waren. Sein Haar erhob sich zu einer dichten, drahtigen Masse auf seinem Kopf, als wolle es nach den Sternen greifen. Er pflegte so stolz und aufrecht umherzulaufen, als gehöre ihm die ganze Welt. Und was für eine Unverschämtheit, sie Mrs du Toit zu nennen. »Missus« war die traditionelle Anrede für sie, aber dieser Junge hatte nur Frechheiten im Kopf. Für seinesgleichen war Brei nicht gut genug. In Alettas Augen war Dans Bemühen, höflich zu sein, nichts anderes als eine verschleierte Beleidigung.
»Du bist genau wie dein Vater«, rief sie ihm nach. »Viel zu clever, als gut für euch ist. Und wohin haben ihn sein Verstand und sein überlegenes Gehabe gebracht?«
Sie wandte sich ab und kehrte zum Herd zurück. Ein Eingeborener war ein Eingeborener, und als solchen respektierte sie ihn. Jeder Schwarze konnte sich in einer Notsituation an sie um Hilfe wenden, aber wenn sie anfingen, die Weißen nachzuäffen, sah sie rot. Der Ursprung all dieser Probleme war Dans Großmutter, Nosisi, die sogenannte Sangoma, wie die Eingeborenen ihre Medizinmänner und Kräuterhexen nannten.
Die Arme in die Hüften gestemmt, beobachtete sie Dan, wie er an den Eseln vorbeispazierte, so unschuldig, wie man es sich nur wünschen konnte, als wüsste er nicht, wo die grau gefleckte Henne ihre Eier versteckte. Sie beschloss, die Familie de Vries auf Dans schlechtes Benehmen anzusprechen. Dann verbannte sie den Jungen aus ihren Gedanken und richtete ihre Aufmerksamkeit wieder dem Holzofen zu, der morgens stets ein wenig unberechenbar war. Kurze Zeit später war der Kessel heiß, und der Porridge blubberte vor sich hin.
***
Auf der Nachbarfarm schlief Pieter länger als gewöhnlich. Der Geruch von Kaffee und das leise Gepolter seiner Mutter, die in der Küche arbeitete, weckten ihn. Mit schlechtem Gewissen stieg er aus dem Bett. Er zog sich ein T-Shirt und Shorts an und ging hinaus. Es würde ein herrlicher Tag werden. Der Himmel war von einem zarten Safranton, die Lebombo-Berge leuchteten purpurn, die Luft war so seidig, dass jeder Atemzug zu einer Wonne wurde, die Frühlingsblumen hatten die Felsen und die sandfarbene Erde mit einem weißen Teppich überzogen, und der Piet-myn-vrou-Kuckuck sang sich vor Freude über den neuen Tag das Herz aus dem Leib.
Die Esel schrien, und Pieter trottete zum Schuppen hinüber. Er schüttete etwas Futter in einen alten Paraffinbehälter und schleppte ihn zum Kraal hinüber, wo er für eine Weile stehen blieb. Er liebte den moschusartigen Geruch der Esel und ihr raues Fell. Von den zehn Eseln waren Jacob und Lady die ältesten und damit die Anführer der kleinen Herde. Lady wurde langsam zu alt für die Arbeit. Ihre langen braunen Zähne waren abgekaut und fielen einer nach dem anderen aus. Er dachte, wie schön es wäre, sie zum Grasen hinauslassen zu können, aber wenn man arm war und selbst um jeden Bissen kämpfen musste, war kein Platz für Sentimentalitäten. Das Leben ist hart, dachte er niedergeschlagen. Gerade wenn ein Tier perfekt ausgebildet war, musste man es erschießen. Um nichts in der Welt hätte er zugegeben, dass er diesen alten Esel liebte.
Die Tiere drängten sich von allen Seiten an ihn, bis er das Gleichgewicht verlor. Er fiel in die Dornen. »Autsch! Eines Tages werde ich einen neuen Kraal bauen«, murmelte er. Ihrer war zu baufällig; die eine Seite bildete eine eingestürzte Steinmauer und die andere eine Wand aus Akazienzweigen. Aber der Kraal erfüllte seinen Zweck, denn die zweieinhalb Zentimeter langen Dornen der Akazie reichten völlig aus, um zehn launische Esel in Schach zu halten.
Ihre Farm war groß, gut neunhundert Hektar, aber sie bestand größtenteils aus Felskopjes, kleinen Felskuppen, Kiesflächen und schlechtem Weideland. Es gab lediglich zwei fruchtbare Äcker, auf denen sie Gemüse und Tomaten anbauten. Das war nicht genug, um davon leben zu können. Sein Vater stand als Farmvorarbeiter in Diensten der Cronjes; er überwachte ihre riesigen Zucker- und Tomatenplantagen. Für ihre eigene Farm blieb ihm keine Zeit, aber sie hatten ja Sam, Dans Großvater, und vor und nach der Schule half auch Pieter mit. Jetzt hörte er seine Ma aus der Küche rufen.
»Der Kaffee ist fertig, Pieter. Nimm dir einen Zwieback«, sagte sie, als er hineinkam. »Ich habe sie gerade gebacken.«
Sie brach ab und musterte ihn mit Augen voller Mitgefühl.
»Hör mal, Pieter, ich habe schlechte Neuigkeiten für dich«, begann sie. »Es ist besser, wenn du es von mir hörst und nicht von jemand anderem. Jeder redet inzwischen darüber, daher wirst du es ohnehin erfahren. Die Mädchen in der Schule und ihre Eltern haben sich beschwert, weil Lizas Haut so dunkel geworden ist. Verstehst du, sie wurde als Kind ausgesetzt, und niemand hat je erfahren, wer ihre Eltern waren.«
Sie warf einen schnellen Blick in Pieters Richtung und sah, dass er mit leidenschaftsloser Miene die Wand anstarrte. Er hatte seine Gefühle noch nie offen gezeigt, aber wenn er einen derart leeren Gesichtsausdruck hatte, dann litt er, wie sie aus Erfahrung wusste.
»Damals sind die Behörden davon ausgegangen, dass sie weiß war. Jetzt, da sie älter wird, sieht es zunehmend so aus, als sei sie es nicht. Die Leute erzählen sich, dass sie als Farbige reklassifiziert werden solle. Man wird sie zu ihren eigenen Leuten schicken. Was für eine Schande. Es tut mir so leid, dass ich diejenige bin, die dir das sagen muss.« Sie legte Pieter eine Hand auf die Schulter.
Pieter schüttelte sie ab und ging hinaus. Er trat in den Kraal und streichelte geistesabwesend einen Esel, während es in seinen Ohren rauschte und sich ein hohler Schmerz in seinem Magen ausbreitete. Von einem Moment auf den anderen war er in einen Zustand katapultiert worden, in dem nichts mehr real schien. Liza eine Farbige? Das war verrückt. Und Ma redete so, als sei es eine feststehende Tatsache. Glaubte sie das wirklich? Ja, dachte er, sie glaubte es offenkundig. Und Lizas Haut war tatsächlich dunkel. Monatelang hatte er das Offensichtliche vor Augen gehabt, ohne es je zu bemerken. Der Schock kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Wie konnte so etwas geschehen? Während er an seinen Fingernägeln kaute, versuchte er, die schlimme Neuigkeit zu verarbeiten. Ohne lange nachzudenken, machte er sich auf die Suche nach Sam, der für ihn weniger ein Arbeiter, sondern vielmehr ein Freund war. Als er die Hütte des alten Mannes erreichte, kam Sam gerade herausgehumpelt. Er schob sich das Hemd in die Hose und blinzelte.
»Was ist los, Pieter?«, fragte er, da er den Kummer des Jungen sofort bemerkt hatte.
»Hast du gehört, was man über Liza sagt?«
Als er Pieters Schmerz sah, stieg Traurigkeit in ihm auf. »Natürlich habe ich davon gehört, aber niemand weiß es mit Sicherheit, und das ist die Wahrheit. Die Leute können nur Vermutungen anstellen. Ich bin davon überzeugt, dass sich eine Lösung finden wird. Du bist doch für die Schule viel zu früh dran, wie wär’s also, wenn du mir ein wenig zur Hand gehst?«, fügte Sam hinzu und wünschte, er hätte dem Jungen etwas Hilfreicheres sagen können.
Sie mussten warten, bis die Esel gefressen hatten. Dann spannten sie die zehn Tiere paarweise hintereinander an. Nur die beiden Leittiere wurden mit Zaumzeug ausgestattet, während sie den anderen nur einen alten Lederharnisch umlegten. Mittlerweile kannten die Esel ihre Aufgabe so gut, dass sie sie mit geschlossenen Augen verrichten konnten. Sam pfiff und schnalzte mit der Zunge, und Pieter drückte das Tor auf und führte die Esel zu dem Pflug, der vor dem Cottage der de Vries lag. Er befestigte die Esel mit Ketten an der Deichsel des Pfluges, umfasste die hölzernen Griffe und rief den Tieren etwas zu. Die Esel legten die Ohren an, verdrehten die Augen und setzten sich in Bewegung.
Normalerweise erfüllten das scharfe Klatschen des Leders, das Klipp-Klapp der Hufe, die Erregung der Esel und das erwachende Veld Sam mit einer Woge des Glücks, aber Pieters Schmerz hatte ihm den Morgen verdorben. Sam liebte den Jungen, und er tat ihm leid. Er war so stolz und erfüllt von überschäumender Hoffnung und Selbstbewusstsein, aber seine Familie besaß so wenig – sie waren praktisch arme Weiße. Diese Stadt wird ihn zerstören, dachte er, geradeso, wie sie meinen Victor zerstört hat.
Für eine Weile verlor er sich in Erinnerungen an seinen einzigen Sohn, Victor, der versucht hatte, das System zu stürzen. Es war alles seine Schuld. Sam war Schullehrer gewesen und voller hehrer Ideen für Veränderungen und Freiheit, die Victor zu stark beeindruckt hatten. Jetzt verbüßte sein Sohn eine lebenslängliche Zuchthausstrafe mit Zwangsarbeit auf Robben Island. Nach der Verhandlung seines Sohns hatte Sam den Lehrerberuf an den Nagel gehängt und die Frau und das Baby seines Sohnes auf die Farm der de Vries’ gebracht, an seinen eigenen Geburtsort. Er hatte dort eine Hütte bezogen, und bekam für seine Arbeit einen jämmerlichen Lohn sowie zu essen. Victors Frau hatte ebenfalls für Mrs de Vries gearbeitet, bis sie in die Stadt gegangen war und ihren Sohn, Dan, im Stich gelassen hatte. Also hatte Sam Dan und Pieter beigebracht, wie man jagte und im Busch überlebte, wie man ein Feld pflügte und hundert andere Dinge, die Jungen wissen mussten. Früher einmal waren die beiden unzertrennlich gewesen, aber in letzter Zeit trieb der gesellschaftliche Druck sie auseinander.
Sam seufzte. Er bekam Pieter jetzt nicht mehr oft zu Gesicht.
Während sie die lange Bahn über das Feld in Angriff nahmen, dachte Sam über die Weißen und ihre eigenartigen Gebräuche nach. Nelfontein war eine so hübsche Stadt, wie man es sich nur wünschen konnte, mit Blumen und Bäumen entlang der Gehwege und grasbewachsenen Flächen. Ja, wenn es darum ging, eine Stadt zu verschönern, wussten diese Leute tatsächlich, was sie taten, dachte Sam verbittert. Die Buren hatten einen Blick für Schönheit. Die fleißigen Farmer mit ihrer ausgeprägten Begabung für Ordnung und Sauberkeit hatten ihren Teil des afrikanischen Kontinents gezähmt. Alles arbeitete für sie … Sogar das Land, und was immer arbeitete, durfte bleiben. Daher gestatteten sie sogar den Nilpferden, ungehindert im Fluss zu weiden. Und warum…? Weil die Nilpferde das wuchernde Unkraut niedrig hielten. Selbst die Krokodile, die zwischen hohen Binsen lauerten und sich entlang sandiger Ufer die Sonne auf den Panzer brennen ließen, hatten im System des weißen Mannes ihren Platz, sodass auch sie bleiben durften.
Schwarze wie er durften bleiben, wenn sie Jobs hatten, denn ihr Nutzen lag in ihrer Arbeit. Also wurden sie registriert, man nahm ihnen die Fingerabdrücke ab, versorgte sie mit Pässen und gestattete ihnen, auf weißem Land zu arbeiten und dort, wenn nötig, auch zu schlafen. Die Übrigen wurden in das Homeland ihres Stammes verbannt, nach KaNgwane, wo ihre Familien lebten. In den weißen Städten lebten Schwarze und Weiße in einer eigenartig symbiotischen Beziehung, Herren und Diener, wobei der eine die Bedürfnisse des anderen befriedigte, und solange man das System nicht anfocht, funktionierte es.
Eine Weile dachte Sam über Liza nach und fragte sich, womit er den Jungen vielleicht trösten konnte. Die Nachricht von ihrer misslichen Lage hatte sich wie ein Lauffeuer in der Stadt verbreitet. Sie hatte, vermutete Sam, keine allzu großen Chancen, in Nelfontein zu bleiben. Die Buren waren ein harter, schlauer, sturer Schlag, deren Prioritäten einer unverrückbaren Ordnung folgten – an erster Stelle kamen ihr Gott und ihre Moralvorstellungen, dann ihre Familie, dicht gefolgt von ihrem Land und ihrer Regierung. Für Menschen außerhalb ihres Laagers, ihrer Wagenburg, hatten sie nur wenig Mitgefühl. Während Sam hinter dem Pflug hertrottete und weder seiner Arbeit noch dem Verstreichen der Zeit große Beachtung schenkte, stürmten düstere Gedanken wie ein Heuschreckenschwarm auf ihn ein.
Die Esel wussten jetzt, was zu tun war. »Zeit für die Schule«, rief Sam Pieter zu. »Und lass dich von den weißen Jungs nicht beleidigen.« Während Pieter Lady zum Abschied einen Klaps auf die Flanke gab, sie hinterm Ohr kraulte und eine Möhre für sie aus seiner Tasche hervorkramte, wünschte Sam, er hätte den Jungen nicht so gerngehabt.
Kapitel 4
Pieter entdeckt Liza schon aus einiger Entfernung. Sie saß auf einem großen Steinbrocken am Rand der Hauptstraße, den Kopf in die Hände gestützt, die Schultasche achtlos neben sich auf den Boden geworfen. Als er näher kam, sah er ihr bleiches Gesicht und die Ringe unter ihren Augen. Die Scham, die ihr ins Gesicht geschrieben stand, sprach sie schuldig. Warum musste sie mit einer solchen Armesündermiene herumlaufen? Was war los mit ihr? Sie war immer noch seine Liza, oder? Er blendete die Realität aus seinen Gedanken aus und beschloss, so zu tun, als sei alles normal.
»Hey, Liza. Wessen Beerdigung soll das sein?«, neckte er sie. Sie reagierte nicht, sondern starrte nur in sich zusammengesunken auf ihre Füße, während ihr das Haar übers Gesicht fiel.
Vielleicht war der Versuch, zu scherzen, nicht die richtige Methode. Er ging neben ihr in die Hocke, legte die Arme um sie und strich ihr das Haar aus der Stirn.
»Bitte, schau nicht so traurig drein, Li. Du darfst nicht zulassen, dass sie dich so sehen. Wo bleibt dein Mut?«
Sie ließ den Kopf noch tiefer sinken, sodass ihr Gesicht vollends unter den Haaren verschwand.
»Wen schert es, was sie denken? Stöcke und Steine können dir die Knochen brechen, aber Worte nicht«, rasselte er das alte Sprichwort herunter, brach dann jedoch jäh ab. Es war nicht die Wahrheit. Die Mädchen in der Schule waren schon immer eifersüchtig auf Liza gewesen, und jetzt hatten sie eine geeignete Waffe in der Hand, um sie zu verletzen und zu vernichten, um sie für ihre Schönheit zu bestrafen.
»Du bist immer noch für alle hier dieselbe Liza«, fuhr er fort. Aber auch das traf nicht zu, nicht einmal auf ihn. Es war nicht so, dass seine Gefühle für sie sich verändert hätten. Aber sie war anders … anders als das Bild, das er immer von ihr gehabt hatte, sodass er es nicht verhindern konnte, sie eine Spur anders zu sehen.
Ein Lastwagen hielt an. Es war Mr Brits, der mit einer Ladung Tomaten auf dem Weg zum Bahnhof war. Pieter stieg auf den Vordersitz und half dann Liza hinauf. Glücklicherweise schien sie den forschenden Blick nicht zu bemerken, den Mr Brits ihr zuwarf. Es hatte sich also bereits herumgesprochen …
Ohne etwas von Pieters Verwirrung gespürt zu haben, fühlte Liza sich durch seine Nähe beschützt. Gran hatte darauf bestanden, dass sie heute ihr zweitbestes Kleid trug, das aus einem hübschen, blau geblümten Baumwollstoff gemacht war und einen Rüschensaum hatte. Die Kleider, die Liza gewöhnlich trug, hatte Gran aus gebleichten Maissäcken genäht, und die Mädchen zogen sie stets deswegen auf. Ihr bestes Kleid war aus rosafarbenem Musselin, und sie durfte es nur zur Kirche anziehen. Selbst sonntags musste sie das kostbare Kleidungsstück ablegen, sobald sie wieder zu Hause waren, und noch bevor sie Luft holen konnte, lag es auch schon im Waschzuber. Diese simple Geste der Freundlichkeit am Morgen sagte Liza, dass Gran sich angesichts ihres Martyriums auf ihre Seite gestellt hatte.
Liza machte sich keine Illusionen darüber, was ihr in der Schule bevorstand. Sie würde geächtet, verspottet, geschnitten und beschimpft werden. Bisher hatte sie die Verachtung der anderen Mädchen stoisch ertragen, wohl wissend, dass das Recht auf ihrer Seite war. Aber jetzt …? Sie wusste nicht länger, wer oder was sie war.
»Lieber Gott, gib nur, dass ich nicht vor Scham sterbe«, flüsterte sie. Wenige Minuten später stieg Liza mit vor Furcht zusammengekrampftem Magen aus dem Lastwagen und zwang ihre Beine, auf die Schule zuzugehen.
»He, willst du dich gar nicht von mir verabschieden?«, rief Pieter ihr nach. Dann fiel ihm sein Geschichtsaufsatz wieder ein. Er hätte heute abgegeben werden müssen, aber der Lehrer würde ihn nicht nachsitzen lassen können, weil die Schule früh schloss. Der alte Cronje wollte eine Rede halten, und danach würde es eine Parade und einen Wettbewerb im Luftgewehrschießen geben sowie einen Preis für den besten Schützen. Pieter besaß kein Luftgewehr und konnte daher nicht an dem Wettbewerb teilnehmen. Er war zu jung, um einen Waffenschein für ein Gewehr zu bekommen, und mit Mas uralter Waffe an dem Wettbewerb teilzunehmen, wäre vollkommen illegal gewesen – und deswegen konnte er sie kaum mit in die Schule bringen.
Der Preis war ein brandneues Rennrad, das auf dem Podest vor der Zuschauertribüne am Sportplatz der Schule stand. Es war ganz leicht, aber robust genug, um damit selbst über die holprigsten Wege zu fahren, und der metallisch blaue Stahlrahmen funkelte verheißungsvoll. Es hatte neun Gänge, der Ledersattel war gefedert, die Klingel verchromt, und die Rücklichter blinkten im Sonnenlicht. Vor dem Morgengebet ging Pieter zu dem Rad hinüber, um es in Augenschein zu nehmen. Er wusste, dass es ihm niemals gehören würde, aber dennoch konnte er den Blick nicht davon losreißen. Außerstande, sich zu beherrschen, stieg er auf das Podest und strich mit den Händen über den Siegespreis.
»Du hast wohl die Absicht, es zu gewinnen, wie, Pieter?«, erklang direkt hinter ihm eine Stimme. »Dann lass uns mal dein Gewehr sehen. Du willst uns wohl allen zeigen, wie man richtig schießt?«
Es war Tony, der mit Abstand reichste Junge in der Schule, was wohl ein Glück für diesen mageren, bleichgesichtigen Zwerg war, überlegte Pieter. Seine hellblauen Augen glänzten, und seine blassen Lippen waren zu einem hässlichen Grinsen verzogen.
Es war ungerecht, dass die Farm des alten Cronje, die an die seiner Ma angrenzte, so fruchtbar war, während sie selbst ebenso wie Mrs du Toit fast nur steiniges Land, das kaum Ernte trug, ihr Eigen nennen konnten. Abgesehen von seiner Farm gehörten Cronje mehrere Zuckerplantagen und eine Zeitung in Johannesburg. Dazu kamen einige Werkstätten im Homeland KaNgwane, die Cronje großzügige Steuerersparnisse verschafften, und eine Abfüll- und Packanlage irgendwo auf dem Reef– sodass man sich nicht wundern musste, dass Cronje so selbstherrlich war und sein Sohn so verwöhnt. Cronje war außerdem der Bezirkskandidat der Unabhängigen Opposition. Das war der eigentliche Grund für seine Rede an diesem Tag. Streng genommen sollte er über Umweltschutz sprechen, denn auf dem Schulgelände durfte nicht über Politik geredet werden, aber Pieter wusste, dass Cronje hier und da ein wenig Propaganda in seine Ansprache einfließen lassen würde.
Pieter blickte über die Schulter und funkelte Tony an, der heute mehr Mut zu haben schien als sonst, vielleicht weil sein Vater in die Schule kam. »Hast du dein Gewehr vielleicht in deinem Maissack versteckt?«, verhöhnte er Pieter. Einige der Jungen stimmten in Tonys Gelächter ein, denn sie wussten, dass Pieter sehr stolz war und es hasste, dass seine Hemden aus gebleichten Maissäcken genäht waren und niemals richtig passten. In der vergangenen Woche hatte einer der Jungen gesehen, wie Pieter mit Hilfe seiner Steinschleuder einen Hasen betäubt hatte, was neuerlichen Spott heraufbeschwor. »Hast du deine Zwille mitgebracht, Pieter? Willst du damit gewinnen?« – »Bitte doch deinen Kaffernfreund, dir seinen Speer zu leihen.«
Dann wurden sie noch hämischer, und die unerwartete Grausamkeit ihrer Worte ließ Pieter erstarren: »Deine Freundin ist eine Farbige. Das wissen alle! Man wird sie reklassifizieren.«
Er fuhr herum, um zu sehen, wer gesprochen hatte. Es war Johan, Tonys Freund. »Entschuldige, würdest du das wiederholen? Ich habe dich nicht verstanden.«
»Na klar. Ich habe gesagt, dass dein Mädchen …« Weiter kam er nicht. Eine Woge glühenden Zorns verlieh Pieter Schnelligkeit und Stärke. Im nächsten Moment wälzten sie sich auf dem Boden, und die Jungen um sie herum feuerten sie an.
Ein Schlag in den Magen, der für Pieter überraschend kam, raubte ihm den Atem. Wütend schlug er um sich, boxte und trat. Ein übelkeiterregendes Knirschen war zu hören, gefolgt von einem gequälten Aufheulen. Plötzlich verstummten die Jungen, die sie angefeuert hatten.
»Du hast mir die Nase gebrochen! Verdammte Scheiße, du hast mir die Nase gebrochen, du Arschloch!«, rief Johan, der sich die Hände aufs Gesicht presste. Dann warf er einen Blick auf die warme rote Flüssigkeit, die ihm am Arm hinunterrann, und übergab sich.
»Wenn ihr wisst, was gut für euch ist, lasst ihr Liza in Ruhe.«
Einige der Jungen kicherten, aber keiner von ihnen wollte es mit Pieter aufnehmen. Er gewann jeden Kampf.
Er war spät dran fürs Morgengebet. Als er sich in die hinterste Reihe stahl, war ihm die Kehle wie zugeschnürt, so sehr litt er mit Liza. Hier im Lowveld hatten die Leute einen Farbigen so schnell ausgemacht wie ein Silberreiher eine Zecke. Man würde sie niemals akzeptieren. Was brachte ihr also all ihre Schönheit?
***
Es war zwei Uhr nachmittags und heiß wie in einem Ofen. Sie hatten mehr als eine Stunde lang in der Sonne gestanden und Cronjes monotonen Vortrag angehört. Für den war das alles gut und schön. Schließlich stand er im Schatten des überhängenden Dachs des Pavillons neben dem glänzenden Fahrrad. Seine Stimme klang durch das schlechte Mikrofon wie die eines Roboters.
»Diejenigen unter euch, die durch KaNgwane