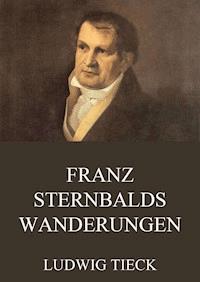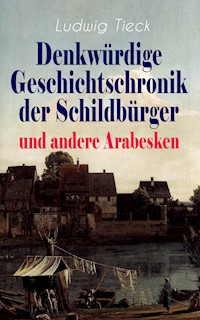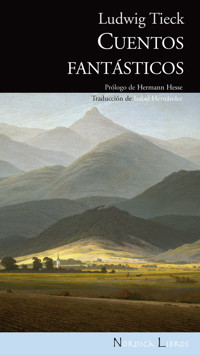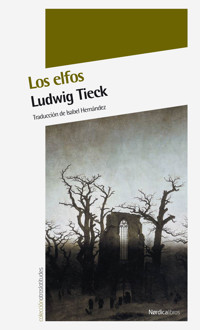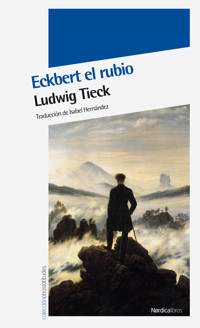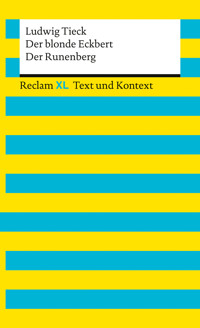Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Reese Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Enthält die Liebes-, Lebens-, Spott- und Schauergeschichten Fermer, der Geniale, Die männliche Mutter, Männertreue, Die Rechtsgelehrten, Das Porträt, Die beiden merkwürdigsten Tage aus Siegmunds Leben, Der Fremde und den kleinen Roman Peter Lebrecht. Johann Ludwig Tieck (* 31. Mai 1773 in Berlin; † 28. April 1853 ebenda) war ein deutscher Dichter, Schriftsteller, Herausgeber und Übersetzer der Romantik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Fermer, der Geniale
Die männliche Mutter
Männertreue
Die Rechtsgelehrten
Das Porträt
Die beiden merkwürdigsten Tage aus Siegmunds Leben
Der Fremde
Peter Lebrecht
ERSTER TEIL
ERSTES KAPITEL
ZWEITES KAPITEL
DRITTES KAPITEL
VIERTES KAPITEL
FÜNFTES KAPITEL
SECHSTES KAPITEL
SIEBENTES KAPITEL
ACHTES KAPITEL
NEUNTES KAPITEL
ZEHNTES KAPITEL
ELFTES KAPITEL
ZWÖLFTES KAPITEL
DREIZEHNTES KAPITEL
VIERZEHNTES KAPITEL
FÜNFZEHNTES KAPITEL
SECHZEHNTES KAPITEL
SIEBZEHNTES KAPITEL
ACHTZEHNTES KAPITEL
NEUNZEHNTES ODER LETZTES KAPITEL
ZWEITER TEIL
ERSTES KAPITEL
ZWEITES KAPITEL
DRITTES KAPITEL
VIERTES KAPITEL
FÜNFTES KAPITEL
SECHSTES KAPITEL
SIEBENTES KAPITEL
ACHTES KAPITEL
NEUNTES KAPITEL
ZEHNTES KAPITEL
ELFTES KAPITEL
ZWÖLFTES KAPITEL
DREIZEHNTES KAPITEL
VIERZEHNTES KAPITEL
FÜNFZEHNTES KAPITEL
SECHZEHNTES KAPITEL
Über den Autor
Impressum
Hinweise und Rechtliches
E-Books im Reese Verlag (Auswahl):
E-Books Edition Loreart:
Ludwig Tieck
Die männliche Mutter
Erzählungen
Fermer, der Geniale
Als Fermer von der Universität zurückgekommen war, ging er zuerst mit hochklopfendem Herzen nach der Straße, in der seine Geliebte wohnte. Er gedachte auf diesem Gange zu verscheiden, so drängte sich ihm das Blut aus allen Adern nach dem Kopfe.
Die Straße war etwas entlegen, und er hatte Zeit, unterwegs einige nicht unwichtige Betrachtungen anzustellen. Ist sie mir noch getreu geblieben? sagte er zu sich selbst, warum habe ich seit langer Zeit keine Briefe von ihr erhalten? Bei Gott! wenn ich sie treulos fände.
Mit einem erhitzten Gesicht lief er gegen ein langes Stück Bauholz, das ein Lastträger mit einer unverschämten Miene durch die Gasse trug. Vorgesehn! rief dieser, als er bemerkte, daß der junge Fermer eben in hitzige Vorwürfe ausbrechen wollte.
Fermer fluchte ein paarmal und fuhr dann in seinen Seufzern fort, denn er sah nun schon das Haus vor sich, ja, er glaubte sogar am Fenster eine weibliche Gestalt zu bemerken.
Fermer hatte Vermögen, seine Eltern waren gestorben, er hatte nur, wie man zu sagen pflegt, zu seinem Vergnügen studiert, um in der Welt über manches mitsprechen zu können, denn das ist ein Nutzen, den man den Wissenschaften nie wird ableugnen können.
Fermer klingelte jetzt, aber ehe ich in meiner Erzählung fortfahre, erlaube mir der Leser eine kleine
Vorrede
die schon vor dem vierten Bande dieser Sammlung ihren Platz hätte finden sollen; ich schalte sie listigerweise hier ein, damit ich um so mehr versichert bin, daß man sie nicht überschlägt.
Ich habe mir schon oft den Kopf zerbrochen, warum die meisten Leser sich so gar nichts aus einer Vorrede machen, daß sie gleich immer zum Werke eilen, um nur den Helden der Geschichte recht bald kennenzulernen, so daß sie darüber den wahren Helden, der den andern hervorbringt, gänzlich vergessen. Ich muß gestehn, daß ich weit mehr Vorreden als Bücher lese, denn die Verfasser schildern sich meistenteils mehr darinne, als sie selber wissen; um mich zu belehren und zu bessern, lese ich daher oft die Vorrede und lasse das moralische oder politische oder unterhaltende Buch selber ungelesen. Da ich aber den Wert einer Vorrede so sehr zu schätzen weiß, so sollte es mich eben deswegen sehr kränken, wenn der Leser gegenwärtige, äußerst unentbehrliche Vorrede überschlüge.
Der kritische Leser wird schon aus einigen gelehrten Blättern ersehn haben, daß seit dem vierten Bande ein anderer Verfasser als der des Siegfried von Lindenberg die Straußfedern fortsetzt, und ich habe schon immer im stillen gefürchtet, daß aus diesem Grunde (die tausend bessern Gründe ungeachtet), diese Sammlung von Erzählungen dem Leser weniger gefallen möchte als die drei ersten Bände.
Wenn man es genau überlegt, so ist es für einen Schriftsteller ein sehr schlimmer Umstand, daß er immer von seinen Lesern abhängt, die wenigen unter den Deutschen, die es so weit gebracht haben, daß sie gefallen, sie mögen auch schreiben, was sie wollen, sind in der Tat zu beneiden. Wenn ich aber an meine Leser denke, so gerate ich augenblicklich in eine solche Furcht, daß ich erst eine Weile die Feder niederlegen muß, mich zerstreuen und von der Vorstellung des Lesers erholen, ehe ich weiterschreiben kann. Dem einen sind die Erzählungen nicht unterhaltend, dem andern nicht fein genug; einer tadelt den Vortrag, der andere den Inhalt; ein dritter liest sie gar nicht, sondern rezensiert sie nur. Ich bin mit den gewöhnlichen Herzstärkungen der Autoren unbekannt, ich habe keine Freunde, die mich bewundern und die Welt und ihr Urteil verachten lehren; ich kenne mich selbst zu gut, um ohne diese Freunde stolz zu sein, und wieder zu wenig, um genau zu wissen, wieviel ich als Herausgeber der Straußfedern wert bin - kurz, ich weiß durchaus nicht, woran ich mit meinem sogenannten geneigten Leser bin.
Vieles in der Welt, besonders aber der Geschmack, beruht bei den meisten Leuten nur auf einem Vorurteil. Ich sage dies nicht, um mich zu rechtfertigen, sondern nur um den Leser darauf aufmerksam zu machen, wenn er sich etwa in diesem Falle befinden sollte.
Das Vorurteil ist in der Welt immer noch sehr mächtig, viele Leute gelten nur deswegen für witzig, weil andre es von ihnen sagen, ja, ich habe zuweilen aus keinem bessern Grunde ganze Bücher für philosophisch gehalten. Dies fühlte auch ein berühmter Hanswurst sehr gut, der, nachdem sein Vorgänger abgenutzt und tot war, zum erstenmal das Wiener Theater betreten sollte. Er fühlte seine Schwäche und die große Macht des Vorurteils, als er daher auftrat, fiel er vor einem verehrungswürdigen Publikum auf die Knie und bat ums Himmels willen, daß man doch ja über ihn lachen möchte. Er erreichte dadurch seinen Endzweck am besten. - Ich möchte etwas Ähnliches versuchen, wenn ich mir nur versprechen könnte, daß es ebenso gelingen würde.
Bitte:
Meine Verehrungswürdigen! geruhen Sie allerseits an meiner geringen Spaßhaftigkeit, an meinem wenigen Witze ein Vergnügen zu finden, weil ich sonst der Verzweiflung nahe bin und ich mit den schmerzhaftesten Tönen ausrufen muß: Oleum et operam perdidi! - Wenn Ihnen an dem Leben eines Menschen nur etwas gelegen ist, so geben Sie sich die Mühe, mich nur ein klein wenig zu bewundern, es kann Ihnen ja so viele Mühe nicht kosten, und Sie sind ja sonst nicht so sparsam damit.
Ich sollte mich nun eigentlich noch in Kupfer stechen lassen, wie ich demütig auf den Knien liege, und ich hoffe, daß man mich aus bloßer Rührung, aus purem Mitleide sehr witzig finden würde. - Ich kann nicht begreifen, warum noch kein einziger Buchhändler auf diesen Gedanken gekommen ist, es würde vielleicht mehr wirken als ihre pomphaften Ankündigungen.
Es tut mir leid, daß der Rezensent in der Nürnberger gelehrten Zeitung nun durch mich selbst erfährt, daß Herr Müller diese Straußfedern nicht mehr schreibt, denn indem der Rezensent vom fünften Teile spricht, kann er nicht genug den Witz und die unerschöpfliche satirische Laune dieses Schriftstellers bewundern; er hat mich also gelobt, ohne es zu wissen; ich sage ihm den ergebensten Dank und bitte nur, unermüdet auf dem Wege fortzufahren; es sollte mir sehr leid tun, wenn er jetzt diese Sammlung von Erzählungen schlechter fände, seit er weiß, daß sie von niemand als einem anonymen Schriftsteller herrühren, der nicht einmal den Mut hat, seinen Namen zu nennen.
Die nicht rezensierenden Leser mögen sich übrigens davon ein Beispiel nehmen und sehn, wieviel ein günstiges Vorurteil vermag. Ein günstiges Vorurteil ist ein sehr mächtiger Freund und Beschützer. - Ich will mich also hiermit dem ganzen Publikum empfohlen haben.
Doch es ist wohl endlich Zeit, zur Geschichte zurückzukehren.
Der Liebhaber klingelte, ein Bedienter öffnete die Tür. Er ging die Treppe hinauf (denn es ist zuweilen gut und angenehm, alles recht weitläuftig zu beschreiben), er fand Louisen in ihrem Zimmer.
Ohne aber weiter Umstände zu machen, sprang er auf sie zu und drückte sie herzhaft in seine Arme: dies ist von jeher ein Vorrecht der Verliebten gewesen. - Sosehr er trunken von Wonne war, so glaubte er dennoch zu bemerken, daß seine Geliebte seine Herzlichkeit nicht so erwiderte, als sie wohl hätte tun sollen; indessen die Szene war einmal zur Freude bestimmt, und so gab er sich denn darüber zufrieden.
Warum hast du mir so lange nicht geschrieben, Teuerste? rief er aus; wie konntest du mich in dieser entsetzlichen Ungewißheit lassen? Du glaubst nicht, was ich gelitten habe, all mein Glück, alle meine Plane lagen zerschlagen vor meinen Füßen, und der wütendste Schmerz fraß und nagte in meinem Herzen.
Louise schlug die Augen nieder. Ich war nicht wohl, mein Vater war krank, unsre liebe Vertraute, durch die du immer meine Briefe bekommen hast, war verreist.
Fermer: Louise, schreckliche Dinge gingen damals in meinem Innern vor, ich glaubte dich untreu, alles fiel mir bei, was ich je in Büchern von dem Leichtsinn der Mädchen gelesen hatte. Keine Nacht konnt’ ich schlafen. Du glaubst nicht, was ich gelitten habe.
Louise: Unaussprechlich Teurer!
Fermer: Wie wohl ist mir, daß ich dich wiederhabe, daß ich mich wieder an diesen Augen erlaben kann, daß ich deine süße Stimme höre! Alle Harmonie in mir war zerrissen und verstummt, ich glaubte an keine Unsterblichkeit mehr, alle meine Nerven zitterten.
Louise: Schrecklich, schrecklich!
Fermer: Jawohl, schrecklich! Die getrennte Liebe ist die Hölle auf Erden. Aber du bist nicht so froh, wie ich dich wünschte, und um mich blühn alle Seligkeiten des Himmels, und du -
Louise: Ich kann mich von dieser Freude noch gar nicht erholen.
Die Aufwärterin trat herein, um Louisen zu ihrem Vater abzurufen, die Liebenden drückten sich noch einmal zärtlich an die Brust, dann schieden sie.
Fermer kam sich auf der Straße wie ein großer Held vor; er machte noch einen kleinen Spaziergang, redete einige Bekannte an, tat gegen andre, als hätte er sie nie gesehn, und ging dann nach Hause.
Er gehörte nicht zu den schönen Leuten. Seine Augen waren nicht blau und sanft und klug, in denen aber auch das Feuer des Mutes aufleuchtete, auch nicht dunkelbraun, eine Farbe, die bei den Liebhabern und Helden von Geschichten auch sehr beliebt ist, sondern wenn ich die Wahrheit sagen soll, so fielen sie mehr ins Graue. Er war klein von Person, sein Gesicht war gelblich und hatte häufige Pockennarben.
Es braucht mir niemand zu sagen, daß ich hier gegen die ersten Regeln eines Schriftstellers anstoße, gegen Regeln, die sogar die Kinder auswendig wissen. Die Wahrheit aber ist mir teurer als alles, und darum habe ich den jungen Geliebten so beschrieben. Der Leser darf nur die gangbaren Bücher zusammenrechnen, die Helden und Heldinnen summieren, so wird er erstaunen, welche Menge von Schönheitsidealen sich unter uns Deutschen herumtreiben, und dann die Klagen der Bildhauer und Maler gar nicht begreifen können, die unaufhörlich jammern, daß es ihnen so ganz an schönen Modellen fehle. Sooft ich gereist bin, habe ich mich in den Städten und auf dem Lande fleißig nach der unzähligen Menge von vortrefflichen Liebhabern und Liebhaberinnen umgesehn, die ich in den Büchern hatte kennenlernen; aber immer wurde ich getäuscht. Seit der Zeit mißfallen mir alle jene bezaubernden Schilderungen, jene Menge von Engels- und Adlersblicken, jene unbeschreiblich lieblichen Physiognomien, weil ich nicht mehr recht daran glauben kann.
Meine Leser mögen also den Helden dieser Geschichte entschuldigen, daß er nicht besonders schön ist; denn das sind Gaben, die der Himmel gibt und für die niemand kann.
Als Fermer nach Hause gekommen war, war seine erste Frage, ob der Briefträger keinen Brief gebracht habe. Der Bediente überreichte ihm einen; er besah das Siegel und sagte: Gottlob! Dann erbrach er ihn und las:
Geliebter meiner Seele,
Dich sollt’ ich vergessen können? Unmöglich! Schon seit anderthalb Tagen bist Du abgereist, und immer steht Dein Bild noch so lebendig vor mir, als wenn Du noch hier gegenwärtig wärst. Immer hör’ ich noch Deine süßen Schwüre, die gewaltigen Ausdrücke, die Deine Liebe suchte und so behende fand. Du hast recht, etwas Außerordentliches muß auch auf eine außerordentliche Art ausgesprochen werden. - Ich lese die Bücher, die Du mir empfohlen hast, und bin jetzt eben beim Turnier von Nordhausen; schreibe mir doch Deine Meinung darüber, die kühne Darstellung hat mich gewaltig ergriffen, wie ich denn überhaupt sehr für das Große bin. Ich denke an Dich, ich träume von Dir; ich weiß nicht, wie es mit mir werden soll, in sechs Monaten wird eine schlimme Periode für mich eintreten. Doch ich kann mich dann vielleicht schon mit einem süßern Namen nennen, als ich mich jetzt unterschreibe
Deine geliebte Nanette B.
Wie war Fermer von Nanettens Liebe, von ihrer Seelengröße gerührt! Er konnte vor Beendung gar nicht zu sich selber kommen, bis er bemerkte, daß er gähne und sich daher sehr schnell niedersetzte, um diesen teuren Brief noch an diesem Abend zu beantworten. Er wunderte sich über seine seltsame romantische Lage, stand wieder auf und ging in der Stube auf und ab. Aus seiner Büchersammlung nahm er ein Buch und fing den Clavigo an zu lesen, um sich wieder etwas zu beruhigen, der Stil war ihm nur nicht stark genug, er fing an zu seufzen, dachte recht inbrünstig an Nanette, suchte Louisen auf einige Augenblicke zu vergessen und schrieb nun seinen Brief nieder:
Teureste meiner Seele!
Wie leer und nüchtern ist mir die Welt, seit ich Dich verlassen habe. Allenthalben steht mir Dein Bild vor Augen. Soeben bin ich aus dem Wagen gestiegen, und soeben habe ich Deinen Brief gelesen; welche Wonne strömte durch alle meine Adern, als ich die Züge Deiner Hand gewahrte.
Der Turnier zu Nordhausen ist gewiß eins der kräftigsten deutschen Bücher. Welche Sympathie hat unsre Seelen so gleichgestimmt! Ich bekomme eine hohe Achtung für Deutschland, wenn ich mich all der Helden, all der trefflichen Dichter erinnre. Es ist Zeit, daß auch ich mich aufnehme, ich bin lange genug müßig gewesen, und mein Vaterland hat Forderungen an mich.
Vergib die Kürze dieses Briefs, ich bin müde, die Uhr schlägt zwei in der Nacht, mit den Gedanken an Dich schläft ein
Leopold Fermer
Er siegelte den Brief und setzte sich nieder, um den Genius weiterzulesen, auf dessen Schluß er sehr begierig war, denn es hatte eben erst sieben geschlagen.
Dann verzehrte er ein sehr gutes Abendbrot, legte sich zu Bette, las im Genius weiter, schlug das Blatt ein und entschlief sanft.
Wenn er des Morgens aufstand, war gewöhnlich sein erstes Geschäft, einige Zeit aus dem Fenster zu sehn, er rauchte dabei seine Pfeife und dachte an tausend Dinge, die ihm um keine andre Tageszeit einfielen.
Bin ich nicht ein Tor? sagte er zu sich selber, nachdem ihn einige Vorübergehende höflich gegrüßt hatten: nicht im Clavigo, nein, in der Stella ist meine ganze Lage geschildert, gemalt zum Sprechen!
Er ging zurück und las dies Stück, indem er seinen Kaffee trank. Es ist gut, dachte er dabei, daß es doch Bücher und Gedichte für alle Menschen und für alle Situationen gibt; wie ich mich hier in jedem Zuge wiederfinde, es ist, als wenn der Verfasser mich vor Augen gehabt hätte; Nanette ist die Madam Sommer, Louise die Schwärmerin Stella. Ach, was richten wir Männer nicht für Unheil in den Herzen der Weiber an!
Er hatte geendigt, betrachtete das Kupfer vorn, stand auf und stellte sich vor den Spiegel. Ja, sagte er mit bedeutenden Gebärden, es geht den feurigen Gemütern nicht anders; kann ein junger, hitziger, genievoller Mensch leben wie ein sechzigjähriger Alter? Empfinden wie er? Mir braust die Kraft in jeder Ader, meine Phantasie läuft mit meinem Kopfe davon; es müßte bei alledem ein interessantes Buch werden, wenn jemand mich so recht schildern könnte.
Mit vielem Selbstbewußtsein sah er wieder aus dem Fenster und erblickte im gegenüberstehenden Hause ein sehr reizendes Gesicht; er betrachtete sie, sie ihn; er grüßte, sie dankte; er zog sich zurück, legte ein elegantes Nachtkamisol an und kam dann mit diesem und seinem besten meerschaumnen Pfeifenkopfe wieder ans Fenster. Die unbekannte Schöne lächelte, er lächelte gleichfalls. Wenn zwei Leute erst lächeln, ist es fast ebenso gut, als wenn sie sich lieben, so stand es wenigstens in Fermers Katechismus über die Menschenkenntnis, und er hatte diese Beobachtung bei allen Aufwärterinnen auf der Universität bestätigt gefunden.
Als er sich ankleidete, erkundigte er sich bei seinem Bedienten, wer die interessante Dame gegenüber sei, er erfuhr, die Frau eines Hauptmanns. Mit wunderlichen Planen ging er auf das nächste Kaffeehaus, um doch auch in der Politik und den dorthin einschlagenden Wissenschaften nicht zu sehr zurückzukommen. Er hatte schon mancherlei treffende Bemerkungen eingeerntet, als er in einem Winkel des Saals den Namen seiner geliebten Louise nennen hörte; er war aufmerksam, vergaß Pitts Plane und näherte sich den Sprechenden.
Er glaubte seinen Ohren nicht zu trauen, als er hörte, daß Louise verlobt sei und in vierzehn Tagen ihre Hochzeit feiern würde; aber er blieb außer allem Zweifel, als sich ein großer, wohlgewachsener Mann näherte, die Sprechenden ihm gratulierten und er ohne Umstände den Glückwunsch annahm.
Fermer steckte seine Pfeife ein, nahm Hut und Stock, ging fort, ohne, wie er sonst tat, mit dem Markör zu spaßen, und lief auf dem Spaziergange schnell auf und ab.
Menschen! Menschen! sprach er ganz laut, heuchlerische, giftige Krokodilbrut! Ihre Augen sind Wasser, ihre Herzen sind Erz! Küsse auf den Lippen und Schwerter im Busen! O Bosheit, hab’ ich dulden gelernt usw.
Er hielt die ganze Rede Karl Moors und bemerkte in seiner Wut nicht, daß sie nicht ganz auf seinen Zustand passe; wer wird auch in der Leidenschaft auf solche Kleinigkeiten Rücksicht nehmen!
Die Leute betrachteten ihn sehr aufmerksam; er hatte einen großen Hut, klirrende Sporen, die er immer trug, obgleich er nie ritt, einen Knotenstock, wie es einem Biedermann ziemt, dabei arbeitete er mit den Händen gewaltig in der Luft herum, so daß es manchen Einfältigen wohl zu verzeihn war, die ihn für einen Wahnsinnigen erklärten.
Er ging nach dem Hause seiner Geliebten, stürmte die Treppe hinauf und brach, ohne anzuklopfen, in ihr Zimmer. Sie frisierte sich eben und erschrak über seinen verwilderten Anblick.
Grausame! rief er und stellte sich starr vor sie hin.
Louise wußte nicht, ob sie den Puderquast aus der Hand legen sollte. Was ist Ihnen? sagte sie furchtsam.
Fermer: O nichts, nichts! Das ist Weibertreue? Ha! Schlangenfalschheit! Du bist mir fremd, Louise.
Louise: So haben Sie vielleicht gehört -
Fermer: Alles, alles! Und du wagst es noch, mir ins Gesicht zu sehen? Das Entsetzen, die Scham macht dich nicht zum Leichnam?
Louise: Lieber Fermer -
Fermer: Lügnerin! Oh, wie die Wut in mir tobt! Ich kann mich nicht lassen -
Er nahm wütend die Puderschachtel, brach sie in Stücke und warf sie zum Fenster hinaus.
Wie Sie auch sind! sagte Louise, indem sie aufstand; womit soll ich mich denn nun frisieren?
Fermer stampfte gewaltig mit den Füßen, warf sich auf den Boden, erhob sich wieder und ging vor den Spiegel. - Wie es mich angreift! sagte er niedergeschlagen, ich fühle, mein Ende ist nicht mehr weit, der Tod wird mitleidiger sein als Sie.
Aber, sagte Louise sanftmütig, es mußte ja doch einmal anders werden; man kann ja doch nicht ewig schwärmen; mein Vater hat recht, man muß doch auch auf eine Versorgung denken. Ich wollte Ihnen nur neulich nichts sagen, weil ich Ihre Hitze fürchtete. Nun sehen Sie, da schwimmen die Stücke der Puderschachtel. Was nur die Leute davon denken werden.
Sie sah den Fragmenten wehmütig nach, und Fermer sah aus, als ob er den Tisch nachwerfen wollte.
Ich glaubte, Sie hätten mich längst vergessen, fuhr Louise fort.
Aber meine liebevollen Briefe!
Ich dachte, Sie schrieben sie nur, um sich im Stil zu üben, und dann war ich immer in Angst, mein Vater würde endlich noch den ganzen Handel erfahren.
So müssen wir uns denn trennen? sagte Fermer in einem weinlichen Ton.
Auf ewig! sagte Louise sehr rasch.
Auf ewig! seufzte Fermer und lag in ihren Armen; wer weiß, ob wir uns nicht nach vielen Jahren einmal wiedersehn.
Wie würde mich das rühren, sagte Louise, wegen all der Erinnerungen. Sie kennen ja wohl die schöne Szene in der Aussteuer von Iffland.
Ach ja! Und damit schieden die Unglücklichen. - Er eilte so schnell die Treppe hinunter, daß er sich mit dem Sporn den einen Stiefel aufriß und beinah gefallen wäre.
Als er wieder auf seinem Zimmer war, sagte er: Teure Nanette! Große Seele! Jetzt erst erkenne ich ganz deinen Wert. - Er nahm sein Stammbuch und machte auf dem Blatte, auf das sich Louise geschrieben hatte, ein großes Kreuz mit Tinte; denn für ihn war sie ja gestorben. Es war ein rührender, ein großer Moment; er legte Löschpapier dazwischen, damit das unglückliche Zeichen nicht die gegenüberstehende Seite verderbe und so ein übles Omen hervorbringe; denn Nanette hatte sich vis-à-vis eingeschrieben.
Es gibt Stunden im Leben, in denen sich der Mensch an Empfindungen so erschöpft hat, daß er notwendig einschlafen muß. Fermer zog sich also aus, schickte den Stiefel zum Schuster und legte sich trübselig aufs Bett. Der Bediente hörte ihn schnarchen, als er vom Schuhmacher zurückkam.
Louise saß indes an ihrem Schreibtisch und fertigte folgenden Brief an ihre Vertraute aus, die nach einer benachbarten kleinen Stadt verreist war, um unter Onkeln und Tanten auf Picknicks und einigen bevorstehenden Hochzeiten den Frühling auf dem Lande zu genießen.
Liebe Seele!
Fermer und ich sind geschieden, es war eine entsetzliche Szene; ich mußte ihn mit Gewalt und mit Tränen zurückhalten, daß er nur nicht aus dem Fenster hinaus in den Kanal sprang. Ich hätte nie geglaubt, daß er einer so unendlichen Liebe fähig sei. Meine Seele ist jetzt beunruhigt und ruhig zugleich; die Szene ist vorüber; aber er irrt jetzt vielleicht verzweifelt in den Wäldern umher, haßt die Menschen und sich und schlägt kein Auge auf, um die Natur nicht gewahr zu werden, die er an meiner Seite so oft bewunderte. Wir Weiber sind doch schwache Geschöpfe, das kann ich nun wohl mit Recht sagen; denn der Herr Walther gefällt mir im Grunde doch besser, er ist schöner; mein Vater sagt, er sei reich. - Ich habe mich darein ergeben; kommen Sie doch ja zu meiner Hochzeit zurück.
Wie schön ist der Frühling hier auf dem Lande, schrieb die Freundin zurück; aber schade, daß ich noch fast gar nicht aus der Stadt gekommen bin und es auch noch nicht habe möglich machen können, die Lektüre des Matthisson anzufangen. Aber meine Lust zu tanzen kann ich hier recht befriedigen, denn es wird alle Abend getanzt und gewalzt, und der Sohn des Bürgermeisters hier ist ein exzellenter Tänzer und auch sonst ein artiger Mensch; er hat erstaunlich viel vom Marquis Posa, dessen Rolle er auch fast ganz auswendig weiß. Leben Sie wohl, bis wir uns fröhlicher wiedersehn.
Fermer erhob sich gestärkt und getröstet vom Lager; die Dame gegenüber sah wieder aus dem Fenster, er ging im Zimmer auf und ab; bald sah er nach ihr; dann grüßte er; dann setzte er sich in einer schwermütigen Stellung dicht an das offene Fenster, damit sie ihn gewahr werden möchte; ja, er gab sich selbst alle mögliche Mühe, um zu weinen, bildete es sich auch endlich ein und trocknete zu wiederholten Malen die Augen. Als er durchs Schnupftuch nach dem Frauenzimmer hinübersah, bemerkte er, daß sie wieder lächle, und er schloß daher, ihre Seele müßte ungemein sympathisieren.
Als sich die Dame zurückgezogen hatte, fiel es ihm ein, daß seine Mitbürger, nachdem er von der Akademie wieder zurückgekommen, wahrscheinlich irgend etwas von ihm erwarten würden. Er dachte an seine Geschichte, seine Empfindungen, an sein Herz, und er beschloß, alles in einem gutgesetzten Ritterromane wieder anzubringen; er sah sich schon gedruckt, rezensiert, in Kupfer gestochen. Auf einem feinen Bogen Papier schrieb er den Titel nieder, seinen Namen und inwendig: Erste Szene, denn es sollte dialogiert werden; dann durchdachte er die Materie und Einkleidung etwas genauer, trat bald vor den Spiegel, bald ans Fenster und arbeitete so den größten Teil des Tages.
Er erhielt am folgenden Tage wieder einen schmeichelhaften Brief von Nanetten, die die Tochter eines Handwerkers war, aber immer große Gesinnungen äußerte, so daß sie ihn selbst zuweilen beschämt hatte. Ideal! rief er aus, du sollst wahrlich in dem Buche nicht vergessen werden (er küßte den Brief), nein, ich mache dich aus Dankbarkeit zur Hauptheldin, alle deine Briefe sollen mit kleinen unbedeutenden Abänderungen gedruckt werden; Welt und Nachwelt sollen sie ebenfalls genießen und die weibliche Tugend bewundern.
Er antwortete, er bekam Briefe, Louise feierte ihre Hochzeit, er schrieb an seinem Buche, er las andre Bücher, um sich zu bilden, ging spazieren und rauchte einen neuen Pfeifenkopf braun, sah die Frau des Hauptmanns täglich, und als so ein Vierteljahr vergangen war und Nanettens Briefe ausblieben, so gestand er es sich endlich, daß er in die Dame im Fenster gegenüber sterblich und unsterblich verliebt sei.
Eine neue wunderbare Situation! Sie war verheiratet; aber sie liebte ihren Mann gewiß nicht; der Hauptmann war gewiß ein roher, gefühlloser Mensch; die Frau schmachtete wahrscheinlich nach Liebe und Büchern und edelmütigen Gesprächen; sie lächelte immer, wenn sie ihn sah - warum sollte er nicht den kühnen Schritt wagen, ihr seine Liebe zu gestehn?
Er wagte ihn, und da er kein andres Mittel sah, warf er einen großen Brief in ihr Zimmer hinein, als das Fenster an einem warmen Tage offengelassen war; dieser Brief enthielt alle seine Empfindungen, seine ewige Liebe, ganz genau beschrieben, so daß man hätte blind sein müssen, um sie zu verkennen.
Er wollte nun den Erfolg seiner Erklärung abwarten; aber die Frau ließ sich seit der Zeit gar nicht mehr am Fenster sehn, und indem er noch in der höchsten Ungewißheit war, erhielt er ein Billett, das nichts weniger als eine Ausforderung vom Hauptmann enthielt, der durchaus auf eine blutige Art die Beleidigung seiner Frau rächen wollte.
Fermer vergaß seine Bücher, seine Nanette, seine neue Geliebte, alles, über diese unvermutete Ausforderung. Er schloß sich ein, er setzte sich nieder, er las das Billett, noch einmal, und der Inhalt war um nichts besser; er weinte, er beklagte sein grausames Schicksal und sein frühzeitiges Ende, den Verlust seines Vaterlandes, die Vernichtung aller großen Plane. Er beschloß, die Ausforderung nicht anzunehmen; denn die Gesetze hätten dergleichen mörderliche Duelle verboten, ein junger Mensch könne wohl einmal in Versuchung fallen, verdiene aber deswegen nicht, daß er gleich umgebracht werde. Kurz, er hatte ungemein moralische Gedanken; er beschloß, in die Gattin des Hauptmanns nicht weiter verliebt zu sein, denn es sei wirklich unrecht, aber auch nicht sich der Gefahr auszusetzen, die Spitze eines Degens in den Leib zu bekommen.
Aber bin ich nicht ein Feigling? rief er aus, indem ihm Friedrich mit der gebißnen Wange in die Augen fiel; soll sich ein deutscher Mann so betragen? Was ist denn der Mut anders als eben die Verachtung der Gefahr? Wahrlich, wenn es keine Gefahr gäbe, würden wir alle ohne Umstände mutig sein. Jetzt nimmt vielleicht die größte Periode meines Lebens ihren Anfang, und ich ziehe mich selber schändlicherweise zurück; nein, ich will dem Abenteuer, ich will meinem Feinde entgegengehn.
Er betrachtete seinen Degen, den er bis dahin noch nicht genau angesehn hatte, dann las er die Beschreibung einiger fürchterlicher Zweikämpfe und hatte es noch nie so lebhaft empfunden, wieviel an Leib und Leben diese deutschen Helden gewagt hatten.
Er sah sich als Sieger aus dieser blutigen Fehde kommen, ein ganz neues, interessantes Kapitel in seiner Lebensgeschichte, er hörte sich bewundern, er war mit sich selber ungemein zufrieden.
Aber, unterbrach er diese angenehmen Vorstellungen, ich könnte mir denken, daß mein Gegner auch der Held einer interessanten Lebensgeschichte wäre, in der ich gleichsam als Episode erschiene, als Nebenperson, die nur aufgefüttert ist, um den Ruhm dieses mir fremden Menschen zu verherrlichen; denn hätten jene alten Helden keine tapfern Männer umgebracht, so hätten wir auch von jenen Gefallenen weitläuftige Sagen der Vorzeit. Wer steht mir für den Sieg?
Dadurch wurde seine Heiterkeit wieder niedergeschlagen, er beschloß, niemand etwas von seiner Gefahr zu vertrauen, um sein gutes oder böses Schicksal in bestmöglichster Ruhe abzuwarten.
Der Bediente trug das Abendessen auf, aber der Herr hatte allen Appetit verloren; seine Schwermut war so merklich, daß ihn selbst Johann fragte, ob ihm etwas fehle. Fermer seufzte, drehte den Kopf von der Seite und sagte: ihm fehle nichts.
Der Bediente kam wieder und nahm das Abendessen fast ganz so wieder mit, wie er es aufgetragen hatte, das war ein unerhörter Fall; er konnte ohnmöglich seinen Herrn allein leiden lassen, Fermer ward durch die Treue seines Dieners gerührt, er fiel ihm schluchzend um den Hals. Johann! rief er aus, ich gehe in meinen Tod, mit dem Anbruch des Tages bin ich nicht mehr.
Johann entsetzte sich, denn er hatte noch rückstehenden Lohn zu fordern, er suchte seinem Herrn begreiflich zu machen, daß er nicht recht bei Sinnen sei, wie er aus diesen Reden und aus dem wenigen Appetite ganz deutlich abnehme. Fermer aber blieb in seiner tragischen Laune, behauptete, er könne nichts entdecken, aber sein Tod sei ihm nur allzu gewiß.
Die Beredsamkeit Johanns stockte endlich, und der Herr nahm nun von seinem Diener den rührendsten Abschied. Einer hing am Halse des andern; beide weinten, die Edeln litten gewaltig.
Johann ging endlich zu Bette, in der grausenden Mitternacht schrieb Fermer diesen kurzen Brief an Nanette:
Gute!
Lebe wohl, ewig wohl - ich danke Dir dafür, was Du mir in diesem Leben warst; die Erinnerung will ich mit in die Ewigkeit hinübernehmen. Es ist schwarze Nacht, und der aufgehende Tag wird noch schwärzer sein, mein Schicksal ruft mit eherner Glockenstimme, ich muß ihm folgen, lebe wohl.
Es wurde wirklich Tag, woran Fermer immer noch im stillen gezweifelt hatte, er nahm seinen Degen unter seinen Überrock und verließ die Stadt. Es war ihm schauerlich, daß noch alle Leute schliefen und er allein so früh aufgestanden sei, um sich abschlachten zu lassen.
An dem bestimmten Orte sah er den Hauptmann mit entblößtem Degen stehn. Aller Mut verließ ihn, er näherte sich zitternd und sank auf ein Knie nieder.
Großmütiger Feind! rief er demütig, schonen Sie einen Jüngling, dessen Unbesonnenheit -
Der Hauptmann gab ihm ein paar Schläge mit der Klinge, die ziemlich empfindlich waren. Sei Er künftig kein Narr, sagte er, alles war nur ein Spaß. Ich mich schlagen mit einem solchen Schlucker? Er ist jetzt genug gestraft, ich und meine Frau haben schon im voraus über diese Posse gelacht. - Er steckte den Degen ein.
Fermer dankte in den rührendsten Ausdrücken, er flog zur Stadt zurück, Johanns Freude, daß er seinen Herrn wiedersah, war unbeschreiblich; Fermer zahlte ihm seinen Lohn aus und gab ihm noch überdies ein Geschenk, dann legte er sich zu Bette und schlief einen vortrefflichen gesunden Schlaf.
Als er aufstand, war er ungewöhnlich froher, aß stärker als gewöhnlich, er rauchte mehr Tabak als gewöhnlich, er zog sich besser an als gewöhnlich. Es war, als wenn er allen Gütern dieses Lebens seine Antrittsvisite abstatten wollte. Nachmittags schrieb er folgenden Brief an Nanetten:
Teure Seele!
Die Gefahr ist vorüber, ich bin dem Leben zurückgegeben. Beinahe war ich Dir auf mehr als eine Art entrissen worden, aber der Himmel hat sich unsrer Liebe angenommen, nun bin ich ganz, ganz wieder Dein; alle Hindernisse sind gehoben. Jauchze mit mir, die Vernichtung hat nun weiter keinen Teil an mir, ich war der Gefahr zu stark; mein brausendes Blut, meine Nervenstärke hat den Tod zurückgeschreckt. Der Mann müßte kein Mann sein, der nicht einmal das Schicksal besiegen könnte. Ich will in der Einsamkeit nun ganz Dir leben, nur Gedanken an Dich sollen mich beschäftigen.
Adieu
Er gab beide Briefe zugleich auf die Post, der erste sollte mit der reitenden, der andere mit der fahrenden abgehn, so daß sie ohngefähr zu gleicher Zeit ankämen.
Er wollte zum Fenster hinaussehn, zog aber den Kopf schnell wieder zurück, denn die Frau des Hauptmanns sah aus dem gegenüberstehenden.
Fermer machte nun ganz ernsthaft den Plan, die Stadt zu verlassen und sich reizender auf einem Dorfe den Rest des Sommers einzumieten. Es kam ihm so schön vor, sich als ein unbekannter Menschenhasser unter den Bauern umherzutreiben, die Neugier der Leute zu spannen und jeden zu verwünschen, der nur ein menschliches Gesicht habe. Das ganze Menschengeschlecht sah er als eine Rolle von Verrätern an. Louise, die Hauptmännin, der Hauptmann hatten sich treulos gegen ihn erwiesen, und auch von Nanetten war seit lange kein Brief angekommen. Hinlängliche Gründe, um die Welt zu verfluchen, man tut es oft aus noch geringem Ursachen.
Er fand eine Wohnung, die ihm gefiel, und zog mit seinem Bedienten hin. Das Dorf war nur eine halbe Meile von der Stadt entfernt. Johann mußte nun viel leiden, weil er das Unglück hatte, auch zu den Menschen zu gehören; bald war das Essen schlecht, bald wurde seinem Herrn die Zeit lang, bald schimpfte er, daß auf dem Dorfe kein Kaffeehaus sei und kein vernünftiger Mensch zum Umgang, um die Einsamkeit erträglich zu machen.
Er lernte Lieschen, die Tochter des Küsters, kennen. Sie war ein derbes, gesundes Mädchen, dem Fermer seiner Sporen wegen ganz außerordentlich gefiel. Er besuchte den Vater, sprach mit der Tochter, fluchte auf die Menschen, schalt sie alle Bösewichter und machte Lieschen zu seiner Vertrauten.
Sie lernte bald von ihm die Menschen verwünschen und die Einsamkeit der Gesellschaft vorziehn, beide waren daher jetzt unzertrennlich. Fermer verliebte sich, er ward wiedergeliebt, und da Lieschen in Büchern nicht sehr belesen war, so ging diese Liebe bald aus dem Sentimentalischen in die natürliche über. Der Vater bemerkte ihre Vertraulichkeiten und ward ergrimmt; um ihn zufriedenzustellen, ließ sich Fermer mit Lieschen aufbieten und versprach, die Hochzeit in vierzehn Tagen zu feiern.
Plötzlich erschien Nanette im Dorfe; sie hatte Fermern in der Stadt vergebens gesucht; sie war ihrem Vater entlaufen, um bei ihm Trost zu finden. Alle waren in Verzweiflung.
Nanette warf sich auf die Knie und schrie und heulte. - Ich bin Mutter! rief sie pathetisch (und es wäre unnötig gewesen, es zu sagen; denn jedermann bemerkte es). Ums Himmels willen, Leopold! gib diesem Kinde einen Vater, oder ich muß es mit diesen Händen umbringen, so leid es mir auch tun sollte. Laß die Bitten einer Mutter an dein Herz gehn.
Lieschen wollte schon aus dem ähnlichen Tone zu sprechen anfangen, als sich Nanette endlich besänftigen ließ und großmütig, nachdem ihr Fermer einige hundert Taler verschrieben hatte, zurückstand. Sie entdeckte jetzt, daß sie einen Liebhaber habe, der sie heiraten wolle, wenn sie nur einiges Vermögen aufzuweisen habe; er war auf der Universität Hofmeister eines jungen Amtmannssohns gewesen und bekam jetzt eine Stelle an der Schule in Fermers Geburtsstadt.
Alle waren zufrieden, Fermer zog mit seiner Frau in die Stadt und brachte ihr Geschmack an Büchern bei; sie lernte Louisen kennen, diese mit der Vertrauten, die indessen ihren Marquis Posa geheiratet hatte, nebst Nanetten und ihrem Mann machten einen vertraulichen Zirkel aus, in dem man las und sprach und gähnte.
Fermer ist seitdem Schriftsteller geworden und bietet den Buchhändlern folgende Manuskripte an:
Löwenhelm der Bärenstarke,
Vaterlandssage in 3 Bänden.
Die Eroberung von Teltow,
ein brandenburgisch-vaterländisches
Schauspiel in 6 Aufzügen.
Die unsichtbaren Sichtbaren, eine Geschichte,
die man kürzlich in den Obelisken gefunden, 4 Bände.
Rudolph von Kollersporn, gemeinhin genannt der Abgrundspringer, in 2 Bänden.
Die männliche Mutter
Gerade in einer der besten Reden, die einer der berühmtesten Prediger von der Kanzel hielt, war es, in welcher der junge Baron von Biederfeld seine Augen auf das junge, sittsame Fräulein von Bergen warf. Die Kirchen dienen sehr oft zum Gottesdienste der Liebe, und die beiden jungen Leute sahn sich hier öfter; er ging ihr nach, wenn sie die Kirche verließ, und fand jedesmal Gelegenheit, ihr etwas Verbindliches zu sagen oder ihr in dem Gedränge den Arm zu bieten, so daß die arme Amalie jedesmal mit einem feuerroten Gesichte aus der Kirche in die freie Luft trat.
Ihrer Mutter, die eine sehr kluge Frau war, entgingen trotz ihres scharfsichtigen Blickes alle diese Kleinigkeiten, wie es denn sehr oft bei verständigen Leuten der Fall ist. Sie erhalten ihren Scharfsinn in einer ununterbrochenen Tätigkeit und übersehen völlig eine Menge von geringfügigen Umständen, die nur gar zu oft im Fortlaufe der Zeit ihre klug ausgedachten Plane zertrümmern. Amaliens Mutter war eine Frau mit einer fast männlichen Gemütsart; sie hatte in ihrer Jugend viel gelesen und gedacht, ja sich selbst mit einigen Büchern der Gelehrsamkeit bekannt gemacht; ihr Vater hatte sie früh an einen Mann verheiratet, der ihr gleichgültig war und den sie nach der Hochzeit nur aus Pflicht und Gewohnheit liebte. Ihr waren daher alle Empfindungen der Liebe und ihre Leiden und Freuden unbekannt geblieben. Die Liebe ist es eigentlich, die dem edlen Charakter die letzte Vollendung geben muß; bei ihr waren, bei allen Vortrefflichkeiten, die rauhen und widrigen Ecken geblieben. Sie hatte ihre Tochter nach einem eigenen Systeme erzogen, das sie aus keinem Buche gelernt hatte; sie hatte vorzüglich gestrebt, Amalien zu ihrer Vertrauten zu machen, die ihr keinen ihrer Gedanken, nicht die unbedeutendste ihrer Empfindungen verschwiege; es war ihr auch bis in das achtzehnte Jahr ihrer Tochter gelungen, so daß das Verhältnis zwischen beiden mehr wie zwischen zwei Geschwistern war, als wie man es gewöhnlich zwischen Eltern und Kindern findet.
Aber in dieses achtzehnte Jahr fiel die merkwürdige Predigt, in welcher sich Biederfeld und Amalie zum ersten Male sahen. Wer kann die magische Kraft beschreiben oder begreifen, die so oft in einem einzigen Blick eines schönen Auges liegt! Amalie konnte dem Zuge gar nicht widerstehen, der jedesmal in der Kirche ihren Kopf dahin drehte, wo Biederfeld stand, und Biederfeld hatte jedesmal eine solche Stellung gewählt, daß er in der ganzen Kirche nichts weiter als seine geliebte Amalie sehn konnte.
Man traf sich von ohngefähr in Konzerten und in der Komödie, man sprach miteinander und hatte sich hunderterlei unbedeutende Sachen zu erzählen. Biederfeld hätte gern um die Hand des Mädchens angehalten, allein sein Vermögen war zu klein, um diesen verwegenen Schritt zu wagen, und da er wußte, daß die Frau von Bergen zwar so viel besaß, um mit ihrer Tochter anständig leben zu können, aber nichts weniger als reich war, so verwünschte er in manchen Stunden den Zufall, seine Armut und die drückenden Verhältnisse unsrer Welt. Hundertmal nahm er sich vor, Amalien zu vergessen und sie nicht weiter aufzusuchen, und das Schicksal spielte ihm immer den Streich, daß er sie noch an demselben Tage irgendwo sah, und wenn er nur einen einzigen streifenden Blick ihres glänzenden Auges auffing, so hob ein Seufzer seine Brust, und alle seine Vorsätze kamen ihm so abgeschmackt vor, daß er sich selbst hätte verachten müssen, wenn er noch weiter daran gedacht hätte, sie auszuführen.
Amalien ging es fast ebenso. Sie konnte es selbst nicht begreifen, warum es ihr unmöglich sei, ihrer guten Mutter von Biederfeld und seiner Schönheit zu erzählen. Sie hatte schon oft seinen Namen auf der Zunge, aber wenn ihr dann der gütige, aber doch ernste Blick ihrer Mutter begegnete, so schlug sie beschämt die Augen nieder und fing von irgendeiner Kinderei zu reden an, die ihr aber gegen ihre Liebe sehr ernsthaft und bedeutend vorkam.
Es kam aber bald eine Zeit, wo sie aus einer andern Ursache schwieg. Jetzt kamen ihr ihre Empfindungen nicht mehr kindisch und abgeschmackt vor, so daß sie sie aus Scham verbarg, sondern sie fühlte sich nun über ihre Mutter erhaben, sie machte aus ihrer Liebe ein Geheimnis, weil sie sich einbildete, kein anderes Wesen könne die hohen und lautern Empfindungen ihres Herzens begreifen, jedes fremde Ohr dünkte ihr unheilig, um ihm den Namen Biederfeld und ihre Wünsche anzuvertrauen. Sie ward jetzt nachdenklich und liebte die Einsamkeit, sie las Gedichte mit Entzücken und saß stundenlang in Träumereien verloren, so daß sie nichts sah und hörte, was um sie her vorging, und wie aus dem Schlafe auffuhr, wenn die Mutter sie zuweilen rief. Diese aber bemerkte noch immer nichts, sondern meinte, das lustige, flüchtige Mädchen komme nun nach und nach zu Verstande.
So gewiß ist es, daß alle Menschen, die wir im gemeinen Leben klug und verständig nennen, nur bis auf eine gewisse Linie mit ihrer Klugheit reichen und sich jedesmal verrechnen, wenn sie sich weiter wagen. Die Frau von Bergen hatte nie geliebt, sie verstand also alle Symptome der Liebe an ihrer Tochter unrecht; ihre ganze Erziehung bis dahin war sehr gut und konsequent gewesen, sie hatte für alle Fälle stets die besten und wirkendsten Mittel in Bereitschaft, aber hier verließ sie ihr guter Genius völlig, so daß sie ihre Tochter ganz frei und ungehindert den Weg gehen ließ, den sie sich selber ohne alle andre Beihülfe gebahnt hatte.
Es gab freilich auch manche Stunden, worin Amalie sich das Unvernünftige ihrer Leidenschaft vorwarf, und wenn nur jemand gewesen wäre, dem sie sich ganz hätte vertrauen können, so wäre auch ihre Heilung vielleicht nicht unmöglich gewesen. Aber vom ersten Augenblicke hatte ihre Liebe den Reiz des Geheimnisvollen bekommen, das bewog sie, alles, was vorfiel, jeden Blick und jede unvermutete Zusammenkunft, jedes gesprochene Wort und jede kleine Aufmerksamkeit, als ein heiliges Geheimnis zu betrachten, dessen Verrat ihr Unglück machen würde. - Er war so schön und liebte sie so innig, wie hätte sie so grausam sein können, ihn nicht mit aller Zärtlichkeit wiederzulieben.
Er drückte ihr eines Tages ein Billett in die Hand, so daß es niemand bemerkte. Sie besann sich am Abend lange, ob sie es lesen sollte, ja, sie hatte schon angefangen, sich auszuziehen, um sich schlafen zu legen, als sie es dennoch erbrach und unter langem Herzklopfen folgende Worte las:
Die Liebenswürdigste ihres Geschlechts verdient auch die höchste Liebe; für Sie war mein Herz geschaffen, weil es der Liebe am meisten fähig ist. Vom ersten Augenblicke, in welchem ich Sie sah, war es Ihr Eigentum. Die Bande, die mich fesseln, sind zu süß, als daß ich jemals streben könnte, sie zu zerreißen: aber wäre es Ihnen wohl möglich, für die heftigste Liebe unempfindlich zu sein, wenn das höchste, das einzige Glück meines Lebens darin besteht, Ihnen nicht gleichgültig zu sein?
Amalie las das Billett und las es immer wieder von neuem, sie wußte es schon auswendig, als sie noch immer nicht den Inhalt ganz begriffen hatte. Sie überlegte dann lange, wie sie sich nehmen solle, sie ergriff die Feder, um in ein paar Zeilen zu antworten, und kam in zehn Briefen, ohne daß sie es bemerkte, in so weitläuftige, rührende Tiraden hinein, in denen sie von Unglück und Liebe, von Sehnsucht und Unmöglichkeit, Tränen und Verzweiflung durcheinandersprach, daß sie vor sich selber erschrak und es nur nach einer großen Selbstüberwindung dahin brachte, daß sie ihrem Liebhaber in wenigen und zweideutigen Worten Bescheid gab. Sie legte sich hierauf zu Bette, konnte aber die ganze Nacht nicht schlafen.
Die Erklärung von beiden Seiten war nun förmlich geschehen, und mit der Annahme des ersten Briefes war zugleich eine große und ununterbrochene Korrespondenz eröffnet. Der Liebhaber fand fast an jedem Tage Gelegenheit, seinem Mädchen einen Brief zuzustecken oder zustecken zu lassen. Geheime Zusammenkünfte wurden veranstaltet, und alles ging den Weg, den solche Intrigen gewöhnlich nehmen, das Geheimnis wird zur Gewohnheit, und mit jedem neuen Tage werden neue Billette geschrieben oder neue Zusammenkünfte veranstaltet.
Einige aufmerksame Beobachter, deren Geschäft es ist, alle Anekdoten und Familienvorfälle zu wissen, und die über alle Liebschaften ein förmliches Register halten, wollten nach einem halben Jahre bemerken, daß sich Biederfeld und Amalie weit seltner an öffentlichen Ortern sähen, weit weniger miteinander sprächen und sich oft beide zu vergessen schienen. Sie schlossen auf einen Zank, auf eine Kälte, die gewöhnlicherweise irgendeinmal bei solchen Begebenheiten eintritt und oft durch die kleinsten Zufälligkeiten veranlaßt wird; ob sie sich irrten oder nicht, wird der Leser aus dem Verfolge dieser Erzählung erfahren, aber Amalie gab ihnen wenigstens zu ihren Schlüssen alle Gelegenheit, denn sie war außerdem zerstreut und traurig, man bemerkte, daß sie oft für sich seufzte, ein geheimer Kummer schien an ihrem Herzen zu nagen.
Ihrer Mutter selbst war seit einiger Zeit diese Veränderung im Wesen Amaliens aufgefallen, sie hatte aber nur wenig daraus geschlossen, weil sie überzeugt war, ihre Tochter würde sich ihr schon entdecken, wenn sie irgend etwas auf dem Herzen hätte. Amalie aber entdeckte ihr nichts, sondern bat bloß um die Erlaubnis, irgendein musikalisches Instrument lernen zu dürfen; sie wählte vor allen übrigen die Laute und sagte, sie hätte von einem Frauenzimmer sprechen hören, das sie vorzüglich gut spiele, man schickte nach dieser, und Amalie nahm täglich eine Stunde.
Bei den ersten Stunden war die Mutter selbst zugegen und freute sich über die schnellen Fortschritte, die ihre Tochter machte. Amalie begriff in kurzer Zeit die Anfangsgründe der Kunst, und ihre Lehrmeisterin war außerordentlich mit ihr zufrieden. Die Mutter, die oft Besuche zu geben hatte oder durch ein andres Geschäft abgehalten wurde, ließ ihre Tochter nachher in ihren Lehrstunden allein, und schon nach einigen Wochen konnte ihr Amalie am Abende kleine Arien auf ihrer Laute Vorspielen.
Plötzlich blieb die Lehrmeisterin aus, sie schien verschwunden, denn niemand konnte von ihr Nachricht geben. Die Mutter war betrübt, daß die Lehrstunden unterbrochen wurden, und Amalie noch mehr, die gerade im Begriff gewesen war, auf der Laute eine Künstlerin zu werden. Amaliens Betrübnis kehrte wieder, und die Mutter erkundigte sich nun selbst bei ihr, was ihr fehle, erhielt aber keine befriedigende Antwort.
Um diese Zeit ward eine Vermählung bei Hofe gefeiert, und die öffentlichen Lustbarkeiten, die Pracht der Residenz zog den Adel der Provinzen nach der Hauptstadt. Unter den Fremden, welche täglich ankamen, befand sich auch der Graf Holfeld, einer der reichsten Edelleute und aus einer der angesehensten Familien; er war ein Mann, der durch seine angenehme Bildung und durch einen edlen Anstand sich jedermann empfahl, er war dreißig Jahr alt und hatte sich auf Reisen gebildet; er besaß nicht jenes abgeschmackte, galante Wesen vieler jungen Herrn, aber seine Unterhaltung war dafür auch um vieles angenehmer und verständiger, wenn nämlich der, mit dem er sprach, Verstand genug hatte, um seinen Witz zu verstehn.
Der Graf sah Amalien von ohngefähr im Theater, und vom ersten Augenblick interessierte er sich für sie; er machte die Bekanntschaft der Mutter und war häufig und am Ende fast täglich in ihrem Hause; er versäumte nichts, um seine Aufmerksamkeit für Amalien zu beweisen, er war ihr Begleiter zu allen Konzerten und Bällen, und die ganze Stadt sprach schon von ihm als dem künftigen Gatten des Fräulein von Bergen, als Amalien dieser Gedanke noch gar nicht eingefallen war.
Die Mutter sah die Zuneigung des Grafen mit Wohlgefallen, sie hatte bis jetzt ihrer Tochter in Ansehung ihrer Hand völlige Freiheit gelassen und schon mehrere Partien zurückgewiesen, weil die Liebhaber nicht gewußt hatten, sich Amaliens Liebe zu erwerben; sie war überzeugt, ihre Tochter würde die Verdienste des Grafen erkennen und nichts gegen seinen Antrag einzuwenden haben. — Amalie schien auch dem Grafen entgegenzukommen, ihre Heiterkeit kehrte etwas zurück, und sie war sehr gern in seiner Gesellschaft.
Die Mutter irrte nicht, wenn sie einen Heiratsantrag des Grafen erwartete; denn kaum waren vierzehn Tage verflossen, als der Graf ihr seine Vermögensumstände auseinandersetzte und um die Hand ihrer Tochter bat. Sie antwortete, daß dies ganz allein von Amalien abhinge. Der Graf verließ sie, und die Mutter ließ die Tochter rufen, um sie selbst um ihre Neigung zu fragen.
Das Zimmer ward verschlossen, und die Mutter fing an: Liebe Tochter, du hast gesehn, daß es nie meine Absicht gewesen ist, dich zu irgendeiner Heirat zu zwingen, wenn die Partie auch noch so vorteilhaft war, ich habe alles immer auf deinen Ausspruch ankommen lassen: der Graf hat um dich angehalten, sage mir aufrichtig, kannst du ihn lieben?
Ich erkenne, antwortete Amalie, die Vorzüge des Grafen, ich schätze ihn so, wie ich bis jetzt noch keinen Mann geschätzt habe, ich würde an seiner Seite eine glückliche Gattin sein, aber, liebste Mutter, ich kann ihn nicht heiraten!
Du achtest ihn, du würdest mit ihm glücklich sein und kannst ihn doch nicht heiraten? Wie verstehst du das?
Amaliens Augen flossen von Tränen über, sie stand auf und sank zu den Füßen ihrer Mutter nieder, sie schluchzte und konnte nicht sprechen. Ein gewaltiger Schmerz schien ihr Inneres zu erschüttern, einzelne ' Ausrufungen entfuhren ihr unwillkürlich.
Was ist dir, meine Tochter? rief die Mutter aus. Was ist dir, mein Kind? Dein Herz wird zerrissen, schütte dein Leiden aus in den Busen deiner Mutter.
Ach! rief Amalie, Ihre Tochter ist sehr unglücklich; darf ich Ihnen mein Unglück vertrauen? Wird sich Ihre zärtliche Liebe nicht in Haß und Abscheu verwandeln? Ach nein, denn meine innere Qual, meine Verzweiflung hat mich schon hinlänglich bestraft.
Nun, so rede, meine Tochter! O ich unglückliche Mutter! Sollte ich mich in dir geirrt haben? Sollte alle meine Zärtlichkeit, meine liebevolle Sorge unnütz gewesen sein?
Ich will Sie nicht hintergehn, sagte Amalie mit einem schmerzlichen Ton, ich habe Sie lange genug hintergangen, aber jetzt will ich aufrichtig sein. Ja, Mutter, Sie sehn zu Ihren Füßen ein unglückliches, ein verführtes Mädchen, die desto unglücklicher ist, da der geliebte Verführer sie nach dem Verlust ihrer Unschuld verlassen hat.
Die Mutter erschrak. Welcher Schmerz, von ihrem einzigen, geliebten Kinde dies Bekenntnis zu hören! Sie betrachtete sie lange stumm, dann hob sie sie sanft von der Erde auf und schloß sie in ihre Arme.
Du bist doch mein Kind, meine geliebte Tochter, rief sie aus. Laß uns jetzt daran denken, wie wir dein Unglück erleichtern, statt darüber zu klagen. Trockne deine Tränen und vertraue dich mir ganz; dieser Fehltritt wird dir für die Zukunft die beste und lehrreichste Warnung sein.
Amalie weinte von neuem und beschwor ihre Mutter, ihr zu verzeihen. Sie entdeckte ihr, daß sie sich seit zwei Monaten schwanger fühle, und die Mutter fing an, über ihren Zustand nachzudenken.
Meine Tochter, fing sie an, der Graf will dich heiraten, und sein Antrag ist für uns der vorteilhafteste. Es wäre etwas Leichtes, die Heirat jetzt zu vollziehen und ihn zu hintergehen; man könnte ihn auch mit deiner Niederkunft betrügen, aber mein Gefühl empört sich dagegen. Das Geheimnis könnte endlich doch entdeckt werden, und du wärst dann doppelt unglücklich. Auch verheimlichen wollen wir deine Schwangerschaft nicht, um dich nach der Entbindung mit ihm zu verheiraten, sondern die ganze Welt soll sie erfahren. Nur muß alles nach meinem Plan mit großer Behutsamkeit und Vorsicht getan werden, besonders muß der Graf noch einige Zeit hingehalten werden. Frage mich jetzt noch nicht, wie alles dies veranstaltet werden soll; genug, ich werde dir alles weitläuftig vorschreiben, was du tun und lassen sollst. Aber jetzt erzähle mir umständlich deine Geschichte.
Ich soll also alle Schmerzen von neuem empfinden? sagte Amalie. Sie bedachte sich einen Augenblick, und dann erzählte sie, was der Leser zum Teil schon weiß, ihre Liebe gegen Biederfeld, wie diese Leidenschaft entstanden und gewachsen sei und welchen unglücklichen Ausgang sie endlich genommen habe.
Ich bat Sie so inständig, sagte sie, mir auf der Laute Unterricht geben zu lassen; ach! dies war nichts als eine Erfindung meines Liebhabers, weil er dies Instrument vorzüglich gut spielte. Er kam in Weiberkleidern, und wir waren täglich allein. Seine Liebe, meine Schwachheit, die Gelegenheit - ach! ich vergaß endlich mich und die Tugend und stürzte in den Abgrund, der mich seitdem so elend gemacht hat. Kaum war der Fehltritt geschehn, so verließ mich der Ungetreue plötzlich; er kam nicht wieder, und ich habe seitdem nicht einmal einen Brief, nicht eine einzige Nachricht von ihm erhalten, wo er sich aufhält.
Amalie weinte und seufzte von neuem. Die Mutter tröstete sie, soviel sie konnte. Wir müssen, sagte sie endlich, auf Mittel denken, deine Schande zu verhüten. In acht Tagen sollst du verheiratet sein, aber nicht an den Grafen, ob ich dich gleich für ihn bestimmt habe.
Ich bitte Sie, liebe Mutter, sagte Amalie, erklären Sie mir das Rätsel, das mir durchaus unbegreiflich ist.
In acht Tagen, antwortete die Mutter, bist du verheiratet, in drei Monaten Witwe, jedermann erfährt dann deine Niederkunft, und du wirst die Frau des Grafen.
Das alles ist mir noch immer unbegreiflich, sagte Amalie; wen soll ich denn in acht Tagen heiraten?
Laß mich nur selber den Plan ausführen, den ich entworfen habe. Der Graf muß sich auf ein paar Tage entfernen; erwidre seine Liebe, wenn er mit dir davon spricht.
Schon am folgenden Tage sagte die Frau von Bergen mehreren ihrer Anverwandten, daß der Graf von Silbersee sich um ihre Tochter bewürbe; sie kenne seine Familie und seine Güter, die sehr ansehnlich wären, nur von der Residenz weit entlegen. Er habe ihr geschrieben, daß er in einigen Tagen selber kommen wolle, um Amalien den Vorschlag zu tun.
Der Graf Holfeld besuchte indes Amalien täglich und sagte ihr, daß er sich jetzt genötigt sehe, auf einige Zeit nach seinen Gütern zurückzureisen, weil ihm seine Mutter geschrieben habe, sie sei krank geworden und wünsche ihn zu sehn.