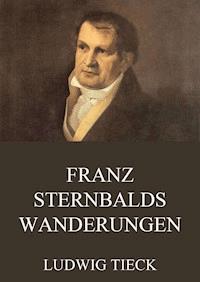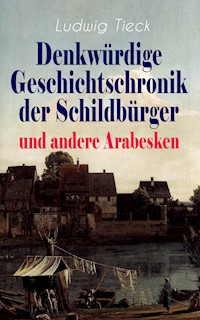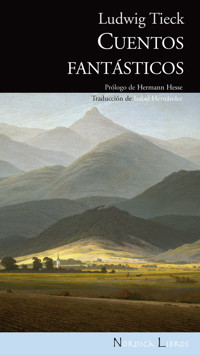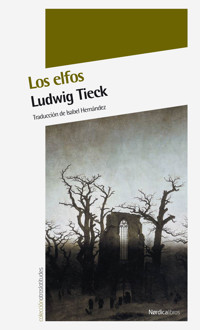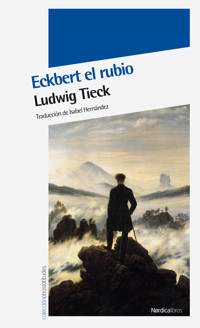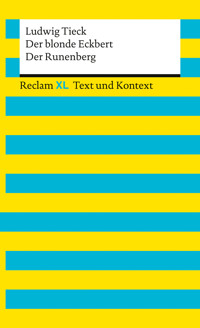Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Erleben Sie die Märchen und Sagen aus aller Welt in dieser Serie "Märchen der Welt". Von den Ländern Europas über die Kontinente bis zu vergangenen Kulturen und noch heute existierenden Völkern: "Märchen der Welt" bietet Ihnen stundenlange Abwechslung. Ein Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis dieses Buches: Der blonde Eckbert Der Getreue Eckart und der Tannenhäuser Der Runenberg Liebeszauber Liebesgeschichte der schönen Magelone und des Grafen Peter von Provence Die Elfen Der Pokal
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Märchen aus dem Phantasus
Ludwig Tieck
Inhalt:
Ludwig Tieck – Biografie und Bibliografie
Die Märchen aus dem Phantasus
Der blonde Eckbert
Der Getreue Eckart und Der Tannenhäuser
Der Runenberg
Liebeszauber
Liebesgeschichte der schönen Magelone und des Grafen Peter von Provence
Die Elfen
Der Pokal
Märchen aus dem Phantasus, Ludwig Tieck
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849603373
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Sweet Angel - Fotolia.com
Ludwig Tieck – Biografie und Bibliografie
Dichter der romantischen Schule, geb. 31. Mai 1773 in Berlin, gest. daselbst 28. April 1853, Sohn eines Seilermeisters, besuchte seit 1782 das damals unter Gedikes Leitung stehende Friedrichswerdersche Gymnasium, wo er sich eng an Wackenroder anschloß, und studierte darauf in Halle, Göttingen und kurze Zeit in Erlangen Geschichte, Philologie, alte und neue Literatur. Nach Berlin zurückgekehrt, lebte er von dem Ertrag seiner schriftstellerischen Arbeiten, die er größtenteils im Verlag des Aufklärers Nicolai veröffentlichte. So erschienen in rascher Reihenfolge die Erzählungen und Romane: »Peter Lebrecht, eine Geschichte ohne Abenteuerlichkeiten« (Berl. 1795, 2 Bde.), »William Lovell« (das. 1795–96, 3 Bde.; vgl. Haßler, L. Tiecks Jugendroman »William Lovell« und der »Paysan perverti« des Rétif de la Bretonne, Dissertation, Greifsw. 1903) und »Abdallah« (das. 1796), ferner Novellen meist satirischen Inhalts in der Sammlung »Straußfedern« (1795–98), worauf er, seinen Übergang zur eigentlichen Romantik vollziehend, die bald dramatisch-satirische, bald schlicht erzählende Bearbeitung alter Volkssagen und Märchen unternahm und unter dem Titel: »Volksmärchen von Peter Lebrecht« (das. 1797, 3 Bde.) veröffentlichte. Den größten Erfolg errangen unter diesen Dichtungen die unheimlich düstere Erzählung »Der blonde Eckert« und das phantastisch-satirische Drama »Der gestiefelte Kater«. Die Richtung, die in seinen Schriften immer deutlicher hervortrat, mußte ihn in schroffen Gegensatz zu Nicolai sowie zu Iffland, dem Leiter des Berliner Theaters, bringen, während die Romantiker ihn begeistert anpriesen als ein Genie, das Goethe ebenbürtig sei. Nachdem er sich 1798 in Hamburg mit einer Tochter des Predigers Alberti verheiratet hatte, verweilte er 1799–1800 in Jena, wo er zu den beiden Schlegel, Hardenberg (Novalis), Brentano, Fichte und Schelling in freundschaftliche Beziehungen trat, auch Goethe und Schiller kennen lernte, nahm 1801 mit Fr. v. Schlegel seinen Wohnsitz in Dresden und lebte seit 1802 meist auf dem Gute Ziebingen bei Frankfurt a. O., mit dessen Besitzern (erst v. Burgsdorff, dann Graf Finkenstein) er eng befreundet war. Doch unterbrach er diesen Aufenthalt durch längere Reisen nach Italien, wo er die deutschen Handschriften der vatikanischen Bibliothek studierte (1805), sowie nach Dresden, Wien und München (1808–10). Während dieses Zeitraums waren erschienen: »Franz Sternbalds Wanderungen« (Berl. 1798), ein die altdeutsche Kunst verherrlichender Roman, an dem auch sein Freund Wackenroder Anteil hatte, »Prinz Zerbino, oder die Reise nach dem guten Geschmack« (Jena 1799), und »Romantische Dichtungen« (das. 1799–1800, 2 Bde.) mit dem Trauerspiel »Leben und Tod der heil. Genoveva« (separat, Berl. 1820) sowie das nach einem alten Volksbuch gearbeitete Lustspiel »Kaiser Octavianus« (Jena 1804), weitschweifige Dichtungen, in denen das erzählende und namentlich das lyrische Element überwiegt, aber aus einem Gewirr mannigfaltigster metrischer Ausdrucksformen gelegentlich doch echte Schönheit hervorleuchtet (vgl. Ranftl, L. Tiecks »Genoveva« als romantische Dichtung betrachtet, Graz 1899). Von den zahlreichen Übersetzungen und Bearbeitungen fremder Werke, die T. damals veröffentlichte, seien erwähnt: die fehlerhaften »Minnelieder aus der schwäbischen Vorzeit« (Berl. 1803), die gelungene Verdeutschung des »Don Quichotte« von Cervantes (das. 1799–1804, 4 Bde.), die wertvolle Übersetzung einer Anzahl Shakespeare zugeschriebener, aber zweifelhafter Stücke u. d. T.: »Altenglisches Theater« (das. 1811, 2 Bde.) u. a. Auch gab er u. d. T.: »Phantasus« (Berl. 1812–17, 3 Bde.; 2. Ausg., das. 1844–45, 3 Bde.) eine Sammlung früherer Märchen und Schauspiele, vermehrt mit neuen Erzählungen und dem Märchenschauspiel »Fortunat«, heraus, welche die deutsche Lesewelt lebhaft für T. interessierte. Das Kriegsjahr 1813 sah den Dichter in Prag; nach dem Frieden unternahm er größere Reisen nach London und Paris, hauptsächlich im Interesse eines großen Hauptwerks über Shakespeare, das er leider nie vollendete. 1819 verließ er dauernd seine ländliche Einsamkeit und nahm seinen Wohnsitz in Dresden, wo nun die produktivste und wirkungsreichste Periode seines Dichterlebens begann. Trotz des Gegensatzes, in dem sich Tiecks geistige Vornehmheit zur Trivialität der Dresdener Belletristik befand, gelang es ihm, hauptsächlich durch seine fast allabendlich stattfindenden dramatischen Vorlesungen, in denen er sich als Meister in der Kunst des Vortrags bewährte, einen Kreis um sich zu sammeln, der seine Anschauungen von der Kunst als maßgebend anerkannte. Als Dramaturg des Hoftheaters (seit 1825) gewann er eine bedeutende Wirksamkeit, die ihm freilich durch Angriffe der Gegenpartei mannigfach verleidet wurde. In der Novellendichtung, der sich T. in dieser Dresdener Zeit vor allem widmete, leistete er zum Teil Vortreffliches; aber er bahnte auch jener bedenklichen Gesprächsnovellistik den Weg, in der das epische Element fast ganz hinter dem reflektierenden zurücktritt. Zu den bedeutendsten zählen: »Die Gemälde«, »Die Reisenden«, »Der Alte vom Berge«, »Die Gesellschaft auf dem Lande«, »Die Verlobung«, »Musikalische Leiden und Freuden«, »Des Lebens Überfluß« u. a. Unter den historischen haben »Der griechische Kaiser«, »Dichterleben«, »Der Tod des Dichters« und vor allen der großartig angelegte, leider unvollendete »Aufruhr in den Cevennen« Anspruch auf bleibende Bedeutung. In allen diesen Novellen befriedigt nicht nur meist die einfache Anmut der Darstellungsweise, sondern auch die Mannigfaltigkeit lebendiger und typischer Charaktere und der Tiefsinn der poetischen Idee. Sein letztes größeres Werk: »Vittoria Accorombona« (Bresl. 1840), entstand unter den Einwirkungen der neufranzösischen Romantik und hinterließ trotz der Farbenpracht einen überwiegend peinlichen Eindruck.
T. übernahm in Dresden auch die Herausgabe und Vollendung der von A. W. v. Schlegel begonnenen Shakespeare-Übertragung (Berl. 1825–33, 9 Bde.), doch hat er selber nur die Anmerkungen beigesteuert. Die Übersetzungen A. W. v. Schlegels (s. d.) wurden zum Teil mit eigenmächtigen Änderungen wieder abgedruckt, die übrigen Stücke übersetzten Tiecks Tochter Dorothea (geb. 1799) und Wolf Graf von Baudissin (s. d.). Diese beiden verdeutschten auch noch sechs weitere Stücke des alten englischen Theaters, die T. als »Shakespeares Vorschule« (Leipz. 1823–29, 2 Bde.) mit ausführlicher literarhistorischer Einleitung herausgab. Ebenso stammen aus dieser Zeit mehrere mit Einleitungen versehene Ausgaben von Werken deutscher Dichter, auf die er die Aufmerksamkeit von neuem hinlenken wollte. So hatte er schon 1817 eine Sammlung älterer Bühnenstücke u. d. T.: »Deutsches Theater« veröffentlicht (Berl., 2 Bde.). Dann gab er die hinterlassenen Schriften Heinrichs v. Kleist (Berl. 1821) heraus, denen die »Gesammelten Werke« desselben Dichters (das. 1826, 3 Bde.) folgten, ferner Schnabels Roman »Die Insel Felsenburg« (Bresl. 1827) und die »Gesammelten Schriften« von J. M. R. Lenz (Berl. 1828, 3 Bde.). Aus seiner dramaturgisch-kritischen Tätigkeit erwuchsen die wertvollen »Dramaturgischen Blätter« (Bresl. 1825–26, 2 Bde.; Bd. 3, Leipz. 1852; vollständige Ausg., das. 1852, 2 Tle.). 1837 verlor T. seine Frau, seine Tochter Dorothea starb 21. Febr. 1841. In demselben Jahre wurde er vom König Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin berufen, wo er, durch Kränklichkeit zumeist an das Haus gefesselt, ein zwar ehrenvolles und sorgenfreies, aber im ganzen sehr resigniertes Alter verlebte. Sein Bildnis s. Tafel »Deutsche Romantiker« (Bd. 17). Seine »Schriften« erschienen in 20 Bänden (Berl. 1828–46), seine »Kritischen Schriften« in 2 Bänden (Leipz. 1848), »Gesammelte Novellen« in 12 Bänden (Berl. 1852–54), »Nachgelassene Schriften« in 2 Bänden (Leipz. 1855). »Ausgewählte Werke« Tiecks gaben Welti (Stuttg. 1886–1888, 8 Bde.), Klee (mit Biographie, Einleitungen und Anmerkungen, Leipz. 1892, 3 Bde.) und Witkowski (mit Einleitung, das. 1903, 4 Bde.) heraus. Aus Tiecks Nachlaß, der sich in der Berliner Bibliothek befindet, veröffentlichte Bolte mehrere Übersetzungen englischer Dramen, unter andern »Mucedorus« (Berl. 1893). Die Ungleichheit von Tiecks Leistungen ist z. T. auf sein improvisatorisches Arbeiten zurückzuführen, das ihn selten zu reiner Ausgestaltung seiner geist-, phantasie- und lebensvollen Entwürfe gelangen ließ; die Gesamtheit seiner Schriften verrät deutlich die Weite und Größe seines Talents. R. Köpke, der T. in den letzten Berliner Jahren nahe stand, veröffentlichte eine ausführliche Biographie u. d. T.: »Ludwig T., Erinnerungen aus dem Leben etc.« (Leipz. 1855, 2 Bde.). Vgl. außerdem H. v. Friesen, Ludwig T., Erinnerungen (hauptsächlich aus der Dresdener Zeit, Wien 1871, 2 Bde.); »Briefe an Ludwig T.« (hrsg. von K. v. Holtei, Bresl. 1864, 4 Bde.); Ad. Stern, Ludwig T. in Dresden (in dem Werk »Zur Literatur der Gegenwart«, Leipz. 1880); Steiner, Ludwig T. und die Volksbücher (Berl. 1893); Garnier, Zur Entwicklungsgeschichte der Novellendichtung Tiecks (Gieß. 1899); Mießner, L. Tiecks Lyrik (Berl. 1902); Ederheimer, Jak. Böhmes Einfluß auf T. und Novalis (Heidelb. 1904); Koldewey, Wackenroder und sein Einfluß auf T. (Leipz. 1904); Günther, Romantische Kritik und Satire bei Ludwig T. (das. 1907). – Tiecks Schwester Sophie T., geb. 1775 in Berlin, verheiratete sich 1799 mit Aug. Ferd. Bernhardi (s. d.), von dem sie 1805 wieder geschieden wurde, lebte dann in Süddeutschland und mit ihren Brüdern, dem Dichter und dem Bildhauer, längere Zeit in Rom, später in Wien, München und Dresden. 1810 schloß sie eine zweite Ehe mit einem Esthländer, v. Knorring, dem sie in dessen Heimat folgte, und starb dort 1836. Sie hat außer Gedichten, z. B. dem Epos »Flore und Blanchefleur« (hrsg. von A. W. v. Schlegel, Berl. 1822), auch Schauspiele und einige Romane, wie »Evremont« (hrsg. von Ludw. T., das. 1836), geschrieben.
Die Märchen aus dem Phantasus
Der blonde Eckbert
In einer Gegend des Harzes wohnte ein Ritter, den man gewöhnlich nur den blonden Eckbert nannte. Er war ohngefähr vierzig Jahr alt, kaum von mittler Größe, und kurze hellblonde Haare lagen schlicht und dicht an seinem blassen eingefallenen Gesichte. Er lebte sehr ruhig für sich und war niemals in den Fehden seiner Nachbarn verwickelt, auch sah man ihn nur selten außerhalb den Ringmauern seines kleinen Schlosses. Sein Weib liebte die Einsamkeit ebensosehr, und beide schienen sich von Herzen zu lieben, nur klagten sie gewöhnlich darüber, daß der Himmel ihre Ehe mit keinen Kindern segnen wolle.
Nur selten wurde Eckbert von Gästen besucht, und wenn es auch geschah, so wurde ihretwegen fast nichts in dem gewöhnlichen Gange des Lebens geändert, die Mäßigkeit wohnte dort, und die Sparsamkeit selbst schien alles anzuordnen. Eckbert war alsdann heiter und aufgeräumt, nur wenn er allein war, bemerkte man an ihm eine gewisse Verschlossenheit, eine stille zurückhaltende Melancholie.
Niemand kam so häufig auf die Burg als Philipp Walther, ein Mann, dem sich Eckbert angeschlossen hatte, weil er an diesem ohngefähr dieselbe Art zu denken fand, der auch er am meisten zugetan war. Dieser wohnte eigentlich in Franken, hielt sich aber oft über ein halbes Jahr in der Nähe von Eckberts Burg auf, sammelte Kräuter und Steine, und beschäftigte sich damit, sie in Ordnung zu bringen, er lebte von einem kleinen Vermögen und war von niemand abhängig. Eckbert begleitete ihn oft auf seinen einsamen Spaziergängen, und mit jedem Jahre entspann sich zwischen ihnen eine innigere Freundschaft.
Es gibt Stunden, in denen es den Menschen ängstigt, wenn er vor seinem Freunde ein Geheimnis haben soll, was er bis dahin oft mit vieler Sorgfalt verborgen hat, die Seele fühlt dann einen unwiderstehlichen Trieb, sich ganz mitzuteilen, dem Freunde auch das Innerste aufzuschließen, damit er um so mehr unser Freund werde. In diesen Augenblicken geben sich die zarten Seelen einander zu erkennen, und zuweilen geschieht es wohl auch, daß einer vor der Bekanntschaft des andern zurückschreckt.
Es war schon im Herbst, als Eckbert an einem neblichten Abend mit seinem Freunde und seinem Weibe Bertha um das Feuer eines Kamines saß. Die Flamme warf einen hellen Schein durch das Gemach und spielte oben an der Decke, die Nacht sah schwarz zu den Fenstern herein, und die Bäume draußen schüttelten sich vor nasser Kälte. Walther klagte über den weiten Rückweg, den er habe, und Eckbert schlug ihm vor, bei ihm zu bleiben, die halbe Nacht unter traulichen Gesprächen hinzubringen, und dann in einem Gemache des Hauses bis am Morgen zu schlafen. Walther ging den Vorschlag ein, und nun ward Wein und die Abendmahlzeit hereingebracht, das Feuer durch Holz vermehrt, und das Gespräch der Freunde heitrer und vertraulicher.
Als das Abendessen abgetragen war, und sich die Knechte wieder entfernt hatten, nahm Eckbert die Hand Walthers und sagte: "Freund, Ihr solltet Euch einmal von meiner Frau die Geschichte ihrer Jugend erzählen lassen, die seltsam genug ist." – "Gern", sagte Walther, und man setzte sich wieder um den Kamin.
Es war jetzt gerade Mitternacht, der Mond sah abwechselnd durch die vorüberflatternden Wolken. "Ihr müßt mich nicht für zudringlich halten", Eng Bertha an, "mein Mann sagt, daß Ihr so edel denkt, daß es unrecht sei, Euch etwas zu verhehlen. Nur haltet meine Erzählung für kein Märchen, so sonderbar sie auch klingen mag.
Ich bin in einem Dorfe geboren, mein Vater war ein armer Hirte. Die Haushaltung bei meinen Eltern war nicht zum besten bestellt, sie wußten sehr oft nicht, wo sie das Brot hernehmen sollten. Was mich aber noch weit mehr jammerte, war, daß mein Vater und meine Mutter sich oft über ihre Armut entzweiten, und einer dem andern dann bittere Vorwürfe machte. Sonst hört ich beständig von mir, daß ich ein einfältiges dummes Kind sei, das nicht das unbedeutendste Geschäft auszurichten wisse, und wirklich war ich äußerst ungeschickt und unbeholfen, ich ließ alles aus den Händen fallen, ich lernte weder nähen noch spinnen, ich konnte nichts in der Wirtschaft helfen, nur die Not meiner Eltern verstand ich sehr gut. Oft saß ich dann im Winkel und füllte meine Vorstellungen damit an, wie ich ihnen helfen wollte, wenn ich plötzlich reich würde, wie ich sie mit Gold und Silber überschütten und mich an ihrem Erstaunen laben möchte, dann sah ich Geister heraufschweben, die mir unterirdische Schätze entdeckten, oder mir kleine Kiesel gaben, die sich in Edelsteine verwandelten, kurz, die wunderbarsten Phantasien beschäftigten mich, und wenn ich nun aufstehn mußte, um irgend etwas zu helfen, oder zu tragen, so zeigte ich mich noch viel ungeschickter, weil mir der Kopf von allen den seltsamen Vorstellungen schwindelte.
Mein Vater war immer sehr ergrimmt auf mich, daß ich eine so ganz unnütze Last des Hauswesens sei, er behandelte mich daher oft ziemlich grausam, und es war selten, daß ich ein freundliches Wort von ihm vernahm. So war ich ungefähr acht Jahr alt geworden, und es wurden nun ernstliche Anstalten gemacht, daß ich etwas tun, oder lernen sollte. Mein Vater glaubte, es wäre nur Eigensinn oder Trägheit von mir, um meine Tage in Müßiggang hinzubringen, genug, er setzte mir mit Drohungen unbeschreiblich zu, da diese aber doch nichts fruchteten, züchtigte er mich auf die grausamste Art, indem er sagte, daß diese Strafe mit jedem Tage wiederkehren sollte, weil ich doch nur ein unnützes Geschöpf sei.
Die ganze Nacht hindurch weint ich herzlich, ich fühlte mich so außerordentlich verlassen, ich hatte ein solches Mitleid mit mir selber, daß ich zu sterben wünschte. Ich fürchtete den Anbruch des Tages, ich wußte durchaus nicht, was ich anfangen sollte, ich wünschte mir alle mögliche Geschicklichkeit und konnte gar nicht begreifen, warum ich einfältiger sei, als die übrigen Kinder meiner Bekanntschaft. Ich war der Verzweiflung nahe.
Als der Tag graute, stand ich auf und eröffnete, fast ohne daß ich es wußte, die Tür unsrer kleinen Hütte. Ich stand auf dem freien Felde, bald darauf war ich in einem Walde, in den der Tag kaum noch hineinblickte. Ich lief immerfort, ohne mich umzusehn, ich fühlte keine Müdigkeit, denn ich glaubte immer, mein Vater würde mich noch wieder einholen, und, durch meine Flucht gereizt, mich noch grausamer behandeln.
Als ich aus dem Walde wieder heraustrat, stand die Sonne schon ziemlich hoch, ich sah jetzt etwas Dunkles vor mir liegen, welches ein dichter Nebel bedeckte. Bald mußte ich über Hügel klettern, bald durch einen zwischen Felsen gewundenen Weg gehn, und ich erriet nun, daß ich mich wohl in dem benachbarten Gebirge befinden müsse, worüber ich anfing mich in der Einsamkeit zu fürchten. Denn ich hatte in der Ebene noch keine Berge gesehn, und das bloße Wort Gebirge, wenn ich davon hatte reden hören, war meinem kindischen Ohr ein fürchterlicher Ton gewesen. Ich hatte nicht das Herz zurückzugehn, meine Angst trieb mich vorwärts; oft sah ich mich erschrocken um, wenn der Wind über mir weg durch die Bäume fuhr oder ein ferner Holzschlag weit durch den stillen Morgen hintönte. Als mir Köhler und Bergleute endlich begegneten und ich eine fremde Aussprache hörte, wäre ich vor Entsetzen fast in Ohnmacht gesunken.
Ich kam durch mehrere Dörfer und bettelte, weil ich jetzt Hunger und Durst empfand, ich half mir so ziemlich mit meinen Antworten durch, wenn ich gefragt wurde. So war ich ohngefähr vier Tage fortgewandert, als ich auf einen kleinen Fußsteig geriet, der mich von der großen Straße immer mehr entfernte. Die Felsen um mich her gewannen jetzt eine andre, weit seltsamere Gestalt. Es waren Klippen, so aufeinandergepackt, daß es das Ansehn hatte, als wenn sie der erste Windstoß durcheinanderwerfen würde. Ich wußte nicht, ob ich weitergehn sollte. Ich hatte des Nachts immer im Walde geschlafen, denn es war gerade zur schönsten Jahrszeit, oder in abgelegenen Schäferhütten; hier traf ich aber gar keine menschliche Wohnung, und konnte auch nicht vermuten, in dieser Wildnis auf eine zu stoßen; die Felsen wurden immer furchtbarer, ich mußte oft dicht an schwindlichten Abgründen vorbeigehn, und endlich hörte sogar der Weg unter meinen Füßen auf. Ich war ganz trostlos, ich weinte und schrie, und in den Felsentälern hallte meine Stimme auf eine schreckliche Art zurück. Nun brach die Nacht herein, und ich suchte mir eine Moosstelle aus, um dort zu ruhn. Ich konnte nicht schlafen; in der Nacht hörte ich die seltsamsten Töne, bald hielt ich es für wilde Tiere, bald für den Wind, der durch die Felsen klage, bald für fremde Vögel. Ich betete, und ich schlief nur spät gegen Morgen ein.
Ich erwachte, als mir der Tag ins Gesicht schien. Vor mir war ein steiler Felsen, ich kletterte in der Hoffnung hinauf, von dort den Ausgang aus der Wildnis zu entdecken, und vielleicht Wohnungen oder Menschen gewahr zu werden. Als ich aber oben stand, war alles, so weit nur mein Auge reichte, ebenso, wie um mich her, alles war mit einem neblichten Dufte überzogen, der Tag war grau und trübe, und keinen Baum, keine Wiese, selbst kein Gebüsch konnte mein Auge erspähn, einzelne Sträucher ausgenommen, die einsam und betrübt in engen Felsenritzen emporgeschossen waren. Es ist unbeschreiblich, welche Sehnsucht ich empfand, nur eines Menschen ansichtig zu werden, wäre es auch, daß ich mich vor ihm hätte fürchten müssen. Zugleich fühlte ich einen peinigenden Hunger, ich setzte mich nieder und beschloß zu sterben. Aber nach einiger Zeit trug die Lust zu leben dennoch den Sieg davon, ich raffle mich auf und ging unter Tränen, unter abgebrochenen Seufzern den ganzen Tag hindurch; am Ende war ich mir meiner kaum noch bewußt, ich war müde und erschöpft, ich wünschte kaum noch zu leben, und fürchtete doch den Tod.
Gegen Abend schien die Gegend umher etwas freundlicher zu werden, meine Gedanken, meine Wünsche lebten wieder auf, die Lust zum Leben erwachte in allen meinen Adern. Ich glaubte jetzt das Gesause einer Mühle aus der Ferne zu hören, ich verdoppelte meine Schritte, und wie wohl, wie leicht ward mir, als ich endlich wirklich die Grenzen der öden Felsen erreichte; ich sah Wälder und Wiesen mit fernen angenehmen Bergen wieder vor mir liegen. Mir war, als wenn ich aus der Hölle in ein Paradies getreten wäre, die Einsamkeit und meine Hülflosigkeit schienen mir nun gar nicht fürchterlich.
Statt der gehofften Mühle stieß ich auf einen Wasserfall, der meine Freude freilich um vieles minderte; ich schöpfte mit der Hand einen Trunk aus dem Bache, als mir plötzlich war, als höre ich in einiger Entfernung ein leises Husten. Nie bin ich so angenehm überrascht worden, als in diesem Augenblick, ich ging näher und ward an der Ecke des Waldes eine alte Frau gewahr, die auszuruhen schien. Sie war fast ganz schwarz gekleidet und eine schwarze Kappe bedeckte ihren Kopf und einen großen Teil des Gesichtes, in der Hand hielt sie einen Krückenstock.
Ich näherte mich ihr und bat um ihre Hülfe; sie ließ mich neben sich niedersitzen und gab mir Brot und etwas Wein. Indem ich aß, sang sie mit kreischendem Ton ein geistliches Lied. Als sie geendet hatte, sagte sie mir, ich möchte ihr folgen.
Ich war über diesen Antrag sehr erfreut, so wunderlich mir auch die Stimme und das Wesen der Alten vorkam. Mit ihrem Krückenstocke ging sie ziemlich behende, und bei jedem Schritte verzog sie ihr Gesicht so, daß ich im Anfange darüber lachen mußte. Die wilden Felsen traten immer weiter hinter uns zurück, wir gingen über eine angenehme Wiese, und dann durch einen ziemlich langen Wald. Als wir heraustraten, ging die Sonne gerade unter, und ich werde den Anblick und die Empfindung dieses Abends nie vergessen. In das sanfteste Rot und Gold war alles verschmolzen, die Bäume standen mit ihren Wipfeln in der Abendröte, und über den Feldern lag der entzückende Schein, die Wälder und die Blätter der Bäume standen still, der reine Himmel sah aus wie ein aufgeschlossenes Paradies, und das Rieseln der Quellen und von Zeit zu Zeit das Flüstern der Bäume tönte durch die heitre Stille wie in wehmütiger Freude. Meine junge Seele bekam jetzt zuerst eine Ahndung von der Welt und ihren Begebenheiten. Ich vergaß mich und meine Führerin, mein Geist und meine Augen schwärmten nur zwischen den goldnen Wolken.
Wir stiegen nun einen Hügel hinan, der mit Birken bepflanzt war, von oben sah man in ein grünes Tal voller Birken hinein, und unten mitten in den Bäumen lag eine kleine Hütte. Ein munteres Bellen kam uns entgegen, und bald sprang ein kleiner behender Hund die Alte an, und wedelte, dann kam er zu mir, besah mich von allen Seiten, und kehrte mit freundlichen Gebärden zur Alten zurück.
Als wir vom Hügel heruntergingen, hörte ich einen wunderbaren Gesang, der aus der Hütte zu kommen schien, wie von einem Vogel, es sang also:
›Waldeinsamkeit,
Die mich erfreut,
So morgen wie heut
In ewger Zeit,
O wie mich freut
Waldeinsamkeit.‹
Diese wenigen Worte wurden beständig wiederholt; wenn ich es beschreiben soll, so war es fast, als wenn Waldhorn und Schalmeie ganz in der Ferne durcheinanderspielen.
Meine Neugier war außerordentlich gespannt; ohne daß ich auf den Befehl der Alten wartete, trat ich mit in die Hütte. Die Dämmerung war schon eingebrochen, alles war ordentlich aufgeräumt, einige Becher standen auf einem Wandschranke, fremdartige Gefäße auf einem Tische, in einem glänzenden Käfig hing ein Vogel am Fenster, und er war es wirklich, der die Worte sang. Die Alte keichte und hustete, sie schien sich gar nicht wieder erholen zu können, bald streichelte sie den kleinen Hund, bald sprach sie mit dem Vogel, der ihr nur mit seinem gewöhnlichen Liede Antwort gab; übrigens tat sie gar nicht, als wenn ich zugegen wäre. Indem ich sie so betrachtete, überlief mich mancher Schauer: denn ihr Gesicht war in einer ewigen Bewegung, indem sie dazu wie vor Alter mit dem Kopfe schüttelte, so daß ich durchaus nicht wissen konnte, wie ihr eigentliches Aussehn beschaffen war.
Als sie sich erholt hatte, zündete sie Licht an, deckte einen ganz kleinen Tisch und trug das Abendessen auf. Jetzt sah sie sich nach mir um, und hieß mir einen von den geflochtenen Rohrstühlen nehmen. So saß ich ihr nun dicht gegenüber und das Licht stand zwischen uns. Sie faltete ihre knöchernen Hände und betete laut, indem sie ihre Gesichtsverzerrungen machte, so daß es mich beinahe wieder zum Lachen gebracht hätte; aber ich nahm mich sehr in acht, um sie nicht zu erbosen.
Nach dem Abendessen betete sie wieder, und dann wies sie mir in einer niedrigen und engen Kammer ein Bett an; sie schlief in der Stube. Ich blieb nicht lange munter, ich war halb betäubt, aber in der Nacht wachte ich einigemal auf, und dann hörte ich die Alte husten und mit dem Hunde sprechen, und den Vogel dazwischen, der im Traum zu sein schien, und immer nur einzelne Worte von seinem Liede sang. Das machte mit den Birken, die vor dem Fenster rauschten, und mit dem Gesang einer entfernten Nachtigall ein so wunderbares Gemisch, daß es mir immer nicht war, als sei ich erwacht, sondern als fiele ich nur in einen andern noch seltsamern Traum.
Am Morgen weckte mich die Alte, und wies mich bald nachher zur Arbeit an. Ich mußte spinnen, und ich begriff es auch bald, dabei hatte ich noch für den Hund und für den Vogel zu sorgen. Ich lernte mich schnell in die Wirtschaft finden, und alle Gegenstände umher wurden mir bekannt; nun war mir, als müßte alles so sein, ich dachte gar nicht mehr daran, daß die Alte etwas Seltsames an sich habe, daß die Wohnung abenteuerlich und von allen Menschen entfernt liege, und daß an dem Vogel etwas Außerordentliches sei. Seine Schönheit fiel mir zwar immer auf, denn seine Federn glänzten mit allen möglichen Farben, das schönste Hellblau und das brennendste Rot wechselten an seinem Halse und Leibe, und wenn er sang, blähte er sich stolz auf, so daß sich seine Federn noch prächtiger zeigten.
Oft ging die Alte aus und kam erst am Abend zurück, ich ging ihr dann mit dem Hunde entgegen, und sie nannte mich Kind und Tochter. Ich ward ihr endlich von Herzen gut, wie sich unser Sinn denn an alles, besonders in der Kindheit, gewöhnt. In den Abendstunden lehrte sie mich lesen, ich fand mich leicht in die Kunst, und es ward nachher in meiner Einsamkeit eine Quelle von unendlichem Vergnügen, denn sie hatte einige alte geschriebene Bücher, die wunderbare Geschichten enthielten.
Die Erinnerung an meine damalige Lebensart ist mir noch bis jetzt immer seltsam: von keinem menschlichen Geschöpfe besucht, nur in einem so kleinen Familienzirkel einheimisch, denn der Hund und der Vogel machten denselben Eindruck auf mich, den sonst nur längst gekannte Freunde hervorbringen. Ich habe mich immer nicht wieder auf den seltsamen Namen des Hundes besinnen können, sooft ich ihn auch damals nannte.
Vier Jahre hatte ich so mit der Alten gelebt, und ich mochte ohngefähr zwölf Jahr alt sein, als sie mir endlich mehr vertraute, und mir ein Geheimnis entdeckte. Der Vogel legte nämlich an jedem Tage ein Ei, in dem sich eine Perl oder ein Edelstein befand. Ich hatte schon immer bemerkt, daß sie heimlich in dem Käfige wirtschafte, mich aber nie genauer darum bekümmert. Sie trug mir jetzt das Geschäft auf, in ihrer Abwesenheit diese Eier zu nehmen und in den fremdartigen Gefäßen wohl zu verwahren. Sie ließ mir meine Nahrung zurück, und blieb nun länger aus, Wochen, Monate; mein Rädchen schnurrte, der Hund bellte, der wunderbare Vogel sang und dabei war alles so still in der Gegend umher, daß ich mich in der ganzen Zeit keines Sturmwindes, keines Gewitters erinnere. Kein Mensch verirrte sich dorthin, kein Wild kam unserer Behausung nahe, ich war zufrieden und arbeitete mich von einem Tage zum andern hinüber. – Der Mensch wäre vielleicht recht glücklich, wenn er so ungestört sein Leben bis ans Ende fortführen könnte.
Aus dem wenigen, was ich las, bildete ich mir ganz wunderliche Vorstellungen von der Welt und den Menschen, alles war von mir und meiner Gesellschaft hergenommen: wenn von lustigen Leuten die Rede war, konnte ich sie mir nicht anders vorstellen wie den kleinen Spitz, prächtige Damen sahen immer wie der Vogel aus, alle alte Frauen wie meine wunderliche Alte. Ich hatte auch von Liebe etwas gelesen, und spielte nun in meiner Phantasie seltsame Geschichten mit mir selber. Ich dachte mir den schönsten Ritter von der Welt, ich schmückte ihn mit allen Vortrefflichkeiten aus, ohne eigentlich zu wissen, wie er nun nach allen meinen Bemühungen aussah; aber ich konnte ein rechtes Mitleid mit mir selber haben, wenn er mich nicht wieder liebte; dann sagte ich lange rührende Reden in Gedanken her, zuweilen auch wohl laut, um ihn nur zu gewinnen. – Ihr lächelt! wir sind jetzt freilich alle über diese Zeit der Jugend hinüber.
Es war mir jetzt lieber, wenn ich allein war, denn alsdann war ich selbst die Gebieterin im Hause. Der Hund liebte mich sehr und tat alles was ich wollte, der Vogel antwortete mir in seinem Liede auf alle meine Fragen, mein Rädchen drehte sich immer munter, und so fühlte ich im Grunde nie einen Wunsch nach Veränderung. Wenn die Alte von ihren langen Wanderungen zurückkam, lobte sie meine Aufmerksamkeit, sie sagte, daß ihre Haushaltung, seit ich dazugehöre, weit ordentlicher geführt werde, sie freute sich über mein Wachstum und mein gesundes Aussehn, kurz, sie ging ganz mit mir wie mit einer Tochter um.
›Du bist brav, mein Kind!‹ sagte sie einst zu mir mit einem schnarrenden Tone: ›wenn du so fortfährst, wird es dir auch immer gut gehn; aber nie gedeiht es, wenn man von der rechten Bahn abweicht, die Strafe folgt nach, wenn auch noch so spät.‹- Indem sie das sagte, achtete ich eben nicht sehr darauf, denn ich war in allen meinen Bewegungen und meinem ganzen Wesen sehr lebhaft; aber in der Nacht fiel es nur wieder ein, und ich konnte nicht begreifen, was sie damit hatte sagen wollen. Ich überlegte alle Worte genau, ich hatte wohl von Reichtümern gelesen, und am Ende fiel mir ein, daß ihre Perlen und Edelsteine wohl etwas Kostbares sein könnten. Dieser Gedanke wurde mir bald noch deutlicher. Aber was konnte sie mit der rechten Bahn meinen? Ganz konnte ich den Sinn ihrer Worte noch immer nicht fassen.
Ich war jetzt vierzehn Jahr alt, und es ist ein Unglück für den Menschen, daß er seinen Verstand nur darum bekömmt, um die Unschuld seiner Seele zu verlieren. Ich begriff nämlich wohl, daß es nur auf mich ankomme, in der Abwesenheit der Alten den Vogel und die Kleinodien zu nehmen, und damit die Welt, von der ich gelesen hatte, aufzusuchen. Zugleich war es mir dann vielleicht möglich, den überaus schönen Ritter anzutreffen, der mir immer noch im Gedächtnisse lag.
Im Anfange war dieser Gedanke nichts weiter als jeder andre Gedanke, aber wenn ich so an meinem Rade saß, so kam er mir immer wider Willen zurück, und ich verlor mich so in ihm, daß ich mich schon herrlich geschmückt sah, und Ritter und Prinzen um mich her. Wenn ich mich so vergessen hatte, konnte ich ordentlich betrübt werden, wenn ich wieder aufschaute, und mich in der kleinen Wohnung antraf. Übrigens, wenn ich meine Geschäfte tat, bekümmerte sich die Alte nicht weiter um mein Wesen.
An einem Tage ging meine Wirtin wieder fort, und sagte mir, daß sie diesmal länger als gewöhnlich ausbleiben werde, ich solle ja auf alles ordentlich achtgeben und mir die Zeit nicht lang werden lassen. Ich nahm mit einer gewissen Bangigkeit von ihr Abschied, denn es war mir, als würde ich sie nicht wiedersehn. Ich sah ihr lange nach und wußte selbst nicht, warum ich so beängstigt war; es war fast, als wenn mein Vorhaben schon vor mir stände, ohne mich dessen deutlich bewußt zu sein.
Nie hab ich des Hundes und des Vogels mit einer solchen Emsigkeit gepflegt, sie lagen mir näher am Herzen, als sonst. Die Alte war schon einige Tage abwesend, als ich mit dem festen Vorsatze aufstand, mit dem Vogel die Hütte zu verlassen, und die sogenannte Welt aufzusuchen. Es war mir enge und bedrängt zu Sinne, ich wünschte wieder dazubleiben und doch war mir der Gedanke widerwärtig, es war ein seltsamer Kampf in meiner Seele, wie ein Streiten von zwei widerspenstigen Geistern in mir. In einem Augenblicke kam mir die ruhige Einsamkeit so schön vor, dann entzückte mich wieder die Vorstellung einer neuen Welt, mit allen ihren wunderbaren Mannigfaltigkeiten.
Ich wußte nicht, was ich aus mir selber machen sollte, der Hund sprang mich unaufhörlich an, der Sonnenschein breitete sich munter über die Felder aus, die grünen Birken funkelten: ich hatte die Empfindung, als wenn ich etwas sehr Eiliges zu tun hätte, ich griff also den kleinen Hund, band ihn in der Stube fest, und nahm dann den Käfig mit dem Vogel unter den Arm. Der Hund krümmte sich und winselte Über diese ungewohnte Behandlung, er sah mich mit bittenden Augen an, aber ich fürchtete mich, ihn mit mir zu nehmen. Noch nahm ich eins von den Gefäßen, das mit Edelsteinen angefüllt war, und steckte es zu mir, die übrigen ließ ich stehn.
Der Vogel drehte den Kopf auf eine wunderliche Weise, als ich mit ihm zur Tür hinaustrat, der Hund strengte sich sehr an, mir nachzukommen, aber er mußte zurückbleiben.
Ich vermied den Weg nach den wilden Felsen und ging nach der entgegengesetzten Seite. Der Hund bellte und winselte immerfort, und es rührte mich recht inniglich, der Vogel wollte einigemal zu singen anfangen, aber da er getragen ward, mußte es ihm wohl unbequem fallen.
So wie ich weiter ging, hörte ich das Bellen immer schwächer, und endlich hörte es ganz auf. Ich weinte und wäre beinahe wieder umgekehrt, aber die Sucht etwas Neues zu sehn, trieb mich vorwärts.
Schon war ich über Berge und durch einige Wälder gekommen, als es Abend ward, und ich in einem Dorfe einkehren mußte. Ich war sehr blöde, als ich in die Schenke trat, man wies mir eine Stube und ein Bette an, ich schlief ziemlich ruhig, nur daß ich von der Alten träumte, die mir drohte.
Meine Reise war ziemlich einförmig, aber je weiter ich ging, je mehr ängstigte mich die Vorstellung von der Alten und dem kleinen Hunde; ich dachte daran, daß er wahrscheinlich ohne meine Hülfe verhungern müsse, im Walde glaubt ich oft, die Alte würde mir plötzlich entgegentreten. So legte ich unter Tränen und Seufzern den Weg zurück, sooft ich ruhte, und den Käfig auf den Boden stellte, sang der Vogel sein wunderliches Lied, und ich erinnerte mich dabei recht lebhaft des schönen verlassenen Aufenthalts. Wie die menschliche Natur vergeßlich ist, so glaubt ich jetzt, meine vormalige Reise in der Kindheit sei nicht so trübselig gewesen als meine jetzige; ich wünschte wieder in derselben Lage zu sein.
Ich hatte einige Edelsteine verkauft und kam nun nach einer Wanderschaft von vielen Tagen in einem Dorfe an. Schon beim Eintritt ward mir wundersam zumute, ich erschrak und wußte nicht worüber; aber bald erkannt ich mich, denn es war dasselbe Dorf, in welchem ich geboren war. Wie ward ich überrascht! Wie liefen mir vor Freuden, wegen tausend seltsamer Erinnerungen, die Tränen von den Wangen! Vieles war verändert, es waren neue Häuser entstanden, andre, die man damals erst errichtet hatte, waren jetzt verfallen, ich traf auch Brandstellen; alles war weit kleiner, gedrängter als ich erwartet hatte. Unendlich freute ich mich darauf, meine Eltern nun nach so manchen Jahren wiederzusehn; ich fand das kleine Haus, die wohlbekannte Schwelle, der Griff der Tür war noch ganz so wie damals, es war mir, als hätte ich sie nur gestern angelehnt; mein Herz klopfte ungestüm, ich öffnete sie hastig – aber ganz fremde Gesichter saßen in der Stube umher und stierten mich an. Ich fragte nach dem Schäfer Martin, und man sagte mir, er sei schon seit drei Jahren mit seiner Frau gestorben. – Ich trat schnell zurück, und ging laut weinend aus dem Dorfe hinaus.
Ich hatte es mir so schön gedacht, sie mit meinem Reichtume zu überraschen; durch den seltsamsten Zufall war das nun wirklich geworden, was ich in der Kindheit immer nur träumte – und jetzt war alles umsonst, sie konnten sich nicht mit mir freuen, und das, worauf ich am meisten immer im Leben gehofft hatte, war für mich auf ewig verloren.
In einer angenehmen Stadt mietete ich mir ein kleines Haus mit einem Garten, und nahm eine Aufwärterin zu mir. So wunderbar, als ich es vermutet hatte, kam mir die Welt nicht vor, aber ich vergaß die Alte und meinen ehemaligen Aufenthalt etwas mehr, und so lebt ich im ganzen recht zufrieden.
Der Vogel hatte schon seit lange nicht mehr gesungen; ich erschrak daher nicht wenig, als er in einer Nacht plötzlich wieder anfing, und zwar mit einem veränderten Liede. Er sang:
›Waldeinsamkeit
Wie liegst du weit!
O dich gereut Einst mit der Zeit. –
Ach einzge Freud
Waldeinsamkeit!‹
Ich konnte die Nacht hindurch nicht schlafen, alles fiel mir von neuem in die Gedanken, und mehr als jemals fühlt ich, daß ich Unrecht getan hatte. Als ich aufstand, war mir der Anblick des Vogels ordentlich zuwider, er sah immer nach mir hin, und seine Gegenwart ängstigte mich. Er hörte nun mit seinem Liede gar nicht wieder auf, und er sang es lauter und schallender, als er es sonst gewohnt gewesen war. Je mehr ich ihn betrachtete, je bänger machte er mich; ich öffnete endlich den Käfig, steckte die Hand hinein und faßte seinen Hals, herzhaft drückte ich die Finger zusammen, er sah mich bittend an, ich ließ los, aber er war schon gestorben. – Ich begrub ihn im Garten.