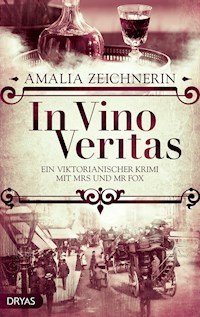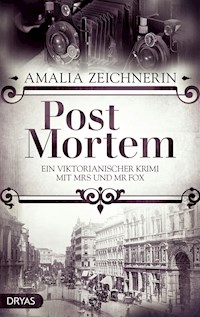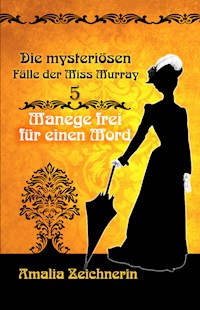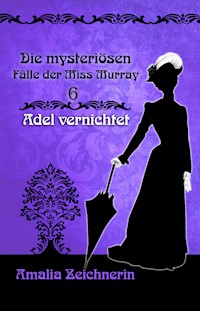
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
London, 1891. Als Cecil Beaumond tot zu Hause aufgefunden wird, deutet alles auf einen tragischen Unfall oder einen Suizid hin. Auch dessen Verlobte glaubt an einen Freitod, denn der junge Adlige neigte zu Depressionen. Als ein Freund des Verstorbenen, Sir Reginald Salisbury, gemeinsam mit Josephine Murray ermittelt, kommen ihnen schon bald Zweifel daran. Währenddessen hat Josephine auch noch mit privaten Problemen zu kämpfen … Ein queerer viktorianischer Cosy Krimi, der finale Band der "Miss Murray" Reihe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Table of Contents
Titelei
Inhaltswarnungen zu diesem Roman
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Epilog
Danksagung
Impressum
Die mysteriösen Fälle der Miss Murray
Adel vernichtet
Teil 6 der „Miss Murray“-Reihe
© Amalia Zeichnerin
Inhaltswarnungen zu diesem Roman
Todesfälle, tödliche Erkrankung (wird erwähnt), Erwähnungen von Depressionen (historischer Begriff: Melancholie), Alkoholismus, Suizidversuch (wird erwähnt, nicht gezeigt), Transfeindlichkeit (in Form von Mikroaggressionen)
1
Freitag, 9. Oktober 1891
Brompton Friedhof, West Brompton
Tränen rannen über Josephines Wangen, als sie auf den Sarg blickte, der in das Grab herabgelassen worden war. Bräunliches Herbstlaub wirbelte vorbei. Ein kühler Wind strich über die Grabsteine und durch die umstehenden Bäume. Josephines Hände fühlten sich klamm an und eine eisige Kälte breitete sich in ihrem Inneren aus. Sie konnte es noch immer nicht fassen, dass Mister Bostwick, ihr Verleger, nicht mehr unter den Lebenden weilte. Ein Herzinfarkt hatte ihn hinweggerafft – das hatten seine Söhne in der Einladung zur Beerdigung geschrieben.
Unter ihrem Mantel trug Josephine das dunkelste Kleid, das sie besaß. Es war nicht schwarz, aber immerhin anthrazit. Sie schaute hinüber zu den anderen Anwesenden, die für den Verlag tätig gewesen waren. Eine Autorin weinte leise und tupfte sich mit einem geblümten Taschentuch übers Gesicht. Ein Mann, den Josephine nicht kannte, tätschelte der Weinenden unbeholfen über den Arm. Der Pastor hatte gerade seine Rede beendet und nun warfen mehrere Leute Erde oder Blumen hinab auf den Sarg. Josephine wäre gern mit ihrer Freundin Constance hergekommen, aber wie hätten sie anderen Gästen das erklären sollen? Sie umklammerte die einzelne weiße Rose, die sie mitgebracht hatte und warf sie auf den Sarg, danach ging sie beiseite, um den Weg für andere freizumachen.
Der längliche Brompton Friedhof war in den 1840ern angelegt worden, das hatte Josephine in einem Buch über London gelesen. Die Anlage verfügte über eine recht große Kapelle mit einem Kuppeldach, die sich in der Nähe befand. Das unübersehbare Gebäude wurde von einigen Katakomben flankiert und zwei lange Kolonnaden führten zu ihm hin.
Josephine war zur Beerdigung, aber nicht zur Trauerfeier eingeladen worden – letztere sollte im engsten Familienkreis stattfinden. Aber die anderen Autoren und Autorinnen sowie weitere Leute, die für den Verlag gearbeitet hatten, wollten sich nach der Beerdigung zu einem Umtrunk zu Ehren des Verstorbenen in einem Pub treffen. Josephine hatte einen entsprechenden Brief von einem Kollegen erhalten und ihm zugesagt.
Eine knappe Stunde später saßen sie alle in dem verräucherten Pub The King's Arms. Das Lokal war recht dunkel, die Wände teilweise mit Holz vertäfelt und mit einigen bunten Werbeplakaten für Bier bestückt. Dazwischen hingen einige Bilder mit Stadtansichten, darunter auch ein Gemälde, das die London Bridge an einem sonnigen Tag zeigte.
Josephine kannte die meisten der neunzehn Anwesenden von Begegnungen und kleinen Feiern, die über die Jahre immer mal im Verlag stattgefunden hatten. Hin und wieder hatte sie sich auch mit den Autoren und Autorinnen über das schriftstellerische Handwerk ausgetauscht. Allerdings kannte sie niemanden näher, hatte sich mit keinem der Anwesenden angefreundet. Einer der Herren, der bisher für den Verlag als Buchsetzer tätig gewesen war, hob sein Bierglas. »Auf Mister Bostwick. Ich werde ihn sehr vermissen.«
»Auf Mister Bostwick«, erwiderte ein Autor. »Möge er in Frieden ruhen.«
Sie prosteten sich gegenseitig zu und Josephine nippte an ihrem Bier.
»Was wird denn nun eigentlich aus dem Verlag?«, fragte eine Kollegin, eine untersetzte Frau mit dunkelblondem Haar und hellen Augenbrauen, die eine Brille trug. »Ich habe diesbezüglich noch gar keine Nachricht erhalten. Und während der Beerdigung wollte ich Mr Bostwicks Söhne nicht ansprechen.«
»Ach, meine Liebe, das wird ein Schreck für Sie werden …« begann einer der Autoren, doch da platzte der Buchsetzer heraus: »Der Verlag wird verkauft! Das hat mir Gary Bostwick, einer der beiden Söhne, mitgeteilt.«
Verdammt! Das waren keinen guten Nachrichten. Allerdings hatte Josephine so etwas in der Art schon befürchtet …
»Oh«, erwiderte die dunkelblonde Dame. »Und was heißt das? Verlieren wir nun alle unsere Arbeit?«
Der Buchsetzer zuckte mit den Schultern. »Mister Bostwicks Familie hat kein Interesse daran, den Verlag weiterzuführen. Die Söhne sind ja, wie die meisten von euch sicherlich schon gehört haben, in ganz anderen Berufen tätig: Gary ist Anwalt und Henry arbeitet als Buchhalter für ein großes Unternehmen in Westminster. Mag sein, dass die neuen Besitzer des Verlags ein paar von uns übernehmen. Aber das wird wohl jeder persönlich neu aushandeln müssen. Ich nehme an, wir alle bekommen demnächst Briefe von Mister Bostwicks Söhnen, in denen sie vom Verkauf des Verlags und weiteren Einzelheiten berichten.«
Das wäre ein Brief, den Josephine lieber nicht erhalten wollte. Jahrelang hatte sie für den Verlag gearbeitet. Einerseits hoffte sie, dass sie dies auch weiterhin tun konnte, für den neuen Verleger. Andererseits … Mister Bostwick war als Mensch und Arbeitgeber in ihren Augen unersetzlich und sie fragte sich, wie sie wohl mit einem anderen Verleger zurechtkäme.
»Hat Gary Bostwick Ihnen auch gesagt, an wen der Verlag verkauft wird?«, hakte sie nach.
Der Buchsetzer schüttelte den Kopf. »Nein. Das ist eine gute Frage.«
Als Josephine später nach Hammersmith heimkehrte, umarmte ihre Freundin Constance sie im Flur der gemeinsamen Wohnung. Wie gewohnt, umgab sie ein zarter Duft nach Veilchen, ihr Parfüm.
»Wie war die Beerdigung?«
Josephine drückte sich an sie, fühlte schon wieder Tränen aufsteigen. »Daran mag ich gerade gar nicht denken. Ich war … ich bin sehr traurig.«
Constance tätschelte ihr mitfühlend den Arm. »Und das Treffen mit deinen Kollegen?«
»Der Buchsetzer hat uns erzählt, dass der Verlag verkauft wird.«
Constance strich sich eine Strähne ihres aschblondes Haares aus der Stirn. »Oh, was für ein Ärger! Ich meine, das ist nicht gut, oder?«
Josephine seufzte. »Ja, das denke ich auch.«
»Da fällt mir ein, du hast einen Brief von den Gebrüdern Bostwick. Und einen von Reginald Salisbury. Sie liegen auf deinem Schreibtisch.«
»Reginald Salisbury? Ah, ich erinnere mich an ihn.« Mit diesem Adligen hatte Josephine kurzfristig vor einem Jahr zu tun gehabt, als sie damit beschäftigt gewesen war, ein gestohlenes Gemälde der Künstlerin Fannie Richardson aufzuspüren. Josephine hatte Sir Salisbury zeitweilig verdächtigt, aber später war klar geworden, dass er für den Diebstahl nicht verantwortlich gewesen war. Sie hatte ihm später auf seinen Wunsch hin über die Auflösung des Falls berichtet.1
»Magst du noch einen Tee trinken, Josie?«, erkundigte sich Constance, während Josephine ihre Stiefel aufschnürte.
»Ja, sehr gern.«
Constance nickte. »Ich setze uns einen auf.« Sie verließ den Flur.
Während sie kurz darauf bei einer Tasse Tee zusammensaßen, öffnete Josephine die beiden Briefe mit einem hölzernen Brieföffner.
Schmerzerfüllt stöhnte sie auf, als sie den ersten gelesen hatte. »So ein Mist!«
»Was ist denn?« Constance stellte ihre Teetasse ab und sah Josephine überrascht an.
»Der Verlag wird nicht nur verkauft, sondern zieht um nach Cardiff. Ein Verlagsunternehmen dort hat alle Rechte erworben.«
»Oh …«
»Wenn er wenigstens in London ansässig bleiben würde. Ich kann doch nicht nach Cardiff ziehen!«
»Ja, allerdings.« Constance streichelte Josephines Hand. »Aber du kannst dich doch hier nach einem anderen Verlag umsehen. Es gibt doch mehrere andere, die auch Heftromane herausbringen.«
»Ja, schon. Aber …« Josephine wusste nicht, wie sie in Worte fassen sollte, was ihr auf der Zunge lag.
»Was denn?« Constance trank einen Schluck Tee, ehe sie sich wieder Josephine zuwandte.
»Mister Bostwick hat mich so akzeptiert, wie ich bin. Er hat mir nie peinliche Fragen gestellt, er hat mir sogar aus der Patsche geholfen, als ich in Essex verhaftet worden bin.2 Wie um alles in der Welt soll ich einen anderen Verleger finden, der mich so gut behandelt?«
»Das wird schon«, erwiderte Constance mit fester Stimme. »Frag vielleicht einmal Lady Thelma, sie und ihre Lebensgefährtin kennen bestimmt eine Menge Leute. Vielleicht können sie dir ein oder zwei Kontakte vermitteln?«
»Das ist eine gute Idee«, stimmte Josephine zu. Aber insgeheim zweifelte sie sehr. Sie kannte den Grund dafür: Eigentlich wollte sie gar nicht für jemand anderen als für Mister Bostwick arbeiten. Alles, was für ihn letztendlich gezählt hatte, war die Qualität ihrer Arbeit gewesen.
Josephine verscheuchte die trüben Gedanken, zumindest für den Moment. Sie griff nach dem zweiten Brief. »Ich frage mich, warum Sir Salisbury mir geschrieben hat …«
Sie las seine Zeilen.
Sehr geehrte Miss Murray,
ich hoffe, Sie befinden sich wohl. Vielleicht erinnern Sie sich noch an mich. Vor rund einem Jahr verdächtigten Sie mich eines Kunstraubes und ich kam später in den Genuss, einen Ihrer Heftromane zu lesen und Ihnen dazu einige Anmerkungen zu schreiben.
Heute wende ich mich an Sie, um eventuell von Ihrem detektivischen Scharfsinn zu profitieren. Ein lieber Freund von mir, der junge Adlige Cecil Beaumond, wurde tot im Hause seiner Familie aufgefunden. Die Polizei geht von einem Freitod oder einem Unfall aus, doch ich kann das nicht glauben. Er hätte gewiss einen Abschiedsbrief hinterlassen, wenn es so gewesen wäre. Allerdings litt er schon seit Jahren an Melancholie.
Da Sie detektivisch tätig sind, wende ich mich an Sie in dieser Angelegenheit. Natürlich würde ich Sie für Ihre Tätigkeit angemessen entlohnen und Sie unterstützen, wo ich nur kann. Bitte kommen Sie am Mittwoch, den 14. Oktober um 17 Uhr zu mir, damit wir weitere Einzelheiten besprechen können, die in diesem Fall dienlich sein mögen. Falls Sie verhindert sein sollten, teilen Sie mir dies bitte mit.
Ich verbleibe mit einem herzlichen Gruß,
Ihr Reginald Salisbury
Josephine reichte ihrer Liebsten den Brief. »Was hältst du davon?«
Constance studierte die wenigen Zeilen. »Ich würde sagen, triff dich mit ihm«, erwiderte sie schließlich. »Er möchte dich bezahlen. Bis du eine neue Arbeit gefunden hast, ist das doch eine gute Gelegenheit, ein wenig zu verdienen.«
»Aber das klingt für mich danach, als ob ich in adligen Kreisen ermitteln müsste.«
Constance zuckte mit den Schultern. »Ja, und?«
»Sieh mich doch an. Allein schon an meiner Kleidung kann man erkennen, dass ich keine Adlige bin.«
»Aber vielleicht spielt das keine so große Rolle? Außerdem hat Sir Salisbury hier geschrieben, dass er dich unterstützen wird. Wer weiß, vielleicht möchte er gemeinsam mit dir ermitteln?«
»Hmm. Ja, vielleicht.«
Es war über ein Jahr her, dass Josephine einen Mordfall im Zirkus Golden untersucht hatte.3 Seitdem hatte sie wie gewohnt für den Verlag geschrieben, sich aber nicht mehr als Detektivin betätigt. Hier bot sich ihr nun ein neues Rätsel. Hatte sich dieser junge Adlige das Leben genommen, weil die Melancholie so sehr an ihm genagt hatte? Oder steckte etwas anderes dahinter? Josephine straffte sich. »Also gut, ich werde mich mit Sir Salisbury treffen.«
Constance lächelte, so dass sich ihr Muttermal am rechten Mundwinkel nach oben verschob. »Sehr gut.« Sie tätschelte Josephines Hand und küsste sie auf die Wange.
Josephine fuhr mit einem leisen Seufzen über Constances Haar. »Ich bin froh, dass du da bist. Dass ich dich habe.«
Constance schmunzelte. »Das geht mir auch so, meine Liebe.«
1Siehe Band 4 dieser Reihe, »Kunstraub in Kensington«
2Siehe Band 3 dieser Reihe, »Mörderische Ostern«
3 Siehe Band 5 dieser Reihe: »Manege frei für einen Mord«
2
Mittwoch, 14. Oktober 1891
Aldford Street, Mayfair
Zur vereinbarten Zeit klopfte Josephine am Haus des Baronets Sir Salisbury. Sie erinnerte sich noch gut an das beigefarben gestrichene Gebäude, das im Vergleich zu den oft prächtigen großen Stadthäusern der Oberschicht vergleichsweise klein war. In ihrer Tasche hatte Josephine wie gewohnt einen Stift und ihr Notizbuch dabei, das sie überall hin mitnahm.
Ein Diener mit buschigen Augenbrauen und einem Backenbart öffnete ihr. Er musterte sie freundlich. »Guten Tag. Sie wünschen?«
Sie begrüßte ihn und stellte sich vor. »Ich bin mit Ihrem Herrn verabredet.«
Der Diener nickte beflissen. »Folgen Sie mir bitte, Miss Murray.«
Er führte sie in einen edel eingerichteten Salon mit einer seidig glänzenden türkisfarbenen Tapete. Mehrere große Zimmerpflanzen in Kübeln zierten diesen Raum, ebenso einiges an Bric-à-Brac – zarte, sehr fein bemalte Porzellanfiguren und kleine Statuetten aus dunklem Holz. An den Wänden hingen mehrere Gemälde, größtenteils ältere Portraitbilder, wie an der veralteten Mode zu erkennen war.
»Sir Salisbury wird gleich bei Ihnen sein, Miss Murray«, teilte ihr der Diener mit.
Sie bedankte sich und er verließ den Raum.
Bereits wenige Minuten später kam der Hausherr herein. Wie sein Diener trug er einen dichten Backenbart. Sir Salisbury war von mittlerem Alter, mit ersten grauen Strähnen im dunklen Haar.
»Ah, Miss Murray, guten Tag. Ich freue mich, Sie wiederzusehen«, sagte er strahlend.
Sie stand auf und knickste. »Die Freude ist ganz meinerseits. Auch wenn der Anlass für Sie gewiss recht traurig ist …«
Das Lächeln verschwand aus dem Gesicht des Adligen. »Ja, das ist er allerdings.«
Der Diener kam mit einem voll beladenen Teewagen herein, darauf befand sich auch eine Etagere mit verschiedenen kleinen Kuchen und Keksen. Es sah aus, als wolle der Hausherr viel mehr als nur einen einzelnen Gast bewirten. Während der Diener alles auf einen Tisch häufte und ihnen Tee einschenkte, nahmen sie beide einander gegenüber Platz.
»Bitte, bedienen Sie sich.« Sir Salisbury deutete auf die Etagere und Josephine nahm sich ein weiches, goldbraunes Stück Kuchen.
Sir Salisbury richtete seine seidig schimmernde Krawatte. »Ich würde Ihnen gern mehr zu den näheren Umständen des Todesfalls erzählen. Aber vielleicht wollen Sie sich Notizen machen?«
»Das ist eine gute Idee.« Josephine legte das Kuchenstück auf dem Teller ab. Sie öffnete ihre Tasche, holte Stift und Notizbuch heraus. »Erzählen Sie mir bitte alles, was Sie wissen. Dann kann ich entscheiden, ob ich Ihnen in dieser Angelegenheit eventuell helfen kann.«
Er räusperte sich, straffte seinen Oberkörper. »Nun … Cecil und ich kennen … ich meine, wir kannten uns durch unseren gemeinsamen Gentlemen’s Club. Wir haben uns nach mehreren Gesprächen dort angefreundet. Ich habe ihn auch hierher eingeladen und wir sind uns gelegentlich auf Abendgesellschaften begegnet.«
»Gab es ein besonderes Interesse, das Sie beide verband?«, fragte Josephine.
Ihr Gegenüber errötete leicht. War er diesem Cecil inniger verbunden gewesen als nur durch eine Freundschaft? Wenn das ans Licht der Öffentlichkeit gekommen wäre, hätte der Skandal vermutlich hohe Wellen geschlagen. Oder kam ihr dieser Gedanke nur, weil sie einige gleichgeschlechtliche Paare kannte? Constance und sie selbst, Eddy und Ignacio, Lady Thelma und ihre Freundin Eliza, außerdem mehrere Damen aus Lady Thelmas Club …
Sir Salisbury blickte hinab auf den Tisch, nicht ihr in die Augen, als er antwortete: »Wir beide hatten ein großes Interesse an den schönen Künsten. Kunst, Theater, Musik … Das hat uns immer viel Anlass für Gesprächsstoff gegeben.« Nun sah er sie doch direkt an. »Aber ich wüsste nicht, wie Ihnen das bei Ihren Ermittlungen weiterhelfen könnte?«
Also waren Cecil Beaumond und Reginald Salisbury offenbar tatsächlich nur Freunde gewesen, nicht mehr. Josephine machte nun eine wegwerfende Geste. »Sie haben sicherlich recht. Es war nur ein Gedanke. Bitte, erzählen Sie mir mehr über Cecil.«
»Die Beaumonds zählen seit Jahrhunderten zur Aristokratie. Cecil und sein Bruder Peter leben … beziehungsweise lebten im Londoner Haus der Familie, in Camden Town. Cecil hatte sich vor wenigen Monaten verlobt, ebenfalls mit einer Adligen.«
Josephine fragte sich, ob diese Verlobung in erster Linie aus einem Pflichtgefühl gegenüber seiner Familie erfolgt war … eine Liebesheirat unter Adligen war wohl eher die Ausnahme.
»Falls Sie sich fragen: Cecil war seiner Verlobten sehr zugetan.« Es schien fast, also ob Sir Salisbury ihre Gedanken gelesen hatte. »Emily Abercromby ist eine ganz liebreizende junge Dame. Ich glaube, er war sehr in sie verliebt.« Der Baronet sagte das mit neutraler Miene.
Josephine nickte und griff nach ihrer Teetasse. »Wann sollte die Hochzeit stattfinden?«, erkundigte sie sich.
»Im September. Sie wurde allerdings verschoben, denn unglücklicherweise ist Cecils Vater im August verstorben.«
»Oh. Wie kam das?«
»Es war ein Unfall. Er wollte eine Straße überqueren und wurde von einer vorbeirasenden Kutsche erfasst, die viel zu schnell um eine Straßenecke gebogen ist. Er hatte keine Chance mehr auszuweichen und ist noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen. Sein Sohn Peter hat das alles mitangesehen.«
»Wie fürchterlich!«, rief sie, lauter als beabsichtigt. »Und seine Frau?«
»Sie ist bereits in den 1870ern verstorben, bei Peters Geburt. Cecil war noch klein, als es passiert ist. Die beiden Söhne wurden teilweise von einer Amme erzogen, später dann von einer Gouvernante, bis sie ins Internat kamen.«
Josephine machte sich eine Notiz und sagte: »Ah, ich verstehe. Wie steht es denn nun um das Familienerbe? Cecil war der ältere der beiden?«
»Ja. Er hat mir anvertraut, dass er das Haus erben würde. Er wollte Peter anbieten, dass dieser dort auch weiterwohnen könnte. Das Haus der Beaumonds ist größer als meines, es bietet Platz genug für zwei Familien. Es ging aber noch um mehr. Der Vater der beiden hat in Aktiengeschäfte investiert. In Surrey hat die Familie außerdem mehrere Hektar Land verpachtet. Und ihnen gehört ein Landsitz. Im Testament hieß es, das alles wäre zu gleichen Teilen an Cecil und Peter gegangen.«
»Aber nun ist Peter der alleinige Erbe …«
»Ja. Und ich frage mich ernsthaft, ob er seinen Bruder deshalb aus dem Weg geräumt hat.«
»Kennen Sie diesen Peter näher? Trauen Sie ihm das zu?«
Sir Salisbury schüttelte den Kopf. »Nein, ich kenne ihn nicht gut. Wir sind uns gelegentlich auf Abendgesellschaften und Bällen begegnet. Aber ich habe nur selten mit ihm gesprochen, abgesehen von oberflächlichen Höflichkeiten. Von daher … ob er seinen Bruder umgebracht hat, das vermag ich nicht einzuschätzen. Aber ein Motiv dafür hätte er ja, aufgrund des Erbes.«
»Wenn beide Brüder einen großzügigen Teil des Familienerbes erhalten sollten, wie Sie mir eben schilderten, dann hätte er eigentlich keinen Grund gehabt, Cecil nach dem Leben zu trachten«, überlegte Josephine.
Sir Salisbury rieb sich über die Stirn. »Ja, ich muss zugeben, das dachte ich mir auch schon.«
Josephine schrieb sich einige weitere Details in ihr Notizbuch, ehe sie sich wieder dem Hausherrn zuwandte. »Bitte erzählen Sie mir, wie Cecil umgekommen ist. Falls Sie nähere Einzelheiten wissen?«
»Ja. Peter hat mir einen Brief geschrieben, da er wusste, dass Cecil und ich befreundet gewesen sind. Er hat dies auch mit einer Einladung zur Beerdigung verbunden. Möchten Sie den Brief sehen?«
»Gern, wenn es Ihnen keine Mühe macht, diesen herauszusuchen.«
Er winkte ab. »Nein, das ist kein Problem. Warten Sie bitte kurz, ich bin gleich wieder da.«
Es dauerte in der Tat nicht lang, bis er wieder in den Salon zurückkehrte, mit einem Briefbogen in der Hand.
»Hier, sehen Sie selbst …« Er reichte Josephine das Schreiben.
Sehr geehrter Sir Salisbury,
wie geht es Ihnen? Bitte entschuldigen Sie, wenn ich mich nicht lange mit Höflichkeiten aufhalte. Ich bin untröstlich, Ihnen mitteilen zu müssen, dass mein Bruder Cecil sich das Leben genommen hat. Seine Verlobte und ich sind tief erschüttert. Da Sie miteinander befreundet waren, nenne ich Ihnen nun weitere Einzelheiten. Sie haben ein Anrecht darauf, diese zu erfahren.
Wie Sie sicherlich wissen, neigte mein Bruder zur Melancholie. Der Tod unseres Vater hat ihn sehr mitgenommen, vielleicht mehr, als er zugeben wollte. Ich habe Cecil vor zwei Tagen spät abends in seinem Arbeitszimmer gefunden, nachdem mich eine unserer Bediensteten alarmiert hatte. Er saß in einem Sessel, ein Buch auf dem Schoß. Zunächst dachte ich, er sei beim Lesen müde geworden und eingeschlafen. Neben ihm, auf dem Schreibtisch, stand eine braune Flasche, die ich beim ersten Ansehen für eine Bierflasche hielt. Ich versuchte ihn wachzurütteln, doch das war vergebens.
Ich fühlte schließlich am Hals nach seinem Puls und da wurde mir klar, dass er nicht mehr lebte. Diese Vermutung hatte auch unsere Bedienstete geäußert. Ich besah mir die Flasche näher und erkannte am Etikett, dass es sich gar nicht um Bier, sondern um Karbolsäure handelte. Mein erster Gedanke war, dass er wohl die entsprechenden Flaschen, die einander ähnlich sehen, verwechselt hatte. Oder dass unser Dienstpersonal sich diesbezüglich geirrt hatte. Ich befragte daraufhin unsere Dienerschaft. Aber niemand von ihnen hat laut eigener Aussage meinem Bruder eine solche Flasche gebracht. Deshalb kann ich nur zweierlei vermuten. Möglicherweise ist mein Bruder in den Vorratsraum gegangen, um sich eine Flasche Bier zu holen. Und dann hat er fatalerweise die Flaschen verwechselt.
Oder aber Cecil hegte die Absicht, sich mit Karbolsäure zu vergiften und so aus dem Leben zu scheiden. Er hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen, auch nicht an seine Verlobte. Deshalb vermuten wir, dass es ein tragischer Unfall war, wie gesagt, eine Verwechslung. Das habe ich auch der Polizei gesagt, die nun ebenfalls von einem Unfall oder einem Suizid ausgeht. Das alles ist uns – seiner Verlobten Emily Abercromby und mir – sehr schmerzlich.
Josephine drehte den Briefbogen um. Auf der Rückseite befanden sich lediglich die Details der Einladung zur Beerdigung. Karbolsäure … Josephine überlegte, was sie darüber wusste. »Ist Karbolsäure nicht ein Reinigungsmittel?«, wandte sie sich schließlich an Sir Salisbury.
»Ja. Man muss man es mit Wasser verdünnen und kann es zur Desinfektion einsetzen. Ich habe mit meinem Diener darüber gesprochen. Er sagte, das sei in Apotheken erhältlich, in braunen Flaschen – die man tatsächlich mit Bierflaschen verwechseln kann. Meine Bediensteten setzen es ebenfalls als Reinigungsmittel ein.«
»Aha … Cecils Bruder spricht ja von einem Unfall oder einem Freitod. Und die Polizei sieht es auch so. Was lässt Sie daran zweifeln, Sir Salisbury?«
»Nun, da wäre die Sache mit der Erbschaft, wie gesagt. Außerdem hat Peter Beaumond offenbar keine Zeugen dafür, wie er seinen Bruder vorgefunden hat. Ich meine, er könnte ihm diese Flasche selbst gebracht haben. Allerdings hätte er dann damit rechnen müssen, dass sein Bruder die Flüssigkeit am Geruch erkannt hätte, bevor er einen Schluck nahm. Meinen Sie nicht auch?«
»Ich kenne den Geruch von Karbolsäure nicht«, erwiderte sie.
»Das Zeug riecht recht durchdringend. Eigentlich kann man es kaum mit Bier verwechseln, schätze ich.« Er zögerte, schien einen Moment lang zu überlegen. »Es sei denn, man ist in dem Moment sehr abgelenkt oder nicht ganz bei sich. Letzteres zum Beispiel, wenn man betrunken ist.«
Sie nickte ihm zu. »Ah, ich verstehe.«
»Ich komme nicht von ungefähr darauf. Ich muss leider sagen, dass Cecil ein Problem mit Alkohol hatte. Er hat oft und viel getrunken. Ich wollte einmal mit ihm in ein Konzert ausgehen und ihn bei sich zu Hause abholen. Aber er hat ganz verwaschen gesprochen und ist so sehr getorkelt, dass ich ihn überredet habe, lieber zu Hause zu bleiben. Cecil wollte mit dem Alkohol seine Melancholie bekämpfen. Er hat mir gegenüber öfter entsprechende Andeutungen gemacht.«
Josephine ließ sich das kurz durch den Kopf gehen. Sie hatte Cecil Beaumond nicht gekannt, aber er tat ihr leid. Melancholie war gewiss eine bittere, schwere Erkrankung, für die es wohl in den meisten Fällen keine Heilung gab. In manchen Romanen wurde diese Krankheit romantisiert, aber das war wohl eine Fantasie, die mit der Realität nichts zu tun hatte.
Ein weiterer Gedanke kam ihr und sie sah ihren Gastgeber an. »Könnte es sein, dass Cecil am Abend seines Todes betrunken war und deshalb diese Flasche verwechselt hat? Und die Karbolsäure nicht erkannt hat?«
»Ja, das wäre denkbar.« Sir Salisbury runzelte die Stirn. »Aber wenn Sie mich fragen, könnte es ebenso gut sein, dass sein Bruder fürs Cecils Trunkenheit gesorgt hat und ihm dann die Flasche mit Karbolsäure als vermeintliches Bier angeboten hat.« Der Baronet blickte sie nun direkt an. »Sagen Sie, Miss Murray, würden Sie in diesem Fall ermitteln? Könnten Sie sich das vorstellen? Ich zahle natürlich, daran soll es nicht scheitern.«
»Nun, ich muss zugeben, ich bin neugierig geworden. Aber ich bin keine Adlige. Und hier sieht es so aus, als ob ich in adligen Kreisen ermitteln müsste.«
Er machte eine wegwerfende Geste. »Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Ich werde Ihnen gern jede Hilfestellung geben, die Sie benötigen. Falls Sie beispielsweise passende Kleidung brauchen, ich kenne eine ausgezeichnete Maßschneiderei.«
»Ja, das könnte unter Umständen hilfreich sein«, gab sie zu. Sie verhandelte nun mit dem Adligen über ihren Lohn und er hatte wirklich nicht zu viel versprochen; von dem Geld, das er ihr in Aussicht stellte, würde sie voraussichtlich in den kommenden Wochen recht gut leben können. Eine Sorge weniger. Außerdem würde er auch für maßgeschneiderte Kleidung aufkommen. »Was können Sie mir noch über Cecil erzählen?«, erkundigte sie sich. »Diese Melancholie beispielsweise – seit wann litt er darunter?«
»Er sagte mir einmal, das erste Mal sei es ihm mit vierzehn aufgefallen. Eine unerklärliche Schwermut. Er hatte dann Schwierigkeiten mit dem Schlafen, mit dem Lernen, auch mit all den kleinen Dingen des Alltags. Und der Appetit kam ihm für eine längere Zeit abhanden, so dass er einiges an Gewicht verlor. Cecil befand sich zu jener Zeit in einem Internat, wie auch sein Bruder. Schließlich wurde die Schwermut so überwältigend für ihn, dass die Schulleitung ihn nach Hause schickte, damit er sich erholen könne. Seine Eltern haben dann mehrere Ärzte konsultiert. Aber keiner von denen konnte Cecil wirklich helfen.« Sir Salisbury runzelte die Stirn. »Er hatte damals Angst, man würde ihn in eine Nervenheilanstalt stecken.«
»Oh.« Josephine fühlte einen kalten Schauer über ihren Rücken jagen. Was sie bisher über solche Anstalten gehört hatte, wie beispielsweise das berüchtigte Bedlam Asylum in Southwark, das versprach nichts Gutes. Da es keine guten Heilmethoden oder lindernde Medikamente gab, wurden viele Leute mit psychischen Erkrankungen in solchen Anstalten lediglich verwahrt, so dass diese Einrichtungen eher Gefängnissen gleichen mochten anstatt Krankenhäusern. Auch hieß es, wer einmal dort eingeliefert wurde, der kam nicht mehr heraus. Vielleicht gab es für Adlige andere Einrichtungen, die komfortabler waren, aber damit kannte sie sich nicht aus.
Sir Salisbury riss sie aus diesen düsteren Gedanken. »Aber seine Eltern haben zu ihm gehalten. Nach einigen Wochen war die Melancholie damals vorbei und er fasste neuen Lebensmut. Aber in den kommenden Jahren kehrte sie immer wieder zurück, häufig im Winter.«
Josephine grübelte. »Ich frage mich gerade, wie sehr litt er an der Melancholie? Hat er Ihnen jemals von Suizidabsichten erzählt?«
Sir Salisbury antwortete nicht gleich, sondern griff nach seiner Teetasse. Bedächtig trank er einen Schluck. »Das hat er, beziehungsweise er sagte mir, mit achtzehn habe er einmal kurz davor gestanden, sich das Leben zu nehmen, weil die Melancholie ihn so mitnahm. Aber er hat es letztendlich doch nicht versucht. Damals kannten wir uns noch nicht. Das dürfte nun sechs Jahre her sein. Und die Melancholie … sie hatte ihn nicht ständig im Griff, aber immer mal wieder.«
Josephine blickte ihn nachdenklich an. Sie schätzte Sir Salisbury auf Mitte dreißig. Warum hatte er sich ausgerechnet mit einem Mann angefreundet, der rund zehn Jahre jünger gewesen war? Dann erinnerte sie sich: Er hatte von ihren gemeinsamen Interessen gesprochen – den schönen Künsten. Vermutlich war den beiden der Altersunterschied vor diesem Hintergrund gleichgültig gewesen …
»Sie haben vorhin erwähnt, dass er sich für die schönen Künste interessierte. Hatte er denn selbst eine künstlerische Veranlagung?«
»Er konnte recht gut singen und Klavier spielen. Gewissermaßen für den Hausgebrauch und bei Abendgesellschaften. Er sagte mir einmal, dass ihm die Musik helfe, gegen die Schwermut anzukämpfen. Wenn es ihm schlecht ging, hat er oft Klavier gespielt. Es sei für ihn wie eine Art Ventil für seine Emotionen, hat er mir einmal gesagt.«
Allmählich entstand in Josephine ein geistiges Bild von Cecil Beaumond – oder zumindest einige Eindrücke, wie er gewesen sein mochte. Aber ob ihr das bei entsprechenden Ermittlungen weiterhelfen würde, war fraglich.
»Nach allem, was Sie mir erzählt haben, können wir nicht ganz ausschließen, dass er sich das Leben genommen hat«, sagte sie frei heraus.
Sir Salisburys Gesicht nahm einen betrübten Zug an. Dann räusperte er sich. »Nun, selbst wenn dem so sei, auch das können wir hoffentlich herausfinden.«
»Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?«
»Das war Anfang September. Zwei Wochen nach der Beerdigung seines Vaters. Er hat mich zum Tee eingeladen, wie wir es öfter gemacht haben. Ich habe ihm kondoliert und er hat von seiner Trauer gesprochen. Aber Trauer ist nicht dasselbe wie Melancholie, das hat er mir auch erklärt. Verstehen Sie, er war traurig wegen seines Vaters Tod, aber nicht des eigenen Lebens überdrüssig. Und deshalb kann ich einfach nicht glauben, dass er sich für einen Freitod entschieden hat. Der Gute hatte so viele Pläne. Zum einen natürlich die Ehe mit Lady Emily. Die beiden hätten gewiss auch bald eine Familie gegründet. Außerdem wollte er einen hiesigen Künstler, dessen Werke er sehr schätzte, als Mäzen unterstützen. Und darüber hinaus war seine Absicht, sich in einem Verein hier in London zu betätigen, der angehende Musiker fördert und unterstützt.«
»Ich verstehe.« Josephine zerteilte ihr Kuchenstück mit einer kleinen Gabel und führte einen Bissen zum Mund. Sie kaute einen Moment lang. Ein köstlicher, zuckriger Geschmack breitete sich in ihrem Mund aus. »Sagen Sie, hat er Ihnen in der letzten Zeit vor seinem Ableben irgendetwas von Menschen erzählt, mit denen er Ärger hatte?«
»Lassen Sie mich kurz nachdenken … ein Bekannter hatte sich von ihm Geld geliehen, das hat Cecil erwähnt. Aber ich weiß nicht, ob dieser Herr es ihm zurückgezahlt hat.«
Josephine sann über seine Worte nach. Hatten Cecil und dieser andere Mann sich wegen der Schulden zerstritten? »Wissen Sie den Namen dieses Bekannten?«
»Timothy Dare. Die beiden kannten sich aus Oxford. Cecil hat dort Wirtschaftswissenschaften studiert, um sich später bestens um die Familiengeschäfte kümmern zu können. Den Landsitz, die Verpachtungen und so weiter.«
»Lebt dieser Mister Dare hier in London?«
»Ja, in Kensington, soweit ich weiß. Die Adresse kann ich sicherlich über Bekannte herausfinden. Denken Sie, ein Gespräch mit ihm würde weiterhelfen?«
Josephine trank einen Schluck Tee, der ein angenehm kräftiges Aroma hatte. »Ich weiß es nicht«, gab sie offen zu. »Wir stehen ja ganz am Beginn, von daher würde ich erst einmal nichts von vornherein ausschließen.«
Er beugte sich ein wenig vor. »Sie nehmen meinen Auftrag also an, Miss Murray?«
Sie musste nicht lange überlegen. »Ja, das möchte ich.«
Der Adlige räusperte sich. »Mir fällt gerade ein … am 31. Oktober bin ich auf einen Kostümball eingeladen, anlässlich von Halloween. Die Familie Duncombe lädt aus diesem Anlass jährlich die Hautevolee von London ein. Ich darf eine Begleitung mitnehmen und habe bisher niemanden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einige Bekannte von Cecil auch dort sein werden. Möglicherweise auch Mister Dare und Emily Abercromby.«
»Aber ist sie denn nicht in Trauer? Er war doch ihr Verlobter.«
»Ja, und das ist der entscheidende Unterschied: Die beiden waren noch nicht verheiratet. Wären sie es gewesen, dann müsste sie ganz offiziell trauern, für zwei Jahre. Aber so steht es ihr frei. Wissen Sie, dieser Ball ist eine große Angelegenheit. Im vergangenen Jahr erzählte mir eine Dame, sie hätte schon Wochen vorher ihr Kostüm schneidern lassen. Das sah übrigens ganz bezaubernd aus. Ich könnte mir vorstellen, dass Emily Abercromby sich diesen Ball nur sehr ungern entgehen lassen würde. Aber selbst wenn sie nicht anwesend sein sollte, vielleicht können wir mit einigen Leuten sprechen, die Cecil gekannt haben. Haben Sie denn am 31. Oktober Zeit?«
Sie ging im Geiste die Termine der nächsten Zeit durch. »Ja. Ich kann Sie gern begleiten.«
»Wunderbar. Können Sie tanzen? Ich meine, die üblichen Tänze, wie zum Beispiel Walzer?«
Josephine überlegte. Wenn sie in Lady Thelmas Salon tanzte, übernahm sie oft den führenden Part.