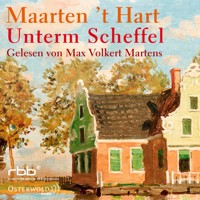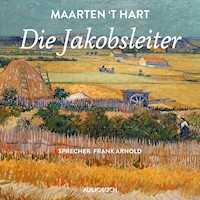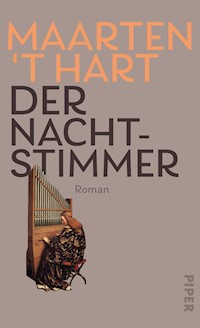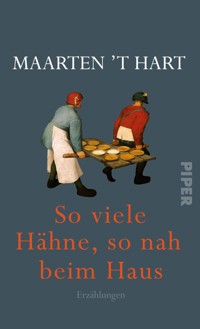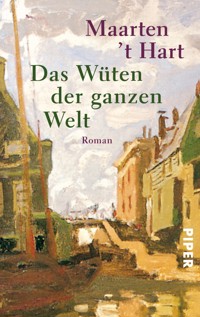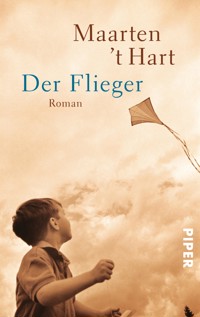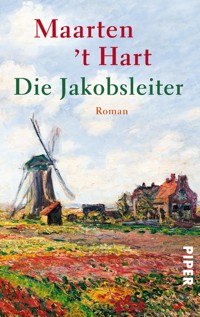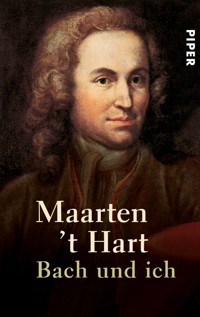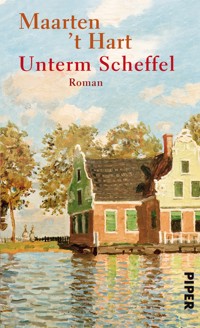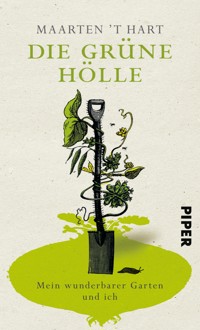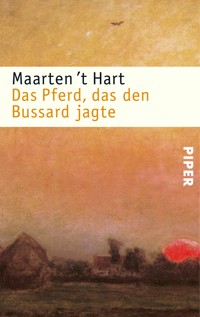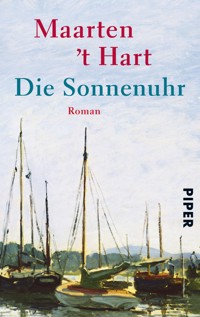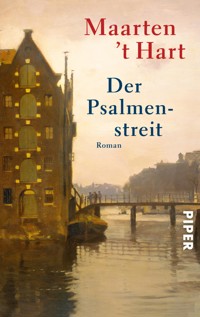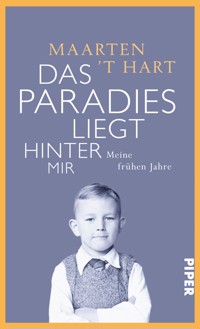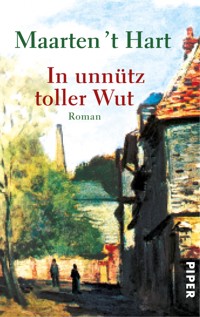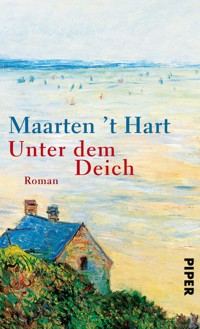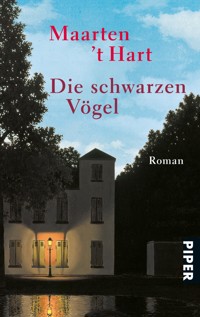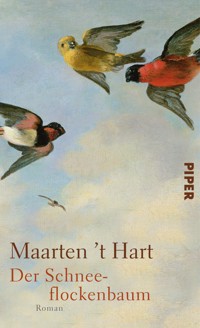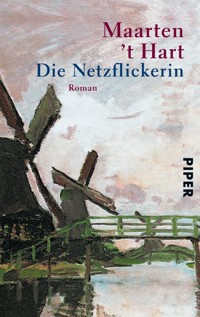
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Diesmal ist es der Apotheker Roemer Simon Minderhout, der im Mittelpunkt des Geschehens steht und dessen kurze, heftige, um so unvergesslichere Liebe zu der Netzflickerin Hillegonda während der deutschen Besatzungszeit in den Niederlanden. Eine Liebe, die ihn 50 Jahre später auf eine beklemmende Weise einholt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Niederländischen von Marianne Holberg
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
13. Auflage 2010
ISBN 978-3-492-96032-8
© 1996 Maarten 't Hart Titel der niederländischen Originalausgabe: »De nakomer«, B.V. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam 1996 Deutschsprachige Ausgabe: © 2005 Piper Verlag GmbH, München Erstausgabe: Arche Verlag AG, Zürich – Hamburg 1998 Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagmotiv: Claude Monet (»Moulins près de Zaandam«, 1871, Ausschnitt)
Prolog
Alexander Goudveyl schrieb in sein Tagebuch: »Meeresstille und Glückliche Fahrt.[1] Etwa sechs Stunden, nachdem wir von Harwich abgefahren waren, kamen wir wohlbehalten in Hoek van Holland an. Wir erreichten gerade noch den Anschlußzug nach Rotterdam. Eigentlich bedauerte ich das. Der Bummelzug hätte in Maassluis gehalten. Nun rasten wir – sieben Minuten nach Abfahrt – in nur dreißig Sekunden durch die Stadt meiner Kindheit und Jugend. Mir blieb kaum Zeit wahrzunehmen, daß der Stadtteil Hoofd fast ganz verschwunden ist. Die President Steynstraat ist abgerissen worden, Lumpenhandel und Lagerhaus stehen nicht mehr. Alice soll noch immer in dem übriggebliebenen Teil vom Hoofd wohnen. Wie mag es ihr wohl gehen? Und Simon? Ob es stimmt, daß er seine Apotheke verkauft hat?
Am Ende dieses wunderbaren, friedlichen, sonnigen Herbsttages brachte uns ein Taxi nach Hause.
›Ich bin gespannt‹, sagte Joanna, ›wie es meinem Vater gefallen hat, so lange mutterseelenallein auf unser Haus aufzupassen.‹
›Das werden wir ja gleich hören‹, sagte ich.
Doch war, als wir eintraten, niemand da, jedenfalls nicht unten.
›Wo ist Aaron bloß?‹ fragte Joanna besorgt.
›Er wird sich oben hingelegt haben, oder er ist zum Einkaufen ins Dorf gegangen‹, sagte ich.
›Es riecht so merkwürdig hier‹, sagte Joanna.
›Ich rieche nichts.‹
›Natürlich nicht. Männer haben keine Nase.‹
Joanna lief schnüffelnd durch das Wohnzimmer, ging schnüffelnd in die Küche, stieg dann schnüffelnd die Wendeltreppe hinauf. Gleich darauf hörte ich einen Schrei. Erschrocken sprang ich auf und lief hastig die Wendeltreppe hinauf. Sollte mein Schwiegervater etwa tot im Bett liegen?
›Jemand hat im Gästebett gelegen‹, sagte Joanna. ›Deswegen schreist du so laut? Müssen Frauen sich denn immer gleich so aufregen?‹
›Du kannst dich zu Tode erschrecken, wenn ein Wildfremder in deinem Gästebett liegt.‹
›Es liegt überhaupt kein Wildfremder da drin.‹
›Irgendein Wildfremder hat da drin gelegen.‹
›Vielleicht hat sich dein Vater eine Freundin ins Haus geholt‹
›Mein Vater? Ach komm, der interessiert sich schon seit Jahr und Tag nicht mehr für Frauen. Der liebt nur noch Mozart und ein paar andere Komponisten … und außerdem … nein, dieses Bett riecht nicht nach einer Frau, dieses Bett riecht nach dem schalen Schweiß eines Mannes.‹
›Ach du lieber Himmel, auch wenn du eine noch so gute Nase hast: Ich glaube dir niemals, daß du riechen kannst, ob eine Frau oder ein Mann da drin gelegen hat.‹
Sie reagierte nicht, sie lief aufgeregt durch das Gästezimmer, kniete sich vor das Bett, schnüffelte wie ein Spürhund daran herum, stand wieder auf, sagte bestürzt:
›In diesem Bett hat jemand gelegen, der furchtbar gewühlt und geschwitzt hat.‹
Sie schlug die Decken beiseite, sagte: ›Sieh dir an, wie die Laken daliegen. Als seien sie zusammengeknotet worden … als seien sie für eine Flucht benutzt worden. Sieh dir das an! Also, wenn ein Mann dies … eine Frau würde ein Bett nie so hinterlassen.‹
›Wie du übertreiben kannst‹, sagte ich.
›Sind die Laken nun entsetzlich zerknautscht oder nicht?‹
›Sie sind ein bißchen zerknittert.‹
›Ich wollte, mein Vater wäre hier. Wo treibt der sich in Gottes Namen herum?‹
›Ich bitte dich, warte mit deiner Panik noch ein wenig. Er kommt bestimmt gleich.‹
Glücklicherweise war das wirklich der Fall. In dem sanften, goldenen Sonnenlicht kam er vergnügt auf dem Gartenweg anspaziert.
Joanna nahm sich nicht einmal die Zeit, ihn zu begrüßen. Als er das Wohnzimmer betrat, rief sie nur: ›Wer hat hier übernachtet?‹
›Ein Greis im grauen Gewand; tief hing ihm der Hut‹[2], sang ihr Vater.
›O mein Gott … kannst du eigentlich niemals normal antworten? Müssen es immer Zitate aus Opern sein? Sag mir bitte, was los ist. Wer hat hier übernachtet? Und warum riecht das Bett da oben eine Meile gegen den Wind nach Angstschweiß?‹
›Simon hat hier übernachtet‹, sagte Aaron.
›Simon Minderhout?‹ fragte ich erstaunt.
›Jawohl.‹
›Als wir mit dem Zug durch Maassluis fuhren, habe ich noch an ihn gedacht‹, sagte ich.
›Aber wenn Simon hier übernachtet hat, warum riechen seine Laken dann nach Angstschweiß?‹
›Simon war hier untergetaucht.‹
›Untergetaucht? Warum?‹
›Er war auf der Flucht vor den Medien. Zeitungen, Radio, Fernsehen, Jungfrauen* [* In der niederländischen Originalfassung auf deutsch. Im folgenden jeweils durch Kursive gekenntzeichnet.], alle waren hinter ihm her.‹
›Warum in Gottes Namen?‹ fragte ich erstaunt.
›Ich habe oben einen ganzen Berg Zeitungsausschnitte. Die mußt du mal lesen. Außerdem: Ehrlich gesagt, ich weiß es selbst nicht so genau, was wirklich dahintersteckt. Zuerst schien es, als sei er in einen Fall von Verrat im Zweiten Weltkrieg verwickelt gewesen. Später wurden auch noch Ereignisse und Episoden aus seiner Jugend hervorgekramt. Sogar etwas über seine Geburt.‹
›Und was sagte er dazu?‹ fragte ich.
›Herzlich wenig. Du weißt, wie er ist. Nett, aber unzugänglich. Es ist schwierig, etwas aus ihm herauszubekommen. Und noch schwieriger, sich in ihn hineinzuversetzen.‹
›Wo ist er jetzt?‹ fragte ich.
›Wieder zu Hause, denke ich, hoffe ich. Ich habe ein paarmal versucht, ihn anzurufen, aber bis jetzt vergeblich. Ich glaube, er wagt es noch immer nicht, den Hörer abzunehmen.‹
›War es denn so schlimm?‹ fragte ich.
›Es muß sehr schlimm gewesen sein‹, sagte Joanna, ›so, wie das Bett riecht … nicht zu glauben.«
Teil 1Roemer
Neletta
Neletta Minderhout zog die Gardine zurück und sah, daß es in der Nacht geschneit hatte. Jacob Minderhout erwachte, richtete sich langsam auf und fragte: »Was ist los?«
»Mir ist wieder so schlecht.«
»Warum gehst du nicht zu dem neuen Doktor?«
»Der ist noch so jung. Wenn es unser alter Doktor wäre, würde ich …«
»Ja, aber der ist nun einmal im Ruhestand, geh doch zu dem Neuen. Er wird allgemein gelobt.«
»Kann sein, aber ich … vielleicht muß ich mich dann vor ihm ausziehen.«
»Warum in Gottes Namen?«
»Weil etwas mit meinem Bauch ist, wahrscheinlich wird er sich das ansehen wollen.«
Sie starrte in das Mondlicht, das auf den Schnee des Martinikerkhof fiel. Wenn sie doch nur brechen könnte, dann würde sie sich wenigstens für kurze Zeit etwas besser fühlen.
Ein paar Stunden später, an demselben klaren Wintertag, lehnte sie sich gegen die Anrichte. Sie hielt sich den Bauch, sie stöhnte. Floer wurde unruhig in ihrem Korb und bellte. Neletta strich ihr über den Kopf, richtete sich dann entschlossen auf, zog ihre Kittelschürze aus und lief zur Haustür. Hastig schlüpfte sie in ihren Wintermantel, und bevor sie es sich anders überlegen konnte, ging sie schon durch den Torbogen. Sie trat auf die mit dünnem Schnee bedeckte Straße. Ab und an schlitterte sie ein wenig, und nach ein paar Metern war sie von der prickelnd frischen Luft und dem Sonnenlicht, das dem Schnee einen hellblauen Glanz verlieh, so aufgemuntert, daß sie, als sie so dahineilte, alles andere als eine Frau mittleren Alters zu sein schien. Sie hatte schon immer auffallend jung ausgesehen. Vielleicht war das auch der Grund gewesen, weshalb Jacob, um viele Jahre jünger als sie, gut ein Jahr, nachdem sie Witwe geworden war, mitten im Torbogen einfach vor ihr auf die Knie gesunken war und sie gefragt hatte: »Willst du meine Frau werden?«
»Steh erst mal auf«, hatte sie gesagt.
»Erst, wenn du geantwortet hast.«
»Dann kannst du da noch lange hocken.«
»Ist das deine definitive Antwort?«
»Die kann ich dir erst geben, wenn du aufgestanden bist.«
»Nein, ich bleibe hier knien, bis du ja gesagt hast.«
»Danke bestens. Weißt du, was meine Mutter immer sagte? Wer A sagt, muß auch B sagen.«
Sie war weggegangen, um eine Besorgung in der Turfstraat zu machen. Als sie zurückkam, sah sie, daß er stand. Sobald er sie erblickte, kniete er sich hastig wieder hin, wie zum Gebet. Sie hatte schon immer gewußt, daß Jacob Minderhout etwas eigenartig war. Wer wußte das nicht in Groningen? Als sie den Tod ihres Mannes meldete, hatte er ihr als diensthabender Gemeindebeamter beigestanden. Seitdem hatte sie oft gespürt, wie sein Blick auf ihr ruhte, einfach so, auf dem Martinikerkhof oder bei dem jüdischen Bäcker in der Folkingerstraat, wenn sie dort Sonntag morgens eine warme Challa holte. Ein anderes Mal sehr lange bei den Spilsluizen in der hellen blauen Dämmerung eines Winterabends.
Wenn sie überhaupt wieder heiraten wollte, konnte sie bestimmt eine schlechtere Wahl treffen. Er kam immerhin aus gutem Hause, sein Vater war Arzt gewesen. Nach dessen Tod war es allerdings mit der Familie Minderhout allmählich bergab gegangen; zuletzt waren Mutter und Kinder – bis auf den ältesten Sohn Herbert, der sein Apothekerstudium schon fast beendet hatte – in der Soephuisstraat untergekommen. Dennoch erinnerte sich in Groningen jeder an den alten Doktor Minderhout. Wie konnte also dessen Sohn, dieses große Kind mit seiner verrückten Amtssprache, es sich einfallen lassen, ihr den Hof zu machen? Sie fühlte sich belästigt und geschmeichelt, sie war verblüfft und verärgert, es amüsierte sie, aber nun schämte sie sich, daß er unter dem Torbogen wieder vor ihr auf die Knie gesunken war. Sie sagte: »Komm, steh bitte auf und geh!«
»Erst, wenn du ja gesagt hast.«
»Such dir ein Mädchen in deinem Alter.«
»Was soll ich mit so einem jungen Ding, das von nichts eine Ahnung hat. Ich will dich, sag ja, dann stehe ich auf.«
Sie war ins Haus gegangen, hatte ab und zu durch das Fenster geblickt, um zu sehen, ob er noch dort kniete. Als es nach einer halben Stunde zu dämmern begann und ab und an Gruppen von schwatzenden, manchmal johlenden, meistens lachenden Leuten bei dem knienden Jacob stehenblieben, war sie nach draußen gegangen. Sie hatte gesagt: »Bitte, laß mich in Ruhe, geh jetzt nach Hause, ich habe drei Kinder zu versorgen, ich in meiner Lage kann gar nicht daran denken, wieder zu heiraten.«
»Sag ja, und ich gehe«, sagte Jacob selbstbewußt. Das fanden alle Umstehenden so lustig, daß auch sie laut auflachte.
»Gib mir wenigstens Bedenkzeit, ich kann mich doch nicht so Knall auf Fall entscheiden.«
»Das kannst du sehr wohl, du kannst sofort einwilligen. Dann handelst du nicht dümmer als andere Menschen, die meinen, sie würden einen solchen Schritt nach reiflicher Überlegung tun. Für jeden von uns ist es ein Schritt ins Dunkle, und hat man ihn getan, macht es, bei Lichte betrachtet, nichts aus, ob du ja oder nein sagst. Was du auch tust, und was du auch läßt, du kennst doch nie die Folgen von dem, was du tust, du könntest ebensogut bei jeder Entscheidung, die du fällst, einen stuiver in die Luft werfen und dann, je nachdem, ob du Kopf oder Zahl bekommen hast, danach handeln. Vielleicht wärst du dann sogar besser dran. Nun aber, weil du ja sozusagen eine Entscheidung gefällt hast, ist es, als könnte alles, was du tust, dir zugeschrieben werden, denn sonst hättest du immer die Entschuldigung: Ja, aber der stuiver zeigte Zahl, dafür kann ich doch nichts.«
»Ich kann dir beim besten Willen nicht folgen, aber, bitte, steh auf.«
»Sag ja, und ich gehe.«
Sie hatte noch eine Weile dort gestanden, während die Leute Gott sei Dank weitergegangen waren. Sie hatte ihn sich noch einmal genau angesehen. Er war für ihren Geschmack eigentlich etwas zu schmächtig, sah aber sehr gut aus. Merkwürdig, daß so ein junger Mann noch nie ein Mädchen gehabt haben sollte.
»Ich verstehe nicht, was du in mir siehst«, sagte sie.
»Ich sehe in dir eine Frau, die schon viel mitgemacht hat. Du warst mit einem schwierigen Mann verheiratet. Mich würdest du geradezu als Erholung erleben, obwohl ich in den Augen vieler Leute einen Tick exzentrisch bin. Aber nun, wer ist das nicht, bei mir sitzt das mehr an der Oberfläche als bei anderen Menschen. Ich bin verrückt genug zu meinen, es sei praktisch, eine Witwe mit drei netten Töchtern zu heiraten, die ihre Milchzähne, Masern und Röteln schon hinter sich haben, so daß ich nicht befürchten muß, nachts durch Kindergeschrei hochzuschrecken.«
»Wenn ich jemals wieder heirate, will ich hier im Martinikerkhof wohnen bleiben, das ist der schönste Platz in ganz Groningen.«
»Ich habe nicht gesagt, daß du umziehen sollst. Meine schmalen Besitztümer können ohne weiteres in deinen Haushalt hier eingehen.«
»Hältst du es für möglich, nun doch aufzustehen und auf eine Tasse Tee hereinzukommen? Dann können wir dort weitersprechen.«
»Also gut«, sagte er, »weil du es bist.«
Sie wußte da eigentlich schon, daß die Diskussion über ihre Wohnung und die spontane Einladung zu einer Tasse Tee fast unvermeidlich ein Jawort enthielten, und daher war zwischen ihnen auch kein Wort mehr darüber gefallen, ob sie heiraten würden oder nicht.
Sie hatte das Jawort, so merkwürdig es ihr auch abgerungen worden war, nie bereut. Jacob war ein wunderlicher, lieber Mann. Einen solchen Mann hatte sie noch nie zuvor gekannt. Er wurde nie böse, er war nie launisch. Er war immer so voller Rücksicht, immer so zuvorkommend, daß sie dem manchmal mißtraute, daß sie manchmal das Gefühl hatte, es stecke etwas dahinter. Wie war es nur möglich, daß jemand mit einer so unerschütterlichen, natürlichen Heiterkeit durchs Leben gehen konnte? Obwohl sie inzwischen schon so lange mit ihm verheiratet war, machte sie das doch immer wieder argwöhnisch.
Sie lief quer durch die Stadt, erreichte die Wohnung ihres früheren Hausarztes am Hooge der A. Sie klingelte. Eine bucklige Haushälterin öffnete.
»Ist der Doktor zu Hause?« fragte sie.
Bevor die verschrumpelte Alte etwas sagen konnte, blitzte schon der Goldrand einer Brille im dunklen Flur des Grachtenhauses auf.
»So, Letje, was ist los mit dir? Was führt dich hierher?«
»Ich … oh, Doktor, morgens … ich …«
»Komm erst einmal herein.«
Sie folgte dem alten Mann durch den Flur, sie war ihre Übelkeit los, fühlte sich wieder völlig gesund. Sie war nicht krank, wie hatte sie das denken können, sie könnte jetzt ebensogut umkehren und wieder hinaustreten in die sonnendurchflutete Welt, an den märchenhaften, weißgepuderten Tjalken und Torfkähnen entlanglaufen, die so ordentlich in Reih und Glied in der A vertäut lagen. Nachdem er sie aber in seinem Arbeitszimmer aufgefordert hatte, auf einem Stuhl Platz zu nehmen, setzte sie sich doch vorsichtig auf die Kante. Der Doktor blieb stehen, er fragte: »Was fehlt dir?«
»Mir ist morgens oft so übel«, sagte sie.
Er sah ihr tief in die Augen, kam einen Schritt näher und sagte: »Streck mal deine Zunge heraus.«
Neletta streckte ihre Zunge heraus. Der Doktor sagte: »Weißt du noch, daß du beim erstenmal, ach, wie alt magst du da gewesen sein, ich war gerade mit dem Studium fertig, wir lebten noch im neunzehnten Jahrhundert, nun sind wir schon ein Jahrhundert weiter … Ich war mehr als doppelt so alt wie du … Weißt du noch, daß du beim erstenmal deine Zunge nicht herausstrecken wolltest? Wie lange ist das her, wie schnell ist das vorübergegangen! Welch ein Glück, daß alles so schnell geht, daß das Leben so kurz ist. Wie würden wir uns langweilen, wenn das Leben länger dauern und die Zeit langsamer verstreichen würde.«
Sorgfältig besah er sich ihre Zunge und sagte:
»Deine Zunge sieht übrigens noch immer aus wie die eines jungen Mädchens. Sehr krank kannst du nicht sein, auch deine Augen sind klar. Wie ist es mit dem Stuhlgang?«
»Gut, Doktor, sehr gut, ich esse jeden Abend vor dem Schlafengehen eine getrocknete Pflaume.«
»Die weichst du doch hoffentlich vorher ein?«
»Ja, Doktor, natürlich.«
»Und morgens ist dir also übel? Hast du das früher schon einmal gehabt?«
»Ja, es ist dieselbe Übelkeit wie damals, als ich schwanger war, aber viel schlimmer als damals.«
»Vielleicht bist du wieder schwanger. Und diesmal ist es ein Junge, weil dir doppelt so übel ist.«
»Nein, nein, das kann nicht sein, das ist nicht möglich, nein … nein … nein, Doktor, tun Sie mir das nicht an.«
»Kann es wirklich nicht sein? Hast du deine Regel nicht mehr?«
»Nur ganz ab und zu noch.«
»Wie oft ist ganz ab und zu?«
»Letztes Jahr noch zweimal.«
»Und wie lange ist das letzte Mal her?«
»Im Sommer, glaube ich, ja, im Sommer.«
»Dann müssen wir die Möglichkeit doch einbeziehen.«
»Ja, aber Doktor, das kann nicht sein, ich werde nächstes Jahr siebenundvierzig, nein … nein, das kann nicht sein, denn Jacob, denn …«
»Jacob ist doch noch ein junger Kerl, ich sehe nicht ein, warum …«
»Aber Jacob … ich … wir …«
»Du willst sagen, daß ihr keinen …«
»Nein, nein, das nicht, das überhaupt nicht, aber ich habe Jacob, als ich ihn heiratete, beschworen, daß ich keine Kinder mehr haben wollte, daß ich genug an meinen drei Töchtern habe und daß Bep, meine Jüngste, nicht ganz richtig im Kopf ist und daß ich Angst habe, das nächste könnte ein Mongölchen sein. Ich habe zu ihm gesagt, daß ich lieber auf Knien von Groningen nach Balloo rutschen wollte …«
»Nach Balloo? Warum nach Balloo?«
»Oh, weil meine Mutter von dort kommt … nach Balloo rutschen würde, als schwanger zu werden. Und darauf nimmt er immer Rücksicht, er paßt wirklich auf, Doktor.«
»Ja, aber wie denn, wenn ich fragen darf? Schon vor dem Gesang wieder raus aus der Kirche?«
Sie nickte kurz.
»Ach, liebe Letje, daran ist mehr Pracht als Macht, manchmal ist ein einziger kleiner Sänger brutal genug, um lange vor den anderen schon in der Kirche zu piepsen, oder manchmal bleibt ein einziger kleiner Sänger heimlich hängen, und niemand merkt es, weil da so unerhört viele kleine Sänger sind … ja, und dann … und dann, ach, dann schleicht so ein kleiner Sänger mutterseelenallein ins Konsistorialzimmer, und da kann es dann sein, daß dort gerade eine kleine Sängerin auf dem Stuhl steht und ihren ersten Auftritt probt, und dann kann es schon einmal passieren, daß so ein kleiner Sänger ihr höflich die rechte Hand reicht, um ihr vom Stuhl herunterzuhelfen, ja … und dann … was soll ich noch weiter dazu sagen, dann fangen die Puppen doch zu tanzen an, meine Liebe, dafür kenne ich Beispiele … Ich fürchte, daß sich ein kleiner Sänger in diesem Vorraum einquartiert hat, es ist nur schade, daß ich die Geräte nicht mehr hier habe, mit denen ich untersuchen kann, ob ich ihn schon ein bißchen tirilieren höre. Du wirst doch zu meinem Nachfolger gehen müssen, du kannst schließlich nicht mehr von mir verlangen, daß ich noch einen Frosch aus dem Graben hole. Weißt du, was ich tun werde? Ich werde meinen Nachfolger anrufen und ihm sagen, daß du kommst, dann brauchst du weiter nichts zu sagen, dann brauchst du nur noch deinen Morgenurin mitzubringen, und dann wird alles gut.«
»Ja, aber Doktor, noch ein Kind, das geht doch nicht … dafür bin ich viel zu alt … ich, o Gott, wie soll das nur werden, ich habe nach der Geburt von Bep alles weggegeben, ich habe nichts mehr, keine Wiege, keinen Kinderwagen, keine Windeln, keine Kleidchen, nichts, oh, Doktor, was soll ich anfangen … noch ein Baby, wie schrecklich.«
»Ach nein, es ist ein kleiner Nachkömmling, sonst nichts, das habe ich schon oft erlebt, und diese Nachkömmlinge lassen das Leben ihrer Eltern noch einmal wieder richtig aufblühen, bestimmt, das werden immer ihre Augäpfelchen. So ein Nachkömmling sorgt oft für einen Nachsommer in der Ehe. Nun ja, für euch stimmt das nicht so ganz, so lange seid ihr noch nicht verheiratet, aber du wirst sehen, es wird alles gut, und außerdem ist vielleicht gar nichts los. Geh jetzt erst mal zu meinem Nachfolger, ich werde ihn anrufen, dann kann er schon einen Frosch auf dem Kaminsims bereithalten.«
Zwilling
Der Froschtest am nächsten Tag zeigte, daß sie in anderen Umständen war, und nachdem Neletta das Ergebnis mittags von dem jungen Spund erfahren hatte, lief sie wütend und zugleich niedergeschlagen nach Hause. Sie erwog, sich ein paarmal die Treppe herunterfallen zu lassen. Vielleicht würde sich dann die Frucht lösen. Sie nahm sich vor, so lange mit dem Fahrrad über die holprigen Sandwege des Ballooërveld zu fahren, bis sie eine Fehlgeburt bekam. Aber all diese in großer Verzweiflung angestellten Überlegungen verflüchtigten sich zu vagen Hirngespinsten, als sie Jacob erzählte, wie es um sie stand. Sie hatte ihn in all den Jahren ihrer verrückten, glücklichen Ehe noch nie weinen sehen. Daher rührte es sie, als sie nach der schlichten Mitteilung: »Ich bin schwanger«, große Tränen über seine Wangen laufen sah. Er wollte etwas sagen, war jedoch so bewegt, daß sie nur einen Schluchzer hörte. Er ist ein guter Kerl, dachte sie, nur ein bißchen rührselig.
Immer wenn er in den nun folgenden Wochen bei Neletta auch nur ein wenig Niedergeschlagenheit verspürte, verglich er sie das eine Mal mit Sara aus dem Alten Testament, dann wieder mit Elisabeth aus dem Neuen Testament.
»Ich habe bisher noch nie etwas davon gemerkt, daß dir die Bibel soviel bedeutet«, sagte sie verdrießlich.
»Oh, aber die Geschichte von der lachenden Sara hat immer großen Eindruck auf mich gemacht«, sagte Jacob. »Zu Abraham kam Gott einfach an die Tür. Dann ist es nicht schwer, ein Glaubensheld zu sein! Aus drei Scheffeln Mehl backt Sara Pfannkuchen. Das mußt du dir vorstellen: Du bekommst von Gott Besuch, und du backst Pfannkuchen. Einfache Pfannkuchen, nicht einmal Speckpfannkuchen.«
»Wenn du über die Bibel sprichst, ist es immer, als wenn du dich darüber lustig machen würdest.«
»Wie kommst du darauf? Ich? Das würde ich nicht wagen, ich wollte, Gott käme hierher zu uns, dann würde ich Speckpfannkuchen backen, und wenn er ordentlich Sirup darauf täte, würde es mir bestimmt nicht so schwerfallen, an ihn zu glauben.«
Er schwieg und fuhr dann fort: »Und die Geschichte von Elisabeth im Neuen Testament ist sogar noch schöner. Als Maria ihre Cousine Elisabeth besucht und sie begrüßt, hüpft das Kind im Bauch von Elisabeth. Wie mag der kleine Johannes das nur geschafft haben, es kann nicht mehr als ein winzig kleiner Sprung gewesen sein.«
»Ich weiß bei dir nie, ob du es ernst meinst. Über alles machst du dich lustig.«
»Daß du's nur weißt, ich pfeife und summe den ganzen Tag, weil du ein Kind bekommst, vergiß das nicht, darüber mache ich mich bestimmt nicht lustig.«
»Nein, das weiß ich, aber ich glaube nicht, daß du begreifst, was es für mich bedeutet. Ich habe solche Angst, daß etwas mit dem Kind nicht in Ordnung ist, ich bin schon so alt, ich bin schon zu alt … Ich habe früher in Drenthe so viele mongoloide Kinder gesehen.«
»Du bekommst kein Mongölchen, du bekommst ein pausbäckiges Baby, einen gesunden, hübschen, klugen, aufgeweckten, schlauen, gescheiten, pfiffigen, durchtriebenen, gerissenen, gewieften, intelligenten kleinen Jungen. Verrückt eigentlich, daß die Sprache so viele Wörter für Intelligenz hat, während die meisten Menschen dumm sind.«
So munterte er sie jeden Tag auf. Hinzu kam, daß ihr die Schwangerschaft nur noch wenig Beschwerden bereitete. Sogar die Übelkeit war jetzt erträglicher, einmal, weil sie nun wußte, worin die Ursache lag, zum anderen, weil sie, wie sie es auch schon bei ihren früheren Schwangerschaften getan hatte, abends vor dem Schlafengehen einen großen Becher warme Milch trank. Damit konnte sie die schlimmste Übelkeit abwenden.
Zwei Monate vor der Geburt begleitete sie Jacob zu einem Konzert der Groninger Orkestvereniging. Vor der Pause erklangen die Maurerische Trauermusik und das Klavierkonzert Nr. 24 von Mozart. Nach der Pause stand die Symphonie Nr. 4 von Anton Bruckner auf dem Programm. Während die Symphonie mit dem tiefen Hörnerruf einsetzte, döste Neletta friedlich vor sich hin und hörte kaum zu. Sie liebte klassische Musik weitaus weniger als Jacob, und Bruckner bedeutete ihr gar nichts. Jacob aber summte wie immer zuerst leise, dann, alles um sich her vergessend, allmählich immer lauter mit. Sie schaute ihn streng an, sie legte einen Finger auf die Lippen, und schuldbewußt nickte er. Plötzlich, während das Orchester sich einem brausenden Fortissimo näherte, fühlte sie, wie das Kind anfing, heftig gegen ihre Bauchwand zu treten. Sie griff nach Jacobs Hand und legte sie etwas unterhalb des Nabels auf ihren Bauch. Sie würde es ihr Leben lang nicht vergessen, wie er, als er die Bewegungen des Kindes fühlte, sie anschaute. Zu ihrer alten Mutter sagte sie am nächsten Tag: »Ich habe noch nie in meinem Leben einen Mann so strahlen sehen.«
Während der vielen Fortissimi, die in der Bruckner-Symphonie folgten, trat das Kind in ihrem Leib jedesmal so kräftig, daß sie kaum still sitzenbleiben konnte. Als das Kind im Frühsommer nach wenigen Wehen auffallend leicht geboren wurde, war sie erstaunt, daß das Baby nicht schrie. Neletta spürte, daß etwas nicht stimmte. Die Hebamme schwieg.
»Was ist los?« fragte sie.
Sie hörte die Hebamme schwer atmen. Sie richtete sich in ihrem Bett auf und fragte geradeheraus: »Ist es tot?«
»Ja.«
Sie wußte nicht, ob sie sich erleichtert fühlen durfte. Was ihr so bevorstand, das Stillen, die fehlende Nachtruhe und vor allem das, was danach kam: dieses unaufhörliche Achtgebenmüssen, das niemandem anders zu übertragen war, sollte jetzt an ihr vorübergehen, und es fiel ihr schwer, nicht insgeheim froh darüber zu sein. So fragte sie nur kurz: »Junge oder Mädchen?«
»Junge.«
»Wie furchtbar wird das für Jacob sein. Er hat neun Monate lang gepfiffen und gesungen, du hättest ihn sehen sollen, wie er neulich im Konzert strahlte, als er spürte, wie sich sein Kind bewegte. Es trat für zwei, wie kann es jetzt tot sein? Ach, wie schlimm für Jacob.«
»Schlimmer für dich, du hast es neun Monate lang getragen, dein Mann da …«
Neletta hörte fast etwas wie grimmige Schadenfreude in den Worten »dein Mann da«, und sie dachte wieder an den Moment, vor ein paar Stunden, als die Wehen begonnen hatten und die Hebamme Jacob, der nur allzugern bleiben wollte, mit den Worten: »Fort mit dir, wir können hier kein Mannsvolk gebrauchen«, unerschrocken zur Tür des Geburtszimmers hinausgescheucht hatte. Bereits auf der Schwelle, den Türgriff in der Hand, hatte Jacob sich noch einmal kurz nach ihr umgesehen und gesagt: »Na, na, was hast du für eine Menge Haare auf den Zähnen, die wachsen dir schon direkt durch die Oberlippe.«
Wütend hatte die Hebamme Jacob hinausgeschoben und die Tür zugeworfen. Dann hatte sie sich verzweifelt mit dem Finger über ihren kräftigen Oberlippenbart gestrichen.
Während Neletta an die linkische Geste zurückdachte, fühlte sie auf einmal einen furchtbaren Schmerz in sich aufsteigen. Sie schrie. Die Hebamme legte den toten kleinen Jungen hin, rief: »Was ist los? Die Nachgeburt? Deswegen braucht man nicht so zu schreien, hör doch auf.«
»O mein Gott, was für ein Schmerz, es ist nicht zu glauben, wie ist das möglich, ein solcher Schmerz nach der Geburt, das ist doch nicht normal. Gott, Heiliger Jesus, dies ist viel schlimmer als eben, oh, oh, oh, halte mich fest, oh, Jesus, Maria, Jakob, oh … au …«
Da wurde plötzlich das schon stark verformte Köpfchen eines zweiten Kindes sichtbar.
»Kommt da doch wahrhaftig noch so ein Würmchen«, sagte die Hebamme. Fünf Minuten später hielt sie einen lauthals schreienden, wild zappelnden kleinen Jungen in Händen, das Ebenbild des toten Kindes. Als sie das weinende Baby für einen Augenblick in ihre Arme nehmen durfte, dachte Neletta: Der hat seinen Bruder totgetreten, neulich bei Bruckner.
Hinten in der Waschküche aber lief Jacob pausenlos hin und her und sah zu, wie Floer die rosa Würmchen säugte, die sie nachts geboren hatte. Als er jetzt seine Nachkommenschaft schreien hörte, schlug er die Hände vor die Augen und murmelte unter Tränen: »Da ist unser Apostelchen, ach, ach, ach, da ist unser Apostelchen.«
So kam im Frühsommer 1914, keineswegs geplant und zumindest von seiner Mutter keineswegs erwünscht, der Sohn von Jacob und Neletta Minderhout zur Welt, fast gleichzeitig mit einem Hündchen, das dem Tode des Ertränkens entkam, weil Jacob es übersah, als er die rosa Würmchen von Mutter Floer wegholte. Man könnte es für grausam halten, daß Jacob die kleinen Tiere ertränkte, aber er wußte, daß er die jungen Hunde, allesamt ausnehmend häßliche Promenadenmischungen, nur schwer loswerden würde, und er wollte nicht einen Wurf junger, noch nicht stubenreiner Hunde am Hals haben, gerade jetzt, wo auch noch ein Baby angekommen war. Es würde schon ohne Hunde schwierig genug werden. Wie schwierig, zeigte sich bereits, als Neletta und er sich nicht über den Vornamen des Babys einigen konnten. Jacob wollte das Kind Roemer nennen, aber Neletta sagte: »Was ist das für ein lächerlicher, altmodischer Name, Roemer, wie kommst du darauf, nein, wir nennen ihn Simon nach deinem Vater, das ist ein schöner, ehrlicher, solider holländischer Name.«
Als Roemer Simon Minderhout meldete Jacob seinen Sohn an. Das heißt, so schrieb er ihn selbst im Rathaus ein. Hartnäckig nannte er ihn weiterhin Roemer, aber Neletta und seine drei Halbschwestern, von denen zwei schon aus dem Hause waren, nannten ihn Simon.
Die erste Gelegenheit, bei der ein Vorname ausdrücklich gebraucht wird, ist die Taufe. Die Taufe von Roemer Simon Minderhout war Anlaß zu vielem, nur allzu menschlichem Leid. Seine Schwester Bep wollte ihn in die Kirche tragen, aber Mutter Neletta fand dies, im Gedanken daran, daß bei Bep nicht alles ganz richtig im Kopf war, unverantwortlich. Außerdem gehörte es sich nicht. Wer sonst als ihre Mutter kam in Frage, das Kind in die Kirche zu tragen? Bep schluchzte, und Jacob wetterte, aber Neletta verkündete, daß sie »ihren Kopf durchsetzen« würde. Und sie setzte ihren Kopf durch. An einem warmen Sonntag im Juni wurde Roemer Simon Minderhout von seiner Großmutter zu Beginn des Taufgottesdienstes unter den hohen Gewölben der Martinikerk nach vorn getragen. Dem war ein bemerkenswertes Streitgespräch zwischen Großmutter und Schwiegersohn vorausgegangen.
»Morgen brauchst du einen Pfropfen, der tüchtig mit Branntwein und Zucker getränkt ist«, hatte die Großmutter am Vorabend der Taufe zu ihrer Tochter gesagt.
»Wofür soll das gut sein?« hatte Jacob gefragt. »Für den Kleinen, damit er daran lutschen kann. Dann ist er mucksmäuschenstill.«
»Ja, das will ich gern glauben«, hatte Jacob gesagt, »aber ich bin strikt dagegen. Damit nebelst du das junge Gehirn ein, das kann nicht gut sein.«
»Ach, hör auf, das macht man seit Jahrhunderten so. Es ist die einzige Methode, um die Kinder den ganzen Gottesdienst hindurch still zu halten. Sonst schreien sie.«
»Nun verstehe ich auf einmal«, hatte Jacob gesagt, »warum die feinen Leute nicht vom Alkohol loskommen. Bei der Taufe haben sie es gelernt, bei der Taufe hat die Abhängigkeit angefangen, und es ist mir schon oft aufgefallen: je feiner, um so hemmungsloser beim Trinken. Ja, denn je feiner, desto länger dauert auch der Gottesdienst, und desto mehr Branntwein ist nötig, um so ein Kleines lange still zu halten. Also daher … daher … so lernt man noch etwas dazu … so kommt man zu Erkenntnissen. Daß die Reformierten alle saufen wie die Bürstenbinder, ist auf die Taufe zurückzuführen, da fängt es an.«
»Ach, Mann, was schwatzt du da, so 'n bißchen Branntwein, das ist …«
»Wieviel ist ein bißchen?«
»Ein halbes Schnapsglas reicht schon.«
»Für solch ein Würmchen? Ein Kind von sechs Pfund? Das sind umgerechnet zehn Gläser für einen Kerl von sechzig Kilo! Herrgott noch mal, damit würdest du den strammsten Trinker lahmlegen. Es ist himmelschreiend. Wenn du also bitte kapierst, daß ich das nicht haben will.«
Und in diesem Punkt setzte Jacob »seinen Kopf durch«. Das Kind wurde ohne süßen Branntweinpfropfen in die Kirche getragen. Mit großen hellblauen Augen sah es um sich. Als das kalte Taufwasser seine Stirn berührte, hörte man einen zarten Schrei, aber Roemer Simon weinte nicht, sondern sah in den Armen seiner schwarzgekleideten Großmutter lediglich staunend seinen Vater an, der während des ganzen Gottesdienstes Grimassen schnitt, um ihn still zu halten.
Prins
Während Roemer Simon trank, schlief und um sich schaute, wuchs das Hündchen, das Jacob Minderhout übersehen hatte, schnell zu einer Sehenswürdigkeit heran. Mit seinem viel zu langen Schwanz wußte das Tier nichts anzufangen. Meistens hing er, zusammengerollt wie ein Schweineschwänzchen, direkt vor seinem Hinterausgang. Manchmal versuchte es, damit zu wedeln, aber das mißlang dramatisch. Das Tier war ein undefinierbares Mosaik aus Weiß und Schwarz. Da das eine Auge von einem Kranz weißer, das andere von einem Kranz schwarzer Haare umgeben war, sah es alles andere als vertrauenswürdig aus. Zuerst meinte man, das Hündchen schiele. Bei näherem Hinsehen entstand dieser Eindruck nur durch den Farbunterschied. Das eine Ohr hing herab, das andere stand steil hoch. Eine der Pfoten war krummer als die drei anderen, so daß es schien, als hinke das Tier. Wenn das kleine Monster bellen wollte, öffnete sich das Maul, und es erschienen schneeweiße Zähnchen; es sah aus, als grinse es. Und unter dem winzigen Maul hing ein ausgefranstes Bärtchen wie aus steifem schwarzem Garn.
Noch bevor der Hund richtig entwöhnt war, bevorzugte er zunehmend die Gesellschaft dessen, mit dem er am selben Tag zur Welt gekommen war. Nach ungefähr vier Wochen wurde er zum erstenmal erwischt. Mutter Neletta wollte ihrem Sohn das Fläschchen geben, beugte sich über die Wiege, schlug das Deckchen zurück, um ihn hochzunehmen, und stieß einen Schrei aus. Dicht an Roemer Simon gedrückt, schlummerte das Scheusal.
»Das will ich nicht haben!« rief Neletta entsetzt. Sie wiederholte dies abends Jacob gegenüber und machte ihm Vorwürfe, weil er das Hündchen nicht sofort nach der Geburt umgebracht hatte. Sie drang darauf, daß es jetzt noch geschehen solle. Obwohl Jacob vage Pläne in dieser Richtung machte, erwies es sich als nicht ganz einfach, sie auszuführen. Einmal hatte Jacob das Hündchen gepackt, war mit ihm zum Schuppen gelaufen in der Hoffnung, dort etwas zu finden, womit er es barmherzig töten könne. In dem Augenblick, als Jacob eine Hand losließ, um im Halbdunkel nach einem geeigneten Gegenstand zu suchen, versuchte das Tier, mit seinem komischen Schwanz zu wedeln. Als Jacob das sah, ließ er das Hündchen fallen. Ein Schmerzensschrei erklang, als es auf dem harten Boden des Schuppens landete. Jacob beugte sich herab. Voller Schuldgefühl strich er dem Hündchen lange über den Kopf. Und nicht das Hündchen kehrte mit hängenden Pfoten ins Haus zurück, sondern der verhinderte Mörder.
Seitdem wurde das Hündchen mit schöner Regelmäßigkeit in Roemer Simons Wiege angetroffen.
Wie er es schaffte, in die Wiege zu klettern, wußte niemand, sah auch niemand. Es passierte immer wieder, allen Protesten Nelettas zum Trotz. Sehr bald zeigte sich, daß, falls Roemer Simon überhaupt weinte, er es jedenfalls nie tat, wenn das Hündchen neben ihm in der Wiege lag. So duldete es Mutter Neletta auf die Dauer. Viel später, als Roemer schrie, weil seine ersten Milchzähne durchkamen, legte Mutter Neletta das Hündchen sogar von sich aus zu Simon in die Wiege. Aber das geschah erst, nachdem das Tierchen sich einen Namen als Roemer Simons Retter gemacht hatte.
In den ersten Monaten spazierte Neletta häufig zusammen mit ihrer Tochter Bep hinter dem noch aus dem neunzehnten Jahrhundert stammenden Kinderwagen durch die Straßen von Groningen. Der Wagen, ein Erbstück aus Jacobs Familie, war hauptsächlich aus geflochtenem Korb und steifem Segeltuch angefertigt. Als es August wurde, hatten Mutter und Tochter schon so manches Mal die Straßen der Innenstadt durchkreuzt, und so antwortete Neletta an einem warmen Nachmittag ihrer Bep auf die immer wieder gestellte Frage: »Sag, Mami, darf ich jetzt nicht mal allein mit dem Kinderwagen spazierengehen?«, kurz: »Na gut, meinetwegen, aber bitte vorsichtig, und sei bald wieder zurück.«
Zum Schutz gegen den Staub wurde noch schnell ein Tuch über den Kinderwagen gelegt, und dann wurde Roemer Simon geholt. Während das geschah, erklomm das Scheusal den Wagen und versteckte sich am Fußende unter dem Deckchen. Roemer Simon wurde in den Wagen gelegt, und wenig später marschierte seine stolze Schwester Bep höchst vergnügt hinter dem Kinderwagen über den Martinikerkhof. Durch die Turfstraat ging es zum Turfsingel. Leise sang sie ein Kinderliedchen:
Sieh nur im Walde, wie's schaukelt ganz sacht,
Von Blütenschleiern bedeckt:
Ein Wieglein, das haben zwei Vöglein gemacht,
Gar sauber, fein und versteckt.
Wenn der Wind dann leicht
Über Ranken streicht,
Schaukelt das Wieglein gar leis hin und her
Wie's Schifflein auf wogendem Meer.
Stets die letzte Zeile wiederholend, schritt Bep hinter dem Erbstück aus Korb zum Schuitendiep. Wer sie da so in der Sonne gehen sah, hätte denken können, daß sie eine blutjunge, stolze Mutter sei, die ihr erstes Kind in der Stadt ausfährt, eine junge Mutter, die mühelos einen Wettbewerb im Lächeln hätte gewinnen können. Auch auf der Höhe vom Damsterdiep lächelte Bep noch unaufhörlich, und Roemer Simon starrte sie mit erstaunten blauen Augen an. Bep blickte auf die meist doppelt vertäuten Torfkähne, Schuten und Tjalken im Damsterdiep und murmelte: »Viel zu viele Schiffe, viel zu viele Schiffe.« Sie blieb die ganze Zeit nahe am Wasser, lief erst den ganzen Herensingel entlang, überquerte dann das Herenplein, wo sie einen Moment lang warten mußte, bis die neue elektrische Straßenbahn vorbeigefahren war, und schob schließlich, immer noch lächelnd und dabei die Zeile »Wie's Schifflein auf wogendem Meer« wiederholend, den Kinderwagen vorsichtig über den abschüssigen Grashang des Ubbo Emmiussingel auf den Verbindungskanal zu. Dort angekommen, wo sich Land und Wasser berühren, schob sie, ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, den Kinderwagen einfach weiter, und das Erbstück glitt den Abhang hinab ins Wasser. Als ihre Schuhspitzen die Wasserkante erreicht hatten, gab sie dem Wagen einen kräftigen Stoß, und er fuhr noch ein Stück von alleine weiter. Einen Augenblick schien es, als würde das schwerfällige Gefährt kentern, aber dann richtete es sich auf und trieb langsam vom Ufer fort.
War es nun der leichte Sommerwind, oder gab es doch eine Strömung im Wasser, wie dem auch sei: Wie ein Schifflein auf wogendem Meer glitt der Kinderwagen ganz langsam in Richtung Oosterhaven. Er passierte die wenigen vertäuten Tjalken und Torfkähne und trieb unter einer Brücke hindurch. Unterwegs schien er sich mit Wasser vollzusaugen, denn er sank nach und nach tiefer. Auf einmal erschien backbord über dem inzwischen zur Reling avancierten Korbrand der Kopf des Scheusals, einen Zipfel des Deckchens halb über der Schulter. Er richtete sich weiter auf, schüttelte das Deckchen ab und fing, offenbar in vollem Bewußtsein über den Ernst der Lage, wie wild an zu bellen. Noch nie hatte man bisher das Scheusal bellen hören, aber das Geräusch, das es jetzt von sich gab, paßte überhaupt nicht zu ihm. Das Tierchen schaffte es, ein rauhes, tiefes, drohendes Gebell zu produzieren, es bellte wie ein Dragoner, ein kolossales Bellen, zu dem mindestens ein Hund von der Größe eines Mecheler Schäferhunds gehört hätte.
In der Kajüte eines der Torfkähne hörte die Frau des Schiffers das Bellen näher kommen, hob den Kopf, runzelte die Augenbrauen und horchte. Einen Augenblick lang meinte sie, eine schnelle Tjalk käme steuerbord vorbei, mit einem Schäferhund an Bord, aber es verblüffte sie, daß ihr Kahn nicht schaukelte, was doch der Fall war, wenn ein schnelles Schiff passierte. Sie kletterte aus der Kajüte an Deck, sah den Kinderwagen ruhig vorübertreiben und entdeckte gerade noch den daumenlutschenden Roemer Simon. Sie erlebte den schwimmenden Kinderwagen mit dem Hündchen und seinem schwarzweißen Haarkranz so sehr als ein Bild, das nur in einen Traum gehören konnte, daß sie zunächst gar nicht daran dachte, etwas zu rufen oder zu unternehmen. Schwerfällig ging sie aufs Vorderdeck. Sie blickte dem Kinderwagen nach, kehrte dann kopfschüttelnd um. Der Schiffer, der mit dem Teeren der Taue beschäftigt war, hörte ihre Holzschuhe klappern, schaute auf und fragte: »Was ist los?«
»Ein Kinderwagen ist eben vorbeigetrieben, mit einem Hündchen an Deck und einem Baby darin«, sagte sie träumerisch.
»Bei dir piept's wohl«, sagte der Schiffer.
»Nein, sieh selbst, da sind sie.«
Sie zeigte auf den Kinderwagen, der inzwischen schon auf der Höhe der nächsten Tjalk trieb. Der Schiffer lief aufs Vorderdeck, sah den Wagen, rannte zum Achtersteven und sprang ins Beiboot, das hinter dem Torfkahn trieb. Er machte das Boot los und ruderte hinter dem Kinderwagen her. Auch er hatte die leichte Sommerbrise im Rücken, und als geübter Ruderer holte er schnell auf. Als er auf gleicher Höhe mit dem Kinderwagen angelangt war, stieß er diesen mit seinem einen Ruder in Richtung des sanft ansteigenden, mit Gras bewachsenen Kanalabhangs, während er mit dem anderen stakte. Die Frau des Schiffers war inzwischen von Bord gegangen und lief in ihren schneeweißen Holzschuhen zum grünen Abhang des Radesingels. Sobald der Schiffer den Kinderwagen so weit an Land gestoßen hatte, daß die Räder festen Boden berührten, konnte die Schiffersfrau, die inzwischen ein Stück ins Wasser hineingelaufen war, das Verdeck am Segeltuch festhalten. Begleitet von dem heiseren Bellen des Scheusals, gelang es ihr, den Wagen ans Ufer zu ziehen. Es war eine Rettungsaktion, die schnell, vernünftig und wirkungsvoll durchgeführt wurde, und es ist wirklich bedauerlich, daß an diesem warmen, stillen Sommernachmittag im Jahre 1914 noch anderes geschah, so daß nicht einmal von einem zufällig vorbeikommenden Spaziergänger eine Fotografie überliefert ist. Auch in die Zeitungen hat es die Rettungsaktion nicht geschafft.
Und nun? Was macht man nun mit einem Kinderwagen, den man aus einem Kanal herausgefischt hat? Nimmt man an, daß der Wagen versehentlich ins Wasser geraten und Gott sei Dank nicht gesunken ist und daß die rechtmäßige Eigentümerin sicher sehr bald händeringend auftauchen wird? Oder bringt man einen solchen triefenden Wagen unverzüglich zur Polizei? Die Schiffersfrau schob den Kinderwagen bis zur Laufplanke ihres Kahns und wartete in aller Ruhe ab, ob jemand auftauchen würde. Sie blickte das Hündchen an, das vergeblich versuchte, mit seinem gekräuselten Schwänzchen zu wedeln, sie streichelte Simons flaumweiches Haar, und sie kniff auch vorsichtig in seine kleine Wange.
»Du bist ein lieber kleiner Junge«, sagte sie, »mußtest du gar nicht weinen, als du beinahe ertrunken bist?«
Wie zur Antwort steckte Roemer Simon seinen linken Daumen wieder in den Mund. Das Wasser des Verbindungskanals glitzerte im Sonnenschein, die Sommerbrise nahm zu, versuchte, soweit das möglich war, die braunen, größtenteils aufgerollten Segel der Tjalke zu blähen. Eines stand fest: Die Welt war so eingerichtet, daß der Kinderwagen mit Roemer Simon und dem Scheusal darin ebensogut noch lange Zeit unbemerkt hätte bleiben oder selbst hätte kentern können. Bis heute begreift niemand, warum der schwerfällige Wagen nicht gesunken ist, ebenso wie keiner je hat begreifen können, warum Bep ihn ins Wasser geschoben hat. Sie selbst hat als Antwort auf diese Frage immer nur dasselbe geantwortet: »Das Wasser zog so, das Wasser zog so.«
Sobald Bep den Kinderwagen hatte davontreiben sehen, war sie nach Hause zurückgelaufen. Sie zog die Haustür mit dem Seil auf, das aus dem Briefkastenschlitz hing, flog in die Küche und schrie ihrer Mutter zu: »Ich hab das Kindchen ins Wasser gefahren
Mutter und Tochter rannten dann zusammen durch die Herenstraat zu den Kanälen. Und da fanden sie schließlich den Wagen wieder, behütet von der Schiffersfrau, die nur einen einzigen Blick auf die aufgelöste, totenblasse Neletta zu werfen brauchte, um zu wissen, daß dies die Mutter des kleinen Jungen sein mußte.
Noch Jahre später war die Schiffersfrau entrüstet, daß ihr gar keine Zeit gelassen worden war zu berichten, wie ihr Mann und sie selbst unter Einsatz ihres Lebens das Kind gerettet hatten. Erst abends, als sich Jacob bei den beiden bedankte und dem Schiffer diskret einen Geldschein in die Hand drückte, hatte sie Gelegenheit, ihre Geschichte loszuwerden. Aufmerksam hörte Jacob ihr zu. Danach erzählte er die Geschichte der Rettung jedem, der sie hören wollte. Immer wieder betonte er dabei die Rolle des Hündchens, das seit diesem Nachmittag in seiner ganzen »Prinzenherrlichkeit« – wie Jacob es nannte – neben Roemer Simon in der Wiege schlafen durfte. Dem Ausdruck »Prinzenherrlichkeit« hat er wohl auch seinen Namen zu verdanken. Schon bald nach dieser Wasserfahrt wurde das Scheusal Prins genannt.
Spanische Grippe
In der zweiten Hälfte des Jahres 1918 wütete in der ganzen Welt die Spanische Grippe. Eine Milliarde Menschen wurde krank, zwanzig Millionen starben. Auch in Groningen verhalf die Influenza im Oktober, November und Dezember behutsam Dutzenden von Menschen zur ewigen Ruhe. Begeistert sagte Jacob an einem Novembertag beim Abendbrot: »Ich war heute der einzige im Rathaus. Alle liegen grippekrank zu Hause!«
»Und darüber freust du dich?« sagte Neletta.
»Na, und ob! Solch ein herrlich stilles Rathaus wer träumte nicht davon? Und wenig Leute! Nur ab und an einer, der wieder einen Todesfall anzeigte. Er mäht sie einfach dahin, dieser Spanische Freund, ja, ›der Tod übergeht nicht Haus noch Tür‹, wie der große Vondel schon gesagt hat. Wir sollten auch etwas für unsere Beerdigung beiseite legen.«
»Ach, du, daß du dich sogar darüber lustig machen mußt«, sagte Neletta.
»Sogar darüber? Gerade darüber! Nichts ist weniger schlimm, als zu sterben, oder wie Schubert schreibt: ›Als wenn das Sterben das Schlimmste wäre, was uns Menschen begegnen könnte.‹ Ewig leben, das wäre erst schrecklich.«
»Sollten wir nicht doch auch Menthaformtabletten schlucken?«
»Ach nein, die sind unverschämt teuer, die helfen nicht, das einzige, was hilft, ist der Saft von Schwarzen Johannisbeeren. Davon sollten wir jeden Tag einen vollen Eßlöffel in den Haferbrei tun.«
Im Haus am Martinikerkhof wurde niemand krank. Einer starb, der Hund Floer, an Altersschwäche. Dennoch veränderte sich Jacobs und Nelettas Leben durch die Spanische Grippe vollkommen. Im Dörfchen Anloo starb der Gemeindesekretär. Unter normalen Umständen wäre jemand wie Jacob nie für dieses Amt in Betracht gekommen, aber in der weiteren Umgebung von Anloo hatte die Spanische Grippe alle Kandidaten geholt. So wurde auf Empfehlung des Bürgermeisters von Groningen schließlich Jacob zum neuen Gemeindesekretär des Dörfchens oben auf dem Hondsrug ernannt. Er würde fünfhundert Gulden im Jahr verdienen, und Jacob beschrieb seine Aussichten so: »Ob sich wohl mal ein kleines dubbeltje zwischen den vielen großen centen findet?«
Nach dem Ersten Weltkrieg zogen also Jacob und Neletta Minderhout in ein Haus ganz in der Nähe der kleinen, uralten Kirche von Anloo. Für Jacob, der aus der Soephuisstraat stammte, der im Rathaus als Volontär angefangen hatte und durch Strebsamkeit, Selbststudium, Liebenswürdigkeit und Pflichttreue langsam zum Beamten aufgestiegen war, bedeutete diese Ernennung eine geradezu unvorstellbare Beförderung. Für Neletta dagegen war es entsetzlich, in das Land ihrer Vorfahren umzusiedeln, in Häuser mit klammen Betten, mit Zimmern ohne elektrisches Licht, kurz, ins neunzehnte Jahrhundert. Sie war sich jedoch darüber im klaren, daß sie dies auf sich nehmen mußte. Ein Gemeindesekretär, außer dem Bürgermeister der einzige Beamte im Rathaus, war nun einmal ein wichtiger Mann. Oder wie Jacob selbst spöttisch bemerkte: »Jetzt gehören wir auch zu den Notabeln.«
Die ersten Erinnerungen von Roemer Simon beginnen mit dem Umzug nach Anloo. Täglich zogen Prins und er im Spätsommer 1918 zusammen los. Meistens hörte Mutter Neletta wenig später wildes Gegacker in der sommerlichen Stille, dem gewöhnlich das helle, ausgelassene Gelächter ihres Sohnes und das dunkle, dragonerhafte Gebell von Prins folgten. Für sie bedeuteten Gelächter und Gebell, daß sie sich keine Sorgen um den Kleinen zu machen brauchte; er war weder in einen Graben gefallen, noch hatte er sich verlaufen. Ab und an, wenn sie an der Anrichte stand und durch das Küchenfenster schaute, konnte sie ihn hinter der Kirche auftauchen und unter den Ulmen auf dem Brink, dem Dorfplatz, verschwinden sehen. Oder er streifte mit Prins zusammen über die Allmende. Und immer wieder hörte sie das Gegacker, das übermütige Lachen, das ihm folgte und das sie immer wieder ein warmes Gefühl von Glück empfinden ließ. Vielleicht wäre dieses Glücksgefühl weniger groß gewesen, wenn sie ihrem Sohn einmal nachgegangen wäre und gesehen hätte, wie er gezielt Steine und Äste auf eins der vielen frei herumlaufenden Hühner warf. Wurde ein Huhn durch den geschickten Wurf des Kindes getroffen, dann gackerte es, als würde es ermordet, und stob davon. Daraufhin schoß Prins hinterher und versuchte, das Huhn zu packen.
So sah es Simon Minderhout wieder vor sich, Jahrzehnte später, als er nachts seine Schlaflosigkeit zu bezwingen suchte, indem er an seine früheste Kindheit zurückdachte: Prins und er, wie sie in der sonnendurchfluteten, satten, grünen Welt durchs Dorf jagten und das Federvieh aufscheuchten. Manchmal war die Erinnerung so stark, daß er das panische Gegacker wieder hören konnte und wieder haargenau wußte, wie beglückt er dabei gewesen ist. Dann dachte er darüber nach, wie merkwürdig es ist, daß die tiefsten Glücksgefühle eines Menschen mit etwas so Harmlosem wie dem Aufscheuchen von Hühnern zusammenhängen können.
Eines Tages, es war Ende September, packte Prins, vermutlich versehentlich, ein junges Huhn. Er schüttelte das Tier so lange wild hin und her, bis es tot war. Noch am selben Tag erschien am späten Nachmittag, kurz vor dem Abendessen, der Ortspolizist, der zugleich Gemeindebote war. Jacob Minderhout, der gerade nach Hause gekommen war, fragte überrascht: »Voortink? Du hier? Was führt dich her? Eben haben wir noch im Rathaus …«
»Wollte dort nicht davon anfangen«, sagte Voortink. Er schwieg, während er eins seiner Ohrläppchen massierte. Dann hustete er herzzerreißend.
»Mijnheer Minderhout«, sagte er schließlich, »ich bin in einer ernsten Angelegenheit hier.«
»Setzen Sie sich erst einmal hin«, sagte Jacob. »Zu Diensten«, sagte der Ortspolizist.
Er setzte sich und zog einen zerknitterten Briefumschlag aus der Tasche eines abgetragenen Kleidungsstücks, das im neunzehnten Jahrhundert eine Uniform dargestellt hatte. Er nahm die Mütze ab, wühlte mit der Hand in seinem Haar, setzte die Mütze wieder auf und sagte: »Ich hab es hier alles so aufgeschrieben, wie es mir zu Ohren gekommen ist«, und wies auf die Rückseite des Briefumschlags.
»Heraus damit«, sagte Jacob.
»Ja, sehen Sie … sehen Sie … ich denke nicht, daß es Ihr Sohn ist … es ist mehr der Hund, glaube ich, aber man beschwert sich … man beschwert sich …«
Er atmete schwer, sein Gesicht lief rot an, er preßte die Lippen zusammen, ballte die Fäuste, brachte dann heraus: »Es ist ein Barnevelder.«
Nach diesen rätselhaften Worten schwieg er eine lange Zeit. Er schielte nach seinem Briefumschlag und sagte dann mit dumpfer Stimme: »Tot.«
Lange blieb es still. Nur die Fliegen summten. Dann sagte der Ortspolizist: »Das wollte ich nur sagen.«
»Ich verstehe«, sagte Jacob.
»Hier steht es«, sagte der Ortspolizist und drückte dabei mit seinem Daumen die Rückseite des Briefumschlags kräftig auf die Tischplatte.
»Kurz zusammengefaßt«, sagte Jacob, »wenn ich es richtig verstehe, läuft es auf folgendes hinaus: Mein Sohn und unser Hund haben den Tod eines Barnevelder Huhns auf dem Gewissen.«
»Ich hätte es nicht besser ausdrücken können«, sagte der Ortspolizist.
»Und nun?« fragte Jacob. »Soll ich für das Huhn eine Entschädigung zahlen? Wessen Huhn ist es?«
»Mulsteges.«
»Sag zu Mulstege, daß ich eine Entschädigung für das Huhn zahle.«
Der Ortspolizist nickte, nahm dann seine Mütze wieder ab, wühlte wieder ausgiebig in seinem Haar, setzte die Mütze wieder auf und sagte: »Vielen Dank.«
Er schloß die Augen.
Jacob Minderhout lächelte, fragte: »Haben Sie das Huhn vielleicht bei sich?«
Der Ortspolizist nickte mehrmals, die Lippen zusammengepreßt.
»Ist es hier vielleicht auch üblich, einen Hund, der so ein armes Viech totgebissen hat, ein paar Tage lang mit dem toten Huhn, an den Hals gebunden, herumlaufen zu lassen? Damit so ein Hund von da an hoffentlich nie mehr ein Huhn beißen wird?«
Der Ortspolizist nickte.
»Sie sind, wie ich schon früher gemerkt habe, ein Mann von wenig Worten«, sagte Jacob, »aber ich nehme an, daß Sie mich jetzt fragen wollen, ob unser Hund mit diesem Huhn …«
Wieder nickte der Ortspolizist. Dann zeigte er auf Simon.
»Sie finden, daß mein Söhnchen auch mit solch einem Huhn um den Hals herumlaufen soll?«
»Halbes Huhn«, sagte der Ortspolizist, »andere Hälfte für den Hund.« Er seufzte tief auf, sagte leise: »Das einzige, was hilft.«
»Nun, dann muß es eben sein.«
Der Ortspolizist wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er stand auf, lief nach draußen und kam mit einem Jutesack wieder. Daraus holte er zwei halbe Hühner, die schon mit einem geflochtenen Halsband versehen waren. Feierlich überreichte er Jacob die vorbereiteten Vogelhälften. Der nahm sie dem Ortspolizisten mit einer kleinen Verbeugung ab und sagte: »Voortink, ich danke dir, das geht in Ordnung.«
Der Ortspolizist tippte sich an die Mütze, nickte Neletta kurz zu und verschwand eilends.
Und das ist es nun, was Simon Minderhout, wenn er im Bett liegt und mit seinen Erinnerungen der Nachtruhe hinterherjagt, nach all den langen Jahren nicht mehr weiß: Ist er tatsächlich mit diesem Huhn um den Hals herumgelaufen? Er hat sogar seinen Vater kurz vor dessen Tod noch gefragt: »Habe ich damals wirklich dieses halbe Huhn mit mir herumgetragen?«
»Ich denke, ja.«
»Aber doch nicht mehr am selben Abend, daran kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Am nächsten Tag vielleicht?«
»Nein, nicht an demselben Abend, du warst erst vier, du gingst selbstverständlich nach dem Essen sofort ins Bett.«
»Also am nächsten Tag?«
»Ich glaube, ja.«
»Aber wie war das dann? Habe ich geweint?«
»Nicht, daß ich wüßte, du hast fast nie geweint, ich habe dich eigentlich nur ein einziges Mal in meinem Leben ganz furchtbar weinen sehen.«
»Als Prins starb.«
»Ja, als Prins starb.«
»Damals mit dem Huhn also nicht?«
»Nein, daran erinnere ich mich nicht mehr, ich weiß eigentlich auch nicht so richtig, wann und wie lange wir dieses Huhn … wenn deine Mutter noch da wäre, ja, die würde es wohl besser wissen, denke ich. Ich bin am nächsten Tag wieder früh am Morgen ins Rathaus gegangen. Ich kann mich nur noch gut daran erinnern, daß ich Prins das Huhn um den Hals gebunden habe. Das Hündchen war eigentlich viel zu klein für so ein halbes Huhn um den Hals, der Flügel schleifte am Boden, aber ich muß doch sagen: Geholfen hat es. Mit eurer Schreckensherrschaft auf der Allmende von Anloo war es aus und vorbei. Eigentlich hatte es schon viel zu lange gedauert, aber niemand hatte es gewagt, mir zu sagen, daß ihr die Hühner aufscheuchtet, denn du warst der Sohn des Gemeindesekretärs. Ach ja, damals gab es noch Ortspolizisten, die zugleich Gemeindeboten waren, obwohl sie kaum lesen und schreiben konnten, ja, jetzt leben wir in anderen Zeiten …«
Und dies ist es, was Simon sein Leben lang verwunderte: Warum ärgert es ihn so, daß er nicht mehr genau weiß, ob auch er dieses halbe Huhn als Halsband getragen hat? So wichtig konnte das doch gar nicht sein, oder galt das nicht bei einer solchen Urerinnerung? Warum blieb dieses Detail dunkel, während alles andere so hell war: das überwältigende Grün, in dem sich alles abgespielt hatte, das fast ockergelbe Sommerlicht und die Erinnerungen an ein sonnendurchflutetes Dörfchen, in dem die Hühner bis weit auf die Allmende hinaus frei herumliefen und wo an allen Wegrändern Rainfarn und Herbstlöwenzahn überschwenglich blühten. Er mußte annehmen, daß er auf dieselbe Weise wie Prins bestraft worden war, obwohl er sich auch nicht daran erinnern konnte, daß Prins mit diesem Halsschmuck herumgelaufen war. Es blieb das Bild des Hündchens mit seinem gekräuselten Schwänzchen und seinem einen keck in die Höhe stehenden, dem anderen sittsam herabhängenden Öhrchen, und dann noch das Gefühl, wenn etwas aus seinem ganzen Leben übrigbleiben dürfte, so fiele seine Wahl auf jene Spätsommertage, an denen er zusammen mit Prins die Anlooer Hühner gejagt hatte.
Glockenläuten
Am 1. April des Jahres 1919 brachte Jacob Minderhout es fertig, seinen Sohn, noch keine fünf Jahre alt, in Meester Veltmeijers kleine Schule hineinzumogeln. Es gab in Anloo kaum Jungen seines Alters, und so freundete Simon sich notgedrungen mit Coenraad Galema an, dem Sohn eines reichen Bauern. Zwar war dieser bereits gestorben, aber dessen Frau lebte noch und verwaltete nun die Ländereien und den Viehbestand. Coenraad Galema, einziges Kind und zukünftiger Erbe, hatte sich schon früh die Allüren eines Landjunkers mit den entsprechenden Privilegien zugelegt. So wurde seit Menschengedenken, wohl um Bauern und Knechte auf weit entfernten Feldern wissen zu lassen, daß die Kartoffeln dampfend auf dem Tisch stünden, mittags um zwölf Uhr von einem der Schulkinder die Glocke geläutet. Wer anders als Coenraad Galema kam dafür in Frage? Das gönnte er nicht einmal seinem Freund Simon. Meester Veltmeijer, zugleich Küster und Organist, Vorleser und Feueranzünder, wurde hier mehr Takt abverlangt, als ihm in die Wiege gelegt worden war. So läutete Coenraad viel häufiger die Glocke als jedes andere Schulkind, bis zu jenem denkwürdigen Tag, an dem morgens um acht Uhr, mit zwei Unterbrechungen von einer halben Minute, dreimal sechzig Sekunden lang die Glocke für ihn selbst geläutet wurde. Das war im Herbst des Jahres 1922.
Einen Tag zuvor waren Coenraad und Simon über die Allmende und den Brink gestreift, während sie einander den Arm um die Schultern gelegt hatten, dann wieder frei nebeneinanderher geschlendert waren. Sie waren, am Pastorat vorbei, ein ganzes Stück weit einen Sandweg entlanggelaufen, dann auf einem anderen wieder nach Anloo zurückgekehrt. Sie hatten die letzten Brombeeren gepflückt. Ein Mittwochnachmittag im Herbst, wie es viele in ihrem Leben gegeben hatte, ein Mittwochnachmittag, der wie die Zeit verrinnt und keinen besonderen Eindruck hinterläßt, vielmehr mit all den anderen freien Mittwochnachmittagen verschmilzt, an denen man als Schuljunge umherstreift. Später im Leben fließen sie alle zu einem einzigen archetypischen Nachmittag zusammen: die Erinnerung an eine schon schräg stehende, blasse Sonne und an ein Gespräch, das man vielleicht führte, das man aber niemals mehr wörtlich rekonstruieren konnte, es sei denn, etwas war geschehen, was sich unauslöschlich in das Gedächtnis eingegraben hat.
Etwas Derartiges ereignete sich am Ende dieses Nachmittags im Herbst des Jahres 1922. Coenraad und Simon waren auf der südlichen Allmende ein ganzes Stück ins Land gelaufen. Sie setzten sich auf ein Gatter, schauten hinüber zur Kirche von Anloo mit seinem Satteldachturm und der absurden, dünnen Spitze darauf und liefen nach einer Weile wieder weiter. Unterwegs schlugen sie einem Pferd auf den Widerrist, das sich die Klapse gutmütig gefallen ließ, und danach schlenderten sie in Richtung des Hofs. Gerade als sie auf dem Weg, der zum Grundstück führte, angelangt waren, sah Simon halb versteckt im Sand ein altmodisches Hufeisen liegen. Vielleicht lag das Ding dort schon seit Jahren und war von Regenwürmern, Pferdehufen oder Wagenrädern aufgewühlt worden. Als Simon es aufhob, hatte er nicht im geringsten das Gefühl, daß er etwas Besonderes aus dem Sand zog. Er hielt das verrostete Hufeisen auf Armeslänge von sich und wollte es schon wegwerfen, als Coenraad sagte: »Gib her.«
»Warum?«
»Das gehört uns.«
»Ich hab es gefunden.«
»Ja, aber auf unserm Weg.«
»Es gehört euch nicht, ich hab es gefunden.«
»Du mußt es mir geben.«
»Nein, ich hab es gefunden.«
»Gib her.«
»Nein.«
»Du bist ein Scheißkerl.«
Coenraad versuchte, das Hufeisen, das Simon mit der linken Hand festhielt, wegzureißen. Es glückte ihm nicht. Daraufhin versetzte er Simon einen Stoß mit der Schulter, versuchte nochmals, ihm das Eisen aus den Händen zu reißen. Durch die heftige Begierde seines Freundes erschien Simon das, was er gerade eben noch achtlos hatte wegwerfen wollen, immer wertvoller. Er dachte nicht daran, es herzugeben, er hielt es fest umklammert.
Ende der Leseprobe