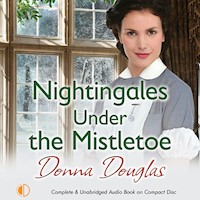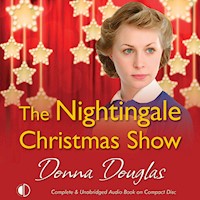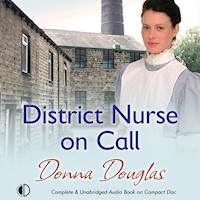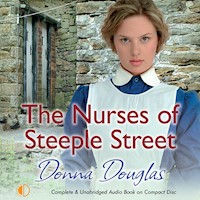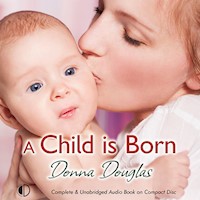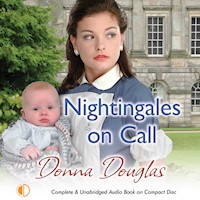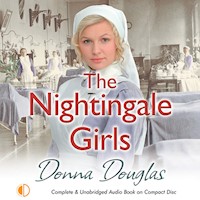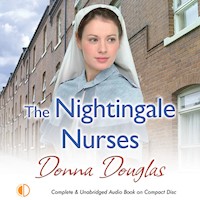9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nightingales-Reihe
- Sprache: Deutsch
London, 1935. Bei Dora, Millie und Helen geht der Alltag im berühmten Nightingale-Hospital weiter. Doch auch das zweite Ausbildungsjahr bringt neue Prüfungen, sowohl im Krankenhaus als auch im Privatleben: Während die sonst so forsche Dora unter furchtbarem Liebeskummer leidet, wird ihre Freundin Millie von gleich zwei attraktiven Männern umworben. Auch die neue Nachtschwester sorgt für Aufregung, denn Violet scheint nicht die Frau zu sein, für die sie sich ausgibt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 636
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Über das Buch
Titel
KAPITEL EINS
KAPITEL ZWEI
KAPITEL DREI
KAPITEL VIER
KAPITEL FÜNF
KAPITEL SECHS
KAPITEL SIEBEN
KAPITEL ACHT
KAPITEL NEUN
KAPITEL ZEHN
KAPITEL ELF
KAPITEL ZWÖLF
KAPITEL DREIZEHN
KAPITEL VIERZEHN
KAPITEL FÜNFZEHN
KAPITEL SECHZEHN
KAPITEL SIEBZEHN
KAPITEL ACHTZEHN
KAPITEL NEUNZEHN
KAPITEL ZWANZIG
KAPITEL EINUNDZWANZIG
KAPITEL ZWEIUNDZWANZIG
KAPITEL DREIUNDZWANZIG
KAPITEL VIERUNDZWANZIG
KAPITEL FÜNFUNDZWANZIG
KAPITEL SECHSUNDZWANZIG
KAPITEL SIEBENUNDZWANZIG
KAPITEL ACHTUNDZWANZIG
KAPITEL NEUNUNDZWANZIG
KAPITEL DREISSIG
KAPITEL EINUNDDREISSIG
KAPITEL ZWEIUNDDREISSIG
KAPITEL DREIUNDDREISSIG
KAPITEL VIERUNDDREISSIG
KAPITEL FÜNFUNDDREISSIG
KAPITEL SECHSUNDDREISSIG
KAPITEL SIEBENUNDDREISSIG
KAPITEL ACHTUNDDREISSIG
KAPITEL NEUNUNDDREISSIG
KAPITEL VIERZIG
KAPITEL EINUNDVIERZIG
KAPITEL ZWEIUNDVIERZIG
KAPITEL DREIUNDVIERZIG
KAPITEL VIERUNDVIERZIG
KAPITEL FÜNFUNDVIERZIG
KAPITEL SECHSUNDVIERZIG
KAPITEL SIEBENUNDVIERZIG
KAPITEL ACHTUNDVIERZIG
KAPITEL NEUNUNDVIERZIG
KAPITEL FÜNFZIG
Über die Autorin
Impressum
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Inhaltsbeginn
Impressum
Über das Buch
London, 1935. Bei Dora, Millie und Helen geht der Alltag im berühmten Nightingale-Hospital weiter. Doch auch das zweite Ausbildungsjahr bringt neue Prüfungen, sowohl im Krankenhaus als auch im Privatleben: Während die sonst so forsche Dora unter furchtbarem Liebeskummer leidet, wird ihre Freundin Millie von gleich zwei attraktiven Männern umworben. Auch die neue Nachtschwester sorgt für Aufregung, denn Violet scheint nicht die Frau zu sein, für die sie sich ausgibt …
Donna Douglas
DieNIGHTINGALE SCHWESTERN
Geheimnisse des Herzens
Roman
Aus dem Englischen von Ulrike Moreno
KAPITEL EINS
Es war ein bitterkalter Abend im Dezember 1935, als Violet Tanner im Nightingale Hospital in Bethnal Green eintraf.
Auf allen Stationen wurden in Öfen und Kaminen Feuer angezündet, da der beißend kalte Wind wie ein wildes Tier heulte und Schnee- und Graupelschauer gegen die Fenster warf. Die Babys auf der Kinderstation schrien vor Furcht, und sogar die Patienten auf der Orthopädischen für Männer, die sonst stets zu Scherzen aufgelegt waren und den starken Mann markierten, starrten ängstlich auf die dicht an den Fensterscheiben vorbeischwingenden Äste und waren sich einig, noch nie eine solche Nacht erlebt zu haben.
Die Schwestern, die draußen auf dem Weg zum Abendessen waren, zogen ihre dicken marineblauen Umhänge fest um sich und hielten so gut wie möglich ihre gestärkten Häubchen fest.
Schwester Wren sah Violet als Erste. Normalerweise erschien sie gerne früh zum Abendessen, doch diesmal war sie stehen geblieben, um eine Lernschwester zurechtzuweisen, die sie dabei erwischt hatte, wie sie die Abkürzung durch den für Schwestern reservierten Gang nahm.
Das Mädchen hatte sich damit rechtfertigen wollen, dass sie ihren Umhang vergessen hatte und deshalb nicht hinausgehen könne. Aber das ließ Schwester Wren nicht gelten.
»Und wessen Schuld ist das? Es gibt Ihnen nicht das Recht, die Gänge zu benutzen, die den Schwestern vorbehalten sind, oder?«, hatte sie das Mädchen angefahren.
»Nein, Schwester.« Die junge Lernschwester im zweiten Jahr namens Benedict zog mit ihrem hübschen Gesicht, dem blonden Haar und ihrer selbstbewussten, kessen Art Medizinstudenten an wie ein Glas Honig Wespen. Sie war also genau die Art von Mädchen, die Schwester Wren am verhasstesten waren.
»Allerdings nicht. Und nun gehen Sie den gleichen Weg wieder zurück und überqueren den Hof wie all die anderen jungen Schwestern.«
Benedict warf einen besorgten Blick auf den Schnee, der gegen das Fenster klatschte, dann richtete sie ihre großen blauen Augen flehentlich auf Schwester Wren. Wäre sie ein Mann gewesen, hätte sie sich vermutlich vor Hilfsbereitschaft überschlagen und Benedict angeboten, sie über den windgepeitschten Hof zu tragen.
»Ja, Schwester«, seufzte sie.
Schwester Wren sah ihr nach, als sie enttäuscht und mit gesenktem Kopf den Rückweg durch den Gang antrat. Der Gedanke, wie nass und schmuddelig das Mädchen vom Abendessen zurückkehren würde, entlockte Schwester Wren ein Lächeln. Mit etwas Glück würde Benedicts Stationsschwester äußerst aufgebracht darüber sein.
Als Schwester Wren sich umdrehte, sah sie die Frau am anderen Ende des Gangs stehen und eilte auf sie zu.
»Sie da!«, rief sie herrisch. »Was haben Sie hier zu suchen?«
»Ich suche das Büro der Schwester Oberin.« Ihre Stimme war leise, heiser und von einem leichten ländlichen Akzent geprägt. Schwester Wren musste näher herantreten, um sie zu verstehen.
»Und wer sind Sie?«
»Mein Name ist Violet Tanner. Ich bin die neue Nachtschwester.«
»Oh.« Schwester Wren musterte die Frau mit einem abschätzenden Blick. Sie war Anfang dreißig, sehr groß – was im Vergleich zu Schwester Wren, die klein und zierlich war, allerdings für die meisten Leute galt – und dunkelhaarig. Das Haar, das unter ihrem Hut hervorquoll, hatte den blauschwarzen Glanz eines Elsternflügels. Schwester Wren achtete immer eifersüchtig auf das Haar der anderen, weil ihr eigenes so dünn und dürftig war, ganz egal wie viele Dauerwellen sie sich machen ließ. Der Mantel der Frau sah teuer aus, obwohl er nicht der neuesten Mode entsprach. Schwester Wren las die Vogue und erkannte gute Qualität, wenn sie sie sah, auch wenn sie sich selbst diese Dinge nicht leisten konnte.
Kurz gesagt, die Frau war jemand, den kennenzulernen sich lohnen könnte.
»Sie sind in die falsche Richtung gegangen, fürchte ich. Ich werde Sie begleiten und Ihnen den Weg zeigen«, erbot sie sich.
»Das ist nicht nötig. Wenn Sie mir einfach sagen, wohin ich gehen muss …«
»Es macht mir keine Umstände. Ich muss selbst in diese Richtung.«
Eigentlich war sie in der entgegengesetzten Richtung unterwegs, aber sie würde sich auf keinen Fall die Chance entgehen lassen, als Erste alles über die neue Nachtschwester herauszufinden.
»Ich heiße Miriam Trott und bin Oberschwester auf der Gynäkologischen«, stellte sie sich vor, als sie sich auf den Weg machten. »Sie können mich Schwester Wren nennen, da das der Name meiner Station ist.«
Violet Tanner nickte, sagte aber weiter nichts dazu. Tatsächlich machte sie so gut wie gar keine Konversation, als Schwester Wren sie durch ein Gewirr von Gängen zum Büro der Schwester Oberin zurückführte.
»Das ist ein ganz schönes Labyrinth hier, nicht wahr?«, versuchte es Schwester Wren erneut. »Man kann sich sehr leicht verirren zwischen all diesen kunterbunt zusammengewürfelten Gebäuden. Aber Sie werden sich mit der Zeit daran gewöhnen.« Sie sah die neue Schwester von der Seite an. »War Ihr letztes Krankenhaus auch so groß wie dieses?«
»Ich habe einen Privatpatienten gepflegt.«
»Oh. Und wo war das?«
»In Suffolk.« Sie stieß das Wort hervor, als widerstrebte es ihr, ihren Lippen auch nur eine einzige Silbe entschlüpfen zu lassen.
»Wirklich? Ich habe Verwandte in Suffolk«, griff Schwester Wren die Neuigkeit begierig auf. »Wo waren Sie denn dort?«
»In einem kleinen Dorf. In einer sehr ländlichen Gegend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Name Ihnen etwas sagen würde.«
»Nun ja, vielleicht …« Schwester Wren sah Miss Tanners abweisende Miene und wagte nicht, auf ihrer Frage zu beharren.
Also versuchte sie es anders. »Ich nehme an, Sie werden im Schwesternheim einziehen, wenn Sie es nicht bereits getan haben? Miss Filcher – das war die letzte Nachtschwester – hatte das Zimmer gegenüber von meinem. Nicht, dass Sie jetzt denken, sie wäre in diesem Raum gestorben«, fügte sie rasch hinzu. »Sie ist während ihres Dienstes tot umgefallen. Können Sie sich das vorstellen? Vorher hat sie jedoch noch dafür gesorgt, dass alle Stationsschwestern ihren Bericht erhielten. Typisch Miss Filcher, immer so gewissenhaft.« Sie seufzte. »Auf jeden Fall ist ihr Zimmer sehr hübsch, weil es ein Eckzimmer mit zwei verschiedenen Aussichten ist. Auf der einen Seite sieht man auf die Gärten hinaus …«
»Ich werde nicht hier wohnen.«
Schwester Wren starrte sie an. »Warum denn nicht?«
»Ich habe andere Arrangements getroffen.«
»Aber alle Schwestern …«
»Ah, jetzt sehe ich schon, wo ich bin. Das Büro der Schwester Oberin ist am Ende dieses Gangs, nicht wahr?«, unterbrach Miss Tanner sie rundheraus. »Ich will Sie nicht länger aufhalten, Sie haben doch sicher viel zu tun.«
»Aber …«
»Vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe, Schwester Wren.«
»Warten Sie …«, rief Schwester Wren ihr nach, doch Miss Tanner hatte sich schon wieder auf den Weg gemacht.
Die Tatsache, dass Miss Tanner sich so irritierend ungenau geäußert hatte, hielt Schwester Wren nicht davon ab, den neuesten Klatsch im Speisesaal herumzuerzählen.
»Ich habe sie gesehen«, verkündete sie, als sie verspätet und atemlos am Schwesterntisch erschien. Die etwas abgelegene Ecke des Speisesaals war eine Oase der Ruhe und der Ordnung, und die lange Tafel dort wurde von Dienstmädchen betreut, die zwischen dem Tisch und der Küchendurchreiche hin und her eilten. Der Rest des großen Speisesaals war vom Geklapper der Teller, dem scharrenden Geräusch von Stühlen und dem Geplapper junger Frauenstimmen erfüllt.
»Da bist du ja, Miriam.« Schwester Blake blickte lächelnd auf. »Wir fingen schon an, uns Sorgen um dich zu machen. Wir dachten, du hättest vielleicht einen Notfall auf deiner Station.«
»Als ob sie deswegen ihr Abendessen versäumen würde«, murmelte Schwester Holmes. Schwester Wren warf ihr einen bösen Blick zu, als ein Dienstmädchen leise einen Teller vor sie hinstellte.
»Wenn ihr unbedingt wissen wollt, warum ich zu spät komme … Ich habe unsere neue Nachtschwester zum Büro der Oberin begleitet.« Schwester Wren blickte sich triumphierend in der Runde um. Es kam nicht oft vor, dass sie Aufmerksamkeit am Tisch erregen konnte. Normalerweise waren alle viel zu sehr damit beschäftigt, sich über Patienten auszutauschen oder sich eine von Schwester Blakes amüsanten Geschichten anzuhören.
Und nun wartete sie darauf, von den anderen mit neugierigen Fragen bombardiert zu werden. Aber mehr als ein beifälliges Nicken von der einen oder anderen Schwester erntete sie nicht, bevor diese ihr Gespräch wiederaufnahmen.
»Habt ihr nicht gehört, was ich gerade sagte? Ich bin der neuen Nachtschwester begegnet«, beharrte sie, um die anderen zu Fragen zu ermuntern.
»Und?«, entgegnete Schwester Hyde. »Hatte sie zwei Köpfe?«
Schwester Wren warf ihr einen gereizten Blick zu, sagte aber nichts. Nicht einmal die anderen Oberschwestern widersprachen der Schwester, die die Frauenstation für chronische Erkrankungen leitete. Schwester Hyde war Mitte sechzig, groß, hager und äußerst furchteinflößend. Auch Schwester Wren hatte nie ganz die Furcht vor ihr verloren, seit sie selbst Lernschwester im Nightingale gewesen war.
»Ich wage zu behaupten, dass wir anderen ihr noch früh genug begegnen werden«, bemerkte Schwester Holmes und nahm sich noch etwas Gemüse.
»Ihr könntet wirklich ein bisschen mehr Interesse zeigen, meine Damen«, tadelte Schwester Blake sie milde. »Schwester Wren will uns unbedingt ihren neuesten Klatsch erzählen, und keiner hört ihr zu.« Ihre dunklen Augen funkelten, als sie sich Schwester Wren zuwandte. »Du kannst es mir erzählen, Miriam. Ich bin schon sehr gespannt.«
»Es ist ja wohl kaum Klatsch«, erwiderte Schwester Wren mürrisch. Sie wusste nie, ob Schwester Blake sich über sie lustig machte oder nicht. Sie hatte immer ein Lächeln im Gesicht, als ob die ganze Welt ein Witz wäre, den nur Eingeweihte verstanden. »Ich hab sie bloß gerade gesehen, das ist alles.«
»Und wie ist sie?«
»Wenn ihr es unbedingt wissen wollt … ich fand, dass sie etwas Merkwürdiges an sich hatte.«
»Sie hatten recht, Schwester Hyde. Sie hat anscheinend wirklich zwei Köpfe!« Schwester Blake lachte.
»Wenn ihr mich fragt, haben alle Nachtschwestern etwas Komisches an sich«, warf Schwester Parry vom anderen Ende des Tischs aus ein. »Ich habe nie verstanden, was für eine Art von Krankenschwester auf eigenen Wunsch immer nur Nachtdienst macht und auf den Gängen herumschleicht, wenn alle anderen schlafen.«
»Nicht alle«, sagte Schwester Hyde. »Patienten neigen ja bekanntlich dazu, bei Nacht besonders unruhig zu sein, wenn sie sich noch einsamer und ängstlicher als während des Tages fühlen. Sie brauchen jemanden, der sie beruhigt.«
»Und die jungen Schwestern auch«, stimmte Schwester Holmes ihr zu. »Es ist eine große Verantwortung für eine Lernschwester, eine Station die ganze Nacht über zu leiten. Sie brauchen eine zuverlässige Person, an die sie sich bei einem Notfall wenden können.«
»Früher, in der Probezeit empfand ich mehr Furcht als Erleichterung dabei, die Nachtschwester zu sehen«, gestand Schwester Blake fröhlich. »Ich hatte immer Angst, sie könnte uns bei einer unserer mitternächtlichen Teepartys mit den Medizinstudenten in der Stationsküche erwischen.«
Die anderen Schwestern lachten, und sogar Schwester Hyde wirkte leicht belustigt, als sie »Na, na!« sagte und den Kopf schüttelte.
»Es ist nicht nur das«, beharrte Schwester Wren. »Sie hatte etwas Sonderbares, diese Miss Tanner. Etwas … Mysteriöses.«
»Ach du liebe Zeit! Haben Sie schon wieder Ihre grässlichen Detektivromane gelesen?«, fragte Schwester Holmes. »Das sollten Sie lassen, sie verursachen nur Albträume.«
Schwester Wren spürte die Hitze, die in ihre Wangen stieg, als die anderen Schwestern lachten. Aber dann dachte sie an Miss Tanners kurz angebundene, ja fast schon schroffe Art und ihre dunklen Augen, die ihren Blick nie richtig erwidert hatten.
»Lacht ihr ruhig«, sagte sie. »Aber ich sage euch, mit dieser Frau stimmt irgendetwas nicht.«
Kurz vor Mitternacht machte Violet Tanner erneut die Runde. Das schrille Heulen des heftigen Windes wirkte in der Dunkelheit des schlafenden Krankenhauses noch bedrohlicher, und die schwankenden Äste schlugen gegen die Fenster, als würden sie jeden Moment die Scheiben zerschlagen. Bei all dem Lärm draußen brauchte Violet ihre weich besohlten Schuhe kaum, um sich geräuschlos durch die verwinkelten Gänge zu bewegen.
Die Gebäudegruppe, die durch ein Gewirr von Gängen und Treppen verbunden war, in denen sie sich tagsüber noch so schlecht zurechtgefunden hatte, begann ihr nun allmählich vertrauter zu erscheinen, selbst in der Dunkelheit.
Sie bog um eine Ecke und fand sich in einem Büro-Flur wieder, der so lang war, dass sein Ende von undurchdringlicher Finsternis verschluckt wurde. Violet hielt ihre Taschenlampe höher, was Bewegung in die Schatten um sie herum brachte.
Als sie an der ersten Tür vorbeiging, hörte sie einen kurzen erschrockenen Aufschrei, der sie zusammenfahren ließ.
»Wer ist da?«, fragte eine Stimme, die kaum mehr als ein Quieken war. Im nächsten Moment tauchte das Gesicht einer Frau aus den Schatten auf, der die Augen fast aus dem Kopf traten vor lauter Schreck. Sie fuchtelte mit einem Besen herum, als wäre er eine Waffe.
Violet erkannte eine der Reinigungskräfte, die sie vor ein paar Stunden selbst mit hinaufgenommen hatte. Als Nachtschwester war es ihre erste Aufgabe gewesen, zum Pförtnerhäuschen hinunterzugehen und einige der Frauen auszusuchen, die sich jeden Abend dort versammelten und sich für eine Nacht lang Arbeit mit dem Reinigen der Büroräume erhofften. Bei dem schlechten Wetter waren jedoch nur ein paar der Verzweifelten gekommen. Violet war froh, dass sie keine von ihnen hatte abweisen müssen.
»Verzeihen Sie, Schwester, aber ich hatte Sie für ein Gespenst gehalten.« Die Frau ließ ihren Besen sinken und drückte eine Hand an ihr wild pochendes Herz. »Ich hab mich verlaufen und bin hier im Dunkeln herumgeirrt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin …« Ihre Stimme zitterte. »Und das Licht geht nicht mehr an. Wird wohl ein Stromausfall oder so was sein.«
Die Augen der Frau waren rund vor Furcht. »In einer so schrecklichen Nacht wie heute, und wo alles so dunkel ist – na ja, da stellt man sich eben alles Mögliche vor.«
»Machen Sie sich keine Sorgen. Sie sind hier sicher.«
Die Frau blickte sie bewundernd an. »Ich wette, Sie fürchten sich vor gar nichts, oder, Miss?«
Violet lächelte im Stillen. Wenn du wüsstest, dachte sie. »Hier, nehmen Sie die lieber«, sagte sie und reichte ihr die Taschenlampe.
»Sind Sie sicher, dass Sie sie nicht brauchen?«, rief die Hilfskraft ihr nach, als sie weiterging.
»Ganz sicher.« Die Dunkelheit hatte nichts Beängstigendes für Violet Tanner. Sie fühlte sich sogar sicherer im Dunkeln.
Das schlechte Wetter hatte viele der Patienten in Unruhe versetzt. Auf der Frauenstation für chronische Erkrankungen schienen die erschöpften jungen Lernschwestern den Tränen nahe zu sein, als sie umhereilten und verzweifelt versuchten, die alten Damen zu beruhigen, die jammerten, schluchzten und an den Schutzgittern ihrer Betten rüttelten. Auf der Kinderstation war es das Gleiche. Nur waren es hier die verängstigten, vom heulenden Wind geweckten Babys, die unaufhörlich schrien.
»Schwester Parry meint, wir sollen sie schreien lassen«, sagte die junge Schwesternschülerin schnell zu Violet, als sie zu dem nächsten Bettchen ging, in dem ein Kleinkind mit rot angelaufenem Gesicht aufrecht dastand und sich die Seele aus dem Leib brüllte.
»Schwester Parry ist nicht hier, oder? Ich dagegen schon.« Violet ging an dem jungen Mädchen vorbei, und das Kind, das die Gegenwart einer mitfühlenden Person wahrnahm, streckte seine pummeligen Ärmchen aus.
»Aber Schwester Parry sagt, sie würden zu sehr verwöhnt, wenn wir sie hochnehmen«, beharrte das Mädchen. »Sie sagt, wenn wir sie ignorieren, würden sie sich müde schreien und wieder einschlafen.«
»Wie heißen Sie?«
»Hollins, Schwester.«
»Nun, dann sagen Sie mir, Hollins, wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie durcheinander und verängstigt wären, und alle würden Sie ignorieren?«
Während das Mädchen noch verblüfft nach Worten rang, hob Violet den kleinen Jungen auf die Arme. Sie konnte die Schluchzer fühlen, die ihn erschütterten, als er sein Gesicht an ihren Nacken drückte, und roch den Babypuder an seiner warmen Haut.
»Pst, mein Kleiner. Du brauchst keine Angst zu haben. Es ist nur der dumme Wind, der so viel Lärm macht, das ist alles.« Sie wiegte ihn sanft in ihren Armen und flüsterte ihm beruhigende Worte zu. Seine weichen Löckchen kitzelten sie an der Wange.
Nach und nach ließen die Schluchzer nach, und sein Gewicht lastete schwerer an ihrer Schulter, was ihr verriet, dass er eingeschlafen war.
»Und sollte er wieder zu weinen beginnen, Hollins, will ich, dass Sie ihn beruhigen«, wies Violet die Lernschwester an, während sie den Kleinen behutsam in sein Bettchen zurücklegte. »Das Gleiche gilt für die anderen Babys. Und falls Schwester Parry etwas dagegen hat, kann sie es mir sagen«, fügte sie hinzu, als das Mädchen den Mund öffnete, um zu protestieren.
»Ja, Schwester.« Hollins nickte, wenn auch mit verkniffenem Gesicht.
Zwei Stunden später beendete Violet ihre Runden und kehrte in das kleine Büro der Nachtschwester zurück. Auf dem Weg dorthin ging sie schnell noch in die Küche, um sich eine Tasse Tee zu machen. Die Oberin gestand den Nachtschwestern den Luxus eines Dienstmädchens zu, das ihnen Tee bringen und sich um andere Annehmlichkeiten kümmern konnte, doch Violet wollte sie nicht damit belästigen. Je weniger Leute sie bemerkten, desto weniger Fragen würden ihr gestellt werden. Und Violet mochte keine Fragen.
Aber ihr gefiel das Nightingale. Ursprünglich war sie sich da nicht allzu sicher gewesen, doch nachdem der alte Mr. Mannion verstorben war, hatte sie nirgendwo anders hingekonnt. Und dann war die Annonce mit dem Stellenangebot für eine Nachtschwester im Nursing Mirror erschienen, und es war fast so gewesen, als wiese die Vorsehung ihr damit den Weg.
Außerdem war sie hier wahrscheinlich sicherer. Ein geschäftiges Krankenhaus im Londoner East End war der letzte Ort, an den irgendjemand denken würde, um sie zu suchen.
»Violet Tanner«, sagte sie laut und lauschte dem Klang ihrer eigenen Worte. Es war lange her, seit sie sich so genannt hatte, und sie hatte sich noch immer nicht ganz daran gewöhnt, obwohl sie sich im Allgemeinen ziemlich schnell an alle ihre Namen gewöhnte.
Sie rührte ihren Tee um. »Violet Tanner, Nachtschwester im Florence-Nightingale-Lehrkrankenhaus«, sagte sie erneut.
Ja, dachte sie. Das passt. Zunächst einmal.
KAPITEL ZWEI
Auf dem Abendbrottisch stand ein zusätzliches Gedeck für Alf Doyle.
»Tut mir leid, ich hab nicht nachgedacht. Alte Gewohnheiten sind schwer abzulegen, nicht?«, sagte Rose mit einem spröden Lächeln, als sie den Teller wieder abräumte.
Niemand am Tisch sagte etwas, aber Dora wusste, dass alle das Gleiche dachten: Ihre Mum mochte zwar wie immer ein tapferes Gesicht aufsetzen, aber sie täuschte niemanden damit.
Es war Neujahrsabend, und im Rose and Crown um die Ecke veranstalteten die Anwohner ihren üblichen Silvester-Tanz und nahmen lärmend Abschied vom Jahr 1935. Dora konnte das Gelächter und Singen die Griffin Street hinunterschallen hören, als sie und ihre Familie sich an den Abendbrottisch setzten.
In jedem anderen Jahr wären sie mittendrin gewesen im Silvestertrubel. Oma Winnie würde in ihrem besten Kleid, das Gesicht dick bepudert und dem Anlass entsprechend natürlich auch mit ihren falschen Zähnen im Mund, bei einer Flasche süßem Starkbier im Gesellschaftsraum sitzen und alles genauestens beobachten, um es später mit ihren Freundinnen beschwatzen zu können. Doras Mutter Rose, deren Gesicht von zu viel Portwein mit Zitrone gerötet wäre, würde all die beliebten alten Lieder mitsingen, die auf dem Klavier gespielt wurden.
Aber nicht in diesem Jahr. Die Atmosphäre in der Küche von Griffin Street Nummer Achtundzwanzig war düster, obwohl alle ihr Bestes taten, den Eindruck von Normalität zu erwecken.
Bis auf Doras jüngste Schwester Bea natürlich. Die Zwölfjährige machte sich nie die Mühe, ihre Gefühle vor irgendjemandem zu verbergen.
»Was ist das?« Sie schob den braunen Fleischklumpen auf ihrem Teller umher und rümpfte angewidert ihre sommersprossige Nase.
»Es ist Milz«, zischte Dora. Als ob Bea das nicht wüsste. Der Metzger verkaufte sie für drei Pence, und die Einheimischen nannten sie ›Arme-Leute-Braten‹.
»Aber sonst gibt es doch immer Huhn zu Silvester«, protestierte Bea.
»Wir hatten schon zu Weihnachten ein Huhn, Liebes. Es reicht nicht für ein weiteres.« Ihre Mutter gab einen Löffel Kartoffelbrei auf einen Teller. »Wir schwimmen nun mal leider nicht im Geld.«
»Als Dad noch hier war, bekamen wir immer Hühnchen«, sagte Bea verdrossen.
»Pst!«, zischten Dora, Oma Winnie und Josie wie im Chor.
»Ja, wir hatten viele Dinge, als euer Dad noch hier war«, entgegnete Rose schroff. »Aber jetzt ist er nicht mehr hier, und deshalb müssen wir einfach das Beste aus allem machen, nicht wahr?«
Sie lächelte, als sie es sagte, doch Dora sah, wie die Hände ihrer Mutter zitterten, als sie noch einen Teller weiterreichte.
Es war drei Monate her, seit Doras Stiefvater Alf Doyle verschwunden war. Er hatte eines Tages eine Tasche gepackt und sich ohne ein Wort davongemacht. Selbst seine Kollegen bei der Eisenbahn, wo er gearbeitet hatte, hatten ihn seither nicht mehr gesehen. Doras Mutter und Großmutter waren zur Polizei gegangen, doch die hatten sich keine Mühe gemacht, Alf Doyle zu finden. Für die Polizei war er bloß ein weiterer dieser Kerle, die ihre Familien im Stich gelassen hatten.
Dora bedauerte nicht, dass er verschwunden war. Fünf Jahre lang war sie von Alf missbraucht worden, hatte in der ständigen Furcht gelebt, dass er sich bei Nacht wieder in ihr Zimmer schleichen würde, und aus Scham geschwiegen. Erst nachdem sie herausgefunden hatte, dass er inzwischen auch ihre Schwester Josie belästigte, hatte sie endlich die Sprache wiedergefunden.
Genützt hatte es allerdings nicht viel. Als sie Alf zur Rede stellte, hatte er nur gelacht und sie dann verprügelt. Aber als sie schon sicher gewesen war, dass sie niemals gegen ihn ankommen würde, war er urplötzlich verschwunden.
Es war für sie alle ein Schock gewesen, aber ihre Mutter hatte es am schwersten getroffen. Rose Doyle war eine typische East-End-Frau, zäh und ohne Scheu vor harter Arbeit. Sie war die Art von Frau, die sich nie beklagte, sondern die Ärmel hochkrempelte und sich dem Leben stellte, was auch immer es ihr auferlegen mochte. Sie war damit klargekommen, als ihr Mann vor elf Jahren gestorben und sie allein mit fünf Kindern zurückgeblieben war. Und den Tod ihrer Tochter Maggie mit nur dreizehn Jahren hatte sie auch verkraftet. Aber das Verschwinden ihres zweiten Ehemannes hatte ihr den Mut genommen und das Herz gebrochen.
Niemand sprach während des Essens. Das einzige Geräusch war die knisternde Stimme Al Bowllys im Radio, der ›Blue Moon‹ sang und mit seiner klagenden Stimme die Atmosphäre noch düsterer erscheinen ließ.
Dora starrte unglücklich auf ihren Teller herab. Sie hatte um die seltene Erlaubnis gekämpft, für eine Nacht nicht ins Krankenhaus zurückkehren zu müssen, um den Silvesterabend mit ihrer Familie verbringen zu können. Sie wusste, dass ihre Mutter froh war, sie hier zu haben, und dennoch dachte Dora voller Schuldbewusstsein, dass es im Schwesternheim sogar unter den wachsamen Augen der Heimschwester viel lustiger gewesen wäre.
Oma Winnie versuchte, die Stimmung ein wenig aufzulockern. »Wie wär’s, wenn wir nach dem Tee zum Pub hinuntergehen, um uns ein bisschen aufzuheitern?«, schlug sie vor.
»Geht ihr nur, wenn ihr wollt«, sagte Rose achselzuckend. »Ich bleibe hier.«
»Aber ohne dich wäre es nicht dasselbe, Rosie. Komm schon, mal wieder auszugehen, würde dir nicht schaden. Ein paar Liedchen mit deinen alten Freunden zu singen, würde dir wahrscheinlich sogar richtig guttun, Liebes.«
»Und all die Nachbarn über mich reden hören? Nein, danke.«
»Niemand redet über dich, Liebes.«
»Ach komm, Mum! Du hast sie alle doch genauso tuscheln gehört wie ich.« Ärger flackerte in Roses dunklen Augen auf, als sie Winnie ansah. »Unsere Familie ist das Einzige, worüber sie im Moment reden. Weißt du was? Ich habe sogar gehört, wie Lettie Pike herumgetratscht hat, ich hätte Alf wegen der Versicherung um die Ecke gebracht. Als ob es bei uns Ochsenmilz zum Abendessen gäbe, wenn ich an Geld gekommen wäre!«
Sie lachte, aber Dora spürte den verborgenen Schmerz. Rose Doyle war eine stolze Frau, die sehr zurückhaltend war und gern für sich blieb. Zu wissen, dass ihre Familienangelegenheiten das Tagesgespräch von Bethnal Green waren, musste die reinste Tortur für sie sein.
»Außerdem«, sagte sie und legte ihre Gabel und ihr Messer weg, »kann ich eh nicht ausgehen. Ich habe noch einige Flickarbeiten zu erledigen.«
»Für einen Abend wirst du die doch wohl mal liegenlassen können?«
»Ich beschäftige mich eben gern. Außerdem brauchen wir das Geld, vergiss das nicht.«
»Wie kommt ihr finanziell überhaupt zurecht, Mum?«, fragte Dora.
»Ach, es geht schon. Seit einiger Zeit nehme ich neben den Flickarbeiten auch noch Wäsche zum Waschen an, das bringt noch etwas mehr ein. Und seit dein Bruder und Lily oben eingezogen sind, helfen sie uns mit der Miete. Wir haben nicht mehr so viel Platz wie vorher, aber dafür brauche ich auch nicht mehr so viel sauber zu halten«, fügte sie lächelnd hinzu.
»Wir müssen uns alle ein Schlafzimmer teilen«, murrte Bea. »Dort ist überhaupt kein Platz, und wir können Oma unten schnarchen hören.«
»Ich schnarche nicht!«, widersprach ihre Großmutter heftig. »Wie kann ich schnarchen, wenn mein Hexenschuss mich die ganze Nacht wachhält?«
Dora blickte über den Tisch zu ihrer Mutter hinüber. Sie lachte mit den anderen, doch Dora konnte ihr die seelische Belastung an den Augen ansehen. Die Doyles waren eine der wenigen Familien auf der Griffin Street gewesen, die ein ganzes Haus für sich allein gemietet hatten, und nun ein Zimmer untervermieten zu müssen, war ein schwerer Schlag für Roses Stolz. Ein Glück war, dass es nur Peter und seine Frau waren, die hier bei ihnen lebten. Sich das Haus mit einer anderen Familie teilen zu müssen, wie die Pikes und Rileys nebenan es taten, wäre weitaus schlimmer gewesen.
»Ich wünschte, du würdest mir erlauben, die Schule aufzugeben, damit ich dich unterstützen kann, Mum«, warf Josie ein. »Ich habe dir gesagt, dass ich Arbeit bei Gold Garments bekommen könnte …«
»Und ich habe dir gesagt, dass du nicht mal daran denken sollst«, entgegnete ihre Mutter. »Du bleibst in der Schule und machst deine Prüfungen, damit du Lehrerin werden kannst, und dabei bleibt es. Ich bin stolz auf meine beiden klugen Mädchen«, sagte sie und strahlte Dora an, »und ich werde dafür sorgen, dass euch nichts im Wege steht. Selbst wenn ich Tag und Nacht arbeiten muss«, fügte sie nachdrücklich hinzu.
Dora und Josie sahen sich an. »Streiten wir lieber nicht mit ihr«, sagte Dora lächelnd.
»Außerdem«, fuhr Rose fort, »wird Alf bestimmt bald von seiner Reise zurückkehren, und dann wird alles wieder gut.«
Ein drückendes Schweigen legte sich über den Raum. »Herrgott nochmal, Mädchen, glaubst du wirklich, er käme je wieder zurück?«, sagte Oma Winnie, als ihr schließlich die Geduld riss. »Nach all dieser Zeit ohne ein Sterbenswörtchen könnte er schon halb in China …«
»Er wird zurückkommen«, unterbrach Rose sie entschieden. »Mein Alf würde seine Familie nicht im Stich lassen.«
»Das hat er schon getan, Liebes. Gott weiß warum, aber er ist weg. Du bist nicht die erste Frau, deren Kerl abgehauen ist, und wirst auch nicht die letzte sein. Ein Mann wie der ist sowieso nicht mal das Schwarze unter den Fingernägeln wert, nach dem, was er dir angetan …«
»Sprich nicht so über ihn!«, fauchte Rose. »Er ist ein guter Mann. Wir wissen nicht, was ihn daran hindert zurückzukommen. Er könnte einen Unfall gehabt haben … oder vielleicht sogar tot in der Themse liegen!«
»Ich bete zu Gott, dass es so ist«, murmelte Oma Winnie mit grimmiger Miene. »Denn wenn er nach all dem Ärger, den er uns gemacht hat, noch mal hier vor dieser Tür auftaucht, schmeiße ich ihn selbst hinaus!«
Bea, der kein Drama entging, begann zu schluchzen. »Mum, ist das wahr? Ist Dad tot? Ist er ermordet worden?«
»Und du hältst jetzt gefälligst mal den Mund!«, fuhr Oma Winnie sie an. »Wer packt schon seine Taschen, bevor er irgendwo ermordet wird? Verflixt noch mal, man kann in dieser Familie wirklich sehen, wer was im Kopf hat und wer nicht«, murmelte sie.
»Er hat nicht alles gepackt«, gab Rose zu bedenken. »Er hat nur ein paar Sachen mitgenommen, was bedeutet, dass er vorhatte, zurückzukommen.« Mit einem unsicheren Lächeln blickte sie sich in der Runde um. »Außerdem bin ich mir sicher, dass er seine Gründe hatte, fortzugehen. Aber er wird bald wieder nach Hause kommen, und dann wird hier alles wieder in bester Ordnung sein.«
»Und Moby Dick wird die Themse hinaufschwimmen!«, murmelte Oma Winnie.
»Glaubst du, dass er zurückkommt?«, fragte Josie Dora etwas später, als sie in der kleinen Spülküche das Geschirr abwuschen.
»Ich hoffe nicht.« Dora stellte die Teller in den angeschlagenen Spülstein.
»Manchmal wünschte ich, er täte es.«
Dora wandte sich überrascht ihrer Schwester zu. »Nach allem, was er uns angetan hat?«
»Ich möchte Mum bloß wieder glücklich sehen.« Josies braune Augen blickten ernst. Anders als Dora, Bea und ihr älterer Bruder Peter, die alle rothaarig, sommersprossig und kräftig gebaut waren wie ihr verstorbener Vater Jack, hatte die Fünfzehnjährige die schlanke, dunkelhaarige Schönheit ihrer Mutter geerbt. »Ich hasse ihn, Dora, das weißt du. Aber ich hasse es auch, Mum jede Nacht weinen zu hören, wenn sie glaubt, wir schliefen alle. Und wusstest du, dass sie ihn sucht? Oft ist sie stundenlang auf den Straßen unterwegs, und das auch mitten in der Nacht. Oder sie geht zum Eisenbahndepot und stellt sich an die Tore, als erwartete sie, dass er zu seiner Schicht erscheint, als wäre nichts geschehen. Es bricht mir das Herz.« Sie biss sich auf die Lippe. »Und sie macht sich Sorgen, wie es mit uns weitergehen soll. Ich weiß, dass sie sagt, wir kämen zurecht, doch jedes Mal, wenn der Mann anklopft, der die Miete abholt, kann ich ihr am Gesicht ansehen, wie besorgt sie ist. Und sie arbeitet sich kaputt, um alle Rechnungen bezahlen zu können.«
»Ich werde mit ihr reden«, sagte Dora.
»Das wird nichts nützen. Sie wird bloß lächeln und dir wie immer sagen, sie käme klar. Du weißt doch, wie sie ist.«
Der Rest des Abends zog sich hin. Während draußen auf der Straße gelacht und gesungen wurde, und die Betrunkeneren fluchend stolperten und hinfielen, tat Dora ihr Bestes, um ihre Familie mit Brettspielen aufzumuntern und die Lieder im Radio mitzusingen.
Rose saß derweil mit gesenktem Kopf am Feuer und erledigte ihre Flickarbeiten im schwachen Licht der Gaslampe. Dora dachte, dass kein Chirurg je solch feine Stiche hinbekommen würde wie ihre Mutter. Rose konnte eine abgetragene Manschette umdrehen oder ein Loch in einem Kleid flicken, als wäre es nie da gewesen.
Sie ging zu ihr hinüber. »Ich habe etwas für dich, Mum«, sagte sie und zog zwei Pfundnoten aus der Tasche, die sie ihrer Mutter in die Hand drückte. »Es ist nicht viel, aber es müsste zumindest reichen, um etwas Kohle zu kaufen oder den Vermieter zufriedenzustellen.«
»Aber das ist ein Monatsgehalt für dich. Ich kann dir nicht dein ganzes Geld wegnehmen, Liebes.« Rose versuchte, es ihr zurückzugeben.
»Da ich mein erstes Lehrjahr hinter mir habe, werde ich jetzt ein bisschen mehr verdienen«, sagte Dora und hörte selbst, wie erzwungen die Fröhlichkeit in ihrer Stimme klang. »Und wofür sollte ich es schon ausgeben? Schließlich habe ich freie Kost und Logis im Schwesternheim.«
»Na ja, wenn du sicher bist …?« Rose blickte auf die Geldscheine in ihrer Hand herab. »Ich kann nicht so tun, als käme es mir nicht gelegen.« Sie ließ ihre Näharbeit sinken und blickte lächelnd zu Dora auf. »Was würde ich ohne eine Tochter wie dich nur machen?«
»Ich wünschte, ich könnte mehr tun.« Dora seufzte. »Doch Lernschwestern verdienen leider nicht sehr viel.«
»Ja, aber eines Tages wirst du Oberschwester sein, nicht wahr?«
»Nicht so schnell, Mum! Zuerst habe ich noch zwei weitere Ausbildungsjahre durchzustehen. Und wenn ich dann die Prüfungen schaffe, werde ich zunächst einmal als ganz normale Krankenschwester arbeiten, und dann …«
»Du wirst es schaffen, Liebes. Du hast es ja auch bis hierher geschafft, nicht wahr?«
»Ja.« Und trotzdem gab es noch immer einige, die der Meinung waren, dass die kleine Dora Doyle, das Arbeiterkind aus dem ärmeren Teil von Bethnal Green, in einer Krankenschwestern-Ausbildung zwischen all den achtbareren Schülerinnen aus der Mittelklasse nichts zu suchen hatte. Im Laufe des vergangenen Jahres hatte sie den meisten von ihnen das Gegenteil bewiesen, aber es war ein andauernder Kampf.
»Ich bin stolz auf dich, Liebes. Sehr sogar. Komm, nimm deine Mum mal in den Arm.« Als Rose die Arme ausstreckte, um ihre Tochter zu umarmen, konnte Dora die hervorstehenden Knochen ihrer Mutter unter deren Kleidern spüren. Aß sie überhaupt vernünftig? Vor Jahren, bevor Alf in ihrem Leben erschienen war, hatte ihre Mutter die Mahlzeiten oft ganz ausgelassen, damit ihre Kinder genug zu essen hatten.
Als die alte Uhr auf dem Kaminsims in der Küche halb zwölf schlug, legte Dora sich ihren Mantel um und ging in den Hinterhof hinaus, um sich das Geläut der Glocken von St. Paul’s anzuhören, die hoch über den Dächern von East London das neue Jahr einläuteten.
Als sie die Hintertür öffnete, fiel ein Lichtstrahl aus der Küche auf ein junges Paar, das in einer leidenschaftlichen Umarmung neben dem Zaun des Nachbarhauses stand. Verlegen versuchte Dora, sich schnell zurückzuziehen, aber es war bereits zu spät.
»Alles klar, Dor? Frohes neues Jahr!«, begrüßte ihre beste Freundin Ruby Pike sie fröhlich, während sie rasch die Knöpfe ihrer Bluse schloss. Blonde Locken hatten sich aus ihrer kunstvoll toupierten Hochfrisur gelöst.
»Frohes neues Jahr.« Dora konnte sich kaum dazu überwinden, Rubys Freund Nick Riley anzusehen. Denn wäre sie im vergangenen Jahr nicht zu ängstlich gewesen, sich von ihm küssen zu lassen, hätte sie jetzt das Mädchen in seinen Armen sein können. »Ich dachte, ihr würdet unten im Pub Silvester feiern?«
»Meine Leute sind alle dort. Und Nicks Mum natürlich auch.« Ruby verdrehte vielsagend die Augen. Jeder wusste, wie selten es vorkam, dass June Riley einmal nicht in irgendeiner Bar in Bethnal Green herumhing. »Wir hatten eigentlich vor, nach St. Paul’s raufzugehen, aber Nick will Danny nicht alleinlassen.«
Dora sah Nick an, der noch immer versuchte, Rubys verschmierten Lippenstift von seiner Wange zu reiben.
»Er ängstigt sich, wenn er allein ist«, murmelte er.
»Er ist sechzehn, Nick«, seufzte Ruby. »Genauso alt wie meine Brüder.«
»Aber er ist nun mal nicht wie deine Brüder, stimmt’s?«
Ruby verzog verärgert das Gesicht, aber Dora konnte verstehen, warum Nick sich sträubte. Er war seinem jüngeren Bruder gegenüber äußerst fürsorglich. Vor einigen Jahren hatte Danny einen schrecklichen Unfall gehabt, der einen bleibenden Hirnschaden bei ihm hinterlassen hatte. Es hieß, er sei von ihrem brutalen Vater verprügelt worden, der nach seiner Tat angeblich solche Angst bekommen hatte, dass er die Flucht ergriffen hatte. Doch wie im Leben so vieler Menschen auf der Griffin Street erfuhr niemand je die ganze Geschichte.
»Ich kümmere mich um ihn, wenn du möchtest«, erbot sich Dora. »Wir unternehmen sowieso nicht viel, da kann er auch hereinkommen und sich zu uns setzen.«
»Das können wir nicht …« Nick wollte ihr Angebot schon ablehnen, als Ruby sich begeistert einmischte.
»Würdest du das tun? Das wäre fabelhaft, Nick, nicht wahr?« Sie hakte sich bei ihm unter und blickte bittend zu ihm auf.
»Bist du sicher?« Zum ersten Mal sah Nick Dora richtig an. Und selbst in dem schwachen Licht, das aus der Küche fiel, drohte sein Anblick, ihr den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Er überragte sie um Längen mit seiner großen, breitschultrigen Gestalt, und sein etwas zerzaustes dunkles Haar fiel ihm wie immer in die Augen.
Wann hatte sie eigentlich gemerkt, dass sie in ihn verliebt war? Dora wusste es nicht mehr genau, doch wann immer es auch gewesen war, jetzt war es zu spät. Jetzt gehörte er Ruby, die ihn nicht mehr aufgeben würde.
Woran er auch gar kein Interesse hatte, da war sich Dora sicher. Ruby war alles, was sie nicht war – blond, vollbusig und glamourös wie ein Hollywood-Filmstar. Genau die Art von Mädchen, die jemand wie Nick Riley an seinem Arm würde haben wollen.
Wahrscheinlich brach ihm jedes Mal der kalte Schweiß aus, wenn er sich daran erinnerte, wie kurz davor er gewesen war, sich mit einem unscheinbaren Mädchen mit krausem rotem Haar zufriedenzugeben.
»Bei uns ist er gut aufgehoben«, sagte sie. »Und scheinbar haben wir sowieso keine andere Wahl«, fügte sie ein wenig spöttisch hinzu, als Ruby ins Haus lief, um Danny zu rufen, bevor irgendjemand es sich anders überlegte.
»Du könntest auch mitkommen«, bot Nick an.
Dora lächelte, als sie sich Rubys Gesicht vorstellte, falls sie wirklich mitginge. »Drei sind einer zu viel, wie es so schön heißt.«
Bevor Nick antworten konnte, kam Ruby wieder aus dem Haus und scheuchte Danny vor sich her. Schüchtern, wie er war, schlurfte er mit gesenktem Kopf und hochgezogenen Schultern zu ihnen herüber. Doch seine besorgte Miene hellte sich augenblicklich auf, als er Dora entdeckte.
»Siehst du? Ich hab’s dir ja gesagt!«, rief Ruby. »Du hättest sein Gesicht sehen sollen, als ich ihm sagte, dass du hier bist. Wenn du mich fragst, hat unser Danny eine Schwäche für dich, Dor. Ist es nicht so, Danny-Boy?«
Sie schlang ihren Arm um seine knochigen Schultern, drückte ihn nicht allzu sanft an sich und fuhr ihm mit der Hand durchs Haar, worauf er zusammenzuckte und sich loszureißen versuchte.
»Lass ihn in Ruhe. Du weißt doch, dass er nicht angefasst werden will«, sagte Nick gereizt.
»Ganz im Gegensatz zu seinem Bruder, richtig?« Ruby zwinkerte ihm zu.
Nick beachtete sie nicht, als er Danny durch die schmale Öffnung im Zaun half, wo die Latten zerbrochen und von dichtem Unkraut überwuchert waren. Es war eine Stelle, die Dora und Ruby seit Jahren regelmäßig benutzten, um von einem Haus zum anderen zu gelangen.
»Alles in Ordnung, Danny?«, begrüßte Dora ihn lächelnd. Der Junge nickte scheu und zog den Kopf ein. Es war jedes Mal das Gleiche, wenn sie sich begegneten. Als ob sie sein Vertrauen erst wieder ganz von Neuem gewinnen müsste.
»Aber bist du sicher, dass du klarkommen wirst?«, fragte Nick seinen Bruder.
»Natürlich wird er das. Hör auf zu jammern wie eine alte Frau, sonst verpassen wir den ganzen Trubel noch.« Ruby nahm Nicks Arm und zog ihn mit sich fort.
Dora sah sie Hand in Hand die Gasse hinuntereilen und hörte Rubys aufgeregtes Lachen noch durch die kalte Nacht schallen, nachdem sie längst verschwunden waren. Dann wandte sie sich Danny zu.
»Alles klar, Danny? Sollen wir hineingehen und uns am Feuer aufwärmen?«
»Ich guck mir gern die Sterne an.« Danny stand fröstelnd neben ihr und blickte zu dem tintenschwarzen Himmel über ihnen auf. »D-deine Josie hat mir ihre Namen gesagt.« Er zeigte mit einem langen Finger in die Höhe. »Dieser eine dort … d-das ist der Große Wagen.«
»Ist das wahr?« Dora betrachtete das Sternbild skeptisch. »Für mich sieht er eher wie eine alte Pfanne aus.«
»Und der da heißt Orion«, fuhr er fort. »Er soll einen Mann m-mit einem Schwert darstellen.«
Dora hörte geduldig zu, als er ihr noch weitere Sternbilder zeigte. Sie hatte Danny oft auf dem Eingang zum Kohlenkeller hocken und ins Leere starren sehen. Jetzt wusste sie, was er betrachtet hatte.
»Du hast all ihre Namen behalten, Danny. Gut gemacht!«, sagte sie, und er schenkte ihr ein schiefes Lächeln und war sichtlich stolz auf sich.
»G-glaubst du, sie haben solche Sterne auch in A-Amerika?«
»Das nehme ich doch an, Dan. Wirst du auch dort die Sterne beobachten, wenn du erst mal da bist?«
Danny nickte. »Nick sagt, er kauft mir ein T-Tel-tel …« Sein Gesicht verzog sich, als er mit dem Wort kämpfte.
»Ein Teleskop, meinst du? Du Glückspilz. Das wird aber ganz schön was kosten, möchte ich wetten.«
»Nick s-sagt, dass er das G-Geld dafür haben wird, wenn er W-Weltmeister ist.«
»Das wird er, ganz bestimmt.« Sie fragte sich, ob Nick Ruby von seinem geheimen Plan erzählt haben mochte, mit Danny nach Amerika zu gehen, sobald er genug Geld von seinen Boxwettkämpfen zurückgelegt hatte. Wie Dora träumte er davon, sich ein besseres Leben aufzubauen. Sie war sicher, dass ihre Freundin Ruby einiges dazu zu sagen haben würde, falls sie es herausfand.
Aber vielleicht wäre Ruby ja sogar einverstanden? Irgendwie konnte Dora sich sehr gut vorstellen, dass sie sich wie zu Hause fühlen würde, wenn die Chance bestand, mit all ihren liebsten Hollywoodstars wie Claudette Colbert und Myrna Loy zusammenzukommen.
Dora blickte seufzend zum Himmel auf. Und sie würde dann wahrscheinlich immer noch hier auf der Griffin Street sein und versuchen, ihre Familie vor dem Zerbrechen zu bewahren.
Plötzlich erklangen die Glocken von St. Paul’s und zerrissen die stille Nachtluft. Ein Gebrüll erhob sich von den Gästen des Rose and Crown, als sie auf die Straße hinausströmten und sich zur Begrüßung des Jahres 1936 alle gegenseitig mit einer lauten und trunkenen Interpretation von ›Auld Lang Syne‹ zu überbieten versuchten.
»Frohes n-neues Jahr, Dora«, sagte Danny.
Dora wandte sich ihm lächelnd zu. »Das wird es hoffentlich, mein Lieber«, sagte sie.
KAPITEL DREI
Eine Stunde nach Dienstbeginn am ersten Tag des neuen Jahres wurde Lady Amelia Charlotte Benedict – oder Millie, wie sie sich lieber nannte – von einer so jähen Übelkeit erfasst, dass sie sich im Waschraum heftig übergab.
Oh Gott. Sie starrte auf das große Abflussloch in der Mitte des steinernen Beckens und umklammerte haltsuchend die kalte Kante. Die eisige Januarluft, die durch das Lüftungsgitter eindrang, trug nichts dazu bei, den Schweiß auf ihrer Haut zu trocknen.
Sie hätte nicht einfach so davonlaufen sollen. Ja, der Gestank war überwältigend gewesen, und der Anblick, der sich ihr geboten hatte, als sie die Bettdecke zurückschlug, mehr als widerlich, aber eine richtige Krankenschwester hätte sich niemals so verhalten, wie sie es getan hatte.
Die Erinnerung an Schwester Hydes verblüffte Miene, als sie, eine Hand vor den Mund gepresst, auf dem Korridor an ihr vorbeigerannt war, genügte, um ein weiteres heftiges Erbrechen zu erzeugen.
Als sie die Waschraumtür hinter sich aufgehen hörte, stöhnte sie erschrocken auf und wappnete sich innerlich schon gegen Schwester Hydes erboste Stimme. Die Oberschwester brauchte kaum noch einen Anlass, um Millie an ihre Unzulänglichkeiten zu erinnern. Sie konnte ihr eine halbstündige Standpauke halten, wenn sie die Station in der falschen Richtung ausfegte, und nur der Himmel wusste, was sie davon halten würde, dass sie eine Patientin einfach sich selbst überließ, um davonzulaufen und sich zu übergeben.
Zum Glück war es jedoch nur Millies Zimmerkameradin Helen Tremayne. Sie waren beide der Chronischen für Frauen zugewiesen worden, obwohl Helen ein Jahr weiter war als Millie und ihr auch in jeder anderen Hinsicht überlegen war.
»Die Oberschwester hat mich geschickt, um herauszufinden, wohin du verschwunden bist.«
»Ist sie sehr verärgert?«, flüsterte Millie.
»Sie hat jedenfalls nicht gelächelt, als ich ging.« Millie stand noch immer über das Waschbecken gebeugt, als sie sah, wie Helens robuste schwarze Schuhe, die wie immer spiegelblank poliert waren, neben ihren eigenen erschienen. »Du hättest Mrs. Church nicht einfach so liegenlassen dürfen. Kein Wunder, dass die Oberschwester die Geduld mit dir verliert.«
»Ich konnte gar nicht anders!« Millie blickte zu ihrer Freundin auf und verzog das Gesicht, als das grelle Licht der Deckenleuchten ihr in die tränenden Augen stach. »Du hast nicht gesehen, wie sie aussah. Es war fürchterlich!«
»Das ist typisch Messy Bessie.«
Bessie Church oder ›Messy Bessie‹, wie die Schwestern sie ihrer Unsauberkeit wegen nannten, war ein sehr trauriger Fall, da die ältere Frau schon vor Jahren ihren Verstand verloren hatte. Im Allgemeinen war sie eine friedfertige alte Seele, doch trotz endloser Bitten – und einigen strengen Worten der Oberschwester – konnte oder wollte sie noch immer keine Bettpfanne benutzen. Bessie zog es vor, der Natur ihren Lauf zu lassen und den Schwestern die Beseitigung ihrer Hinterlassenschaft zu überlassen.
Sehr zu Millies Missfallen war ihr heute Morgen diese unangenehme Aufgabe zugefallen, und da sie sich schon bei Dienstantritt nicht wohlgefühlt hatte, war das Säubern einer inkontinenten Patientin heute wirklich das Letzte, was sie brauchen konnte.
Der bloße Gedanke daran drehte ihr schon wieder den Magen um. Sie spürte, dass ihr die Haube vom Kopf rutschte, als sie sich schnell über das Becken beugte, und schaffte es gerade noch, sie aufzufangen, bevor sie in dem extragroßen Abfluss landete.
»Du weißt, dass das allein deine Schuld ist«, schallten Helens Worte ihr schmerzlich in den Ohren. »Du wärst nicht in diesem Zustand, wenn du nicht die ganze Nacht lang unterwegs gewesen wärst.«
»Pst! Sonst wird die Oberschwester dich noch hören. Außerdem war ich nicht die ganze Nacht lang unterwegs.«
»Wann bist du denn nach Hause gekommen?«
»Ich weiß nicht … so gegen zwei?«
»Wohl eher gegen vier.«
»Wirklich? Ach, du meine Güte.« Millie beugte sich vor und stützte den Kopf auf den Rand des Beckens, um ihre heiße Stirn an dem kalten Stein zu kühlen. »Dann muss ich wohl die Zeit vergessen haben, fürchte ich.«
Dummerweise hatte sie so einiges vergessen. Unter anderem wohl auch die Anzahl Martinis, die sie getrunken hatte.
»Es wundert mich, dass du dir nicht den Hals gebrochen hast, als du durch unser Fenster eingestiegen bist. Du solltest in diesem Zustand keine Regenrinnen hinaufklettern, das ist viel zu gefährlich.«
»Ach was. Das habe ich schon oft genug gemacht.«
»Den Hals braucht man sich nur einmal zu brechen.«
Millie war froh, dass ihr Magen sich endlich zu beruhigen schien, und ließ sich zu Boden sinken, lehnte sich an die gekachelte Wand und begann, ihre Haube wieder festzustecken.
»Es war Silvester, Tremayne. Erzähl mir nicht, du wärst nicht auch versucht gewesen, dich hinauszuschleichen und mit deinem Charlie zu feiern?«
»Ganz und gar nicht.« Helen errötete bei der Erwähnung ihres Freundes. Es erstaunte Millie immer wieder, dass die ach so perfekte Schwester Tremayne tatsächlich einmal lange genug von ihrem Podest herabgestiegen war, um sich zu verlieben.
Und dann auch noch in einen so wunderbar unpassenden Mann. Charlie war ein echter Schatz, aber er war Tischlerlehrling, und sein Vater betrieb einen Obst- und Gemüsestand. Helens Mutter war außer sich gewesen vor Empörung.
»Ich habe über meinen Büchern gesessen, bis das Licht ausgeschaltet wurde, und bin dann sofort eingeschlafen«, setzte Helen steif hinzu.
»Am Silvesterabend?«
»Ich muss dieses Jahr die Staatliche Abschlussprüfung machen. Wenn ich sie bestehen will, muss ich lernen.«
»Aber bis dahin sind es doch noch Monate!«
»Und wahrscheinlich denkst du, ich sollte alles bis zur letzten Minute aufschieben, so wie du es tust?«
Millie grinste sie mit einem Mund voller Haarklemmen an. Helen hatte sich sehr verändert, seit sie sich zum ersten Mal begegnet waren, doch manchmal konnte sie immer noch furchtbar selbstgefällig und pedantisch sein.
Als spürte sie, was ihre Freundin dachte, lächelte Helen widerstrebend. »Und was hast du gestern Nacht gemacht?«, fragte sie. »Ich hoffe nur, es war den Kater von heute Morgen wert?«
»Oh ja, das war es.« Millie lächelte bei der Erinnerung. Sie und ihr Verlobter Seb waren mit ihren Freunden ins Hotel Savoy gegangen. Zuerst hatten sie in Harrys Bar Martinis getrunken und später im Ballsaal unter einer gewaltigen Sanduhr, die über ihren Köpfen hing, getanzt. Als die letzten Sandkörnchen durchrieselten, hatten Trompeter aus der Leibgarde eine mitreißende Fanfare geschmettert. Danach hatte es noch mehr Cocktails und Tanz gegeben, und die Stunden waren wie im Flug verstrichen. Und ohne sich genau erinnern zu können, wie sie dorthin gekommen war, hatte sie schließlich mit Seb in einem Taxi gesessen und ihn draußen vor den Krankenhaustoren zum Abschied leidenschaftlich geküsst.
Sie erschauderte bei der Erinnerung. Wieso Hopkins, der Chefportier, sie nicht gesehen hatte, war ihr ein Rätsel. Es war pures Glück, dass sie sich heute Morgen nicht schon wieder vor der Schwester Oberin hatte rechtfertigen müssen.
»Wir hatten so viel Spaß«, erzählte sie Helen. »Und wir haben einen ganz wundervollen neuen Cocktail getrunken. Er nennt sich ›Silent Third‹, und ich glaube, er besteht aus Zitronensaft, Cointreau und Scotch. Hast du den schon mal probiert? Oh, das solltest du unbedingt, er ist einfach großartig. Der Prince of Wales trinkt nichts anderes mehr, wie ich hörte …«
»Der Prince of Wales muss auch nicht um sieben Uhr morgens bereit stehen, um Betten zu machen und Patienten zu versorgen, oder?«
Millie rappelte sich hastig auf. Schwester Hyde stand in der Tür. Sie war eine große, schlanke Person und eine stattliche Erscheinung in ihrer strengen grauen Uniform. Ihr Haar trug sie unter ihrer gestärkten Haube glatt zurückgekämmt. Die kecke Schleife unter dem Kinn stand in krassem Gegensatz zu ihrem hageren, von starren Linien geprägten Gesicht, das Selbstbeherrschung und Disziplin ausstrahlte.
»Wenn Sie Ihren Aufgaben nur halb so viel Zeit widmen würden wie Ihrem Gesellschaftsleben, wären Sie vielleicht keine solche Belastung, Benedict«, sagte sie. »Darf ich Sie daran erinnern, dass Mrs. Church noch immer auf Ihre Hilfe wartet?«
»Ja, Schwester. Entschuldigen Sie, Schwester.«
»Nicht ich bin es, bei der Sie sich entschuldigen sollten, Benedict, sondern die arme Mrs. Church.«
»Sie hat wahrscheinlich nichts davon bemerkt.« Millie war sich nicht einmal bewusst, dass sie die Worte ausgesprochen hatte, bis sie Schwester Hydes empörte Miene sah.
»Ein Grund mehr, warum sie darauf angewiesen ist, dass wir uns um sie kümmern!«, fuhr sie Millie an, und ihre grauen Augen wurden hart und kalt wie Stein.
»Ja, Schwester.« Millie senkte demütig den Blick auf ihre Schuhe und wünschte, der Boden möge sich unter ihr auftun und sie verschlingen.
»Also stehen Sie nicht herum, Mädchen, sondern beeilen Sie sich!«
Millie spürte Schwester Hydes missbilligenden Blick auf sich, als sie Seife, Haarbürste und Kamm, Franzbranntwein und Talkpuder auf ihren Wagen legte und dann die Waschschüssel mit heißem Wasser füllte.
»Ist das die richtige Temperatur?«
»Ja, Schwester.«
»Sind Sie sicher? Sie dürfen die Patientin nicht verbrühen.«
»Nein, Schwester.«
»Und lassen Sie nicht wieder die Seife im Wasser liegen, während sie die Patientin waschen, wie Sie es gestern getan haben«, erinnerte Schwester Hyde sie. »Das ist eine himmelschreiende Verschwendung.«
»Nein, Schwester.«
»Und versuchen Sie, ein etwas freundlicheres Gesicht zu machen, Himmelherrgott noch einmal!«, ertönten die letzten Worte der Oberschwester hinter ihr.
Sie hasst mich, dachte Millie, als sie den Wagen zur anderen Seite der Station hinüberschob.
Schwester Hyde und sie hatten im vergangenen Jahr keinen guten Start gehabt, als Millie sie während ihrer praktischen Abschlussprüfung versehentlich mit einem Seifeneinlauf durchnässt hatte. Das Bild von Schwester Hyde, wie sie mit durchnässter Haube und Seifenwasser im Gesicht, das von dem Ende ihrer langen Nase heruntertropfte, dagestanden hatte, hatte Millie seitdem immer wieder heimgesucht.
Und auch Schwester Hyde hatte den Vorfall offensichtlich nicht vergessen, da sie sich keine Gelegenheit entgehen ließ, sie zu quälen. Nicht ohne Grund hatte Millie die Zuteilung zur Chronischen für Frauen gefürchtet.
Kein Tag verging, an dem Schwester Hyde sie nicht aus irgendeinem Anlass scharf zur Rede stellte. Sie setzte Millie viel mehr als irgendeiner der anderen Schwestern zu.
»Sie dürften nicht länger als drei Minuten brauchen, um ein leeres Bett zu machen, Schwester«, sagte sie, wenn sie urplötzlich mit der Uhr in der Hand hinter Millie stand. Oder: »Warum schütteln Sie die Laken? Du liebe Güte, Mädchen, Sie verursachen hier noch einen Orkan!« Auch folgte sie Millie gern beim Saubermachen und fuhr mit dem Finger über die Spinde und unten um die Badewannen herum, bis sie schließlich irgendetwas fand, was sie bemängeln konnte.
Millie versuchte, freundlich zu bleiben und in allem und jedem das Gute zu sehen, doch langsam konnte sie sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Schwester Hyde absolut nichts Gutes in sich hatte.
Wie die meisten der anderen Stationen im Nightingale Hospital war auch die Chronische für Frauen weitläufig wie eine Kathedrale. Die beiden längeren Wände waren gesäumt von zwanzig Betten, zwischen denen jeweils ein gekachelter Nachttisch stand. In der Mitte der Station befanden sich der Schreibtisch der Stationsschwester und der Kamin, in dem während der Wintermonate stets ein anheimelndes Feuer brannte. Hohe Fenster boten einen Ausblick auf den Hof mit der Gruppe Londoner Platanen in der Mitte, wo manchmal Patienten saßen, wenn ihr Zustand es erlaubte.
Doch keine der Patientinnen auf der Chronischen für Frauen kam je auf den Hof hinaus. Nur wenige schafften es bis zu den Fenstern, um von dort den Ausblick zu genießen. Sie waren nicht ins Nightingale gekommen, um wieder gesund zu werden, sondern um zu sterben.
Auch das war ein Grund, warum Millie ihre Zuweisung hierher gefürchtet hatte. Die Frauen auf der Chronischen waren so furchtbar traurig. Viele von ihnen waren von ihren Familien aufgegeben worden, um hier vergessen und allein zu sterben. Einige waren sogar aus dem Arbeitshaus hierhergeschickt worden. Auf diese Station kamen nie Besucher und brachten Blumen, ein Lächeln oder gute Laune mit.
Doch eigentlich spielte das auch keine große Rolle, da viele der Patientinnen zu alt, zu krank oder dement waren, um zu wissen, wo sie sich befanden. Sie warfen sich im Bett herum und schrien viel, rüttelten an den Gitterstäben ihrer Betten und schlugen nach den Krankenschwestern. Oder sie führten Selbstgespräche und Unterhaltungen mit unsichtbaren Freunden und Familienangehörigen. Und dann gab es auch Patientinnen, die nur dalagen und an die Decke starrten, mit Gesichtern, die bar jeglicher Hoffnung waren. Diese Frauen waren es, die Millie von allen am meisten zu Herzen gingen.
Manchmal dachte sie, dass dies der Grund sein könnte, warum Schwester Hyde immer so schlechtgelaunt und verbittert war. Sie selbst wäre wahrscheinlich auch nicht anders, wenn sie die letzten dreißig Jahre an einem so deprimierenden Ort verbracht hätte.
Mrs. Church schenkte ihr ein breites, zahnloses Grinsen durch die Gitterstäbe ihres Betts, als Millie ihren Wagen durch die Lücke zwischen den Trennwänden bugsierte. Sie war nicht größer als ein Kind. Perlmuttartige Haut spannte sich über den Knochen ihres Gesichts, das von einem flaumigen Kranz aus spärlichem weißem Haar umgeben war. Es wirkte, als ob sie die stinkenden Exkremente an ihren faltigen Händen und ihrem weißen Nachthemd gar nicht wahrnahm. Aber sie schien zum Entsetzen der Schwestern ihren Spaß daran zu haben. Messy Bessie hatte sich ihren Spitznamen zweifellos verdient.
Erneut erfasste Millie heftige Übelkeit, als ihr der Gestank entgegenschlug, aber sie kämpfte dagegen an und zwang sich zu einem Lächeln, als sie das Schutzgitter seitlich am Bett herunterließ. »Gut, Mrs. Church, dann wollen wir Sie mal säubern«, sagte sie ermunternd und zog ihre Gummihandschuhe an.
»Nein!« Bessie Church schreckte auf, griff nach der Bettdecke und zog sie mit panisch aufgerissenen Augen bis unter das Kinn.
Millie erschauderte, als sie die verschmierten Handabdrücke auf der Decke sah. »Na kommen Sie, Sie wollen doch nicht in diesem schmutzigen Bett liegenbleiben?«, sagte sie ermutigend. »Sie werden sich viel besser fühlen, wenn Sie frisch und sauber sind.«
Aber Bessie krallte ihre schwarzgeränderten Fingernägel in die Decke und ließ nicht locker.
»Neiiin!« Ein schauerlicher Angstschrei entrang sich ihrem zahnlosen, weit aufgerissenen Mund.
»Himmelherrgott, Schwester, können Sie diese Frau nicht zum Schweigen bringen?«
Es war Maud Mortimers Stimme, die sich gebieterisch auf der anderen Seite der Station erhob. Sie war eine große Dame Mitte siebzig und eine der wenigen Patientinnen auf der Station, die noch im Vollbesitz ihrer geistigen Fähigkeiten war. Nur ihr Körper ließ sie im Stich. Sie war ans Bett gefesselt, weil sie unter fortschreitendem Muskelschwund litt. Aber es schien so, als hätte sie beschlossen, die Zeit, die ihr noch auf Erden blieb, dazu zu verwenden, alle anderen so unglücklich zu machen, wie sie nur konnte.
Millie hörte Stationsschwester Willis zu Mrs. Mortimers Bett hinübergehen. Sie war eine sanfte Frau mit leiser Stimme, und so konnte Millie kaum verstehen, was sie flüsterte. Mrs. Mortimers lautstarke Antwort hörte sie jedoch nur allzu deutlich.
»Was soll das heißen, ich störe die anderen Patienten? Du meine Güte, haben Sie dumme Frau diesen Heidenlärm da drüben nicht gehört? Ich habe keine Ahnung, was die Schwester hinter diesen Trennwänden treibt, aber ich hoffe aufrichtig, dass sie die arme Frau mit einem Elefantengewehr von ihrem Elend erlöst!« Wieder hörte Millie nur Gemurmel von Schwester Willis, dann sagte Mrs. Mortimer empört: »Ich werde erst an die anderen Patienten denken, wenn sie mal einen Moment lang an mich denken! Barmherziger, man kann hier ja nicht einmal in Ruhe sterben, wie es scheint.«
Millie konnte nicht umhin zu lächeln. Maud Mortimer erinnerte sie an ihre eigene Großmutter, die Ehrfurcht gebietende Gräfinwitwe Rettingham, eine Frau, die so von der Richtigkeit ihrer eigenen Ansichten überzeugt war, dass sie es für völlig sinnlos hielt, sich die Ansichten eines anderen anzuhören.
Doch dann drehte Millie sich um, und ihr Lächeln erlosch, als sie sah, was Bessie Church getan hatte.
»Oh nein! Nun sehen Sie mich an!« Entsetzt starrte sie auf ihre Schürze herab. Sie war zu sehr damit beschäftigt gewesen, Maud Mortimer zuzuhören, um zu bemerken, dass Messy Bessie die Bettdecke losgelassen hatte und stattdessen nun sie selbst betätschelte.
Bessie Church klatschte nur in die Hände und grinste sie zufrieden an. Millie nutzte die Gelegenheit und schlug die Bettdecke zurück. Bessies krächzendes Gelächter verwandelte sich in einen empörten Aufschrei. Sie versuchte, das Bettzeug zu ergreifen, und als das nicht klappte, griff sie stattdessen nach Millie.
»Au! Lassen Sie mich los!« Für eine so kleine Frau war Mrs. Church erstaunlich kräftig. Ihre schmutzigen Finger krallten sich so fest um ein Büschel Haar unter Millies Haube, dass sie aus dem Gleichgewicht geriet und kopfüber auf das Bett fiel.
»Was in Herrgotts Namen ist hier los?«
Schwester Hyde riss eine der Trennwände zurück. Millie entwand sich Bessies Griff, rappelte sich auf und versuchte, ihre Haube zurechtzurücken. Sie wagte nicht, an sich herabzublicken, aber ihr war klar, dass sie fast genauso schmutzig war wie Bessie.
Schwester Hyde musterte sie von oben bis unten. »Gehen Sie sich umziehen, Benedict«, sagte sie schließlich mit schmalen, nahezu unbewegten Lippen. »Ich werde jemand Kompetenteren finden, um Mrs. Church zu waschen.«
Millie schlich mit gesenktem Kopf die gesamte Station hinunter, wobei sie die amüsierten Blicke der anderen Schwestern in ihrem Rücken spürte. Selbst die Schwesternschülerinnen im ersten Lehrjahr, die in der Hierarchie ganz unten standen und fast ihre ganze Zeit damit verbrachten, Bettpfannen zu reinigen, grinsten.
Als Millie den Waschraum erreichte, begann sie zu verstehen, warum sie hier war. Angewidert nahm sie ihre Haube und ihre Schürze ab.
Plötzlich schien es eine Ewigkeit her zu sein, seit sie die Cocktails im Savoy getrunken hatte.
KAPITEL VIER
Die wöchentliche Stationsvisite des Chefarztes machte Schwester Wren stets sehr nervös. Das hatte allerdings nichts mit der Sorge zu tun, dass Dr. Cooper etwas an der Pflege ihrer Patientinnen zu beanstanden haben könnte, denn dafür war ihre Station viel zu gut geführt. Es war mehr so etwas wie die prickelnde Erregung, die die jungen Mädchen in Peg’s Paper erfasste, wenn sie ihren Liebsten sahen.
Denn sie liebte ihn, oh ja, obwohl sie sich das nur tief in ihrem Herzen eingestehen konnte. Sie liebte alles an ihm. Seine tiefe, aufregende Stimme. Sein charmantes Lächeln und die Art und Weise, wie sich einer seiner Mundwinkel dabei verzog. Seine faszinierenden Augen und sein glänzendes schwarzes Haar. Seine geschickten Chirurgenhände, die die Gabe besaßen, Leben zu retten. Oh, wie fasziniert sie vom Anblick dieser langen, feinfühligen Finger war! Manchmal musste sie sich zwingen, sie nicht anzustarren und sich vorzustellen, sie streichelten ihr Gesicht oder knöpften ihre Bluse auf …
Wie die Mädchen in Peg’s Paper wusste jedoch auch Schwester Wren, wie aussichtslos ihre Liebe war. Denn James Cooper war verheiratet. Sie hatte zwar ihre Zweifel, ob er mit einer Frau glücklich sein konnte, die sich kleidete wie eine Bohemienne, und selbst auf öffentlichen Veranstaltungen keinen Hehl aus ihrem Missmut machte und, was das Schlimmste war, zudem noch Französin war. Aber Schwester Wren wusste auch, dass er viel zu anständig war, um etwas zu tun, das seinen oder ihren Ruf beschmutzen könnte.
In Gedanken rief sie sich zur Ordnung, als sie vor dem Spiegel in ihrem Wohnzimmer ihre aschbraunen Locken toupierte. Er ist nun mal verheiratet, ermahnte sie sich streng. Und wie sehr sie – und vielleicht auch er – diese Tatsache bedauern mochten, sie musste praktisch denken.
Denn auch Schwester Wren hatte Bedürfnisse. Und da diese Bedürfnisse von dem Mann, den sie liebte, nie erfüllt werden könnten – es sei denn, ein schrecklicher Unfall widerführe Mrs. Cooper –, musste sie sich jemand anderen suchen.
Sie warf einen Blick auf die heutige Ausgabe der Times