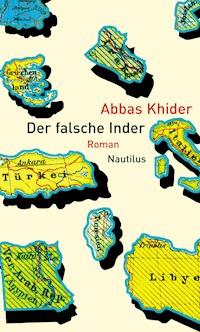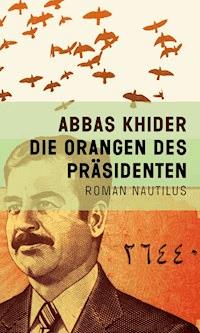
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nasrija, Irak, 1989: Am Tag der letzten Abiturprüfung wird Mahdi zu einem Ausflug eingeladen. Sein Klassenkamerad Ali hat sich ein Auto ausgeliehen, und die beiden wollen das Ende der Schulzeit feiern. Doch es ist das falsche Auto, und Ali kennt die falschen Leute - die beiden werden ohne Anklage und Prozess inhaftiert. Mahdi stehen zwei Jahre Gefängnisalltag bevor, Hunger, Folter, Grausamkeiten, Zynismus: Zum Geburtstag Saddam Husseins wird den Häftlingen eine Amnestie in Aussicht gestellt - doch dann bekommt jeder nur eine Orange als Geschenk. Mahdi rettet sich in dieser Hölle durch seine Begabung zum Geschichtenerzählen. Drastisch, tragikomisch und ergreifend berichtet er Episoden aus seiner Kindheit und Jugend, besonders von der Freundschaft mit dem Taubenzüchter Sami und dem Geschichtslehrer und Literaturübersetzer Razaq. Der Roman lässt ein eindrucksvolles Bild des Irak der achtziger und neunziger Jahre entstehen. Nach seinem fulminanten, viel beachteten Debüt legt Abbas Khider hier seinen zweiten Roman vor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Abbas Khider
Die Orangendes Präsidenten
Roman
Danksagung: Walter, dem Vater, den ich mir immer gewünscht habe. Jacob, meinem treuesten Freund und deutschen Bruder, den ich sicher schon in einem früheren Leben kannte. Ebenso Steffen, dem zukünftigen Engel oder Dichter. Susanne, die goldene Taube, die mir das Fliegen im Lebendigsein beigebracht hat. Ohne Eure Hilfe und Unterstützung hätte ich es nicht geschafft, meine Texte zu dem zu machen, was sie sind.
Die Arbeit an diesem Roman wurde durch ein Stipendium des
Deutschen Literaturfonds e.V. gefördert.
Edition Nautilus Verlag Lutz Schulenburg
Schützenstraße 49 a · D-22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten · © Edition Nautilus 2010
Originalveröffentlichung · Erstausgabe März 2011
Umschlaggestaltung: Maja Bechert, www.majabechert.de
Druck & Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg
3. Auflage Juni 2011
Print · ISBN 978-3-89401-733-0
eBook · ISBN 978-3-86438-043-3 (ePub)
ISBN 978-3-86438-044-0 (PDF)
Meine Mutter weinte, wenn sie sehr glücklich war. Sie nannte diesen Widerspruch »Glückstränen«. Mein Vater dagegen war ein überaus fröhlicher Mensch, der überhaupt nicht weinen konnte. Und ihr Kind? Ich erfand eine neue, melancholische Art des Lachens. Man könnte es als »Trauerlachen« bezeichnen. Diese Entdeckung machte ich, als mich das Regime packte und in Ketten warf.
Wann immer mehrere Gefängniswärter unsere Zelle betraten, begann das wöchentliche Todesspiel von Neuem: mit schweren Militärstiefeln getreten oder mit knochigen Fäusten und unerbittlichen Offiziersstäben geschlagen zu werden. Jedes Mal versuchte ich verzweifelt, wenigstens mein Gesicht mit den Händen zu schützen, und überließ den Rest meines Körpers den Wärtern.
Ein Mal war ich ganz in der Gewalt eines Wärters, den ich Charlie Chaplin nannte. Er trieb nur einige Wochen lang bei uns sein Unwesen, danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Er war sehr klein, nur knapp über einen Meter groß, schien mir, und trug einen lustigen Zweifingerschnurrbart. Er hatte einen Offiziersstab bei sich, mit dem er gerne um uns herumtanzte und immer wieder auf uns einstach und -schlug. Wenn er einen Gefangenen verprügelte, biss er sich mit spitzen Zähnen vor Lust auf seine wulstige Zunge und schrie, dass ihm der Speichel aus den Mundwinkeln triefte: »Hiwanat – Tiere!«, und schlug weiter und weiter wie eine Maschine auf uns ein.
Chaplin malträtierte mich übel mit dem Stab, und ich krümmte mich wie üblich wimmernd vor Schmerz, Hilflosigkeit und Hass auf dem Boden. Als er kurz Pause machte, um wie ein hechelnder Hund nach Luft zu schnappen, befreite ich mein Gesicht von den schützenden Händen und warf einen schnellen Blick auf das seine. Er war erschöpft, schwitzte, und noch immer hielt er seine Zunge zwischen den Zähnen. In diesem Moment musste ich unwillkürlich an den echten Charlie Chaplin denken und konnte mich nicht länger beherrschen. Ich prustete laut los und schrie in allen Tonlagen, krümmte und gebärdete mich, als hätte ich Lachgas eingeatmet. Den Wärtern fielen vor Überraschung fast die Knüppel aus der Hand, und sie beobachteten mich wie ein Wissenschaftler ein höchst seltenes und unerklärliches Phänomen.
Einer brach schließlich das Schweigen und forderte, ich solle aufhören. Ich konnte aber nicht. Ich versuchte es, musste aber doppelt so laut und heftig wie zuvor loslachen. Während ich mich auf dem Boden wälzte, bekam ich einen Fußtritt in den Magen und einen anderen in die Nierengegend – beide ohne Wirkung und ohne dass ich sie überhaupt spürte. Das Lachen machte mich unempfindlich gegenüber dem Schmerz, gegenüber der Angst und gegenüber der Verzweiflung. »Aufhören, du Wahnsinniger!«, befahl einer. Aber ich lachte weiter.
Der falsche Charlie Chaplin raunte schließlich seinen Kollegen zu: »Ich glaube, er hat seinen Verstand verloren!« Als ich das hörte, war es ganz um mich geschehen; ich explodierte förmlich wie eine Mine. Ich zitterte am ganzen Leib, schlug wie ein protestierendes Kind mit den Händen auf den Zellenboden und strampelte dazu mit beiden Beinen. Ich hatte das Gefühl, meine Lunge wäre bereits durchlöchert, und schmeckte Blut und Schleim in meinem trockenen Mund. Immer wieder musste ich husten und mein Kopf pochte. Meine Umgebung nahm ich nur noch verschwommen und wie entfernt wahr, da meine Augen vor Tränen regelrecht überliefen.
Die Wärter waren so verstört, dass sie nicht wussten, wie sie auf die Situation reagieren sollten, und verließen schließlich kopfschüttelnd und mit einem Gesichtsausdruck, als sei ihre gesamte Weltanschauung in Zweifel gezogen, unsere Zelle. Meine Mitgefangenen starrten mich aus ihren eingefallenen Gesichtern mit den riesigen Augen in ihren dunklen, knochigen Höhlen zutiefst befremdet an. Irgendwann hörte ich ebenso plötzlich mit dem Lachen auf, wie ich es begonnen hatte. Und ich stellte zu meiner eigenen Verwunderung fest, dass ich bei äußerst klarem Verstand und anscheinend doch nicht verrückt geworden war. Aber was war es dann? Ich habe bis heute keine Erklärung dafür gefunden …
Jetzt, mehr als ein Jahr des Schreckens nach diesem einmaligen Tag des Lachens, sitze ich in einer anderen Art von Gefängnis ein: ein Flüchtlingslager an der irakisch-kuwaitischen Grenze, im Herzen der Wüste. Ich bin umgeben von Naturgewalten: von der Sonne, die lodernd und unbarmherzig alles verbrennt, dem Wind, der in unsere Gesichter peitscht, dem Sand, der sich als dünne Kruste auf unsere Haut gelegt hat und uns so staubig wie ein Wandervolk aussehen lässt, den ausländischen Soldaten, die bis an die Zähne bewaffnet sind und misstrauisch und jederzeit schussbereit alles um sich herum beobachten, als wäre die Wüste ein Mörder. Dann sind da die vielen weißen Zelte, die wie ein schäumendes Meer die Wüste überschwemmen. Und die vielen Flüchtlinge, die wie die Sandkörner überall zu sehen sind.
Ich harre hier meines Schicksals und warte. Worauf? Worauf warte ich? Ich weiß es nicht mit Sicherheit. Auf die Zukunft? Auf Hoffnung? Auf Veränderung? Jedenfalls nicht auf Godot. Das Einzige, das zählt, ist jedoch, dass ich noch lebe. Und das ist an sich schon eine große Leistung, wenn ich an die Erlebnisse der letzten Monate denke.
In dieser aufregenden Zeit des Wandels, der Kriege, der Umbrüche, habe ich – Langeweile, unsägliche Langeweile. Flüchtlingslager sind der langweiligste Ort der Welt. Ich zähle Sandkörner, bis mir vielleicht irgendein Traumland Asyl gewährt. Wann das sein wird? Ich habe keine Ahnung, aber der Sand wird mir nicht ausgehen. Es gibt Tausende hier, die mit mir darauf warten.
Ich denke, ich sollte mich irgendwie nützlich machen, sonst schafft die Langeweile, was all die grauenvollen Abenteuer der letzten Jahre nicht vollbracht haben: mir endgültig den Verstand zu rauben. Das Beste wird sein, mir ein Heft und einen Stift zu besorgen und in die Vergangenheit zurückzukehren. Vielleicht gelingt es mir ja sogar auf diese Weise, endlich das Geheimnis meines Lachens zu ergründen …
Mahdi Hamama
Der Taubenzüchter
Eine wahre Geschichte
Taube,wenn mein Haus verbrenntwenn ich wieder verstoßen werdewenn ich alles verlieredich nehme ich mit,Taube aus wurmstichigem Holz,wegen des sanften Schwungsdeines einzigen ungebrochenen Flügels.Hilde Domin
Es war am letzten Tag der Abiturprüfung. Der Tag, an dem ich jäh aus meinem gewohnten Leben gerissen wurde und den Lauf der Dinge völlig neu kennenlernen musste. Als ob ich die Welt zum ersten Mal erblickt hätte. Und alles nur wegen einer Autofahrt mit Ali, meinem Schulkameraden.
Er war ein sehr netter Kerl mit kurzen schwarzen Haaren und braunen Augen. Ein kräftiger Junge mit muskulösem Körper. Sein Vater war im Irak-Iran-Krieg verschwunden. Es wurde weder eine Leiche gefunden noch gab es eine Nachricht. Und weil Alis Vater nur als vermisst galt, hatte seine Familie von der Regierung keine so große Unterstützung erhalten wie die Familien, die einen Gefallenen beklagen mussten und einen Renault, ein Grundstück und zweitausend Dollar als Entschädigung bekamen. Alis Familie erhielt vom Staat nur einen Renault, den die Mutter verkaufte, um die Kinder ernähren zu können. Nicht lange, und es fand sich nichts mehr zu essen im Kühlschrank. Seitdem arbeitete Ali als Helfer und Lehrling bei einem Automechaniker, um seine kranke Mutter und seine sechs Geschwister durchzubringen. Trotzdem besuchte er weiterhin die Schule.
Eigentlich wollte Ali nicht viel im Leben erreichen, nur eine Autowerkstatt führen. Denn alles, was mit Autos zu tun hatte, entfachte seine Leidenschaft. Oft starrte er diesen blechernen Kästen mit Rädern auf den Straßen mit sehnsüchtigen Blicken hinterher wie Männer hübschen Frauen. »Mein einziges Hobby und meine einzige Liebe«, gestand er.
Mit Ali lernte ich für die Abiturprüfung. Bei mir. Er konnte sich bei seiner Familie nicht konzentrieren, weil es dort weder Platz noch Ruhe gab. Seine kleinen Geschwister waren sehr laut. »Lauter als alle Musikläden im Zentrum«, scherzte er. Deswegen übernachtete er fast immer bei mir.
Wir lernten täglich etwa acht Stunden. Einen Monat lang hatten wir mit allen möglichen Fächern zu tun. Es gab nichts Aufregenderes in unserem Leben als Bücher.
In dieser Zeit durfte ich mich nicht um meine Tauben kümmern, mich nicht einmal in ihrer Nähe aufhalten. »Dein Abitur!«, mahnte mein älterer Freund Sami. »Du musst mindestens einen Notendurchschnitt von siebzig Prozent haben, um an der Pädagogischen Hochschule studieren zu dürfen«, fuhr er fort. »Keine Tauben mehr. Es wird nur noch gelernt! Hast du verstanden?«
Die Prüfungszeit war sehr anstrengend. Uns blieb nur ein freier Tag zwischen zwei Prüfungen. Jeden Morgen standen wir um fünf Uhr auf, um den Stoff des Faches zu wiederholen, in dem wir die Klausur schreiben mussten. Die Schule, in der die Prüfung abgehalten wurde, lag nicht weit von unserem Viertel entfernt. Als wir am letzten Prüfungstag ankamen, ließen uns die Lehrer nicht hinein. Normalerweise begann die Prüfung um acht Uhr morgens. Bis neun Uhr warteten wir draußen vor dem Hauptportal. Ein Lehrer erklärte schließlich, die Unterlagen aus der Prüfungszentrale seien nicht angekommen, und die Klausur werde deswegen erst um dreizehn Uhr stattfinden.
Genervt kehrte ich nach Hause zurück. Vor der Haustür stieß ich auf jemanden, der wutentbrannt brüllte: »Sami! Krüppelbein! Du Arschloch! Ich bring dich um!« Einige Nachbarn bemühten sich, ihn zu beruhigen. Doch der Mann hörte nicht auf, sich die Seele aus dem Leib zu schreien. Ich kannte ihn. Er war ein Taubenzüchter wie Sami, sein Name war Karim.
Zuerst konnte ich Sami nirgends entdecken. Er war auf dem Dach, saß auf dem Boden vor dem Taubenschlag und fütterte die Vögel. Er schien das Brüllen draußen überhaupt nicht zu hören, war ganz in sich versunken. Erst als ich direkt vor ihm stand, blickte er überrascht zu mir auf und erkundigte sich sofort nach der Prüfung. Ich erzählte kurz, was geschehen war, und fragte besorgt: »Was ist denn da draußen los? Warum will dieser Verrückte dich umbringen?«
»Karim gleicht einer Trommel, außen laut und innen hohl. Nimm ihn nicht so ernst! Er ist nur ein kaputter Schwanz.«
Ich schaute Sami stumm an und wartete auf eine Erklärung.
»Der Idiot hat früher einmal eine Taube von mir gefangen und wollte sie nicht zurückgeben. Heute Morgen, kurz nachdem du weg warst, habe ich meine Tauben fliegen lassen. Plötzlich kam eine fremde Taube und mischte sich unter meinen Schwarm. Ich ließ alle auf dem Dach landen und sperrte sie mit ein. Ich wusste nicht, dass sie eine seiner Tauben war. Nun will er, dass ich sie ihm zurückgebe. Das werde ich aber bestimmt nicht tun. Auge um Auge. Und verkaufen werde ich sie auch nicht, nicht für tausend Dinar. Es ist eine grüne Taube, und die sind selten.«
Ich betrachtete sie aufmerksam. Die Farbe ihrer Federn war gelb, grau und braun gemischt, mit einem leuchtenden, wie gemalten weißen Punkt auf dem Kopf. Ein makelloser Schnabel. Ihr Jabot sah aus wie eine offene Rose. Strahlend weiß das Daunengefieder. Ihre kleinen Augen glichen zwei Granatapfelkernen, sie starrten ängstlich in die Gegend.
»Aber sie ist doch gar nicht grün«, wunderte ich mich.
»Du musst sie dir in der Sonne anschauen.«
Tatsächlich, ihre unterschiedlichen Farben, die zwischen gelb, grau, braun und weiß wechselten, verwandelten sich im Licht der Sonne in ein helles, fast schimmerndes Grün.
»Sie ist unwahrscheinlich schön.«
Sami gebärdete sich wirklich wie ein Kind, das sich auf ein neues Spiel freut. Obwohl ich gern die grüne Taube noch näher betrachtet hätte, wandte ich mich von ihr und Sami ab und ging ins Wohnzimmer, um noch einmal kurz den Prüfungsstoff für den Nachmittag durchzugehen.
Die Prüfung war um fünfzehn Uhr zu Ende. Ich war wirklich sehr erleichtert und wartete draußen auf Ali. Der verließ als einer der letzten die Prüfungsräume.
»War’s schwer?«, fragte ich.
»Denk jetzt nicht daran! Nun müssen wir feiern. Die Freiheit und die Ferien. Oder die Universität, wenn wir bestanden haben.«
»Wohin fahren wir?«
»Nach Zikkurat Ur. Warte hier!«
Er ging zum Schulparkplatz, stieg in ein Auto und hielt dann direkt neben mir. »Steig ein!«, schmunzelte er gönnerhaft.
»Woher hast du das?«
»Von einem Freund ausgeliehen, um heute feiern zu können.«
Es war ein kleiner roter Mitsubishi. Ich stieg ein, und Ali brauste sofort los. Ich schaltete den Rekorder ein und ließ die Musik laut spielen, bis wir direkt vor den Überresten der alten Stadt Ur hielten.
Ein paar Besucher schlenderten in Richtung der Ruinen. Vor der Zikkurat-Treppe standen zwei Männer, die uns zuwinkten. Ali sagte, die beiden seien seine Freunde. Wir stiegen aus. Die zwei Männer kamen auf uns zu und begrüßten uns mit Handschlag. Plötzlich hörte ich laute Schreie: »Keine Bewegung!«
Erstes Kapitel
Untersuchungshaft
1989
Ein Haufen uniformierter, bewaffneter Männer und ein paar in Zivil Gekleidete kreisten Ali, seine beiden Freunde und mich ein, richteten ihre Waffen auf uns und brüllten: »Polizei!« Einer der Zivilen stand direkt vor mir und schlug mir völlig unerwartet mit seiner Pistole auf den Kopf, sodass sich die Erde wie ein Karussell um mich herum drehte. Ich schwankte. Der Mann umklammerte meinen Oberkörper, drückte mich nieder und presste mir ein Knie gegen den Hals. »Keine Bewegung!« Schließlich drehte er mir die Hände auf den Rücken und legte mir Handschellen an.
Völlig überrumpelt lag ich auf dem Boden. Der Zivile steckte seine Hand in meine Tasche und holte meinen Geldbeutel heraus. Dann half er mir, mich aufzurappeln und begleitete mich zu einem Auto, das neben ein paar anderen hinter der Treppe des Tempelturms geparkt war.
Der Mann am Steuer fuhr scharf an, und das losrasende Auto zog eine dichte Staubwolke hinter sich her. Ich drehte mich um und sah sechs oder sieben Autos hinter uns. Ein Uniformierter saß neben mir auf dem Rücksitz. Der andere steuerte das Auto, und der Zivile saß neben ihm.
»Darf ich fragen, was los ist?«, fragte ich.
Der neben mir drückte mit der Hand meinen Kopf nieder, schimpfte grob »Halt’s Maul!« und verband meine Augen mit einem Tuch.
Die Welt war ausgeknipst. Pulsierende Wellen in meinen Augenhöhlen. Ein komisches Gefühl, gefesselt zu sein. Polizei? Wieso?
Die Polizisten schalteten Musik ein. Die sanfte Stimme der libanesischen Sängerin Fairuz drang an mein Ohr: »Ich liebe dich im Sommer. Ich liebe dich im Winter …«
Draußen tobte der übliche Nachmittagslärm der Stadt, der sich mit menschlichen Stimmen vermischte, sobald das Auto irgendwo anhielt. Kurze Zeit später vernahm ich das Geräusch eines starken Windes, der heftig an das Autofenster schlug. Nach einer Weile war nichts mehr zu hören außer der Musik. Das Auto rollte einige Minuten lang sehr langsam und blieb dann unvermittelt stehen.
Ich hörte, wie die Wagentüren aufgerissen wurden, und die Schritte der Polizisten, die ausgestiegen waren. Einer griff nach meinem Arm: »Beweg dich!«, schnarrte er. Ich stieg aus und hörte die vielen Schritte um mich herum, das stärker gewordene Klopfen meines Herzens. Wir marschierten los. Nach ungefähr dreihundert Metern das Knarren einer Tür. Noch einige Schritte. Dann durfte ich mich auf einen Stuhl setzen. Die Schritte entfernten sich. Ich hörte gar nichts mehr.
Es war kalt. Seltsame Geräusche nebenan. Sie näherten sich. Ein flüsterndes Pfeifen in meinen Ohren. Es kam näher und entfernte sich wieder. Dann nichts mehr. Stille. Wieder ein Pfeifen. Ob hier einer mit mir spielte? Stille.
Fragen schwirrten durch meinen Kopf. Was ist los, verdammt noch mal?! Warum? Ich konnte mich nicht konzentrieren. Mich an nichts Konkretes erinnern. Ich fühlte aber die Angst in mir, die wie Sandkörner in meinem leeren Inneren durcheinanderwirbelte. Ich wusste nicht genau, wie lange ich dasaß. Fünf Minuten oder eine Viertelstunde? Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit.
Plötzlich ein Krach. Eine Tür war zugeschlagen worden. Dann eine andere Tür, näher als die erste. Schritte näherten sich. Einer legte die Hand auf meine Schulter. »Steh auf!« Ich ging einige wenige Schritte. Der Bewacher klopfte an eine Tür. »Komm rein!«, sagte einer. Wieder einige Schritte. Der Begleiter salutierte: »Zu Befehl!« Dann flüsterte er mir ins Ohr: »Setz dich!«
Noch einige Sekunden Lautlosigkeit. Dann hörte ich leise Geräusche. Irgendjemand blätterte vermutlich in einem Buch oder in einer Zeitung. Nach mehr als einer Minute ertönte eine sehr harte, kräftige Stimme: »Bist du Mahdi Muhsin?«
»Ja. Mit wem spreche ich?«
»Antworte auf die Frage! Bist du es?«
»Ja. Bin ich.«
»Wie alt bist du?«
»Achtzehn.«
»Beruf?«
»Schüler.«
»Wie heißt dein Vater?«
»Muhsin Hussein.«
»Der Beruf deines Vaters?«
»Geografielehrer.«
»Und wie heißt die Mutter?«
»Haiat Mozan.«
»Wo leben deine Eltern?«
»Sie sind tot.«
»Wo bist du geboren?«
»In Babylon. Hilla.«
»Seit wann wohnst du in Nasrijah?«
»Über ein Jahr.«
»Bei wem?«
»Bei meinem Onkel.«
»Habt ihr in der Familie einen, der im Gefängnis war?«
»Nein.«
»Also, ich rate dir etwas. Es gibt eine Redewendung: ‹Die Rettung liegt in der Ehrlichkeit.› Wenn du ehrlich bist, bist du gerettet.« Die Stimme näherte sich meinem Gesicht. Ich bemerkte den Gestank von Rauch. »Junge! Wenn du lügst, dann werde ich dir das Leben zur Hölle machen.«
»Ich sag Ihnen alles, was Sie wollen.«
»Ich will aber nicht, dass du uns sagst, was wir wollen, sondern nur die Wahrheit. Mehr will ich von dir nicht hören.«
Der Mann schwieg eine Weile. Dann fragte er: »Möchtest du Tee, Kaffee oder Wasser?«
»Wasser, bitte.«
Mir wurden die Handschellen geöffnet und das Tuch abgenommen. Das grelle Licht der Glühbirne blendete mich. Ich sah einen großen Raum. Ohne Fenster. Weiße Wände. Dann erkannte ich einen etwa fünfzigjährigen Mann, der mir gegenübersaß. Weiße Haut, graue Haare und ein schwarzer Anzug. Zwischen uns nur ein weißer Tisch. Darauf ein großer blauer Ordner, in dem der Grauhaarige ruhig blätterte. Außerdem noch eine Flasche Wasser und zwei Gläser. Hinter dem Grauhaarigen hing ein Bild des Präsidenten mit Zigarre an der Wand. Daneben ein Bild, auf dem dieser Grauhaarige und der Präsident nebeneinanderstanden und direkt in die Kamera schauten, mit geheimnisvollem, ernstem Lächeln. Rechts neben dem Bild ein weißer, geschlossener Schrank. An der linken Seite die Nationalflagge. Ich drehte den Kopf nach hinten und sah vier weitere Männer auf Stühlen neben der Tür, die ebenfalls schwarze Anzüge trugen und mich mit durchdringenden Augen musterten. Daneben standen zwei Uniformierte, die Augen geradeaus gerichtet. Ein weiterer Uniformierter, dessen Gesicht ich nicht sehen konnte, stand hinter mir. Als ich mich umdrehte, schlug er mir mit der Hand auf den Kopf und drehte ihn mir nach vorne. Der Grauhaarige klappte den Ordner zu, schüttete Wasser ins Glas und stellte es vor mir auf den Tisch.
»Nun, erzähl!«
»Was?«
»Alles, was du weißt.«
»Was wollen Sie wissen? Ich kann Ihnen alles sagen, was Sie wollen. Aber was?«
»Wer ist dein Führer? Und wer war mit dir in eurer Organisation? Was sind eure Ziele?«, fragte der Grauhaarige.
»Welche Organisation?«
Wieder ein Schlag von hinten. Der Grauhaarige gab mit der Hand ein Zeichen, dass der Uniformierte gehen solle. Er öffnete den Ordner, blätterte noch einmal darin, schaute mir ins Gesicht und grinste. »Du hast gesagt, du bist bereit, uns alles zu sagen.«
»Ja, hab ich gesagt, aber Sie wollen die Wahrheit. Ich bin niemals in irgendeiner Organisation gewesen.«
»Ach so, und das Auto? Ali und die anderen?«
»Ich kenne nur Ali.«
»Und du arbeitest mit ihm?«
»Nein. Ich schwöre es. Wir sind nur Nachbarn und in derselben Klasse.«
»Und das Auto?«
»Es gehört seinem Freund.«
»Wem?«
»Ich kenne ihn nicht. Wir haben heute die letzte Abiturprüfung gehabt. Und Ali wollte das mit mir feiern. Deswegen hat Ali das Auto von seinem Freund ausgeliehen. Mehr nicht.«
»Und du willst, dass ich das glaube?«
»Ja.«
Der Grauhaarige schaute mir ins Gesicht. Seine tiefschwarzen Augen glänzten merkwürdig. »Ich gehe jetzt und kehre in ein paar Minuten zurück. Überlege es dir gut!«
Er stand auf. Alle Anwesenden salutierten. Er schritt langsam durch den Raum. Ein kleiner Mann mit großem Bauch. Er öffnete die Tür und verschwand.
Schweigen.
Ich überlegte, wie ich mich verhalten sollte. Was für eine Scheiße! Ich verfluche dich, Ali! Große Angst überkam mich. Ich fror, als säße ich in einem Kühlschrank. Mein Mund war plötzlich ausgetrocknet. Ich versuchte, ruhig zu bleiben, aber ich konnte nicht. Ich zitterte. Ich fror noch mehr. Mein Mund wurde noch trockener. Mein Hals begann zu brennen.
Einer der vier zivil gekleideten Anwesenden brach das Schweigen, stand auf und setzte sich auf den Stuhl mir gegenüber. Sein Körper war durchtrainiert, fast wie der eines Boxers. Dunkelblaue Augen. Blonde Haare. Große Hände, wie bei einem Bären.
»Wie lange brauchst du, um es dir zu überlegen?«, fragte er mürrisch.
»Ich …«
»Hör mal. Ich glaube, du bist ein guter Kerl. Wir wollen dir nicht wehtun. Ich gebe dir einen Rat. Gib es zu! Welche Organisation?«
»Was?«
»Die Organisation, habe ich gefragt.«
»Welche?«
»Welche? Die Organisation der verdorbenen Fotze deiner Mutter.«
Die Augen des Blonden wurden halb weiß, halb hellrot. Er starrte mich wütend an. »Hör mal, du Arschloch! Wenn du es nicht zugibst, dann sorge ich dafür, dass dich alle Wärter und Gefangenen hier ficken. Sag endlich was! Hurensohn!«
»Ich schwöre, ich habe nichts getan. Ich schwöre bei Gott, beim Propheten.«
»Ich scheiße auf dich und deinen Gott und deinen Propheten. Soldaten!«
»Ich habe nichts gemacht. Ich schwöre!«
»Halt’s Maul!«, schrie er und schlug mir mit aller Kraft ins Gesicht. Ich kippte mitsamt dem Stuhl um. Die drei Uniformierten sprangen schnell auf mich zu und fesselten mir die Hände auf dem Rücken. Einer ging zum Schrank, holte ein schwarzes Gerät heraus, das wie ein Radio aussah, und stellte es auf den Tisch. Dann holte er einen Koffer, legte ihn gleichfalls darauf und klappte ihn auf. Der wütende Blonde nahm vier Stöcke aus dem Koffer und kniete sich vor mich hin. »Such dir einen aus! Welchen hättest du denn gerne?!« Er deutete zynisch grinsend auf ein Bündel Stöcke.
»Bitte nicht! Ich habe nichts getan.«
»Auswählen!«, drängte er und verpasste mir einen Stoß auf die Nase. »Auswählen!«
Ich schaute die Stöcke an und wählte weinend den dünnen aus. »Den da.«
Der Blonde lachte höhnisch: »Da hast du dir aber den Falschen ausgesucht. Dünne Stöcke sind sehr schmerzhaft. Sag bloß, du weißt das nicht! Nächstes Mal musst du den dicken nehmen. Trottel!« Er stand abrupt auf. »Hängen!«
Die Uniformierten zogen den Tisch in die Mitte des Zimmers. Einer verband mir die Augen mit einem Tuch. Ein Zitteranfall durchlief meinen Körper: Hände, Füße und sogar den Hintern. Ich konnte mich nicht still halten, als bebte die Erde unter meinen Füßen. Einer befahl mir aufzustehen. Ein zweiter umschlang meinen Oberkörper mit den Armen. Der Dritte packte meine Unterschenkel, und gemeinsam hievten sie mich auf den Tisch. Wieder ein anderer griff nach den Handschellen, riss sie mitsamt meinen Armen hoch und hängte sie irgendwo ein. Sie ließen mich los und ich baumelte wie der Klöppel einer Glocke hin und her.
»Oh Gott!«, stöhnte ich.
Ich fühlte mich wie ein Schaf in der Metzgerei. Die Arme, dachte ich, würden bald abreißen. Ein stechender Schmerz. Ich konnte nur mühsam atmen. Mein Körper fühlte sich unvorstellbar schwer an. Ich schrie aus Leibeskräften: »Bitte, genug! In Gottes Namen! Genug!« Der Schmerz wurde von Sekunde zu Sekunde stärker.
»Und? Kannst du fliegen?«, traf mich die zynische Stimme des Blonden. »Ab heute wirst du den Tag hassen, an dem du geboren worden bist.« Dann traf mich überraschend ein Schlag auf die Fußsohle. Ich schrie auf. Dann auf mein Bein. Ich schrie wieder laut. Dann einer auf den Rücken. Ein Schlag nach dem anderen. Alles in mir brannte. Mit jedem Schlag zitterte ich noch mehr, und der Schmerz in den Schultern wurde mit jeder Bewegung unerträglicher. Der Blonde schlug weiter. »Und, Mahdi? Willst du uns jetzt alles erzählen? Aber jetzt wollen wir nicht mehr. Jetzt ist es zu spät.«
Nach einer Weile hörte er mit dem Schlagen auf. Mein ganzer Körper brannte, als wäre Glut unter meiner Haut. »Jetzt der Strom!«, kommandierte der Blonde. Ich fühlte, wie er irgendetwas an meinen beiden großen Zehen befestigte. Einige Sekunden später dachte ich, die Haut spränge von meinem Leib ab, als hätte mich ein Blitz getroffen. Ich zitterte wie ein Palmenblatt im Wüstensturm. Wieder schrie ich laut auf. Mehrere Sekunden lang. Dann ließ das Zittern nach. Und noch ein Stromstoß. Gefolgt von heftigem Schütteln. Ich brüllte und dachte, meine Muskeln fielen von meinen Knochen ab. Ohne es zu wollen, pinkelte ich in die Hose. Dann noch mal eine ganze Reihe von Stromstößen. Länger als vorher. »Die Organisation! Wer ist dein Führer?« Der Blonde gab nicht nach. Plötzlich hörte ich eine andere Stimme: »Lasst ihn runter! Jalla!«