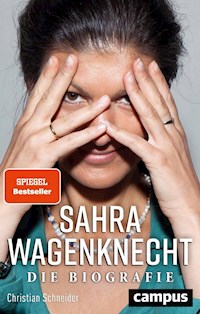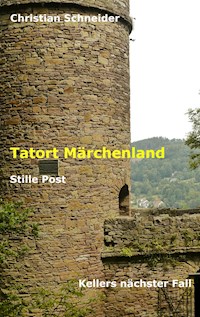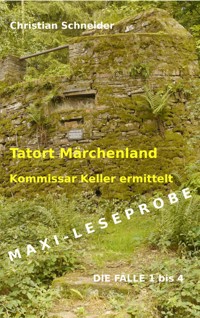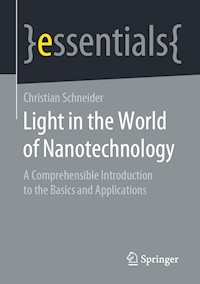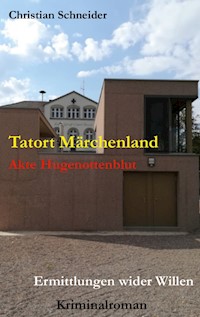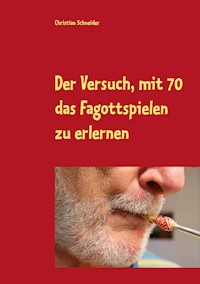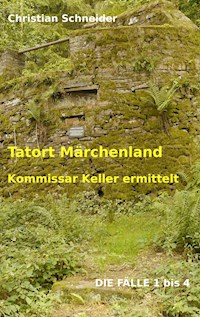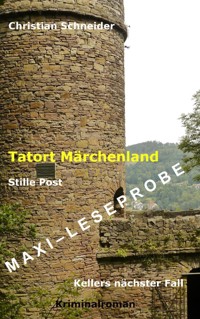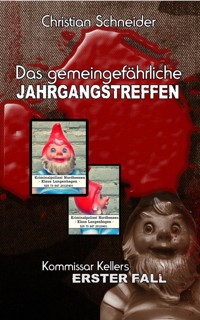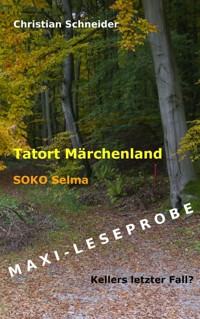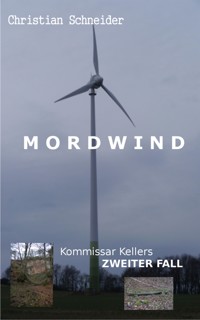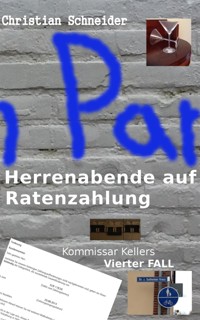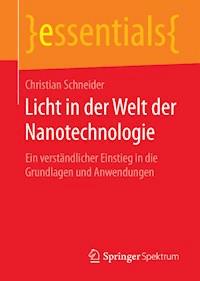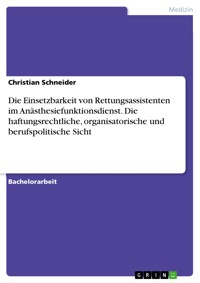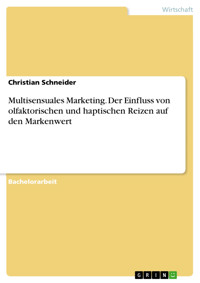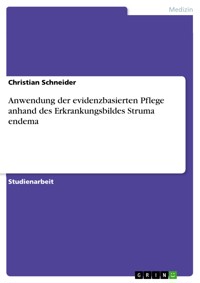13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Pflegewissenschaft - Pflegemanagement, Note: 1,0, Frankfurt University of Applied Sciences, ehem. Fachhochschule Frankfurt am Main, Sprache: Deutsch, Abstract: Bei gehörlosen älteren Menschen die in Pflege- und Altenheimen betreut werden, bleiben kommunikative Bedürfnisse meist unberücksichtigt. Dadurch steigt die Gefahr der sozialen Isolation und Vereinsamung, die bei den Betroffenen zu schweren psychischen Problemen führen kann. In der Hausarbeit wird dieser Prozess untersucht und es werden Vorschläge für Heimbetreiber und Pflegekräfte erarbeitet, um diesen Zustand zu verbessern. Grundlage für die Untersuchung ist die Isolationstheorie nach Jantzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung
1 Einführung
2 Methode der Literaturrecherche
3 Die Lebenswelt der gehörlosen Menschen
3.1 Wer ist gehörlos?
3.2 Die Gebärdensprache
3.3 Die Kultur der Gehörlosen
4 Gehörlosigkeit: Ein sozialer Prozess
4.1 Die Isolationstheorie nach Jantzen
4.2 Die drei wesentlichen isolierenden Bedingungen
4.2.1 Überstimulation
4.2.2 Widersprüchliche Informationen (double bind)
4.2.3 Sensorische Deprivation
5 Zusammenführung von Theorie und Praxis
6 Fazit
7 Literaturverzeichnis
Zusammenfassung
1 Einführung
Der Bedarf an professioneller Pflege gewinnt in Deutschland immer mehr an Bedeutung. Durch die zunehmende Alterung der Bevölkerung und der damit einhergehenden Zunahme chronischer Krankheiten steigt das Lebensrisiko pflegebedürftig zu werden (Pick, 2004: 9). Seit der ersten Erhebung war auf Bundesebene durchgängig ein Anstieg bei der Zahl der Pflegebedürftigen zu beobachten: Sie betrug im Jahr 1999 ungefähr 2,02 Millionen und stieg auf 2,25 Millionen im Jahr 2007 an (Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2010: 21). Im Dezember 2011 waren 2,50 Millionen Menschen im Sinne des Sozialgesetzbuches XI (SGB XI) pflegebedürftig (Pfaff, 2013). Während die Zahl der pflegebedürftigen Menschen weiter ansteigen wird, sinkt die Zahl an informellem Pflegepotential. Aufgrund des demographischen Wandels steigt die Anzahl von älteren Menschen, die alleine leben. Durch diesen Trend, den Anstieg der Erwerbsquote von Frauen und durch die wachsende Mobilität gibt es immer weniger Pflegemöglichkeiten innerhalb der Familien (Kaul et al., 2009: 231). Mit dieser Entwicklung steigt der Versorgungsbedarf durch ambulante Pflegedienste und stationäre Pflegeeinrichtungen. So ist gegenüber 1999 die Zahl der in Heimen betreuten Pflegebedürftigen um rund 24 % (+ 136 000) und die Zahl der durch ambulante Dienste Versorgten um 21 % (+ 89 000) gestiegen, während die Pflege durch Angehörige um 1 % (+ 6 000) nur im geringen Maße zunahm. Durch diese Entwicklung sank auch der Anteil der in häuslicher Umgebung Versorgten von knapp 72 % im Jahr 1999 über 69 % (2003) auf rund 68 % im Jahr 2007 (Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2010: 22). Durch den demographischen Wandel wächst auch die Gruppe älterer und alter Menschen mit besonderem Unterstützungs- und Hilfebedarf: umgangssprachlich als „Menschen mit Behinderungen" bezeichnet. Sie haben es generell schwerer, ihr eigenes Leben zu meistern und das Alter stellt sie vor zusätzliche Herausforderungen. Den für die Sozialplanung zuständigen Behörden ist diese Entwicklung und die damit einhergehenden Anforderungen bewusst, aber nicht unbedingt in ihrem ganzen Ausmaß. Ebenso wenig sind die Anbieter im Bereich der Behinderten- und Altenhilfe auf die besonderen Bedürfnisse dieser wachsenden Generation vorbereitet. Somit stehen die Gesellschaft und die Anbieter von Altenpflege und Eingliederungshilfe vor besonderen Herausforderungen (Köhncke, 2009: 4). Speziell auf die Situation von gehörlosen Menschen sind Alten- und Pflegeeinrichtungen nicht adäquat vorbereitet. So stellt eine wissenschaftliche Untersuchung zur Situation gehörloser Menschen im Alter (SIGMA) fest, dass Altenheime, die nicht speziell auf die Bedingungen gehörloser Bewohner eingestellt sind, den kommunikativen und kulturellen Bedürfnissen gehörloser Menschen nicht gerecht werden. Insbesondere die unberücksichtigten kommunikativen Bedürfnisse sehen die befragten Mitarbeiter der Einrichtungen und die Experten als Problem, da dadurch die Gefahr der sozialen Isolation und Vereinsamung ansteigt, die bei den Betroffenen zu schweren psychischen Problemen führen kann (Kaul et al., 2009: 92).
Zielsetzung der Arbeit
Die Hausarbeit beleuchtet die spezielle Situation gehörloser Bewohner im Alten- und Pflegeheim. Insbesondere die isolierenden Bedingungen gehörloser Menschen werden in der vorliegenden Arbeit mit Hilfe der Isolationstheorie nach Jantzen aufgezeigt. Des Weiteren werden die wichtigsten Maßnahmen abgeleitet, die Alten- und Pflegeheimbetreiber sowie Pflegekräfte ergreifen können, um die Situation gehörloser Bewohner zu verbessern.
Aufbau der Arbeit