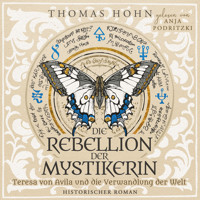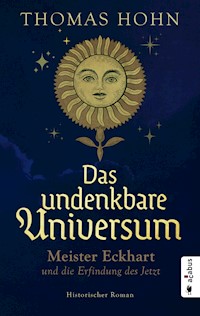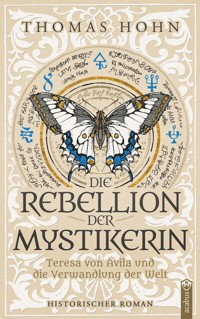
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Stark. Lebendig. Inspirierend. Spanien, 16. Jahrhundert: Das Schicksal einer Frau ist vorgezeichnet: Ehe oder Kloster. Doch Teresa von Avila liebt ihre Unabhängigkeit und ist nicht bereit, andere über sich bestimmen zu lassen. Verzweifelt und mit unbändiger Lebenslust sucht sie trotz aller Rückschläge ihren Weg. Die spätere Schutzpatronin Spaniens begehrt mutig auf und startet ein lebensgefährliches Unterfangen, um ihren Traum zu verwirklichen. Aber nicht nur die Macht der Inquisition tritt ihr entgegen. Diese einmalige und zugleich so menschliche Mystikerin erschüttert mit ihrer Vision die damalige Welt. Ihr Wirken inspiriert und berührt einst wie heute. Teresa von Avila - Die faszinierende Geschichte ihres Lebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 809
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Hohn
DIE
REBELLION
DER
MYSTIKERIN
Teressa von Avila
und die Verwandlung der Welt
Historischer Roman
Impressum:
Hohn, Thomas: Die Rebellion der Mystikerin. Teresa von Avila und die Verwandlung der Welt.
Hamburg, acabus Verlag 2024
1. Auflage 2024
ISBN: 978-3-86282-865-4
Dieses Buch ist auch als eBook erhältlich und kann über den Handel
oder den Verlag bezogen werden.
ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-862-3
Lektorat: Michael Haitel, Amandara M. Schulzke
Korrektorat: Amandara M. Schulzke
Umschlaggestaltung: www.phantasmal-image.de
Bildnachweis: Shutterstock
Zeichnung Avila im Jahre 1571: von Anton van den Wyngaerde, veröffentlicht vom Ayuntamiento de Ávila, gedruckt vom Diario de Ávila.
Mit freundlicher Genehmigung des Historico Archivo Provincial Avila.
Buchsatz, Karte & Innengestaltung: Phantasmal Image
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
https://dnb.de abrufbar.
Der acabus Verlag ist ein Imprint der Bedey Media GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg
https://www.acabus-verlag.de
© acabus Verlag, Hamburg 2024
Alle Rechte vorbehalten.
Gedruckt in Deutschland
Inhalt
Impressum: 2
1Prolog 5
2Liebe und Tod 12
3Lebenslust 47
4Die Augustinerinnen 103
5 Entscheidung und Widerstand 128
6Himmel und Hölle 135
7Die Schwingen des Todes 143
8Der Heilige Josef 204
9Verloren 220
10Die zweite Bekehrung 230
11Verlassen 270
12Engelsstimmen 284
13Fürchte dich nicht 288
14Mut und Widerstand 300
15Verzückung und Fall 345
16Der Ordensgeneral 384
17Schiffbruch in Medina del Campo 392
18Die Prinzessin 417
19Die Macht der Liebe 432
20Das Lied der Liebe 446
21Verliebt in Andalusien 460
22Sevilla 496
23Arrest 511
24Die zerknüllte Wahl 519
25Die siebte Wohnung 529
26Schachmatt 541
27Santa Teresa 545
Nachwort 551
1
Prolog
Avila, 1559
Alles deutete darauf hin, dass es ein gewöhnlicher Oktobernachmittag war. Die spanische Sonne erfüllte die Räume des Klosters mit Wärme, in der Ferne läuteten die Glocken von Ziegen, und wenn sie genau hinhörte, meinte sie das Hämmern eines Steinmetzes zu vernehmen. Das Viertel der Handwerker lag zwischen dem Konvent und der mächtigen Stadtmauer von Avila, manchmal trug der Wind die Geräusche des Lebens von draußen in ihre geräumige Zelle. Sonst war es still und eine Atmosphäre sanfter Gelassenheit lag in der Luft.
Teresa schätzte diese Momente, vor allem wenn sie Zeit und Muße zum Lesen fand. Die Welt schien friedlich zu sein, nichts wies auf finstere Wolken des Unheils hin, auch nicht, als die Stille durch fliegende Füße auf den Treppenstufen durchbrochen wurde. Manche Menschen brauchte sie nicht zu sehen und wusste dennoch, wer zwei Stufen auf einmal nehmend zum Zimmer hoch stürmte. Es konnte nur die fröhliche Estefania Samaniego sein.
Teresa sah von ihrem Buch auf, ungern, wie sie sich eingestand. Sie liebte es, sich in Worte zu versenken, die ganze Welten weben konnten. Noch mehr schätzte sie es, wenn die Zeilen sie nachdenklich zurückließen, ihr eine Spur zeigten, zu Neuem und Unerwartetem, sie zu geheimnisvollen Türen führten. Manchmal öffneten diese sich nur einen Spaltbreit, gerade lang genug, um einen Lichtblick in das Innere zu erhaschen. Bücher waren für sie Tore ins Paradies. Nur zu gerne schritt sie hindurch und verlor sich im Staunen über diese Welt. Doch sie hatte dort auch ein Geheimnis gefunden, auf der anderen Seite dieser versteckten Pforten. Eines, von dem sich viele ihrer Mitmenschen wünschten, dass es niemals an das Licht dieser Welt kommen würde.
Die Tür zu ihrer Zelle flog auf.
»Hast du schon gehört?«, sprudelte es aus Estefania heraus, während sie gleichzeitig nach Luft schnappte. Sie musste gerannt sein, vermutlich den ganzen Weg aus dem Besuchszimmer. »Juliana hat einen Brief aus Frankreich erhalten. Er wurde von einem persönlichen Boten überbracht, aber der war Spanier, keinesfalls Franzose und war in kostbare Gewänder gekleidet, viel zu reich für einen …«
Teresa war bestens informiert über das Gerede, dass die so unscheinbar wirkende, hagere Juliana Briefe schrieb, angeblich an ihren Vetter in Frankreich. Der Inhalt dieser Schreiben sollte gänzlich anderer Natur sein, als es innerhalb der Familie zu erwarten wäre. Sie sollten gar sündig sein, sagten einige. Teresa kannte niemanden, der diese Briefe je zu Gesicht bekommen hatte. Doch die Gerüchte bekamen dadurch Aufwind, dass Juliana dabei erwischt worden war, wie sie des Nachts an der Mauer gestanden und durch einen Spalt mit jemandem gesprochen hatte. Und auf der anderen Seite sollte ein Mann gesehen worden sein, der auf keinen Fall ihr Vetter hätte sein können.
Doch Teresa stand nicht der Sinn nach Einblicken dieser Art. Etwas stimmte nicht. Die ganze Zeit schaute Estefania sie nicht an, ausgerechnet sie, die mit ihren aufgeschlossenen, braunen Augen die Offenheit in Person war. Estefania kam mit allen schnell ins Gespräch und konnte mit ihrer fast naiven Art kein Geheimnis für sich behalten. Nun wirkte sie fahrig, sie fürchtete Teresas prüfenden Blick.
»Estefania.«
»Zu reich für einen Boten, viel zu gut gekleidet, so ganz in Schwarz, er strahlte so etwas Ehrfurchtsvolles aus …«
»Estefania! Was ist wirklich los?«
Für einen Moment war es still, Estefanias Mund öffnete sich, schloss sich wieder, nur um erneut anzusetzen, ohne einen Ton herauszubringen.
»Ich … ich weiß nicht, wie …«
»Dios mio, sag es einfach!«
»Es wird dir nicht gefallen, liebst du es doch so sehr …«
»Was denn?«
»Das Lesen, deine Bücher.«
Verwirrt schaute Teresa sie an. Worauf sollte das hinauslaufen?
»Das Lesen, von Büchern«, wiederholte Teresa gedehnt.
»Ja, die Bücher. Also nicht alle Bücher, aber ich glaube, die Bücher, die du gerne liest, die sind, die sollen …«, stammelte Estefania.
»Heilige Muttergottes, reiß dich zusammen, ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst.«
»Die Inquisition war da.«
In Teresas Adern gefror das Blut. Die Inquisition war immer heikel. War es eh schon schwierig genug, ihr Leben so zu leben, wie sie es wollte, so machten es die Herren der Heiligen Inquisition nicht leichter, um nicht zu sagen, für viele Menschen lebensgefährlich. Sie selbst hatte keine Angst vor diesen Männern, Vorsicht war dennoch immer geboten.
»Ja, die Inquisition«, setzte Estefania fort, griff sich ans Herz, und ließ die Worte aus sich heraus purzeln, anfangs mit langen Pausen, dann immer schneller und zusammenhängender. »Sie verbieten alle Bücher, die im Verdacht stehen, die Menschen auf Irrwege zu führen. Alle Bücher, die ich bei dir gesehen habe, Teresa, sind auf deren Liste. Zudem verbieten sie Frauen, selbst religiöse Texte in unserer Landessprache zu verfassen oder gar zu verbreiten. Die Heilige Inquisition befiehlt, dass alle Bücher, die sie auf den Index setzen, verbrannt werden.«
»Was?«, Teresa starrte Estefania an, als ob sie nicht von Sinnen sei. Begriff sie, was sie da sagte? Estefanias betroffenem Gesicht sah sie nur Ehrlichkeit an. Sie ahnte sehr wohl, welche Tragweite diese Botschaft für Teresa hatte.
»Mir wird übel«, murmelte Teresa. Der Raum begann, sich um sie herum zu drehen, ihre Knie waren wachsweich. Ihre Bücher. »Sie verbieten die Bücher?«
»Das ist das, was sie gesagt haben«, stammelte Estefania. »Ich … ich wusste, dass das keine guten Nachrichten für dich sind. Sie wollen vor allem uns Frauen verbieten, die Bibel oder geistliche Schriften zu lesen, sie sagten, die Bibel sei nicht für ›Zimmermannsfrauen‹ geschrieben.«
»Wie bitte?«
»Auch wenn die Frauen«, zitierte Estefania die Inquisition weiter, »mit unersättlichem Appetit danach verlangen, von dieser Frucht zu essen, ist es nötig, sie zu verbieten und ein Feuermesser davor zu stellen, damit das Volk nicht zu ihr gelangen könne.«
»Das nennst du keine guten Nachrichten? Unsere Welt steht in Flammen.«
»In Valladolid und Sevilla brannten die Feuer bereits, allerdings mit Menschen.«
Teresa nickte, wie vor den Kopf geschlagen.
»Das waren vor allem Menschen, die dem Martin Luther folgten«, sagte Estefania, »da hast du wohl nichts zu befürchten, doch …«
»Was denn noch?«
»Du hast ja auch schon mal was geschrieben, über dein Leben, und das ist auf Spanisch.«
Teresa wich das letzte Blut aus ihrem Gesicht.
»Das muss verschwinden, sonst brennen nicht nur die Bücher«, stimmte Teresa leise zu.
Estefania trat einen Schritt auf Teresa zu, legte die Hand auf ihren Arm und schaute sie offen an.
»Ich bin nur ein Mensch von einfachem Gemüt, ich verstehe von vielem, was du sagst, wenig bis nichts. Doch …«, Estefania sah sie mit einem Ernst an, den Teresa noch nie bei ihr zuvor gesehen hatte. War da ein Flackern von Wut in diesem sonst vor Heiterkeit strahlendem Gesicht? »Vielleicht sollte es nur gut versteckt sein. Du bist etwas Besonderes, Teresa. Das Buch über dein Leben muss gerettet werden, alle werden es lesen, auf der ganzen Welt. Deinen Namen werden sie auch noch in Jahrhunderten kennen.«
»Du bist ja völlig verrückt, ich bin ein einfacher Mensch.«
»Ich bin nicht verrückt, und du bist kein einfacher Mensch. Und was die anderen Bücher angeht«, sie zeigte auf Teresas Regal. »Sieh es mal so, es sind doch nur Bücher, oder? Und nicht du oder ich.«
Teresa nickte wie betäubt. Tränen sammelten sich in ihren Augenwinkeln.
»Weißt du, ich habe Bücher mein Leben lang geliebt«, antwortete Teresa. »Ganz gleich welcher Art. In meiner Kindheit habe ich sogar romantische Ritterromane gelesen.«
»Wirklich, du?«, Estefania sog die Luft ein, dann lachte sie prustend. »So richtig mit tapferen Rittern und holden Prinzessinnen? Und mit Männern, die die Frauen umschwärmen und mit Schönheiten, die den Rittern den Kopf verdrehen?«
Gegen ihren Willen musste Teresa auch lachen, während ihr eine Träne über die Wange rann.
»Ja, genau solche«, nickte sie, »in denen die Männer so ehrenhaft waren und immer die Wünsche der Frauen von deren Augen ablasen, bevor ihnen diese auch nur über die Lippen kommen konnten. Ich habe mit meinem Bruder zusammen sogar einmal begonnen, selbst ein solches Werk zu schreiben.«
»Teresa, ich dachte immer, so wie du lebst, wirst du noch eine Heilige, und jetzt erzählst du so etwas.«
Teresa lachte und weinte zugleich.
»Ich und eine Heilige, ich wüsste nicht, was weiter voneinander entfernt sein könnte. Wenn ich allein daran zurückdenke, wozu ich mich in meiner Jugend alles habe verleiten lassen. Einer meiner Basen folgte ich fast blind in allem, was sie tat, und ich war nur zu gerne bereit, allerlei Übeltaten zu begehen. Als ich damals ins Kloster ging, und dann später so krank wurde, da waren es Bücher, die mich aufrichteten, wenn auch ganz andere als die galanten Ritterromane.«
»Diese da?«, fragte Estefania und zeigte auf die Lektüren in Teresas Regal, hing aber gedanklich offenbar noch bei den romantischen Werken.
»Ja, diese«, antworte Teresa leise. »Weißt du, ich zweifle so, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Die Menschen, die diese Bücher geschrieben haben, sind wie meine Freunde, reden zu mir über Raum und Zeit hinweg. Sie sind die Einzigen, die mir Mut und Halt geben. Bitte ziehe daraus keine falschen Schlüsse, deine Gegenwart ist unendlich kostbar für mich …«
»Keine Sorge, ich begreife zwar nicht, was du sagst, so wie ich nicht fassen kann, was dich bewegt. Auch verstehe ich nicht, wie ein Buch ein solcher Freund sein kann, doch ich sehe, dass sie es für dich sind. Ich wünschte, ich hätte dir bessere Nachrichten überbringen können.«
Teresa atmete tief durch, wischte sich die Tränen weg, schüttelte den Kopf.
»In was für einer Welt leben wir, dass wir Frauen nicht lesen dürfen, was wir wollen, dem Wort von Frauen so wenig Wert beigemessen wird. Eine Welt, in der wir nicht leben dürfen, wie wir es für uns entscheiden.«
»Es ist unfassbar ungerecht. Aber so ist die Welt nun einmal, niemand vermag etwas dagegen zu machen.«
»Die Welt bleibt immer so, wie sie ist, wenn wir sie lassen, wie sie ist«, sagte Teresa.
»Wir sind Gefangene in dieser Welt«, sagte Estefania.
Teresa sah sie lange an. Sie hatte Estefania noch nie so ernst, so bedrückt erlebt. Sie hatte immer einen Scherz auf den Lippen, lebte und lachte mit einer bewundernswerten Einfachheit und gottgegebener Arglosigkeit. Doch war diese offenbar nur ihr Schild, ein Schutzwall gegen die Ungerechtigkeit, um das Unerträgliche zu ertragen. Teresa hatte sich in der jungen Frau grundlegend geirrt.
»Vielleicht sollten wir uns Räume erobern«, sagte Teresa leise. »Die wir gestalten, alleine.«
»Alleine gestalten?« Estefania schüttelte ungläubig den Kopf. »Was hast du vor?«
»Ich weiß es noch nicht. Aber so kann es nicht weitergehen.«
Estefania nickte.
»Wenn du einen Weg findest, teile es gerne. Allerdings muss ich jetzt los, ich bekomme gleich noch Besuch von meiner Schwester. Ich wollte dir nur schnell die Kunde bringen, bevor jemand anderes kommt und dir ohne Vorwarnung deine geliebten Bücher nimmt.«
»Dank dir sehr dafür.«
Estefania straffte sich und lächelte zaghaft. »Es geht schon weiter, nimm es nicht zu schwer, das Leben geht immer auf die eine oder andere Weise weiter.« Noch während sie das sagte, drehte sie sich um und rannte durch die Tür, die Stufen hinunter, als ob sie dem Gespräch und der Schwere dadurch entfliehen könne, und entschwand Teresas Blick.
Die Stille, die blieb, war ohrenbetäubend.
Langsam drehte sich Teresa um, zu dem Regal mit den Büchern. Das Skript mit den vielen Seiten über ihr Leben, das konnte sie verschwinden lassen, das war nicht tragisch. Ihre Bücher allerdings standen auf einem gänzlich anderen Papier. Sie glitt mit ihren Fingern liebevoll über die Einbände. Das konnte niemand verstehen.
Niemand.
Sie nahm eines der Werke, öffnete es und legte es liebevoll auf den Tisch. Sie würde dieses Buch vermutlich nie wieder sehen, diese Zeilen nie mehr lesen können. Wut brandete in ihr auf, sie ballte die Faust und holte aus. Doch bevor sie auf dem Tisch vor ihr aufkam, ertönte eine Stimme.
›Sei nicht betrübt, denn ich werde dir ein lebendiges Buch geben.‹
Sie erstarrte mitten in der Bewegung, drehte sich verblüfft um.
»Eure Majestät?«
2
Liebe und Tod
Dezember 1528
Kalt pfiff der Wind durch die nächtlichen Straßen, trug feinen Sprühregen mit sich, der sich mehr und mehr mit Schneeflocken mischte. Die Kälte kroch mit der Dunkelheit in die Gemäuer, während die Finsternis auf Schattenschwingen durch die Gassen glitt.
Teresa hätte nicht draußen sein dürfen. Erst recht nicht zu dieser Stunde, dazu noch allein, ein Mädchen, jung, im heiratsfähigen Alter. Falls sie erwischt würde, wäre das ein Skandal, über den sich die Gemüter wochenlang erhitzen würden. Ihr drohte der Pranger, wenn nicht Schlimmeres. Doch bei diesem Wetter hatte ihre Base Ines sie nicht nach Hause begleiten wollen. Wären sie gemeinsam aufgegriffen worden, hätte das vermutlich nichts besser gemacht. Es galt zu hoffen, dass bei dieser Witterung und gar in der dunkelsten Stunde der Nacht keine weitere Menschenseele unterwegs war.
Teresa zog sich den groben Überwurf fester über den Kopf, sodass nur die Nasenspitze hinausschaute. Der Wind biss dennoch eisig in ihre Wangen. Kalt war ihr nicht. Allein bei dem Gedanken, was heute Nacht geschehen war, oder besser gesagt, hätte geschehen können, pulsierte es heiß durch ihre Adern.
Sie hatte es fast geschafft, nur noch um die eine Ecke, danach durch die enge Gasse, die eine leichte Kurve beschrieb, und dann war sie gleich da. Sie rannte in das Gässchen, so rasch ihre Beine sie trugen. Die Hälfte lag bereits hinter ihr. Wassertropfen spritzten unter ihren Füßen hoch. Sie hörte ihren eigenen, schnellen Atem, hörte ihre Schritte von den Wänden widerhallen.
Fast hätte sie ihn übersehen.
Er bog in das obere Ende des Weges ein, noch ein Stück weit entfernt. Ein großer, breitschultriger Schatten.
Teresa erstarrte mitten in der Bewegung. An ihm kam sie nicht vorbei, die Gasse war zu schmal. Zudem, wer mochte außer ihr um diese Stunde unterwegs sein? Mit Sicherheit keine ehrenwerte Gestalt.
»Mist!«, fluchte sie, drehte sich um und rannte los. Hatte er sie bemerkt? Sie wagte nicht, sich umzudrehen, doch hörte sie keine Schritte, die ihr folgten. Sie bog um die Ecke, weiter in die Richtung, aus der sie gekommen war. Hatte sie vorhin nicht eine Nische gesehen, in der sie sich jetzt verstecken könnte? Da! Ein enger Spalt zwischen zwei Häusern, eher ein Trampelpfad als eine Gasse. Es würde langen.
Hoffte sie zumindest.
Teresa sprang hinein in die Dunkelheit und kauerte sich nieder. Die Schritte kamen näher. Betrunken wirkte der Mann nicht, was machte der bloß hier? Und warum musste er ausgerechnet jetzt ihren Weg kreuzen? Sie konnte den Atem des Fremden hören, der Schneeregen wurde dichter, der Unbekannte wurde langsamer, als er auf Teresas Höhe war. Teresa duckte sich, so tief sie konnte, in den Schatten ihres Versteckes. Eiskaltes Wasser rann ihr in die Schuhe, sie biss die Zähne zusammen.
Der Fremde blieb stehen. Drehte sich in ihre Richtung.
Teresa verbarg sich fast gänzlich in den Überwurf. Hoffentlich verschmolz dieser mit der Dunkelheit, die sie umgab. Zumindest so, dass sie vor dem suchenden Blick verborgen blieb.
Sie konnte von der Gestalt nur die feinen Schuhe sehen. Diese machten einen Schritt auf sie zu.
Teresa hielt den Atem an.
Eine Böe fegte durch die Straße. Der Fremde brummte etwas Unverständliches, das Wind, Schnee und Regen davontrugen, besann sich offenbar und eilte dann weiter.
Teresa war allein. Sie hätte weinen und zugleich lachen können. Wozu hatte ihre Base sie da nur verleitet. Natürlich, es war aufregend, auch schön, gleichwohl ein Spiel mit dem Feuer. Es war so leicht, durch so eine Unbedachtheit den guten Ruf ihrer Familie zu gefährden oder gar ihre Ehre – die honra – zu verlieren.
Ehre war alles.
Ohne Ehre war man verloren.
Sie raffte sich auf und eilte weiter, so schnell sie konnte. Sie erreichte das Haus auf der Rückseite. Das von der Nässe geschwärzte Holz der Gesindetür hob sich von der hellen Hauswand glänzend ab. Vorsichtig drückte sie die Tür auf.
Gott sei gepriesen, sie war offen. Schnell schlüpfte sie in das schützende Haus. Als die Tür hinter ihr leise ins Schloss schnappte, atmete sie auf und ließ sich gegen das Holz fallen. Das Wasser tropfte aus ihrer Kleidung, ihre Schuhe waren völlig durchnässt und hinterließ eine dreckige Lache auf dem Steinboden. Was für eine Nacht.
»Teresa?«
Sie erstarrte zur Salzsäule. Warum war um diese Zeit noch jemand wach? So laut konnte sie gar nicht gewesen sein.
»Teresa, bist du es?«
»Dios mio«, atmete sie erleichtert auf. Es war Clara, eine der treuen Bediensteten, die immer ein oder auch zwei Augen zudrückte.
»Das ganze Haus ist auf den Beinen, sie suchen schon nach dir«, sagte Clara aufgeregt.
»Wieso sind denn alle wach, es ist doch mitten in der Nacht?«
»Deine Mutter …, aber warum stehst du noch immer an der Tür?«
Clara hob die Laterne an, die sie bei sich führte, und kam rasch näher. Teresa nahm ihren Überhang ab. Ihr langes, krauses Haar fiel nass hinunter. Doch Clara schaute ihr fassungslos ins Gesicht.
»Mutter Maria, wie siehst du denn aus?«
Da dämmerte es Teresa. Natürlich. Es waren nicht nur die Nässe und der Dreck. Der Regen hatte ihre Schminke sicher völlig verwischt, die zum Anfang der Nacht ihre schönen Gesichtszüge noch betont hatte. Sie musste einen furchtbaren Anblick darbieten.
»Warte, so geht das nicht«, erklärte Clara resolut. »Zieh deine Schuhe aus, den Überhang lässt du auch hier, ich mach das später sauber. Du kommst gerade mit in die Küche und ich hole dir deine Sachen.«
In der Küche war es wärmer, ein Kessel mit Wasser köchelte leise auf dem Herd. Wer machte um diese Zeit heißes Wasser? Und warum war angeblich das ganze Haus wach? Teresas Mutter hatte mit Sicherheit nicht nach ihr suchen lassen, dafür ging es ihr nicht wohl genug. Und nach der letzten Schwangerschaft war sie gesundheitlich noch schwerer angeschlagen als zuvor. Wie viele Geburten waren es gewesen? Mit den Fehlgeburten? Mehr als ein Dutzend, sie hatte elf Geschwister, davon waren zwei aus der vorigen Ehe ihres Vaters entsprungen, sie kannte ihre Mutter gar nicht anders als schwanger und sie selbst war mittlerweile vierzehn. Jetzt sah ihre Mutter aus wie eine alte Frau; zu allem Übel kleidete sie sich auch bereits wie eine. Dabei war sie erst dreiunddreißig.
Teresa fing an, sich aus den nassen Sachen zu schälen. Ihre Finger waren ganz blau vor Kälte, und obwohl sie nun im Warmen war, begann sie zu frieren. Vielleicht würde es heute Nacht Frost geben. Die Aufregung, die Anspannung und auch das Rennen durch die nächtlichen Straßen von Avila hatten sie das alles nicht spüren lassen.
Clara kam mit einem Tuch und frischen Sachen.
»Warum bringst du mir Kleidung?«, fragte Teresa. »Ich trockne mich ab und laufe heimlich in mein Zimmer, da schlüpfe ich ins Bett und niemand merkt etwas.«
»Daraus wird nichts«, antwortete Clara bestimmt. »Alle sind auf den Beinen.«
Teresa wurde es trotz der Kälte siedend heiß. Dass sie gelegentlich aus der Tür für das Gesinde entschwand, für gewöhnlich mithilfe von Clara oder einer anderen Bediensteten, war kein wirkliches Geheimnis. Doch bisher hatte sie ihren Vater immer um den Finger wickeln können, lange trug er ihr ein solches Fehlverhalten nicht nach.
»Woher wissen sie, dass …«, fragte Teresa.
»Der Arzt war gerade da«, antwortete Clara.
Teresa war nun völlig verwirrt. Ein Medikus? Langsam dämmerte ihr, dass es nicht um sie ging. Völlig entkleidet ließ sie sich willig von Clara kräftig mit dem Tuch abrubbeln.
Es ging nicht um sie. Sie atmete durch. Gott sei Dank!
»Deiner Mutter ging es in den letzten Stunden von Augenblick zu Augenblick schlechter, die letzte Geburt war …«, erklärte Clara.
»Ja, die war sehr schwer.«
»Zu schwer!«, beendete Clara den Satz, während sie eilig begann, Teresa in die mitgebrachten Kleider zu helfen.
Teresa hielt inne und packte Claras Arm.
»Wie … wie meinst du?«
»Der Medikus hat wenig Hoffnung, dass sie die nächsten Wochen übersteht.«
»Was?«
»Lass dich schnell ankleiden, dann siehst du es selbst, sie fragt nach dir.« Geschickt half ihr Clara weiter in die trockenen Sachen, zog das Korsett fest.
»Dios mio, du hast wirklich den perfekten Körper für diese Mode«, murmelte Clara. »Ich wünschte, es würde bei mir nur annähernd so gut aussehen.«
Teresa hörte das Kompliment nicht. Ihre Mutter sollte im Sterben liegen? Das konnte, ja das durfte nicht wahr sein. Ihre Mutter würde das schon schaffen. So wie immer. Sie musste einfach.
»So, fertig. Lass dich anschauen«, sagte Clara. »Oh nein, Mutter Maria, wo habe ich nur meinen Kopf, dein Gesicht.«
Schnell ging sie zum Herd, goss ein wenig heißes Wasser in eine Schale und tunkte ein frisches Tuch hinein. Clara griff in einen Schrank, holte eine kleine Schatulle hervor. In dieser verbarg sich nicht nur ein wenig Schmuck und das Allernotwendigste, um sich für eine nächtliche Verabredung hübsch zu machen. Auch Utensilien zum Abschminken fanden sich darin, wenn sie spät nach Hause kam. Clara setzte etwas an, mischte es mit dem Wasser. Teresa spürte kaum, wie Clara ihr Gesicht benetzte und geschickt die verwischte Schminke entfernte. Sie schloss die Augen.
Ein Gedanke bemächtigte sich ihrer, breitete sich aus und ließ sie nicht mehr los.
Was würde passieren, wenn ihre Mutter wirklich sterben sollte? Was würde ihr Vater machen, mit zwölf Kindern? Musste sie dann heiraten, um ihm nicht zur Last zu fallen? Ihr wurde allein bei der Vorstellung schlecht.
»Fertig«, hörte sie Clara sagen. »Du bist sehr blass, Kind, aber du siehst nicht mehr aus, als ob du gerade durch die Hölle geritten wärst.«
Teresa wusste im Nachhinein nicht mehr, wie sie es an das Bett ihrer Mutter geschafft hatte. Sie sah nur die Kerzen, die ein schwaches Licht in den dunklen Raum warfen und die eingefallenen Gesichtszüge ihrer Mutter beleuchteten. Sie nahm ihre Geschwister kaum wahr, die alle da waren, teils neben dem Bett auf Stühlen saßen oder sich in den Hintergrund des kleinen Raumes verzogen hatten. Ihr Vater saß zusammengesunken auf der anderen Seite der Schlafstatt, hielt die Hand seiner Frau. Teresa hörte, wie er leise ihren Namen wiederholte, Beatriz, immer wieder.
Rodrigo, ihr knapp drei Jahre älterer Lieblingsbruder, machte ihr am Bett Platz. Als er ihr den Stuhl hinrückte, fragte er sie ins Ohr flüsternd:
»Wo bist du denn gewesen?«
Teresa schüttelte geistesabwesend den Kopf. Als sie sich setzte, drehte sich ihre Mutter zu ihr hin, so gut es ging.
»Teresa, meine Liebe.« Ihre Stimme war brüchig, doch ihr Blick klar, auch wenn ihr anzusehen war, dass sie Schmerzen hatte. »Gib mir deine Hand, meine Liebe, weine nicht, ja? Das Leben ist so schön, genieße es! Du bist so eigenwillig und so wundervoll dickköpfig, ich weiß gar nicht, von wem du das hast. Du wirst deinen Weg finden.«
Teresa rang nach Worten, ihr Mund öffnete sich, doch sie bekam keinen Ton heraus.
»Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada.« Ihre Mutter legte all ihre Liebe hinein, als sie Teresas ganzen Namen aussprach, mit einer Ruhe, die wohl nur denen vorbehalten war, die den Tod vor Augen hatten. »Du bist etwas Besonderes. Du willst immer mit dem Kopf durch die Wand, akzeptierst selten ein Nein und ich weiß wirklich nicht, wie Gott sich deinen Platz in dieser Welt vorstellt. Doch wenn eine Frau ihren Weg in diesem undankbaren irdischen Leben finden wird, dann bist du das.«
Sie hustete.
»Ich hatte ein gutes Leben«, fuhr sie nach kurzem Zögern fort, sie sprach sehr leise, so als ob diese Worte nur für Teresas Ohren gedacht waren. Teresa beugte sich weit vor, damit sie ihre Mutter noch verstehen konnte. »Ich habe einen guten Mann, gut gelungene Kinder, wären da nur nicht diese verdammten Geburten, diese Pflicht, immer auf ein Neues zu gebären.«
Schwang da Wut in ihren Worten mit? Noch bevor Teresa das ergründen konnte, fuhr ihre Mutter bereits fort.
»Das Leben und Gott haben es gut mit mir gemeint, nur ist es sehr bedauerlich, dass ich nie die Abenteuer der Ritter erleben durfte, von denen wir gemeinsam in den Geschichten gelesen haben. Erinnerst du dich?«
Teresa nickte. Tränen liefen ihr über das Gesicht. Natürlich, wie hätte sie diese vergessen können?
»Aber das ist einer Frau in dieser Zeit wohl verwehrt.« Die Stimme von Beatriz de Ahumada wurde noch schwächer. »Doch bitte versprich mir, finde einen Weg, der dich glücklich macht!«
Teresa wartete einen Moment, aber es waren nur die ruhigen Atemzüge zu hören und der sanfte Druck der Hand zu spüren, die Teresa immer noch hielt.
•
Die ersten Lichtstrahlen der morgendlichen Sonne kämpften sich durch die Wolkendecke und fielen durch die Fenster. Teresa war todmüde. Sie saß gemeinsam mit Rodrigo vor dem elterlichen Zimmer im ersten Stock, auf der steinernen Treppe, die nach unten führte, ihren Kopf an seine Schulter gelehnt.
»Wir sind so kurz vor der Heiligen Nacht, der Noche Buena, meinst du, sie erlebt die noch?«, fragte Teresa leise.
»Sie ist zäh, zäher zumindest, als der Medikus für möglich hält«, antwortete Rodrigo. »Herr Vater hat auch noch nicht den Priester holen lassen, er hat vorhin sogar gemeint, dass er sie auf unseren Landsitz nach Gotarrendura bringen will. Es sei einfach schöner dort.«
Teresa nickte. Ihre Mutter war oft krank gewesen, selten war ihr ein Wort des Leidens über die Lippen gekommen und sie hatte sich trotz aller Mühsal immer wieder erholt. Bis jetzt. Allerdings eine lange Tagesreise in den unwirtlichen Norden, zu dieser Jahreszeit, das war vermutlich nicht die beste Idee ihres Vaters.
»Was wird nur aus uns?«, murmelte Teresa.
»Ich träume davon, mich aufzumachen, eines Tages mit einem der Schiffe über den Atlantik, auf den Spuren von Kolumbus und Amerigo Vespucci in die Neue Welt.«
»Westindien?«
»So wird es immer noch genannt.«
»Das ist sehr weit«, flüsterte Teresa.
»Dort sollen Reichtümer warten, unvorstellbare Mengen an Gold und Silber«, sagte Rodrigo. »Daselbst soll es Gold geben wie hier in Spanien Eisen. Neulich belauschte ich Konquistadoren, die erwähnten etwas von El Dorado, wobei mir unklar ist, ob es ein Mann, eine Stadt oder gar ein Land ist. Eines war jedoch klar, es gibt dort unfassbaren Reichtum.«
»Du willst wirklich nur wegen des Geldes dorthin, hast du hier nicht genug?«
»Du weißt genau, dass wir kein endloses Vermögen haben«, sagte Rodrigo und strich Teresa durchs krause, schwarze Haar. »Vater wird genug damit zu tun haben, uns Kinder alle durchzubekommen und gut zu verheiraten.«
»Heiraten …« Teresa schüttelte sich. »Ich bin lieber frei.«
»Du wirst mit deiner Schönheit den Männern den Kopf verdrehen«, lachte Rodrigo leise. »Wenn du das nicht jetzt schon machst. Wie willst du sonst die Freuden des Lebens erfahren, ohne deine Ehre zu verlieren?«
Teresa spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht stieg; so unverblümte Andeutungen durfte nur ihr Lieblingsbruder machen.
»Du lenkst ab«, sagte sie etwas zu schnell. »Du willst also nur in die Ferne reisen, um Vater nicht auf der Tasche zu liegen?«
»Nein, natürlich nicht, nicht nur zumindest«, antwortete Rodrigo. »Du weißt selbst, dass wir Nachfahren von Juden sind. Immer noch werden wir als conversos angesehen, die die neue Religion nur unter Zwang angenommen haben, obwohl wir schon lange Christen sind. Nicht wenige beschimpfen uns als Schweine und auch unser Adelstitel ist nur ein erkaufter, der uns nicht vor allem beschützt.«
»Aber es gab ein Gerichtsurteil, unser Adelstitel ist verbrieft und bestätigt«, begehrte sie wütend auf.
»Genau, es gab eine Verhandlung, ob unser Titel überhaupt rechtens ist.« Rodrigo ließ die Worte wirken. Teresa versuchte, mit ihrem übernächtigten Geist den Punkt zu finden, den ihr Bruder machen wollte. Sie schüttelte unwirsch den Kopf.
»Glaubst du ernsthaft, man hätte gegen ein ehrwürdiges Mitglied der Stadt, gegen jemanden, dessen Familie schon immer im christlichen Glauben gestanden hat, gegen jemanden mit sogenanntem reinen Blut ein solches Verfahren angestrebt?«, fragte Rodrigo.
»Das ist so ungerecht«, brauste Teresa wütend auf. »Was hätte Großvater denn machen sollen? Er hatte damals nur die Möglichkeit zu gehen, zu sterben oder ein converso zu werden. Was hat das aber mit mir zu tun? Wir sind lange vor meiner Geburt von Toledo nach Avila gezogen, damit die Leute uns nicht kennen, wir ein neues Leben anfangen können. Hier ist unsere ganze Bibliothek voll von christlichen Büchern, wir gehen immer in die Messen, wir feiern alle Feiertage …«
»Du hast mich sogar dazu angestiftet, dass wir gegen die Mauren ziehen, um als christliche Märtyrer zu sterben.«
Teresa musste wider ihren Willen lachen. »Da war ich sieben Jahre.«
»Ja, und ich war elf, und du hast mir allen Ernstes erzählt, wir würden dadurch in den Himmel kommen und ich würde endlose Schätze erhalten.«
»Wenn wir nur die Araber erreichen und sie uns den Kopf abhauen würden«, nickte Teresa.
»Die hätten sich sicher sehr gewundert, wenn wir da bei ihnen aufgekreuzt wären.«
»Wir sind ganz schön weit gekommen, bis zu den vier Säulen auf dem Weg nach Salamanca.«
»Wir waren gerade einmal auf der Brücke direkt vor der Stadtmauer.«
»Ein ganzes Stück des Weges waren wir schon«, beharrte Teresa. »Wäre unser Herr Onkel nicht gekommen, mit einem Pferd, das viel schneller ist, als wir es je hätten sein können, dann hätten wir es geschafft! Wir hätten vielleicht noch früher aufstehen sollen, damit wir nicht so schnell entdeckt werden. Dass Eltern auch immer so schnell besorgt sein müssen, da ist Familie manchmal eine echte Bürde.«
»Danach haben wir uns wieder darauf beschränkt, die Tode durch ein Märtyrertum zu spielen. Ich glaube, es war ein ganz schönes Spektakel, das wir geliefert haben.«
Teresa grinste bei der Erinnerung daran.
»Du bist einfach ein herrlicher Märtyrer«, sagte sie. »Die Idee mit der Eremitage fand ich aber auch sehr schön.«
»Stimmt, wir haben auf unserem Landsitz in Gotarrendura alle Steine zusammengesucht, derer wir habhaft werden konnten«, schmunzelte Rodrigo. »Dann haben wir sie in den Garten gekippt, auf verschiedene Haufen.«
»Um dann wunderschöne und durch Schlichtheit bestechende Behausungen zu errichten, in denen wir uns dann als Eremitin und Eremit zurückziehen wollten.«
»Nur dass die Steine nicht hielten und wir über die Grundmauern nicht hinwegkamen«, meinte Rodrigo lachend.
Teresa knuffte ihren Bruder in den Oberarm.
»Das ist nicht wahr, wir hatten nur kein Glück mit den Dächern.«
»Mit den Dächern? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir es jemals bis zu den Fenstern geschaffen hätten.«
»Welche Einsiedelei braucht schon Fenster? Es geht um das Innen, nicht um das Außen«, erwiderte Teresa.
»Wir haben ganz schön viele Steine in den in den Garten geschleppt. Irgendwann hat es Frau Mutter gelangt.«
»Stimmt, sie hat uns dann alles zusammenkehren lassen und dafür gesorgt, dass es wieder auf das Feld gebracht wurde«, grinste Teresa. »Dabei waren das sehr schöne Einsiedeleien. Eine kleine habe ich auch hier gebaut, der Steinhaufen liegt immer noch im Innenhof.«
»Einen direkten Weg in den Himmel, das war es, was wir suchten«, sagte er leise. »Da wollten wir hin und dann dort für ewig bleiben. Wir wurden nicht müde, uns zuzurufen: ›Für immer, immer, immer‹, wie ein Versprechen, ein Kampfesruf, ein göttlicher Eid.«
»Ja, das haben wir: für immer, immer, immer.«
Sie saßen eine Weile schweigend nebeneinander.
»Manchmal sehne ich mich wirklich nach einem Ort jenseits des Lärms der Welt«, sagte Teresa leise. »Ein Ort, an dem einfach nur Frieden ist.«
»Das verstehe ich sehr gut«, sagte Rodrigo. »Vielleicht finde ich diesen ja in Westindien.«
»Doch ich werde hierbleiben, und dann?«, fragte Teresa. »So wie meine Mutter will ich nicht enden.«
»Wie bitte?«, frage Rodrigo erstaunt.
»Schau sie doch an, sie ist noch jung und sieht schon lange wie eine alte Frau aus, eingefallen und ausgemergelt. Sie heiratete und bekam danach ein Kind nach dem anderen.«
»Das ist der Lauf der Welt.«
»Der Lauf der Welt, wenn ich das schon höre.« Teresa atmete verächtlich aus. »Ich will nicht einem Mann gehören, nach seiner Pfeife tanzen und nur noch gebären müssen.«
»Ich glaube, kleine Teresa, du wirst dich nie nach den Befehlen eines anderen richten«, lachte Rodrigo. »Ich würde eher sagen, dass du es sein wirst, die den Weg weist.«
Teresa musste wider Willen lachen.
»Du bringst mir selbst in dieser dunklen Stunde Licht und Heiterkeit in mein Leben«, sagte Teresa. »Bitte, versprich mir, geh nicht fort von hier, zumindest nicht so bald.«
•
In den nächsten Tagen änderte sich der Gesundheitszustand ihrer Mutter nicht. Doña Beatriz schlief die meiste Zeit, war aber noch ansprechbar. Sie verbrachten Weihnachten im engsten Rahmen der Familie und in gedämpfter Stimmung, gingen so oft wie möglich in die Kirche und beteten für ihre Mutter.
Es geschah an einem solchen Tag. Die Wolken hetzten grau über das Himmelszelt, es war windig und kalt. Alle versuchten, schnell in die schützende Kirche zu gelangen. Teresa und ihre Familienangehörigen waren kurz vor dem Kirchportal und drängten sich mit der Menschentraube in Richtung Eingang. In diesem Moment berührte sie jemand an ihrer Schulter; sie bemerkte es zunächst gar nicht, zu dicht gedrängt standen die Menschen zusammen. Als ihr Arm sanft gefasst wurde, drehte sie sich überrascht zur Seite. Federico, der Sohn einer Händlerfamilie, zwei Jahre älter als sie. Teresa hatte ihn gelegentlich in Avila auf dem Markt und in der Kirche gesehen. Sie sah, wie sich ihre dunklen Augen in seinen spiegelten.
Er neigte sich zu ihr hin, damit nur sie es hören konnte.
»Ich vernahm, dass es deiner Frau Mutter nicht gut gehe.«
Teresa nickte.
»Ich habe meine Mutter früh verloren, ich hoffe sehr, dass dir dieses Schicksal erspart bleibt«, sagte er.
»Das sieht gerade nicht so gut aus«, antwortete Teresa leise.
»Ich habe ein erbauliches Buch, das mir damals geholfen hat. Ich hörte, du liest gerne und vielleicht könnte ich es dir einmal vorbeibringen?«, sprudelte es etwas zu schnell heraus. War Federico errötet?
»Mein Vater verbietet es, dass wir Kinder uns mit Fremden unter unserem Dach treffen, nur Familienmitglieder sind gestattet, und wenn ich mich recht entsinne, bist du kein entfernter Vetter.«
»Nein, verzeih, ich wollte dir keinesfalls zu nahe treten.«
Sie waren jetzt auf der Treppe und kurz vor dem Portal, der Weihrauchgeruch wehte ihnen bereits entgegen.
»Bist du nicht«, sagte Teresa. »Vielleicht sieht man sich ja bei einer anderen Gelegenheit.«
Die Frauen und Männer um sie herum bewegten sich auf ihre jeweilige Seite, denn sie standen in der Kirche getrennt. Teresa nickte ihm kurz zu und folgte den Frauen. Sie schaute nach einer Weile noch einmal in Richtung der Männer und machte dort Federico aus. Er war gut gebaut, keine Frage. Muskulös, aber nicht zu sehr, aufrecht, doch nicht zu stolz. Er stand gerade mit dem Rücken zu ihr, sein brauner Lockenkopf war deutlich in der Menge auszumachen. Sie hätte von sich aus vermutlich kein Auge auf ihn geworfen, doch dass er sie ansprach, schmeichelte ihr. Ein Mann, der las und ihr ein Buch anbot, nahm einen sehr ungewöhnlichen Weg, bei ihr vorstellig zu werden. Sie konnte nicht leugnen, er gefiel ihr. Ein wenig zumindest.
»Achte auf unseren Ruf«, zischelte Maria, ihre älteste Schwester. »Mit fremden Männern in der Kirche tuscheln. Was wollte denn der?«
»Nichts wollte er«, seufzte Teresa. Maria würde mit Sicherheit bald heiraten, ihr neues Haus nicht mehr verlassen, zahlreiche Kinder bekommen und brav den Gang gehen, den alle Frauen beschritten. »Ich kenne ihn gar nicht.«
Die Messe begann und unterbrach alle weiteren Nachfragen, Gott sei Dank. Teresa hörte nicht wirklich hin, schaute sich um in der prächtigen Kirche. Eindrucksvolle Bilder bedeckten die Wände und Decken, farbgewaltige Geschichten aus dem Leben Jesu, seiner Jünger und der Heiligen. Beeindruckende Statuen zierten in kleinen Kapellen und Einbuchtungen die Kirche. Direkt neben ihr wurde Teresa einer Figur der Mutter Maria gewahr. Sie sah so milde, so freundlich aus und ihre offenen Arme schienen sie umarmen zu wollen. Teresas Gedanken wanderten zu ihrer eigenen Mutter.
»Was mache ich denn, wenn sie stirbt?«, fragte sie leise, nur für sich, mehr gedacht als geflüstert. Die Statue antwortete nicht, schaute sie lächelnd an. Wenn ihre Mutter nun gehen würde, dann wäre sie allein. Würde ihr Vater versuchen, sie so schnell wie möglich zu verheiraten? Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Wer würde mit ihr die Ritterromane lesen? Wer sie warm in den Arm nehmen? Sie warf noch einmal einen Blick auf die Muttergottes.
Vielleicht sollte sie heute Nachmittag zum Fluss hinunterlaufen, zu der kleinen Kapelle am Adaja-Fluss, mit der schönen Muttergottesstatue. Sie war dort oft gewesen, in ihrer Kindheit. Als sie sich jetzt an das Gesicht der Maria erinnerte, schien es ihr, als ob sie eine große Ähnlichkeit mit ihrer Mutter Doña Beatriz hätte.
•
Die Luft war trocken und kalt, wenige Schneeflocken schwebten langsam vom Himmel, draußen rauschte der eiskalte Fluss. Wie lange war sie nicht mehr hier gewesen, in dieser Kapelle direkt vor den Stadtmauern aus Granit? Als Kind hatte sie hier oft gespielt, war manchmal alleine hinuntergekommen, um den kleinen Wellen zuzuschauen, dem fließenden Wasser ihre Gedanken anzuvertrauen, sich dem Moment hinzugeben. Sie hatte sich damals nicht so getrieben gefühlt. Heute glich sie einem Blatt, das in dem Wildwasser des Stroms mitgerissen wurde, sich treiben ließ und selbst gar nicht recht wusste, was der eigene Pfad war.
Sie war nicht nur mehr sie selbst gewesen, sie hatte sich dem Göttlichen nah gefühlt. Jetzt konnte sie nicht einmal mehr sagen, was das war: das Göttliche. Oder was es für sie bedeutete.
Sie schlüpfte in die Kapelle.
Da war sie. Die Muttergottes. Ihre Erinnerung hatte sie nicht getrogen. Das Gesicht sah dem ihrer Mutter unfassbar ähnlich. Warum war ihr das früher nicht aufgefallen?
Sie kniete vor Mutter Maria nieder, draußen strich ein leiser Wind um die Mauern. Der Boden war eiskalt, doch die steinernen Wände waren ein dürftiger Schutz, für den sie dankbar war.
All ihre Einsamkeit brach über sie herein, ein dunkler Schneesturm, eisig und kalt, eine finstere Decke ohne Geborgenheit, eine Nacht ohne Sterne. Ihre Mutter hatte ihre Abenteuer immer gedeckt, hatte sie in die Welt der Fantasie entführt, mit ihr Bücher und Geschichten gelesen, die ihr Vater niemals erlaubt hätte. Ihre Mutter war eine intelligente und scharfsinnige Frau. Das bestritt keiner, der sie kannte, obwohl niemand auf der Straße Frauen diese Fähigkeit öffentlich zubilligen wollte.
Für Teresa war sie viel mehr. Sie war das Bollwerk gegen die unweigerliche Wirklichkeit des Erwachsenwerdens, gegen das Schicksal, das alle Frauen traf. Wenn ihre Mutter nicht mehr wäre, würde ihre ältere Halbschwester die Bürde übernehmen, in der Familie die Verantwortliche zu sein. Allerdings war Maria bereits zweiundzwanzig, seit Längerem bahnte sich etwas mit Martin Guzmán y Barrientos an. Sie würde sicher bald heiraten. Und dann? Dann war Teresa die älteste Schwester. Allein. Was würde dann geschehen? In all ihrer Verzweiflung warf sie sich in ihrer Vorstellung in die Arme der Muttergottes. Ihr schien es, als ob sie ein sanftes Leuchten wahrnehmen würde.
»Könntest du, Heilige Mutter Maria, könntest du dann nicht meine Mutter sein?«, flehte sie. Tränen rannen über ihr Gesicht.
Ein warmes und zugleich trauriges Gefühl bemächtigte sich ihrer. Traurig, da das Sterbliche unabwendbar schien, ihr eigenes Schicksal damit verwoben und sie in ein unbekanntes Dunkel führte, doch warm, da sie seit Tagen das erste Mal das Gefühl hatte, nicht mehr so allein zu sein.
Es musste einen Weg geben, den sie beschreiten konnte. Vielleicht konnte ihr die Gottesmutter einen Pfad weisen. Als Kind hatte sie sich oft an Jesus gewandt, in ihrer Kammer, in der Kapelle oder beim hoffnungslosen Bau ihrer Eremitage. Vielleicht gab es ja doch einen Hoffnungsschimmer am Horizont, ein Licht aus einer Welt, die ihr gerade sehr weit entfernt schien.
•
»Wann kommst du endlich wieder mit? Du kannst doch nicht die ganze Zeit hier sitzen und Trübsal blasen.«
Ines hatte sich vor ihr aufgebaut, beide Hände in die Seiten gestemmt. Es war ein windiger Tag und Ines langes, rotschwarzes Haar wehte ihr wild vor ihre blitzenden Augen. Ihr schwarzer Lidschatten und die nachgezogenen Augenbrauen betonten ihre großen Augen in dem schlanken und hellen Gesicht. Kein Wunder, dass sich die Männer nach ihr umdrehten. Sie sah abenteuerlustig aus, wie sie da vor ihr in ihrem Innenhof stand. Teresa seufzte.
»Du hast gewiss recht, doch meine Schwester Maria passt auf wie ein Jagdhund.«
»Aber Clara ist dir doch immer noch zur Hilfe und würde dich jederzeit hinaus und herein lassen, zu jeder Stunde.«
Teresa nickte. Clara war eine gute Seele, die es nicht einsah, warum sie Teresa nicht ein wenig Freiheit, Aufregung und Glück gönnen sollte. Sie wusste ja nicht genau, was sie abends unternahm. Sie hatte ihr immer erzählt, dass sie sich mit Freundinnen traf, spazieren ging oder sich bei ihrer Base Ines aufhielt. Familie also, nichts Verwerfliches. Selbst wenn sie ahnte, dass gelegentlich auch ein Vetter oder Freund der Familie dabei war. Teresa kniete nieder und nahm einen kleinen Stein auf, um ihn auf einen anderen zu legen.
»Was ist das eigentlich?«, fragte Ines und zeigte auf den zusammengefallenen Steinhaufen. »Sieht aus, als ob jemand einen ganzen Karren voller Brocken in euren Hof geworfen und dann vergessen hat.«
Teresa musste lächeln.
»Das? Das ist eine Eremitage«, sagte sie fast ehrfurchtsvoll.
»Was?« Ines lachte überrascht. Teresa fiel etwas beschämt in das ungläubige Lachen ein.
»Nun ja«, Teresa hob hilflos ihre Hände, wie sollte sie ihr das erklären, ohne sich lächerlich zu machen? »Ich war ein Kind, wir haben gespielt und ich hatte die Idee, ein Häuschen aus Steinen zu bauen. Es gibt noch viel größere solcher Haufen, draußen auf unserem Landsitz in Gotarrendura.«
»Wie kamst du denn auf eine Einsiedelei?«
Teresa lächelte verlegen.
»Weiß ich auch nicht zu sagen. Wir haben gespielt, dass wir Heilige sind. Manchmal war ich auch eine Märtyrerin, wurde gefesselt und entführt, um dann einen furchtbaren Tod zu sterben.«
»Ernsthaft? Teresa, du?«
Teresa nickte.
»Ja, und da du dir vorstellen kannst, dass ich mit Sicherheit nicht leise sterbe, empfahl uns mein Vater, ein etwas leiseres Schicksal zu wählen, das nicht gleich die ganze Nachbarschaft in Schrecken versetzt.«
Ines lachte laut auf. Teresa bewunderte ihre Freundin im Stillen. Sie hatte zu Hause so viele Freiheiten, durfte Freunde außerhalb der Familie einladen und konnte das Leben genießen. In ihrem Lachen schwang all das mit. Doch Teresa kannte ihre Freundin gut, es wohnte darin auch eine andere Note mit, ein Hauch von Einsamkeit.
»Da wäre ich gerne dabei gewesen«, riss sie Teresa aus ihren Gedanken. »Bei den Abenteuern und den Kämpfen. Allerdings in eine Einsiedelei zu gehen, das wäre ja eine furchtbarere Strafe als mit Pfeilen bestückt zu Boden zu gehen.« Ines schüttelte sich voller Widerwillen; allein bei der Vorstellung gruselte es ihr offenbar.
»Der Vorteil am Märtyrertum sind die unglaublichen Belohnungen im Himmel. Rodrigo fand dort immer Schatztruhen voll Gold«, fiel Teresa in das Lachen ein.
»Nicht der schlechteste Fund, auch wenn ich glaube, dass es in Westindien leichter zu finden sein wird«, sagte Ines. »Himmlische Freuden sind ja ganz wundervoll, doch das irdische Leben erscheint mir etwas näher und aufregender zu sein. Kommst du heute Abend? Wir treffen uns bei mir.«
In diesem Moment ertönte aus dem Haus die Stimme ihres Vaters, der sie suchend rief. Teresa und Ines schreckten auf, als ob sie ertappt worden wären. Doch im Innenhof waren sie alleine.
»Ich muss jetzt auch nach Hause«, sagte Ines. »Wir sehen uns?«
Teresa nickte halbherzig.
Ines rannte fröhlichen Schrittes durch den Garten ins Haus, Teresa hörte noch, wie sie drinnen ein Adios wünschte, bevor die Haustür zufiel.
Teresa stand allein vor dem eingefallenen Steinhaufen, der mal eine Einsiedelei hatte werden sollen. Der Wind strich ihr durch das krause schwarze Haar, ließ es in Böen frei und wild wehen. Die Luft war kalt und klar, der Tod ihrer Mutter wirkte unwirklich weit weg, obwohl es erst wenige Monate her war. Sie kniete sich hin, nahm gedankenvoll einen Stein auf, schichtete ihn behutsam auf die anderen. Sie hatte die Einsiedelei gemocht, den Gedanken, in einer solchen alleine sein zu dürfen, ihren eigenen Raum zu haben, nicht verpflichtet zu sein, zu heiraten und eingesperrt zu werden. Mehr noch zu verstehen, worum es im Leben überhaupt ging und zu sehen, ob es nicht doch andere Schätze im Himmel gab als Truhen voll Gold.
»Für immer, immer, immer«, murmelte sie leise.
»Teresa?« Es war ihr Vater, der rief. Sie musste eilen. Sie schüttelte ihre Mähne, wie um die Gedanken los zu werden, und rannte los.
Ihren Vater fand sie in der Bibliothek. Alonso Sánchez de Cepeda war ganz in Schwarz gekleidet, wie immer. Er strahlte Eleganz aus, das Korsett ließ ihn aufrecht und ehrfurchtsvoll erscheinen und die weiße, tellerartige Halskrause betonte diesen Eindruck. Er sah aus, als ob er zu einem Staatsempfang müsse. Seine Augen wirkten müde und traurig, trotz allem leuchtete die gewohnte Güte aus ihnen.
»Werter Herr Vater?«
»Ah, da bist du ja, liebe Teresa, wir müssen reden.«
»Reden? Worüber?«
»Deine Schwester Maria wird nicht für immer in diesem Haushalt zur Hand gehen können, auch haben wir mit deiner jüngsten Schwester noch einen Säugling im Haus. Ich muss mir Gedanken machen, wie es weitergeht. Auch du bist langsam im heiratsfähigen Alter, auch da müssen wir sehen, wie das werden soll.«
Teresas Rücken versteifte sich. Sie spürte, wie sich ihr Unterkiefer leicht nach vorne schob, kampfeslustig. Rodrigo hatte sich immer lustig darüber gemacht, wohl wissend, dass ab diesem Moment meist nicht gut Kirschenessen mit ihr war.
»Bevor ich irgendjemanden heirate, fließt eher der Rio Adaja rückwärts zur Quelle.«
Alonso Sánchez de Cepeda seufzte.
»Niemand hat davon gesprochen, dass es ein Mann sein soll, den du nicht kennst«, sagte er leise. »Doch gerade mit unserem familiären Hintergrund müssen wir darauf achten, in ehrbare Familien zu heiraten.«
»Du meinst, in Familien, die schon immer christlich waren?« Es war eine rhetorische Frage. Teresa hatte es so satt, dass diese alten Geschichten sie immer wieder einholten.
»Schon lange christlich, allerdings auch nicht unbetucht«, nickte Alonso.
»Ich bin keine Ziege, die auf dem Markt feilgeboten wird, damit sie den besten Preis erzielen kann.«
Alonso hob beschwichtigend die Hände.
»Davon rede ich nicht, mein Kind. Es muss ja auch nicht gleich und sofort sein. Im Moment brauche ich dich hier dringender, doch solltest du beginnen, dir darüber Gedanken zu machen.«
Teresa atmete durch. Es gab offenbar keinen konkreten Mann, den ihr Vater im Sinn hatte.
»Ich kann Maria zur Hand gehen«, antwortete sie schnell. »Mich um die Kleine kümmern und auch sonst nach den jüngeren Geschwistern sehen.«
Ein Lächeln kämpfte sich auf die Lippen ihres Vaters, die von seinem Spitzbart eingerahmt wurden.
»Du wirst sehen«, sagte Teresa, »ich bin hier an einem besseren Ort für dich als in den Armen eines Fremden.«
»Dennoch. Wir müssen an deine Zukunft denken und dürfen das nicht schleifen lassen, verstanden?«
Teresa setzte ihr schönstes Lächeln auf. Sie wusste, dass er ihre Grübchen schon als kleines Kind gemocht hatte und es ihm schwerfiel, ihr etwas abzuschlagen.
»Ich will heute Abend noch zu meiner Base Ines, ich war die letzten Wochen so betrübt, dass ich gar keine Lust hatte, das Haus zu verlassen.«
»Deine Base ist kein guter Umgang für dich. Sie sehen in dieser Familie alles etwas zu frei, lassen die Kinder laufen, und wenn Ines so weitermacht, wird sie den guten Ruf ihrer Familie noch gefährden.« Alfonsos Miene wurde hart.
»Ach bitte, wir wollen nur etwas zusammen sticken und ein wenig reden.« Teresa ging einen Schritt auf ihren Vater zu. Sie hob ihre Augenlider langsam an und schaute ihn voller Vertrauen an. Rodrigo hatte einmal gesagt, sie würde dabei aussehen wie ein junger Welpe. Sie hatte das nicht gemocht, doch der Blick schien seine gewünschte Wirkung zu zeigen.
Sie sah, wie die Worte »Das kommt nicht infrage« bereits auf seinen Lippen lagen, doch bevor er sie aussprechen konnte, fügte Teresa schnell hinzu: »Ich könnte eines der religiösen Bücher aus deiner Bibliothek ausleihen und ihr vorlesen. Vielleicht habe ich ja einen guten Einfluss auf sie?«
Ihr Vater stutzte.
»Nun, gut«, räusperte sich Alonso, zögerte noch.
»Bitte!«
Alonso seufzte erneut. Teresas Herz hüpfte, sie sah es in seinem Blick, er würde nachgeben, wie immer.
»Aber dann nicht so spät wieder hier sein, ich sage am besten Rodrigo, dass er dich abholen soll.«
Jubelnd flog sie ihm in die Arme, wie sie es als kleines Kind oft getan hatte.
»Allerdings greifst du heute Mittag Maria unter die Arme, verstanden? Sie braucht dringend unsere Hilfe.«
Als Teresa die Tür der Bibliothek schloss, lehnte sie sich von außen dagegen und atmete durch. Sie durfte heute Abend zu ihrer Freundin, vielmehr beschäftigte es sie indes, dass zum Stand der Ehe nicht das letzte Wort gesprochen schien. Ihre notwendige Heirat schwebte wie ein Damoklesschwert über ihrem Leben.
Nur heute, heute würde es nicht auf sie fallen. Sie hatte einen Tag gewonnen, vielleicht auch ein bisschen mehr. Vielleicht.
Sie lief von der Bibliothek im ersten Stock die Treppe hinunter. Es galt, ihre älteste Schwester zu finden. Eigentlich war es ihre Halbschwester. Ihr Vater hatte drei Kinder mit in die Ehe gebracht, da seine erste Frau ebenfalls früh starb. Maria und die anderen beiden Brüder waren mit der Familie zusammengewachsen.
Teresa traf Maria in der Küche, wo diese Anordnungen für das Abendessen gab, während sie das Baby auf dem Arm hielt und der fast zweijährige Augustin an ihrem Rockzipfel hing.
»Gut, dass du vorbeischaust, wir brauchen dringend etwas vom Markt. Kannst du es besorgen?«, fragte Maria. Ihr Gesicht war gerötet, so als ob sie gerade noch durch das Haus geeilt wäre; tiefe Augenringe zeigten, dass sie die letzten Nächte wenig Schlaf gefunden hatte.
»Klar, soll ich dir das Kind abnehmen? Ich könnte es in ein Tuch gewickelt zum Markt mitnehmen und du hättest mal etwas Luft?«, fragte Teresa.
»Das würdest du tun? Du bist ein Schatz.« Sie küsste Teresa auf die Stirn, wickelte ihr geschickt das Tuch um und legte die kleine Juana hinein.
Teresa zwickte ihre jüngste Schwester liebevoll in die Wange, während das kleine Menschlein sie aus großen braunen Augen neugierig anschaute. In diesem Moment kam ihr sechsjähriger Bruder Jeronimo laut weinend in die Küche gerannt, sich bitter darüber beschwerend, dass Antonio ihm etwas weggenommen habe. Sein Geschrei war so groß, dass jegliche Unterhaltung unterging. Als dann der achtjährige Antonio in der Tür auftauchte und mit wütend funkelnden Augen Jeronimo beschimpfte, ein verdammter Lügner zu sein, glich die Küche einem Vorort zur Hölle. In diesem Moment kreuzte Pedro auf, der nur ein knappes Jahr älter als Antonio war und lautstark den jüngeren Jeronimo in Schutz nahm. Das Inferno war vollkommen.
»Madre de Dios!«, erhob Maria ihre Stimme. »Ruhe jetzt! Könnt ihr euch nicht einmal auch nur einen Tag vertragen?«
»Weißt du was?«, sagte Teresa. »Ich nehme Augustin, Jeronimo und Pedro mit, sie können mir beim Tragen helfen.«
Zwar murrend zogen sich die beiden Jungen an, doch sahen sie bei der Idee, über den Markt zu schlendern, ganz glücklich aus.
Auf dem zentralen Platz neben ihrer Taufkirche war wie üblich am Markttag viel Trubel: Stände übervoll mit Früchten, Nüssen, Oliven, Knoblauch, Reis und Gewürzen. Es wurde gelacht und geflucht, die Waren lautstark feilgeboten. Juana war in ihrem Tuch an ihrer Brust eingeschlafen, Augustin tappte mit großen Augen neben Teresa her und Jeronimo und Pedro flankierten sie wie eine stolze Eskorte. Während ihr zweijähriger Bruder in Kleid und Schürze gewandet war, schlicht und teuer zugleich, trugen die beiden älteren Jungen bereits die typischen kurzen Beinkleider, ein Wams und einen Rock wie die Erwachsenen.
Zielsicher ging Teresa auf den Gemüsestand zu, Maria wollte Zutaten für Gazpacho. Hier bekam sie Gurken und Knoblauch, die sie für die Suppe brauchte. Brot hatten sie schon. Jeronimo und Pedro nahmen die Einkäufe entgegen.
Teresa war bereits auf dem Weg zu dem Olivenstand des alten Carlos und fädelte sich geschickt durch die Menschenmenge. Erst als sie bei Carlos’ Stand ankam, einem gutmütigen alten Mann, dessen Mondgesicht zerfurcht war von unendlich vielen Lachfältchen, bemerkte sie, dass ihr die beiden Großen abhandengekommen waren. In dem Gewusel der Menschen konnte Teresa sie zunächst nicht ausmachen, doch dann entdeckte sie eine Menschentraube, die sich um einen Tisch drängte.
Teresa seufzte. Wenn es irgendwo etwas zu sehen gab, dann würden ihre Brüder dort zu finden sein. Sie schlängelte sich an den dicht stehenden Menschen vorbei, die mit langen Hälsen und auf Zehenspitzen versuchten, einen Blick auf den Stand zu erhaschen. Was um alles in der Welt gab es da zu sehen?
Augustin im Schlepptau kämpfte sich Teresa an den Erwachsenen vorbei, bis sie fast in den Tisch gestolpert wäre. Sie blickte auf, und tatsächlich, Jeronimo und Pedro standen nicht weit entfernt, am anderen Ende und starrten mit offenen Mündern auf den Kaufmann hinter dem Stand. Dieser wurde von zwei Soldaten mit glänzenden Brustplatten und mit Hellebarden bewaffnet flankiert.
»Das ist kostbarer als Gold«, rief dieser der Menge zu. »Nach geheimer Rezeptur, angereichert mit den Schätzen, die wir Spanier in der Welt jenseits des Ozeans gefunden haben. Sie ahnen nicht, welch ein Reichtum dort zu finden ist. Heidnische Tempelanlagen und Burgen voller Gold und Silber, Städte, die größer sind als Madrid und Rom. Neben dem Gold finden sich in den gefährlichen Urwäldern auch Früchte, die noch nie ein Mensch gesehen hat, von einem Geschmack, den ihr noch nie gekostet habt. Diese Wälder sind nicht im Entferntesten mit unseren zu vergleichen. Wälder mit Bäumen, die größer sind, als alles, was ihr euch vorstellen könnt, mit tödlichen Schlangen und Ungeheuern bevölkert. Dort findet sich das Geheimnis für dieses hier.«
Er hob etwas in die Höhe, was wie ein kleiner, dunkler Steinblock aussah. Was bei der heiligen Mutter Maria war das?
Plötzlich spürte sie, dass sich jemand direkt hinter sie stellte, nicht unangenehm, ihr dennoch näherkam, als es die Ehre erlaubt hätte. Lippen ganz nah an ihrem Ohr flüsterten:
»Weißt du, was das ist?«
Federico. Sie atmete auf, erleichtert, dass ihr niemand völlig Fremdes so nahegekommen war. Er berührte sanft ihren Arm und es durchfuhr sie ein ungewohntes, wenn auch nicht unvertrautes Prickeln.
»Das ist der Bruder meines Vaters«, flüsterte Federico.
Teresa neigte den Kopf sanft zur Seite.
»Und was ist das für ein Stück, das er in der Hand hält und das angeblich so unfassbar kostbar wie Gold sein soll«, flüsterte sie zurück.
»Es gibt Kraft und Schönheit«, rief der Kaufmann der Menge entgegen. »Macht jedes Mahl zu einem Festmahl, verziert die Nachspeisen unseres Königs.«
Teresa neigte sich zurück, war jetzt ganz nah am Ohr von Federico. Sie spürte regelrecht die Röte, die in sein Gesicht stieg, hörte, wie er schwer schluckte.
»Oder«, flüsterte sie in sein Ohr, »ist der Bruder deines Vaters einfach ein geschickter Possenreißer und weiß die Massen zu fesseln.«
Teresa wandte sich wieder nach vorne. Federico schwankte, als ob seine Knie nachgeben würden, was ihr ein feines Lächeln ins Gesicht zauberte. Sie liebte diese Wirkung. Der Junge fing sich schnell.
»Es ist Schokolade«, flüsterte er. »Nur die Spanier in den eroberten Gebieten kennen das Rezept, es wird mit einer Frucht gemacht, die sie Kakao nennen.«
Teresa pfiff leise durch die Zähne. Davon hatte sie gehört. Westindien. So nannten sie das ferne Land, wobei allen klar war, dass es sich nicht um Indien oder den westlichen Teil von Indien handelte. Ein Land voll Glück und Reichtum, vor allem für alle, die hier in Kastilien niemals eine Chance darauf hätten.
»Wenn du magst, wir haben etwas zu Hause, falls du einmal kosten willst«, fuhr er fort.
Teresa schmunzelte.
»Ein Buch, Schokolade, du steckst voller Überraschungen, fremder Federico«, sagte sie, während sie sich einen kleinen Schritt von ihm entfernte und sich weit nach vorn beugte, um ihre Brüder auf der anderen Seite sehen zu können. Jeronimo nahm sie als Erster wahr, und sie machte eine eindeutige Geste, dass sie sich schleunigst in Richtung Olivenstand aufzumachen hatten.
Sie selbst wandte sich zum Gehen, klopfte dabei im Vorbeigehen freundschaftlich auf Federicos Oberarm. »Du lässt ja nichts unversucht.«
Schon war sie aus der Menschentraube und atmete auf. Hoffentlich hatte das niemand gesehen. Doch die Menschen waren alle viel zu sehr mit ihrer Faszination für das Unbekannte beschäftigt.
Als sie beim Olivenhändler Carlos ankam, bediente er eine ältere Frau in feinen Gewändern. Teresa bekam nur den letzten Teil ihres Gespräches mit.
»Das sind doch alles Heuchler«, stieß die Frau hervor.
»Na ja, vielleicht nicht alle«, erwiderte Carlos beschwichtigend.
»Wie könnten sie es nicht sein?«, giftete die Alte zurück. »Nur wir sind von reinem Blut und reinem Glauben. Die haben sich doch alle nur bekehren lassen, damit sie hier ihre fetten Bäuche mästen können.«
»Viele sind auch gute Kastilier«, erwiderte der Olivenhändler ruhig und sammelte die Oliven für seine Kundin zusammen, als ob es ein Plauderstündchen über das Wetter wäre.
»Sie haben eine zu gute Meinung von Menschen«, sagte die Frau kopfschüttelnd. »Es gibt allerdings nur die Guten und die Schlechten, und wir müssen die Spreu vom Weizen trennen.«
»Ich kenne mich mit Religion nicht aus«, erwiderte Carlos. »Dafür mit Oliven. Ich erkenne eine gute Olive nur dadurch, dass ich sie genau anschaue, jede einzelne, sie schmecke und rieche. Wenn Ihr wollt, lerne ich sie auf diese Weise wirklich kennen. Auch ein alter Baum kann eine bittere Frucht haben und ein junger eine Olive mit reichem Geschmack. Aber am Ende sind es alles Oliven. Ich denke, dass wir jeden Menschen neu anschauen müssen, in jedem Moment.«
»Ich sage es ja, Ihr habt eine zu gute Meinung von den Menschen«, erwiderte die Frau kopfschüttelnd, als sie ihre Ware nahm und sich zum nächsten Stand vorkämpfte.
Teresa sah, dass Carlos einen tiefen Atemzug nahm und seufzte.
»Welche Freude, dich zu sehen«, lachte er sie an, als er ihrer gewahr wurde. »Da ist ein ganz schöner Trubel, da drüben, bei den Abenteurern.«
Er zeigte zu dem Schokoladenstand hinüber. Teresas Brüder hatten sich mittlerweile auch eingefunden, mit glühenden Gesichtern; die Aufregung strahlte aus ihren Augen.
»Habt ihr das gesehen?«, fragte der neunjährige Pedro. »Die sind um die halbe Welt gesegelt, haben mit Ungeheuern gekämpft und bringen als Beute wunderhafte Nahrung mit sich, die wertvoller als Gold ist.«
Pedro überschlug sich regelrecht. Carlos und Teresa lachten über den Ungestümen.
»Das hört sich ja fast so an, als ob du gleich selbst auf ein Schiff steigen willst«, lachte Teresa und strich ihrem Bruder liebevoll durch sein Haar.
»Ja, und dann kämpfe ich mit den Ungeheuern«, rief er, schwang ein imaginäres Schwert, hieb und stach auf unsichtbare Gegner ein. Der direkt hinter ihm stehende Jeronimo wich zurück, um den wilden Bewegungen auszuweichen, während der kleine Augustin den Conquistador spielenden Pedro mit offenem Mund anstarrte.
»Ich auch«, krähte der Kleine auf einmal, sich zu Teresa hinwendend. »Ich auch.«
»Ja, du auch«, antwortete Teresa. »Du wirst irgendwann auf einem großen stolzen Schiff segeln, immer dem Sonnenuntergang entgegen.«
»Dabei haben wir doch schon das wahre Gold hier«, schmunzelte Carlos und klopfte auf ein Fass voll Olivenöl. »Das füllt auch den Magen eurer großen Familie, und zwar gleich heute. Allerdings muss ich gestehen, dass ich die Namen deiner Geschwister immer völlig durcheinanderbringe.«
Teresa winkte ab.
»Kinderreich sind wohl die meisten Kunden, wie sollte man sich da alle Namen merken können?«, lachte Teresa.
»Wohl wahr«, erwiderte Carlos gut gelaunt. »Was kann ich für die Familie de Cepeda und Ahumada tun?«
Schnell wurden sie sich einig. Alle Brüder hatten noch ein paar Oliven geschenkt bekommen, und kauten diese genüsslich, als sie sich zum Gehen wandten. Augustin lief das Öl glänzend aus dem Mund. Während sie schlenderten, Stände und Schausteller anschauten, stupste der sechsjährige Jeronimo Teresa an.
»Schau mal, was macht der denn da?«
»Wer?«
Er zeigte quer über den Platz. Unter einer der Arkaden eines Bogenganges saßen Leute auf dem Boden und hörten einem Mann zu.