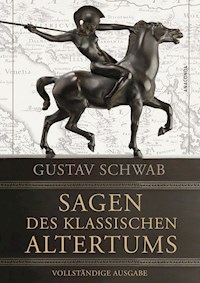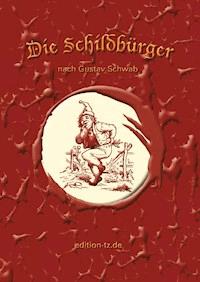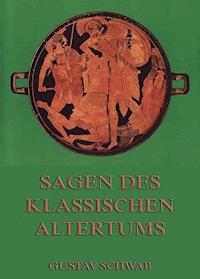3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gustav Schwabs berühmte Nacherzählung der griechisch-römischen Mythologie: Ilias und Odyssee, Trojanischer Krieg und Argonautensage und mehr.
Coverbild: Kozyreva Elena
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Die schönsten Sagen des klassischen Altertums
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenZum Buch
Gustav Schwabs berühmte Nacherzählung der griechischen und römischen Mythologie: Ilias und Odyssee, Trojanischer Krieg und Argonautensage usw.
VORWORT
Es ist eine schöne Eigentümlichkeit der Mythen und Heldensagen des klassischen Altertums, dass sie für die Blicke des Forschers und für das Auge der Einfalt einen zwar verschiedenartigen, aber doch gleich mächtigen Reiz haben.
Während der Gelehrte in ihnen den Anfängen alles menschlichen Wissens, den Grundgedanken der Religion und Philosophie, der ersten Morgendämmerung der Geschichte nachgeht, entzückt den unbefangenen Betrachter die Entfaltung der reichsten Gestalten, das Schauspiel einer gleichsam noch in der Schöpfung begriffenen Natur- und Geisterwelt; er sieht mit Lust und Bewunderung die Erde mit Göttern und Göttersöhnen aus dem Chaos emporsteigen und in raschen Bilderreihen den Prometheusfunken im Menschen den Kampf mit der Barbarei beginnen, sieht, wie die Kultur der Wildnis, die Bildung der Rohheit, die Vernunft oder die Notwendigkeit der Leidenschaft den Sieg abringen.
Die innere lebendige Kraft dieser Bilder ist so groß, dass sie nicht von der vollendeten Kunstgestalt abhängig erscheint, in welcher ein guter Teil jener Gebilde von den größten Dichtern verarbeitet ist, sondern dass die schlichteste Darstellung genügt, ihre Größe auch vor denen zu entfalten, für welche die Kunstform eher ein Hemmnis als eine Förderung des Verständnisses sein muss.
In diesem Falle ist die Jugend im Beginn ihrer klassischen Bildung. Die Heroensage, von der ihre Fantasie mit dem ersten Unterrichte in den Sprachen der Alten Bruchstücke aufnimmt, übt einen Zauber über ihren Geist, lang ehe sie imstande ist, diese Heroengestalten in den Schöpfungen der Dichter zu fassen.
Nähere Bekanntschaft mit diesen Mythen wird sogar als Vorschule für die höhere Bildung ein frühzeitiges Bedürfnis, das auch unsere Literatur längst gefühlt hat und dem sie durch Hilfsbücher aller Art bald in wissenschaftlich belehrender, bald in unterhaltender Form abzuhelfen gesucht hat und noch sucht.
Im vorliegenden Buche nun wird der Versuch gemacht, die schönsten und bedeutungsvollsten Sagen des klassischen Altertums den alten Schriftstellern und vorzugsweise den Dichtern einfach und vom Glanze künstlerischer Darstellung entkleidet, doch, wo immer möglich, mit ihren eigenen Worten nachzuerzählen.
Man hat sich längst von der Ansicht befreit, dass diese auf mythischem Boden spielenden und von den Mythen durchwobenen Geschichten zum Mittel dienen könnten, der Jugend gelegentlich historische, geografische und naturwissenschaftliche Kenntnisse beizubringen, und dass man sie gar zum Vehikel eines moralischen Lehrkurses gebrauchen dürfe.
Die Moral, die auch der antiken Weltanschauung nicht fehlte, muss in der Darstellung empfunden werden; auf das Einseitige und in wesentlichen Stücken Irrtümliche derselben und ihre Unzulänglichkeit gegenüber der Offenbarung des Christentums wird eine mündliche Unterweisung des Vaters oder Lehrers den jungen Leser besser aufmerksam machen als das Buch selbst, das vom Leser zunächst nur mit der Absicht, sich eine angenehme und doch würdige Erholung zu verschaffen, in die Hand genommen werden soll.
Nur dafür hat der Verfasser gesorgt, dass alles Anstößige entfernt bleibe, und deswegen unbedenklich alle diejenigen Sagen ausgeschlossen, in welchen unmenschliche Gräuel erzählt werden, die nur eine symbolische Erklärung gewissermaßen entschuldigt, die aber als Geschichte dargestellt – und als solche müssen diese Sagen der Jugend doch gelten – nur einen empörenden Eindruck auf sie machen könnten.
Wo aber unsern höheren Begriffen von Sittlichkeit widerstrebende oder auch schon im Altertum als unsittlich und widernatürlich anerkannte Verhältnisse (wie in der Ödipussage) in einer ihrer Totalrichtung nach hochsittlichen Mythe nicht verschwiegen werden konnten, glaubt der Bearbeiter dieser Sagen jene auf eine Weise angedeutet zu haben, welche die Jugend weder zum Ausspinnen unedler Bilder noch zu neugierigem Grübeln veranlasst.
Vorausgesetzt wird bei diesem Buche nur die allgemeinste Kenntnis der griechisch-römischen Mythologie und Vorzeit, wie sie die Schulbildung unsrer Jugend beizeiten verschafft.
Während der erste Teil dieser Sammlung eine Mannigfaltigkeit kleinerer Mythen und Geschichten in sich schließt, folgt im zweiten eine einzige Sage, aber die großartigste der alten Zeit, die Sage von Troja, und zwar von der Stadtgründung bis zu ihrem Untergänge, mithin in einer Vollständigkeit, wie sie als Erzählung aus den Quellen noch nie in dieser Gestalt zusammengefasst worden ist.
Der Bearbeiter wünscht und hofft, dass das Ganze, auf diese Weise übersichtlich gemacht, nicht nur der Jugend neu und interessant erscheinen, sondern auch manchem älteren Leser der Ilias als eine im Geiste dieses unsterblichen Gedichts wenigstens versuchte Vervollständigung nicht unwillkommen sein werde. Umso mehr hat er die Pflicht, sich darüber auszuweisen, dass jene Ergänzung von ihm nicht willkürlich, sondern mit gewissenhafter Benützung der Alten selbst, deren Quelle ihrerseits die epischen Darstellungen einzelner zyklischer Dichter waren, vorgenommen worden ist.
Im ersten Viertel dieses Teils musste sich der Verfasser für den Strom der Erzählung mit den trübe fließenden Quellen jener rhetorischen Machwerke behelfen, die wir, aus spätester Zeit, unter dem Namen des Dictys Cretensis und des Dares Phrygius besitzen. Doch bildet ihr Bericht, aus welchem immer das mit Homer am leichtesten Vereinbare herausgesucht wurde, nur das historische Grundgewebe oder die Kette der Begebenheit, während die berühmtesten Dichter des griechischen und römischen Altertums, Sophokles, Euripides, Horaz, Ovid und andere, den farbenreichen Einschlag ihrer Fantasie zu dem Gewebe beisteuerten.
Den Kern der Sage bildet sodann die Ilias Homers, welchem der Erzähler auch für das zweite und dritte Viertel den allgemeinen Ton der Darstellung abzulauschen bemüht war, und dessen Färbung er in dem Teile, in welchem er der einzige Berichterstatter ist, so unverkümmert, als es in ungebundener Rede und doch dabei zusammengedrängtem Vortrage geschehen konnte, beizubehalten sich bestrebt hat.
Die homerische Geschichte der Ilias bildet auf solche Weise fast die Hälfte des zweiten Bandes. Täuscht den Verfasser dieses Buches seine Hoffnung nicht, so ist die innere Gestalt dieser unsterblichen Dichtung auch unter Aufopferung der poetischen Form nicht verlorengegangen, und ihr Götterleib schimmert noch durch das prunklose Gewand der schlichtesten Prosa hindurch.
Das letzte Viertel ist wieder mehreren Dichtern entnommen: Pindar, Sophokles, Vergil sind wiederholt berücksichtigt worden; doch ist hier der Darsteller so glücklich gewesen, in der Fortsetzung Homers durch den Dichter Quintus, dessen weiterer Name, Vaterland und Zeitalter in eine ungerechte Vergessenheit oder Unsicherheit gehüllt sind und den nur die Gelehrsamkeit bald Calaber, bald Smyrnäus benannt hat, eine echt poetische Grundlage und Stoff wie Form zu fortlaufender Erzählung vorzufinden. Die Dichtungen dieses Poeten sind ein klassisches Kunstwerk und werden hoffentlich in ihrer Schönheit und Größe, gleich den Schöpfungen anderer Dichter, sich die Anerkennung aller Freunde echter Poesie gewinnen.
Der künstlerischen Übertragung jenes Gedichtes, welche der Erzähler dieser Sagen im Manuskripte zu benützen Gelegenheit gehabt hat, verdankt seine Darstellung an Farbe und lebendigem Ausdrucke nicht wenig, und der Gelehrte möge den öffentlichen Dank, welcher ihm hier dargebracht wird, nicht verschmähen.
Als der Plan des in den dritten und letzten Teil Aufnehmbaren vom Verfasser entworfen wurde, hielt er es fast für unmöglich, die Schicksale der letzten Tantaliden einer Lesewelt, die zum großen Teile voraussichtlich aus Frauen und Kindern bestehen sollte, unverkürzt mitzuteilen.
Das Verlangen nach Vollständigkeit ermutigte ihn jedoch zu dem Versuche, auch diese Schwierigkeit zu überwinden, und er hofft, dass das gerechte Urteil, welches in den früheren Bänden zarte Schonung verletzbarer Ohren und mit heiliger Scheu zu behandelnder Gemüter anerkannt hat, sich auch auf die Bearbeitung des genannten Stoffes erstrecken werde. Bei der möglichst hergestellten Harmonie der Tragiker ist besondere Rücksicht auf diese Forderung der Sittlichkeit, welche selbst der freieste Schönheitssinn anerkennen wird, genommen worden.
Im vierten Teil, der Odyssee, war eine solche Vorsicht nicht nötig. Hier brauchte sich der Darsteller nur so streng als möglich an das Originalkunstwerk des Altertums zu halten, um den rührendsten Eindruck der Unschuld und Sittenreinheit zu machen.
Wer sich überzeugen will, dass die menschliche Natur, so untüchtig sie auch zum vollkommenen Guten scheint, doch keineswegs vollkommen untüchtig zum Guten ist, der stärke seinen Glauben an die Menschheit, welcher der frömmsten Religionsüberzeugung nicht zuwiderläuft, an diesem Werke des grauen Heidentums.
Die Äneis hat dem Verfasser am meisten zu schaffen gemacht. Hier die Längen abzuschneiden, ohne das Ziel des Weges selbst unzugänglich zu machen, alle jene Zutaten ersonnener Volkssage, die nach einer Ilias und Odyssee in ihrem prunkenden Scheine selbst einem Kinde fühlbar werden müssten, zu entfernen, ohne den Zusammenhang der originellsten und lieblichsten Erfindungen, die bald einen Teil der poetischen Geschichte des Gedichtes, bald unschätzbare Episoden bilden, unerkennbar zu machen oder gar zu zerstören – dies empfand der Bearbeiter als keine kleine Aufgabe, zumal da dieselbe noch von keinem modernen Erzähler der Sagen des Altertums versucht worden war. Sein Bestreben ging dahin, durch Zusammendrängen wesentlicher Schönheit dem kunstvollen Werke des Römers für die Jugend einen Reiz der Neuheit und gewissermaßen der Kurzweiligkeit zu geben, den man im Originale vergebens sucht. Mit dem fünften Abschnitt findet das Werk seinen Abschluss.
Und so möchten denn alle diese Sagen zusammen, als der Inbegriff der klassischen Heroenmythen, sich durch gewissenhafte und dem Zwecke des Buches angemessene Bearbeitung ihres Inhalts zahlreiche Freunde bei der Jugend und manche auch bei den Alten erwerben.
Mit diesem Wunsche entlässt der Verfasser sein Werk, das für ihn zugleich der Widerhall zwanzigjähriger öffentlicher und häuslicher Beschäftigung ist.
Stuttgart, September 1837
ERSTER TEIL – METAMORPHOSEN UND KLEINERE SAGEN
Prometheus
Himmel und Erde waren geschaffen; das Meer wogte in seinen Ufern und die Fische spielten darin; in den Lüften sangen beflügelt die Vögel; der Erdboden wimmelte von Tieren. Aber noch fehlte es an dem Geschöpf, dessen Leib so beschaffen war, dass der Geist in ihm Wohnung nehmen und von ihm aus die Erdenwelt beherrschen konnte.
Da betrat Prometheus die Erde, ein Sprössling des alten Göttergeschlechtes, das Zeus entthront hatte, ein Sohn des erdgeborenen Uranussohnes Iapetos, kluger Erfindung voll.
Dieser wusste wohl, dass im Erdboden der Same des Himmels schlummere; darum nahm er vom Tone, befeuchtete denselben mit dem Wasser des Flusses, knetete ihn und formte daraus ein Gebilde nach dem Ebenbilde der Götter, der Herren der Welt. Diesen seinen Erdenkloß zu beleben, entlehnte er allenthalben von den Tierseelen gute und böse Eigenschaften und schloss sie in die Brust des Menschen ein.
Unter den Himmlischen hatte er eine Freundin, Athene, die Göttin der Weisheit. Diese bewunderte die Schöpfung des Titanensohnes und blies dem halbbeseelten Bilde den Geist, den göttlichen Atem, ein.
So entstanden die ersten Menschen und füllten bald vervielfältigt die Erde. Lange aber wussten sie nicht, wie sie sich ihrer edlen Glieder und des empfangenen Götterfunkens bedienen sollten. Sehend sahen sie nichts, hörten hörend nicht; wie Traumgestalten liefen sie umher und wussten sich der Schöpfung nicht zu bedienen.
Unbekannt war ihnen die Kunst, Steine auszugraben und zu behauen, aus Lehm Ziegel zu brennen, Balken aus dem gefällten Holze des Waldes zu zimmern und mit allem diesem sich Häuser zu erbauen.
Unter der Erde, in sonnenlosen Höhlen, wimmelte es von ihnen, wie von beweglichen Ameisen: nicht den Winter, nicht den blütenvollen Frühling, nicht den früchtereichen Sommer kannten sie an sicheren Zeichen; planlos war alles, was sie verrichteten.
Da nahm sich Prometheus seiner Geschöpfe an: Er lehrte sie den Auf- und Niedergang der Gestirne beobachten, erfand ihnen die Kunst zu zählen, die Buchstabenschrift, lehrte sie Tiere ans Joch spannen und als Genossen ihrer Arbeit verwenden, gewöhnte die Rosse an Zügel und Wagen, erfand Nachen und Segel für die Schifffahrt.
Auch fürs übrige Leben belehrte er den Menschen. Bei Erkrankungen in früheren Zeiten wusste man kein Heilmittel anzuwenden, kannte weder ein Salböl zur Linderung der Schäden noch war man auf geeignete Krankenkostdiät bedacht; wegen Arzneimangel starben die Leidenden elendiglich dahin. Darum zeigte ihnen Prometheus die Mischung milder Heilmittel, allerlei Krankheiten damit zu bekämpfen.
Dann lehrte er sie die Wahrsagekunst, deutete ihnen Vorzeichen und Träume, Vogelflug und Opferschau. Ferner lenkte er ihren Blick unter die Erde und ließ sie hier das Erz, das Eisen, das Silber und das Gold entdecken; kurz in alle Bequemlichkeiten und Künste des Lebens führte er sie ein.
Im Himmel herrschte mit seinen Kindern seit Kurzem Zeus, der seinen Vater Kronos entthront und das alte Göttergeschlecht, von welchem auch Prometheus abstammte, gestürzt hatte.
Jetzt wurden die neuen Götter aufmerksam auf das eben entstandene Menschenvolk. Sie verlangten Verehrung von ihm für den Schutz, welchen sie ihm angedeihen lassen wollten. Zu Mekone (Sikyon) in Griechenland wurde Gericht gehalten zwischen Sterblichen und Unsterblichen und Rechte und Pflichten der Menschen bestimmt. Bei dieser Versammlung erschien Prometheus als Anwalt seiner Menschen, dafür zu sorgen, dass die Götter für die übernommenen Schutzämter den Sterblichen nicht allzu lästige Gebühren auferlegen möchten.
Da verführte den Titanensohn seine Klugheit, die Götter zu betrügen. Er schlachtete im Namen seiner Geschöpfe einen großen Stier, davon sollten die Himmlischen wählen, was sie für sich gerne verlangten.
Er hatte aber nach Zerstückelung des Opfertieres zwei Haufen gemacht; auf die eine Seite legte er das Fleisch und die Eingeweide mit reichlichem Speck, in die Haut des Stieres zusammengefasst, und deckte den Magen darauf, auf die andere die kahlen Knochen, künstlich in das Unschlitt des Schlachtopfers eingehüllt. Und dieser Haufen war der größere.
Zeus, der Göttervater, der Allwissende, durchschaute aber seinen Betrug und sprach:
„Sohn des Iapetos, erlauchter König, guter Freund, wie ungleich hast du die Teile geteilt!“
Prometheus glaubte jetzt erst recht, dass er ihn betrogen, lächelte bei sich selbst und sprach:
„Erlauchter Zeus, größter der ewigen Götter, wähle den Teil, den dir dein Herz im Busen anrät zu wählen.“
Zeus ergrimmte im Herzen, aber geflissentlich fasste er mit beiden Händen das weiße Unschlitt. Als er es nun auseinandergedrückt und die bloßen Knochen gewahrte, stellte er sich an, als entdecke er jetzt eben erst den Betrug, und zornig sprach er:
„Ich sehe wohl, Freund Iapetionide, dass du die Kunst des Truges noch nicht verlernt hast!“
Zeus beschloss, sich an Prometheus für seinen Betrug zu rächen, und versagte den Sterblichen die letzte Gabe, die sie zur Lebenserhaltung bedurften, das Feuer.
Doch auch dafür wusste der schlaue Sohn des Iapetos Rat. Er nahm den langen Stängel des markigen Riesenfenchels, näherte sich mit ihm dem vorüber fahrenden Sonnenwagen und setzte so den Stängel in glosenden Brand.
Mit dem brennenden Feuerzunder kam er auf die Erde, und bald loderte der eiste Holzstoß gen Himmel.
In innerster Seele schmerzte es den Donnerer, als er den fernhin leuchtenden Glanz des Feuers unter den Menschen emporsteigen sah. Sofort formte er, zum Ersatz für des Feuers Gebrauch, das den Sterblichen nicht mehr zu nehmen war, ein neues Übel für sie. Der seiner Kunst wegen berühmte Feuergott Hephästos musste ihm das Scheinbild einer schönen Jungfrau fertigen; Athene selbst, die, auf Prometheus eifersüchtig, ihm abhold geworden war, warf dem Bild ein weißes, schimmerndes Gewand über, ließ ihr einen Schleier über das Gesicht wallen, den das Mädchen mit den Händen geteilt hielt, bekränzte ihr Haupt mit frischen Blumen und umschlang es mit einer goldenen Binde, die gleichfalls Hephästos seinem Vater zulieb kunstreich verfertigt und mit bunten Tiergestalten herrlich verziert hatte. Hermes, der Götterbote, musste dem holden Gebilde Sprache verleihen und Aphrodite allen Liebreiz.
Also hatte Zeus unter der Gestalt eines Gutes ein blendendes Übel geschaffen und nannte sie Pandora, das heißt die Allbeschenkte; denn jeder der Unsterblichen hatte dem Mägdlein irgendein unheilbringendes Geschenk für die Menschen mitgegeben.
Darauf führte er die Jungfrau hernieder auf die Erde, wo Sterbliche vermischt mit den Göttern lustwandelten. Alle miteinander bewunderten die unvergleichliche Gestalt. Sie aber schritt zu Epimetheus, dem argloseren Bruder des Prometheus, ihm das Geschenk des Zeus zu bringen.
Vergebens hatte diesen der Bruder gewarnt, niemals ein Geschenk vom olympischen Zeus anzunehmen, damit den Menschen kein Leid dadurch widerführe, sondern es sofort zurückzusenden.
Epimetheus, dieses Wortes uneingedenk, nahm die schöne Jungfrau mit Freuden auf und empfand das Übel erst, als er es hatte. Denn bisher lebten die Geschlechter der Menschen, von seinem Bruder beraten, frei vom Übel, ohne beschwerliche Arbeit, ohne quälende Krankheit.
Das Weib aber trug in den Händen ihr Geschenk, ein großes Gefäß mit einem Deckel versehen. Kaum bei Epimetheus angekommen, schlug sie den Deckel zurück, und alsbald entflog dem Gefäße eine Schar von Übeln und verbreitete sich mit Blitzesschnelle über die Erde.
Ein einziges Gut war zuunterst in dem Gefäß verborgen, die Hoffnung; aber auf den Rat des Göttervaters warf Pandora den Deckel wieder zu, ehe es herausflattern konnte, und verschloss es für immer in dem Gefäß.
Das Elend erfüllte inzwischen in allen Gestalten Erde, Luft und Meer. Die Krankheiten irrten bei Tag und bei Nacht unter den Menschen umher, heimlich und schweigend, denn Zeus hatte ihnen keine Stimme gegeben; eine Schar von Fiebern hielt die Erde belagert, und der Tod, früher nur langsam die Sterblichen beschleichend, beflügelte seinen Schritt.
Darauf wandte sich Zeus mit seiner Rache gegen Prometheus. Er übergab den Verbrecher dem Hephästos und seinen Dienern, dem Kratos und der Bia (dem Zwang und der Gewalt). Diese mussten ihn in die szythischen Einöden schleppen und hier, über einem schauderhaften Abgrund, an eine Felswand des Berges Kaukasus mit unauflöslichen Ketten schmieden.
Ungern vollzog Hephästos den Auftrag seines Vaters, er liebte in dem Titanensohn den verwandten Abkömmling seines Urgroßvaters Uranus, den ebenbürtigen Göttersprössling. Unter mitleidsvollen Worten und von den roheren Knechten gescholten, ließ er diese das grausame Werk vollbringen.
So musste nun Prometheus an der freudlosen Klippe hängen, aufrecht, schlaflos, niemals imstande, das müde Knie zu beugen.
„Viele vergebliche Klagen und Seufzer wirst du versenden“, sagte Hephästos zu ihm, „denn Zeus’ Sinn ist unerbittlich, und alle, die erst seit Kurzem die Herrschergewalt an sich gerissen, sind hartherzig.“
Wirklich sollte auch die Qual des Gefangenen ewig oder doch dreißigtausend Jahre dauern. Obwohl laut aufseufzend und Winde, Ströme, Quellen und Meereswellen, die Allmutter Erde und den allschauenden Sonnenkreis zu Zeugen seiner Pein aufrufend, blieb er doch ungebeugten Sinnes.
„Was das Schicksal beschlossen hat“, sprach er, „muss derjenige tragen, der die unbezwingliche Gewalt der Notwendigkeit einsehen gelernt hat.“
Auch ließ er sich durch keine Drohungen des Zeus bewegen, die dunkle Weissagung, dass dem Götterherrscher durch einen neuen Ehebund Verderben und Untergang bevorstehe, näher auszudeuten. Zeus hielt Wort; er sandte dem Gefesselten einen Adler, der als täglicher Gast an seiner Leber zehren durfte, die sich, abgeweidet, immer wieder erneuerte. Die Qual sollte nicht eher aufhören, bis ein Ersatzmann erscheinen würde, der durch freiwillige Übernahme des Todes gewissermaßen sein Stellvertreter sein wollte.
Endlich erschien dem Unglücklichen der Tag der Erlösung. Als er jahrhundertelang, furchtbare Leiden erduldend, an dem Felsen gehangen, kam Herakles des Weges, auf der Fahrt nach den Hesperiden und ihren Äpfeln begriffen. Wie er den Götterenkel am Kaukasus hängen sah und sich seines guten Rates zu erfreuen hoffte, erbarmte ihn sein Geschick, denn er sah, wie der Adler, auf den Knien des Prometheus sitzend, an der Leber des Unglückseligen fraß. Da legte er Keule und Löwenhaut hinter sich, spannte den Bogen, entsandte den Pfeil und schoss den grausamen Vogel von der Leber des Gequälten hinweg. Hierauf löste er seine Fesseln und führte den Befreiten mit sich davon.
Damit aber des Götterkönigs Bedingung erfüllt würde, stellte er ihm als Ersatzmann den Zentauren Chiron, der bereit war, an jenes Statt zu sterben; denn vorher war er unsterblich.
Damit jedoch Zeus’ Urteil, der den Prometheus auf weit längere Zeit an den Felsen verbannt hatte, trotzdem nicht unvollzogen bliebe, musste Prometheus fortwährend einen eisernen Ring tragen, an welchem sich ein Steinchen von jenem Kaukasusfelsen befand. So konnte sich Zeus rühmen, dass sein Feind noch immer an den Kaukasus angeschmiedet sei.
Deukalion und Pyrrha
Als das eherne Menschengeschlecht auf Erden hauste und Zeus, dem Weltbeherrscher, schlimme Sage von seinen Freveln zu Ohren gekommen, beschloss er, selbst in menschlicher Gestalt die Erde zu durchstreifen. Aber allenthalben fand er das Gerücht noch milder als die Wahrheit.
Eines Abends in später Dämmerung trat er unter das ungastliche Obdach des Arkadierkönigs Lykaon, dessen Wildheit berüchtigt war. Er ließ durch einige Wunderzeichen merken, dass ein Gott gekommen sei, und die Menge hatte sich auf die Knie geworfen. Lykaon jedoch spottete über diese frommen Gebete.
„Lasst uns sehen“, .sprach er, „ob es ein Sterblicher oder ein Gott sei!“
Dabei beschloss er im Herzen, den Gast um Mitternacht, wenn der Schlummer auf ihm lastete, mit ungeahntem Tode zu verderben. Noch vorher aber schlachtete er einen armen Menschen, den ihm das Volk der Molosser als Geisel gesandt hatte, kochte die halb lebendigen Glieder in siedendem Wasser oder briet sie am Feuer und setzte sie dem Fremdling zum Nachtmahle auf den Tisch.
Zeus, der alles durchschaut hatte, fuhr vom Mahle empor und sandte die rächende Flamme über die Burg des Gottlosen. Bestürzt entfloh der König ins freie Feld. Der erste Wehlaut, den er ausstieß, war ein Geheul, sein Gewand wurde zu Zotteln, seine Arme zu Beinen, er war in einen blutdürstigen Wolf verwandelt.
Zeus kehrte in den Olymp zurück, hielt mit den Göttern Rat und gedachte das ruchlose Menschengeschlecht zu vertilgen.
Schon wollte er auf alle Länder die Blitze verstreuen; aber die Furcht, der Äther möchte in Flammen geraten und die Achse des Weltalls auflodern, hielt ihn ab. Er legte die Donnerkeile, welche ihm die Zyklopen geschmiedet, wieder beiseite und beschloss, über die ganze Erde Platzregen vom Himmel zu senden und so unter Wolkengüssen die Sterblichen zu vernichten.
Auf der Stelle ward der Nordwind samt allen andern die Wolken verscheuchenden Winde in die Höhlen des Äolos verschlossen und nur der Südwind von ihm ausgesendet.
Dieser flog mit triefenden Schwingen zur Erde hinab, sein entsetzliches Antlitz bedeckte pechschwarzes Dunkel, sein Bart war schwer vom Gewölk, von seinem weißen Haupthaar rann die Flut, Nebel lagerten auf der Stirn, aus der Brust troff ihm das Wasser.
Der Südwind griff an den Himmel, fasste mit der Hand die weit umherhangenden Wolken und fing an, sie auszupressen. Der Donner rollte, gedrängte Regenflut stürzte vom Himmel; die Saat beugte sich unter dem wogenden Sturm, darnieder lag die Hoffnung des Landmanns, verdorben war die langwierige Arbeit des ganzen Jahres.
Auch Poseidon, Zeus’ Bruder, kam ihm bei dem Zerstörungswerke zu Hilfe, berief alle Flüsse zusammen und sprach:
„Lasst euren Wogen alle Zügel schießen, fallt in die Häuser, durchbrechet die Dämme!“
Sie vollführten seinen Befehl, und Poseidon selbst durchbrach mit seinem Dreizack das Erdreich und schaffte durch Erschütterung den Fluten freie Bahn.
So strömten die Flüsse über die offene Flur hin, bedeckten die Felder, rissen Baumpflanzungen, Tempel und Häuser fort. Blieb auch wo ein Palast stehen, so deckte doch bald das Wasser seinen Giebel, und die höchsten Türme verbargen sich im Strudel.
Meer und Erde waren bald nicht mehr unterschieden; alles war See, und gestadeloser See. Die Menschen suchten sich zu retten, so gut sie konnten; der eine erkletterte den höchsten Berg, der andere bestieg einen Kahn und ruderte nun über das Dach seines versunkenen Landhauses oder über die Flügel seiner Weinpflanzungen hin, dass der Kiel an ihnen streifte.
In den Ästen der Wälder arbeiteten sich die Fische ab; den Eber, den eilenden, erjagte die Flut: Ganze Völker wurden vom Wasser hinweggerafft, und was die Welle verschonte, starb den schrecklichen Hungertod auf den unbebauten Heidegipfeln.
Ein solch hoher Berg ragte noch mit zwei Spitzen im Lande Phokis aus der alles bedeckenden Meeresflut heraus. Es war der Parnassos.
An ihn schwamm Deukalion, des Prometheus Sohn, dem dieser eine Warnung gegeben und ein Schiff erbaut hatte, mit seiner Gattin Pyrrha im Nachen heran. Kein Mann, kein Weib ward je gefunden, die an Rechtschaffenheit und Gottesfurcht diese beiden übertroffen hätten.
Als nun Zeus vom Himmel herabschauend die Welt von stehenden Gewässern überschwemmt und von den viel tausendmal Tausenden nur ein einziges Menschenpaar übrig sah, beide unsträflich, beide andächtige Verehrer der Gottheit, da sandte er den Nordwind aus, sprengte die schwarzen Wolken und hieß ihn die Nebel entführen; er zeigte dem Himmel die Erde und der Erde den Himmel wieder.
Auch Poseidon, der Meeresfürst, legte den Dreizack nieder und besänftigte die Flut. Das Meer erhielt wieder Ufer, die Flüsse kehrten in ihr Bett zurück; Wälder streckten ihre mit Schlamm bedeckten Baumwipfel aus der Tiefe hervor, Hügel folgten; endlich breitete sich auch wieder ebenes Land aus, und zuletzt war die Erde wieder da.
Deukalion blickte um sich. Das Land war verwüstet, und die Grabesstille versenkt. Tränen rollten bei diesem Anblick über seine Wangen, und er sprach zu seinem Weibe Pyrrha:
„Geliebte, einzige Lebensgenossin! So weit ich in die Länder schaue, nach allen Weltgegenden hin, kann ich keine lebende Seele entdecken. Wir zwei bilden miteinander das Volk der Erde, alle andern sind in der Wasserflut untergegangen.
Aber auch wir sind unseres Lebens noch nicht mit Gewissheit sicher. Jede Wolke, die ich sehe, erschreckt meine Seele noch.
Und wenn auch alle Gefahr vorüber ist, was fangen wir Einsamen auf der verlassenen Erde an? Ach, dass mich mein Vater Prometheus die Kunst gelehrt hätte, Menschen zu erschaffen und geformtem Tone Geist einzuflößen.“
So sprach er, und das verlassene Paar fing an zu weinen; dann warfen sie sich vor einem halbzerstörten Altar der Göttin Themis auf die Knie nieder und begannen zu der Himmlischen zu flehen:
„Sag uns, o Göttin, durch welche Kunst stellen wir unser untergegangenes Geschlecht wieder her! O hilf der versunkenen Welt wieder zum Leben!“
„Verlasset meinen Altar“, tönte die Stimme der Göttin, „umschleiert euer Haupt, löst eure Gürtel und werft die Gebeine eurer Mutter hinter euren Rücken.“
Lange wunderten sich beide über diesen rätselhaften Götterspruch. Pyrrha brach zuerst das Schweigen.
„Verzeih mir, hohe Göttin“, sprach sie, „wenn ich dir schaudernd nicht gehorche und meiner Mutter Schatten nicht durch Zerstreuung ihrer Gebeine kränken will!“
Aber dem Deukalion fuhr es durch den Geist wie ein Lichtstrahl. Er beruhigte seine Gattin mit den freundlichen Worten:
„Wenn mich mein Scharfsinn nicht trügt, bergen die Worte der Götter keinen Frevel! Unsere große Mutter, das ist die Erde, ihre Knochen sind die Steine, und diese, Pyrrha, sollen wir hinter uns werfen!“
Beide misstrauten indessen dieser Deutung noch lange.
Jedoch, was schadet die Probe, dachten sie. So gingen sie denn seitwärts, verhüllten ihr Haupt, entgürteten ihre Kleider und warfen, wie ihnen befohlen war, die Steine hinter sich.
Da ereignete sich ein großes Wunder: Das Gestein begann seine Härte und Spröde abzulegen, wurde geschmeidig, wuchs, gewann eine Gestalt; menschliche Formen traten an ihm hervor, doch noch nicht deutlich, sondern rohen Gebilden oder einer in Marmor vom Künstler erst aus dem Groben heraus gemeißelten Figur ähnlich.
Was jedoch an den Steinen Feuchtes und Erdiges war, das wurde zu Fleisch an dem Körper; das Unbeugsame und Feste ward in Knochen verwandelt; das Geäder in den Steinen blieb Geäder. So gewannen die vom Manne geworfenen Steine mit Hilfe der Götter in kurzer Frist männliche Gestalt, die vom Weibe geworfenen weibliche.
Diesen seinen Ursprung verleugnet das menschliche Geschlecht nicht, es ist ein hartes Geschlecht und tauglich zur Arbeit. Jeden Augenblick erinnert es daran, aus welchem Stamm es erwachsen ist.
Io
Inachos, der uralte Stammfürst und König der Pelasger, hatte eine bildschöne Tochter mit Namen Io. Auf sie war der Blick des Zeus, des olympischen Herrschers, gefallen, als sie auf der Wiese von Lerna die Herden ihres Vaters hütete. Der Gott ward von Liebe zu ihr erfüllt, trat zu ihr in Menschengestalt und fing an, sie mit verführerischen Schmeichelworten zu versuchen:
„O Jungfrau, glücklich ist, der dich besitzen wird; doch ist kein Sterblicher deiner wert, und du verdientest des höchsten Gottes Braut zu sein! Wisse denn, ich bin Zeus, Fliehe nicht vor mir!
Die Hitze des Mittags brennt heiß. Tritt mit mir in den Schatten des erhabenen Haines, der uns dort zur Linken in seine Kühle einlädt; was machst du dir in der Glut des Tages zu schaffen?
Fürchte dich doch nicht, den dunklen Wald und die Schluchten, in welchen das Wild haust, zu betreten. Bin doch ich da, dich zu schirmen, der Gott, der das Zepter des Himmels führt und die zackigen Blitze über den Erdboden versendet.“
Aber die Jungfrau floh vor dem Versucher mit eiligen Schritten, und sie wäre ihm auf den Flügeln der Angst entkommen, wenn der verfolgende Gott seine Macht nicht missbraucht und das ganze Land in dichte Finsternis gehüllt hätte.
Rings umqualmte die Fliehende der Nebel, und bald waren ihre Schritte gehemmt durch die Furcht, an einen Felsen zu stoßen oder in einen Fluss zu stürzen. So kam die unglückliche Io in die Gewalt des Gottes.
Hera, die Göttermutter, war längst an die Treulosigkeit ihres Gatten gewöhnt, der sich von ihrer Liebe ab- und den Töchtern der Halbgötter und der Sterblichen zuwandte; aber sie vermochte ihren Zorn und ihre Eifersucht nicht zu bändigen, und mit immer wachem Misstrauen beobachtete sie alle Schritte des Zeus auf der Erde. So schaute sie auch jetzt gerade auf die Gegenden hernieder, wo ihr Gemahl ohne ihr Wissen wandelte.
Zu ihrem großen Erstaunen bemerkte sie plötzlich, wie der heitere Tag auf einer Stelle durch nächtlichen Nebel getrübt wurde und wie dieser weder einem Strome noch dem dunstigen Boden entsteige noch sonst von einer natürlichen Ursache herrühre. Da kam ihr schnell ein Gedanke an die Untreue ihres Gatten; sie spähte rings durch den Olymp und fand ihn nicht.
„Wenn mich nicht alles täuscht“, sprach sie ergrimmt zu sich selbst, „werde ich von meinem Gatten schnöde gekränkt!“
Und nun fuhr sie auf einer Wolke vom hohen Äther zur Erde hernieder und gebot dem Nebel, der den Entführer mit seiner Beute umschlossen hielt, zu weichen.
Zeus hatte die Ankunft seiner Gemahlin geahnt, und um seine Geliebte ihrer Rache zu entziehen, verwandelte er die schöne Tochter des Inachos schnell in eine schmucke, schneeweiße Kuh.
Aber auch so war die Holdselige noch schön geblieben. Hera, welche die List ihres Gemahls alsbald durchschaut hatte, pries das stattliche Tier und fragte, als wüsste sie nichts von der Wahrheit, wem die Kuh gehöre, woher und von welcher Zucht sie sei.
Zeus, in der Not und um sie von weiterer Nachfrage abzuschrecken, nahm seine Zuflucht zu einer Lüge und gab vor, die Kuh entstamme der Erde.
Hera gab sich damit zufrieden, aber sie bat sich das schöne Tier von ihrem Gemahl zum Geschenk aus.
Was sollte der betrogene Betrüger machen? Gibt er die Kuh her, so wird er seiner Geliebten verlustig; verweigert er sie, so erregt er erst recht den Verdacht seiner Gemahlin, welche der Unglücklichen dann rasches Verderben senden wird! So entschloss er sich denn, für den Augenblick auf die Jungfrau zu verzichten, und schenkte die schimmernde Kuh, die er immer noch für unentdeckt hielt, seiner Gemahlin.
Hera knüpfte, scheinbar beglückt durch die Gabe, dem schönen Tier ein Band um den Hals und führte die Unselige, der ein verzweifelndes Menschenherz unter der Tiergestalt schlug, im Triumphe davon.
Doch machte der Göttin dieser Diebstahl selbst Angst, und sie ruhte nicht, bis sie ihre Nebenbuhlerin der sichersten Hut überantwortet hatte.
Daher suchte sie den Argos, den Sohn des Arestor, auf, ein Ungetüm, das ihr zu diesem Dienste besonders geeignet schien. Denn Argos halte hundert Augen im Kopfe, von denen nur ein Paar abwechslungsweise sich in schloss und der Ruhe ergab, während alle übrigen, über Vorder- und Hinterhaupt wie funkelnde Sterne zerstreut, auf ihrem Posten ausharrten.
Diesen bestellte Hera zum Wächter der armen Io, damit ihr Gemahl Zeus die entrissene Geliebte nicht entführen könne.
Unter seinen hundert Augen durfte Io, die Kuh, tagsüber auf einer fetten Trift weiden; Argos aber stand in der Nähe, und wo er sich immer hinstellen mochte, erblickte er die ihm Anvertraute; auch wenn er sich abwandte und ihr das Hinterhaupt zukehrte, hatte er sie vor Augen.
Wenn aber die Sonne untergegangen war, schloss er sie ein und belastete den Hals der Unglücklichen mit Ketten; bittere Kräuter und Baumlaub waren ihre Speise, ihr Bett der harte, nicht einmal immer mit Gras bedeckte Boden, ihr Trank schlammige Pfützen.
Io vergaß oft, dass sie kein Mensch mehr war, sie wollte Mitleiden erflehend ihre Arme zu Argos erheben: Da ward sie erst daran erinnert, dass sie keine Arme mehr hatte. Sie wollte ihm in Worten rührende Bitten vortragen: Dann entfuhr ihrem Munde ein Brüllen, dass sie vor ihrer eigenen Stimme erschrak, welche sie daran mahnte, wie sie durch ihres Räubers Selbstsucht in ein Tier verwandelt worden sei.
Doch blieb Argos mit ihr nicht an einer Stelle, denn so hatte es ihm Hera geheißen, die Io durch Wechsel des Aufenthaltsortes dem Gemahl umso eher zu entziehen hoffte.
Ihr Wächter zog daher mit ihr im Lande umher, und so kam sie auch mit ihm in ihre alte Heimat, an das Gestade des Flusses, wo sie oft als Kind zu spielen gepflegt. Da sah sie zum ersten Mal ihr Bild in der Flut; als das Tierhaupt mit Hörnern ihr aus dem Wasser entgegenblickte, schauderte sie zurück und floh bestürzt vor sich selbst.
Ein sehnsüchtiger Trieb führte sie in die Nähe ihrer Schwestern, in die Nähe ihres Vaters Inachos; aber diese erkannten sie nicht. Inachos streichelte wohl das schöne Tier und reichte ihm Blätter, die er von dem nächsten Strauche pflückte: Io beleckte dankbar seine Hand und benetzte sie mit Küssen und heimlichen Tränen. Aber wen er liebkoste und von wem er geliebkost wurde, das ahnte der Greis nicht.
Endlich kam der Armen, deren Geist unter der Verwandlung nicht gelitten hatte, ein glücklicher Gedanke. Sie fing an, Schriftzeichen mit dem Fuße zu ziehen, und erregte durch diese Bewegung die Aufmerksamkeit des Vaters, der bald im Staube die Kunde las, dass er sein eigenes Kind vor sich habe.
„Ich Unglückseliger“, rief der Greis bei seiner Entdeckung aus, indem er sich an Horn und Nacken der stöhnenden Tochter hing, „so muss ich dich wiederfinden, die ich durch alle Länder gesucht habe! Wehe mir, du hast mir weniger Kummer gemacht, solange ich dich suchte, als jetzt, wo ich dich gefunden habe!
Du schweigst? Du kannst mir kein tröstendes Wort sagen, mir nur mit einem Gebrüll antworten! Ich Tor, einsam sann ich darauf, wie ich dir einen würdigen Gatten zuführen könnte, und dachte nur an Brautfackel und Vermählung. Nun bist du ein Kind der Herde –“
Argos, der grausame Wächter, ließ den jammernden Vater nicht vollenden, er riss Io von dem Vater hinweg und schleppte sie fort auf einsame Weiden. Dann klomm er selbst einen Berggipfel empor und versah sein Amt, indem er mit seinen hundert Augen wachsam nach allen vier Winden hinauslugte.
Zeus konnte das Leid der Inachostochter nicht länger ertragen. Er rief seinem geliebten Sohne Hermes und befahl ihm, seine List zu gebrauchen und dem verhaften Wächter das Augenlicht auszulöschen.
Dieser beflügelte seine Füße, ergriff mit der mächtigen Hand seine einschläfernde Rute und setzte seinen Reisehut auf. So fuhr er von dem Palaste seines Vaters zur Erde nieder. Dort legte er Hut und Schwingen ab und behielt nur den Stab; so stellte er einen Hirten vor, lockte Ziegen an sich und trieb sie auf die abgelegenen Fluren, wo Io weidete und Argos die Wache hielt. Hier angekommen, zog er ein Hirtenrohr, das man Syrinx nennt, hervor und fing an, so anmutig und voll zu blasen, wie man von irdischen Hirten zu vernehmen nicht gewohnt ist.
Der Diener Heras freute sich dieses ungewohnten Schalls, erhob sich von seinem Felsensitze und rief hernieder:
„Wer du auch sein magst, willkommener Rohrbläser, du könntest wohl bei mir auf diesem Felsen hier ausruhen. Nirgends ist der Graswuchs üppiger für das Vieh als hier, und du siehst, wie behaglich der Schatten dieser dicht gepflanzten Bäume für den Hirten ist!“
Hermes dankte dem Rufenden, stieg hinauf und setzte sich zu dem Wächter, mit welchem er eifrig zu plaudern anfing und sich so ernstlich ins Gespräch vertiefte, dass der Tag herumging, ehe Argos sich dessen versah. Diesem begannen die Augen zu schläfern, und nun griff Hermes wieder zu seinem Rohr und versuchte sein Spiel, um ihn vollends in Schlummer zu wiegen.
Aber Argos, der an den Zorn seiner Herrin dachte, wenn er seine Gefangene ohne Fesseln und Obhut ließe, kämpfte mit dem Schlaf, und wenn sich auch der Schlummer in einen Teil seiner Augen schlich, so wachte er doch fortdauernd mit dem andern Teil, nahm sich zusammen. Da die Rohrpfeife erst kürzlich erfunden worden war, so fragte er seinen Gesellen nach dem Ursprünge dieser Erfindung.
„Das will ich dir gern erzählen“, sagte Hermes, „wenn du in dieser späten Abendstunde Geduld und Aufmerksamkeit genug hast, mich anzuhören.
In den Schneegebirgen Arkadiens wohnte eine berühmte Hamadryade (Baumnymphe), mit Namen Syrinx. Die Waldgötter und Satyrn, von ihrer Schönheit bezaubert, verfolgten sie schon lange mit ihrer Werbung, aber immer wusste sie ihnen zu entschlüpfen. Denn sie scheute das Joch der Vermählung und wollte, umgürtet und jagdliebend wie Artemis, gleich dieser in jungfräulichem Stande verharren.
Endlich wurde auch der mächtige Gott Pan auf seinen Streifzügen durch jene Wälder der Nymphe ansichtig, näherte sich ihr und warb, im stolzen Bewusstsein seiner Hoheit, dringend um ihre Hand.
Aber die Nymphe verschmähte sein Flehen und flüchtete vor ihm durch unwegsame Steppen, bis sie zuletzt an das langsame Wasser des versandeten Flusses Ladon kam, dessen Wellen doch noch tief genug waren, der Jungfrau den Übergang zu wehren. Hier beschwor sie ihre Schutzgöttin Artemis, sich ihrer Verehrerin zu erbarmen und sie zu verwandeln, ehe sie in die Hand des Gottes fiele.
Indes kam der Gott herangeflogen und umfasste die am Ufer Zögernde; aber wie staunte er, als er, statt eine Nymphe zu umarmen, nur ein Schilfrohr umfasst hielt; seine lauten Seufzer zogen vervielfältigt durch das Rohr und wiederholten sich mit tiefem, klagendem Gesäusel. Der Zauber dieses Wohllautes tröstete den getäuschten Gott.
,Wohl denn, verwandelte Nymphe‘, rief er mit schmerzlicher Freude, ,auch so soll unsere Verbindung unauflöslich sein!‘
Und nun schnitt er sich von dem geliebten Schilfe ungleichförmige Röhren, verband sie mit Wachs untereinander und nannte die lieblich tönende Flöte nach dem Namen der holden Hamadryade, und seitdem heißt dieses Hirtenrohr Syrinx.“
So lautete die Erzählung des Hermes, bei welcher er den hundertäugigen Wächter unausgesetzt im Auge behielt. Die Mär war noch nicht zu Ende, als er sah, wie ein Auge um das andere sich schloss und endlich alle die hundert Leuchten im dichten Schlaf erloschen waren.
Nun hemmte der Götterbote seine Stimme, berührte mit seinem Zauberstabe nacheinander die hundert eingeschläferten Augenlider und verstärkte ihre Betäubung.
Während nun der hundertäugige Argos in tiefem Schlafe nickte, griff Hermes schnell zu dem Sichelschwerte, das er unter seinem Hirtenrocke verborgen trug, und hieb ihm den gesenkten Nacken, da wo der Hals zunächst an den Kopf grenzt, durch und durch. Kopf und Rumpf stürzten nacheinander vom Felsen herab und färbten das Gestein mit einem Strome von Blut.
Nun war Io befreit, und obwohl noch unverwandelt, rannte sie ohne Fesseln davon. Aber den durchdringenden Blicken Heras entging nicht, was in der Tiefe geschehen war. Sie dachte auf eine ausgesuchte Qual für ihre Nebenbuhlerin und sandte ihr eine Bremse, die das unglückliche Geschöpf durch ihren Stich zum Wahnsinne trieb.
Diese Qual jagte die Geängstigte mit ihrem Stachel landflüchtig über den ganzen Erdkreis, zu den Szythen an den Kaukasus, zum Amazonenvolke, zum kimmerischen Bosporus und an die mäotische See; dann hinüber nach Asien und endlich nach langem verzweiflungsvollem Irrlaufe nach Ägypten.
Hier, am Strande des Nils angelangt, sank Io auf ihre Vorderfüße nieder und hob, den Hals rücklings gebogen, ihre stummen Augen zum Olymp empor, mit einem Blick voll Jammer gegen Zeus.
Diesen erbarmte der Anblick; er eilte zu seiner Gemahlin Hera, umfing ihren Hals mit den Armen, flehte um Barmherzigkeit für das arme Mädchen, das schuldlos an seiner Verirrung war, und schwur ihr beim Styx, dem Wasser der Unterwelt, bei dem die Götter schwören, von seiner Neigung zu ihr hinfort ganz abzulassen.
Hera hörte während dieser Bitte das flehentliche Brüllen der Kuh, das zum Olymp emporstieg. Da ließ sich die Göttermutter erweichen und gab dem Gemahle Vollmacht, der Missgestalteten den menschlichen Leib zurückzugeben.
Zeus eilte zur Erde nieder und an den Nil. Hier strich er der Kuh mit der Hand über den Rücken; da war es wunderbar anzuschauen: Die Zotteln flohen vom Leibe des Tieres, das Gehörn schrumpfte zusammen, die Scheibe der Augen verengte sich, das Maul zog sich zu Lippen zusammen, Schultern und Hände kehrten wieder, die Klauen verschwanden, nichts blieb von der Kuh übrig als die schöne weiße Farbe. In ganz verwandelter Gestalt erhob sich Io vom Boden und stand aufrecht in menschlicher Schönheit leuchtend.
Am Nilstrome gebar sie dem Zeus den Epaphos, und weil das Volk die wunderbar Verwandelte und Errettete göttergleich ehrte, so herrschte sie lange mit Fürstengewalt über jene Lande. Doch blieb sie trotzdem nicht ganz von Heras Zorn verschont.
Diese stiftete das wilde Volk der Kureten an, ihren jungen Sohn Epaphos zu entführen, und nun trat sie aufs Neue eine lange vergebliche Wanderung an, den Geraubten aufzusuchen.
Endlich, nachdem Zeus die Kureten mit dem Blitz erschlagen, fand sie den entführten Sohn an der Grenze Äthiopiens wieder, kehrte mit ihm nach Ägypten zurück und ließ ihn an ihrer Seite herrschen.
Er heiratete die Memphis, und diese gebar ihm Libya, von der das Land Libyen den Namen erhielt; Mutter und Sohn wurden von dem Nilvolke nach beider Tode mit Tempeln geehrt und erhielten, sie als Isis, er als Apis, göttliche Verehrung.
Phaethon
Auf herrlichen Säulen erbaut stand die Königsburg des Sonnengottes, von blitzendem Gold und glühendem Karfunkel schimmernd; den obersten Gipfel umschloss blendendes Elfenbein, gedoppelte Türen strahlten im Silberglanz, darauf in erhabener Arbeit die schönsten Wundergeschichten zu schauen waren.
In diesen Palast trat Phaethon, der Sohn des Sonnengottes Helios, und verlangte den Vater zu sprechen. Doch stellte er sich nur von ferne hin, denn in der Nähe war das strahlende Licht nicht zu ertragen.
Der Vater Helios, von Purpurgewand umhüllt, saß auf seinem fürstlichen Stuhle, der mit glänzenden Smaragden besetzt war; zu seiner Rechten und zu seiner Linken stand sein Gefolge geordnet, der Tag, der Monat, das Jahr, die Jahrhunderte und die Horen, der jugendliche Lenz mit seinem Blütenkranze, der Sommer mit Ährengewinden bekränzt, der Herbst mit einem Füllhorn voll Trauben, der eisige Winter mit schneeweißen Haaren. Helios, in ihrer Mitte sitzend, wurde mit seinem allschauenden Auge bald den Jüngling gewahr, der über so viele Wunder staunte.
„Was ist der Grund deiner Wallfahrt“, sprach er, „was führt dich in den Palast deines göttlichen Vaters, mein Sohn?“
Phaethon antwortete:
„Erlauchter Vater, man spottet mein auf Erden und beschimpft meine Mutter Klymene. Sie sagen, ich erheuchle nur himmlische Abkunft und sei der Sohn eines unbekannten Vaters. Darum komme ich, von dir ein Unterpfand zu erbitten, das mich vor aller Welt als deinen wirklichen Sprössling erweise.“
So sprach er; da legte Helios die Strahlen, die ihm rings das Haupt umleuchteten, ab und hieß ihn näher herantreten; dann umarmte er ihn und sprach:
„Deine Mutter Klymene hat die Wahrheit gesagt, mein Sohn, und ich werde dich vor der Welt nimmermehr verleugnen. Damit du aber ja nicht länger zweifelst, erbitte dir ein Geschenk; ich schwöre beim Styx, dem Flusse der Unterwelt, bei welchem alle Götter schwören, deine Bitte, welche sie auch sei, soll dir erfüllt werden!“
Phaethon ließ den Vater kaum ausreden.
„So erfülle mir denn“, sprach er, „meinen glühendsten Wunsch und vertraue mir nur auf einen Tag die Lenkung deines geflügelten Sonnenwagens!“
Schrecken und Reue wurden sichtbar auf dem Angesichte des Gottes. Drei-, viermal schüttelte er sein umleuchtetes Haupt und rief endlich:
„O Sohn, du hast mich ein sinnloses Wort sprechen lassen! O könnte ich doch mein Versprechen zurücknehmen! Du verlangst ein Geschenk, dem deine Kräfte nicht gewachsen sind; du bist zu jung; du bist sterblich, und was du wünschest, ist ein Werk der Unsterblichen!
Du erstrebest sogar mehr, als den übrigen Göttern zu erlangen vergönnt ist. Denn außer mir vermag keiner von ihnen auf der glutsprühenden Achse zu stehen.
Der Weg, den mein Wagen zu machen hat, ist gar steil, mit Mühe erklimmt ihn in der Frühe des Morgens mein noch frisches Rossegespann. Die Mitte der Laufbahn ist zu oberst am Himmel.
Glaube mir, wenn ich auf meinem Wagen in solcher Höhe stehe, da kommt mich oft selbst ein Grausen an, und mein Haupt droht ein Schwindel zu fassen, wenn ich so herniederblicke in die Tiefe und Meer und Land weit unter mir liegt.
Zuletzt ist dann die Straße ganz abschüssig, da bedarf es gar sichrer Lenkung. Die Meeresgöttin Tethys selbst, die mich in ihre Fluten aufnimmt, pflegt alsdann zu befürchten, ich möchte in die Tiefe geschmettert werden.
Dazu bedenke, dass der Himmel sich in beständigem Umschwunge dreht und ich diesem reißenden Kreisläufe entgegenfahren muss. Wie vermöchtest du das, wenn ich dir auch meinen Wagen gäbe?
Darum, geliebter Sohn, verlange nicht ein so schlimmes Geschenk und bessere deinen Wunsch, solange es noch Zeit ist.
Sieh mein erschrecktes Gesicht an! O könntest du durch meine Augen in mein sorgenvolles Vaterherz eindringen! Verlange, was du sonst willst von allen Gütern des Himmels und der Erde! Ich schwöre dir beim Styx, du sollst es haben! – Warum bedrängst du mich mit solchem Ungestüm?“
Aber der Jüngling ließ mit Flehen nicht ab, und der Vater hatte den heiligen Schwur geschworen. So nahm er denn seinen Sohn bei der Hand und führte ihn zu dem Sonnenwagen, des Hephästos herrlicher Arbeit. Achse, Deichsel und der Kranz der Räder waren von Gold, die Speichen Silber; vom Joche schimmerten Chrysolithen und Juwelen.
Während Phaethon die herrliche Arbeit von Herzen bestaunte, tat im geröteten Osten die erwachte Morgenröte ihr Purpurtor und ihren Vorsaal, der voll Rosen ist, auf. Die Sterne verschwanden allmählich, der Morgenstern war der Letzte, der seinen Posten am Himmel verließ, und die äußersten Hörner des Mondes verloren sich am Rande.
Jetzt gab Helios den geflügelten Horen den Befehl, die Rosse zu schirren, und diese führten die glutsprühenden Tiere, von Ambrosia gesättigt, von den prunkvollen Krippen und legten ihnen herrliche Zäume an.
Während dies geschah, bestrich der Vater das Antlitz seines Sohnes mit einer heiligen Salbe und machte es dadurch fähig, die glühende Flamme zu ertragen. Um das Haupthaar legte er ihm seine Strahlensonne, aber er seufzte dazu und sprach warnend:
„Kind, schone mir die Stacheln, brauche wacker die Zügel; denn die Rosse rennen schon von selbst, und es kostet Mühe, sie im Fluge zu halten; die Straße geht schräg mit weitumbiegender Krümmung; den Südpol wie den Nordpol musst du meiden. Du erblickst deutlich die Geleise der Räder. Senke dich nicht zu tief, sonst gerät die Erde in Brand; steige nicht zu hoch, sonst verbrennst du den Himmel! Auf, die Finsternis flieht, nimm die Zügel zur Hand; oder – noch ist es Zeit; besinne dich, liebes Kind; überlass den Wagen mir, lass mich der Welt das Licht schenken und bleibe du Zuschauer!“
Der Jüngling schien die Worte des Vaters gar nicht zu hören; er schwang sich mit einem Sprung auf den Wagen, voll Freude, die Zügel in den Händen zu haben, und nickte dem unzufriedenen Vater einen kurzen, freundlichen Dank zu.
Mittlerweile füllten die vier Flügelrosse mit glutatmendem Wiehern die Luft, und ihr Huf stampfte gegen die Barren. Tethys, Phaethons Großmutter, welche nichts vom Lose des Enkels ahnte, tat diese auf; die Welt lag in unendlichem Raume vor den Blicken des Knaben, die Rosse flogen die Bahn aufwärts und spalteten die Morgennebel, die vor ihnen lagen.
Inzwischen fühlten die Rosse wohl, dass sie nicht die gewohnte Last trugen und das Joch leichter sei als gewöhnlich: und wie die Schiffe, wenn sie das rechte Gewicht nicht haben, im Meere schwanken, so machte der Wagen Sprünge in der Luft, ward hoch emporgestoßen und rollte dahin, als wäre er leer.
Als das Rossegespann dies merkte, rannte es, die gebahnten Räume verlassend, und lief nicht mehr in der vorigen Ordnung. Phaethon fing an zu erbeben, er wusste nicht, wohin die Zügel lenken, wusste den Weg nicht, wusste nicht, wie er die wilden Rosse bändigen sollte.
Als nun der Unglückliche hoch am Himmel abwärts sah auf die tief, tief unter ihm sich hinstreckenden Länder, wurde er blass, und seine Knie zitterten vor plötzlichem Schrecken. Er sah rückwärts; schon lag viel Himmel hinter ihm, aber mehr noch vor seinen Augen. Beides ermaß er in seinem Geiste.
Unwissend, was beginnen, starrte er in die Weite, ließ die Zügel nicht nach, zog sie auch nicht weiter an; er wollte den Rossen rufen, aber er kannte ihre Namen nicht. Mit Grauen sah er die mannigfaltigen Sternbilder an, die in abenteuerlichen Gestalten am Himmel herumhingen.
Da ließ er, von kaltem Entsetzen erfasst, die Zügel fahren, und wie sie herabschlotternd den Rücken der Pferde berührten, verließen diese ihre Spur, schweiften seitwärts in fremde Luftgebiete, gingen bald hoch empor, bald tief hernieder; jetzt stießen sie an den Fixsternen an, jetzt wurden sie auf abschüssigen Pfaden in die Nachbarschaft der Erde herabgerissen. Schon berührten sie die erste Wolkenschicht, die bald entzündet aufdampfte. Immer tiefer stürzte der Wagen, und unversehens war er einem Hochgebirge nahe gekommen.
Da lechzte vor Hitze der Boden und spaltete sich, und weil plötzlich alle Säfte austrockneten, fing er an zu glimmen; das Heidegras wurde weißgelb und welkte hinweg; weiter unten loderte das Laub der Waldbäume auf; bald war die Glut bei der Ebene angekommen; nun wurde die Saat weggebrannt, ganze Städte loderten in Flammen auf, Länder mit all ihrer Bevölkerung wurden versengt; rings brannten Hügel, Wälder und Berge. Damals sollen auch die Neger schwarz geworden sein.
Die Ströme versiegten oder flohen erschreckt nach ihrer Quelle zurück, das Meer selbst wurde zusammengedrängt, und was jüngst noch See war, wurde trockenes Sandfeld.
An allen Seiten sah Phaethon den Erdkreis entzündet, ihm selbst wurde die Glut bald unerträglich; wie tief aus dem Innern einer Feueresse atmete er siedende Luft ein und fühlte unter seinen Sohlen, wie der Wagen erglühte. Schon konnte er den Dampf und die vom Erdbrand emporgeschleuderte Asche nicht mehr ertragen, Qualm und pechschwarzes Dunkel umgab ihn; das Flügelgespann war nicht mehr zu bändigen.
Schließlich ergriff die Glut seine Haare, er stürzte aus dem Wagen, und brennend wurde er durch die Luft gewirbelt, wie zuweilen ein Stern bei heiterer Luft durch den Himmel zu schießen scheint. Ferne von der Heimat nahm ihn der breite Strom Eridanos auf und bespülte ihm sein schäumendes Angesicht.
Helios, der Vater, der dies alles mit ansehen musste, verhüllte sein Haupt in tiefer Trauer. Damals, sagt man, sei ein Tag der Erde ohne Sonnenlicht vorübergeflohen. Der ungeheure Brand leuchtete allein über den Erdball.
Europa
Im Lande von Tyrus und Sidon lebte die Jungfrau Europa, die Tochter des Königs Agenor, in der tiefen Abgeschiedenheit des väterlichen Palastes. Ihr wurde nach Mitternacht, wo untrügliche Träume die Sterblichen besuchen, ein seltsames Traumbild vom Himmel gesendet. Es kam ihr vor, als erschienen zwei Weltteile in Frauengestalt, Asien und der gegenüberliegende, und stritten um ihren Besitz.
Die eine der Frauen hatte die Gestalt einer Fremden, die andere – und dies war Asien – glich an Aussehen und Gebärde einer Einheimischen.
Diese wehrte sich mit zärtlichem Eifer für ihr Kind Europa und erklärte, dass sie es sei, welche die geliebte Tochter geboren und gesäugt habe. Das fremde Weib aber umfasste sie wie einen Raub mit gewaltigen Armen und zog sie mit sich fort, ohne dass Europa im Innern zu widerstreben vermochte.
„Komm nur mit mir, Liebchen“, sprach die Fremde, „ich trage dich als Beute dem Ägiserschütterer Zeus entgegen; so ist dir’s vom Geschick beschieden.“
Mit klopfendem Herzen erwachte Europa und richtete sich vom Lager auf, denn der nächtliche Traum war hell wie ein Anblick des Tages gewesen.
Lange Zeit saß sie unbeweglich aufrecht im Bette, vor sich hinstarrend, und vor ihren weitaufgetanen Augen standen noch die beiden Frauen. Erst später öffneten sich ihre Lippen zum bangen Selbstgespräch.
„Welcher Himmlische“, sprach sie, „hat mir diese Bilder zugeschickt? Was für wunderbare Träume haben mich aufgeschreckt, während ich im Elternhaus süß und fest schlummerte? Wer war doch die Fremde, die ich im Traume gesehen? Welch eine wunderbare Sehnsucht nach ihr regt sich in meinem Herzen? Und wie ist sie selbst mir so liebreich entgegengekommen und, auch als sie mich gewaltsam entführte, mit welchem Mutterblicke hat sie mich angelächelt! Mögen die seligen Götter mir den Traum zum Besten kehren!“
Der Morgen war herangekommen; der helle Tagesschein verwischte den nächtlichen Schimmer des Traumes aus der Seele der Jungfrau, und Europa erhob sich zu den Beschäftigungen und Freuden ihres jungfräulichen Lebens.
Bald sammelten sich um sie ihre Altersgenossinnen und Gespielinnen, Töchter der ersten Häuser, welche sie zu Chortänzen, Opfern und Spaziergängen zu begleiten pflegten.
Auch jetzt kamen sie, ihre Herrin zu einem Gange nach den blumenreichen Wiesen am Meer einzuladen, wo sich die Mädchen der Gegend scharenweise zu versammeln und am üppigen Wuchse der Blumen und am hallenden Rauschen des Meeres zu erfreuen pflegten.
Alle Mädchen waren in schmucke, blumengestickte Gewande gekleidet; Europa selbst trug ein wunderherrliches, goldgesticktes Schleppkleid voll glänzender Bilder aus der Göttersage; das köstliche Gewand war ein Werk des Hephästos, ein uraltes Göttergeschenk des Erderschütterers Poseidon, das dieser der Libya geschenkt hatte, als er um sie warb. Aus ihrem Besitze war es von Hand zu Hand als Erbstück in das Haus des Agenor gekommen.
Mit diesem Brautschmuck angetan, eilte die holdselige Europa an der Spitze ihrer Gespielinnen den Meereswiesen zu, die voll der buntesten Blumen standen.
Jubelnd zerstreute sich die Schar der Mädchen da- und dorthin, jede suchte sich eine Blume auf, die nach ihrem Sinne war. Die eine pflückte die glänzende Narzisse, die andere wandte sich der Balsam ausströmenden Hyazinthe zu, eine dritte erwählte sich das sanfter duftende Veilchen, andern gefiel der würzige Quendel, wieder andere wählten den gelben lockenden Krokus. So flogen die Gespielinnen hin und her. Europa aber hatte bald ihr Ziel gefunden; sie stand, wie unter den Grazien die Liebesgöttin, alle ihre Genossinnen überragend, und hielt hoch in der Hand einen Strauß von Rosen.
Als sie genug Blumen gesammelt hatten, lagerten sich die Jungfrauen, ihre Fürstin in der Mitte, harmlos auf den Rasen und fingen an, Kränze zu flechten, die sie, den Nymphen der Wiese zum Dank, an grünenden Bäumen aufhängen wollten.
Aber nicht lange sollten sie sich an den Blumen erfreuen, denn in das sorglose Jugendleben Europas griff unversehens das Schicksal ein, das ihr der Traum der verschwundenen Nacht geweissagt hatte.
Zeus, der Kronide, war von den Geschossen des Liebesgottes, die allein auch den unbezwungenen Göttervater zu besiegen vermochten, getroffen und von der Schönheit der jungen Europa ergriffen worden.
Weil er aber den Zorn der eifersüchtigen Hera fürchtete, auch nicht hoffen durfte, den unschuldigen Sinn der Jungfrau zu betören, so sann der verschlagene Gott auf eine neue List. Er verwandelte seine Gestalt und wurde ein Stier.
Aber welch ein Stier! Nicht, wie er auf gemeiner Wiese geht oder unters Joch gebeugt den schwer beladenen Wagen zieht; nein, groß, herrlich von Gestalt, mit schwellenden Muskeln am Halse und vollen Wammen am Bug; seine Hörner waren zierlich und klein, wie von Händen gedrechselt, und durchsichtiger als reine Juwelen; goldgelb war die Farbe seines Leibes, nur auf der Stirne schimmerte ein silberweißes Mal, dem gekrümmten Horne des wachsenden Mondes ähnlich; bläuliche, von Verlangen funkelnde Augen rollten in seinem Kopf.
Ehe Zeus diese Verwandlung mit sich vornahm, rief er den Hermes zu sich auf den Olymp und sprach, ohne ihm etwas von seinen Absichten zu enthüllen:
„Beeile dich, lieber Sohn, getreuer Vollbringer meiner Befehle! Siehst du dort unten das Land, das links zu uns emporblickt? Es ist Phönizien: Dorthin wende dich und treibe mir das Vieh des Königs Agenor, das du auf den Bergtriften weidend finden wirst, gegen das Meeresufer hinab.“
In wenigen Augenblicken war der geflügelte Gott, dem Winke seines Vaters gehorsam, auf der sidonischen Bergweide angekommen und trieb die Herde des Königs, unter die sich auch, ohne dass Hermes es geahnt hätte, der verwandelte Zeus als Stier gemischt hatte, vom Berge herab nach dem angewiesenen Strande, eben auf jene Wiesen, wo die Tochter Agenors, von tyrischen Jungfrauen umringt, sorglos mit Blumen tändelte.
Die übrige Herde nun zerstreute sich über die Wiesen ferne von den Mädchen; nur der schöne Stier, in welchem der Gott verborgen war, näherte sich dem Rasenhügel, auf welchem Europa mit ihren Gespielinnen saß. Stolz schritt er im üppigen Gras dahin, über seiner Stirne schwebte kein Drohen, sein funkelndes Auge flößte keine Furcht ein: Sein ganzes Aussehen war voll Sanftmut.
Europa und ihre Jungfrauen bewunderten die edle Gestalt des Tieres und sein friedliches Gebaren, ja sie bekamen Lust, ihn recht in der Nähe zu besehen und ihm den schimmernden Rücken zu streicheln.
Der Stier schien dies zu merken, denn er kam immer näher und stellte sich endlich dicht vor Europa hin.
Diese sprang auf und wich anfangs einige Schritte zurück; als aber das Tier zahm stehenblieb, fasste sie sich ein Herz, näherte sich wieder und hielt ihm ihren Blumenstrauß vor das schäumende Maul, aus dem sie ein ambrosischer Atem anwehte.
Der Stier leckte schmeichelnd die dargebotenen Blumen und die zarte Jungfrauenhand, die ihm den Schaum abwischte und ihn zärtlich zu streicheln begann.
Immer reizender kam der herrliche Stier der Jungfrau vor, ja sie wagte es und drückte einen Kuss auf seine glänzende Stirne.
Da ließ das Tier ein freudiges Brüllen hören, nicht wie andere gewöhnliche Stiere brüllen, sondern es tönte wie der Klang einer lydischen Flöte, die ein Bergtal durchhallt. Dann legte er sich zu den Füßen der schönen Fürstin nieder, blickte sie sehnsüchtig an, wandte ihr den Nacken zu und zeigte ihr den breiten Rücken. Da sprach Europa zu ihren Freundinnen, den Jungfrauen:
„Kommt doch auch näher, liebe Gespielinnen, wir wollen uns auf den Rücken dieses schönen Stieres setzen und unser Vergnügen damit haben: Ich glaube, unserer vier haben leicht Platz wie in einem geräumigen Kahn. Er sieht so freundlich und sanftmütig aus und gleicht gar nicht anderen Stieren. Wahrhaftig, er hat Verstand wie ein Mensch, und es fehlt ihm gar nichts als die Rede!“
Mit diesen Worten nahm sie ihren Gespielinnen die Kränze, einen nach dem andern, aus den Händen und schmückte damit die gesenkten Hörner des Stieres; dann schwang sie sich lächelnd auf seinen Rücken, während ihre Freundinnen zaudernd und unschlüssig zusahen.
Als dem Stier seine Absicht gelungen war, sprang er vom Boden auf. Anfangs ging er ganz sachte mit der Jungfrau davon, doch so, dass ihre Genossinnen nicht gleichen Schritt mit seinem Gange halten konnten.
Als er aber die Wiesen im Rücken und den kahlen Strand vor sich hatte, verdoppelte er seinen Lauf und glich nun nicht mehr einem trabenden Stier, sondern einem fliegenden Ross. Und ehe sich Europa besinnen konnte, war er mit einem Satz ins Meer gesprungen und schwamm mit seiner Beute dahin.
Die Jungfrau hielt mit der Rechten eines seiner Hörner umklammert, mit der Linken stützte sie sich auf den Rücken; in ihre Gewänder blies der Wind wie in ein Segel; ängstlich blickte sie nach dem verlassenen Lande zurück und rief umsonst nach den Gespielinnen; das Wasser umwallte den rudernden Stier, und die hüpfenden Meereswellen scheuend, zog die Jungfrau furchtsam die Fersen hinauf. Aber das Tier schwamm dahin wie ein Schiff: Bald war das Ufer verschwunden, die Sonne untergegangen, und im Helldunkel der Nacht sah die unglückliche Jungfrau nichts um sich her als Wogen und Gestirne.
So ging es fort, auch als der Morgen kam; den ganzen Tag schwamm sie durch die unendliche Flut auf dem Tiere dahin; doch wusste dieses so geschickt die Wellen zu durchschneiden, dass kein Tropfen seine geliebte Beute benetzte.
Endlich gegen Abend erreichten sie ein fernes Ufer. Der Stier schwang sich ans Land, ließ die Jungfrau unter einem gewölbten Baume sanft vom Rücken gleiten und verschwand vor ihren Blicken. An seine Stelle trat ein herrlicher, göttergleicher Mann, der ihr erklärte, dass er der Beherrscher der Insel Kreta sei und sie schützen werde, wenn er durch ihren Besitz beglückt würde.
Europa in ihrer restlosen Verlassenheit reichte ihm ihre Hand als Zeichen der Einwilligung, und Zeus hatte das Ziel seiner Wünsche erreicht. Aber auch er verschwand, wie er gekommen war.
Aus langer Betäubung erwachte Europa, als schon die Morgensonne am Himmel stand. Mit verwirrten Blicken sah sie um sich her, als wollte sie die Heimat suchen.
„Vater, Vater!“, schrie sie mit durchdringendem Wehelaut, besann sich eine Weile und rief wieder:
„Ich verworfene Tochter, wie darf ich den Vaternamen nur aussprechen? Welcher Wahnsinn hat mich die Kindesliebe vergessen lassen!“
Dann sah sie wieder, wie sich besinnend, umher und fragte sich selbst
„Woher, wohin bin ich gekommen? – Zu leicht ist der Tod für die Schuld der Jungfrau! Aber wache ich denn auch und beweine einen wirklichen Schimpf? Nein, ich bin gewiss unschuldig an allem, und es neckt meinen Geist nur ein nichtiges Traumbild, das der Morgenschlaf wieder entführen wird. Wie wäre es auch möglich, dass ich mich hätte entschließen können, lieber auf dem Rücken eines Untiers durch unendliche Fluten zu schwimmen, als in Sicherheit frische Blumen zu pflücken!“
So sprach sie und fuhr mit der flachen Hand über die Augen, als wolle sie den hässlichen Traum verwischen. Als sie aber um sich blickte, blieben die fremden Gegenstände unverrückt vor ihren Augen; unbekannte Bäume und Felsen umgaben sie, und eine unheimliche Meeresflut schäumte, an starren Klippen sich brechend, empor am nie geschauten Gestade.
„Ach, dass mir jetzt der verwünschte Stier begegnete“, rief sie verzweifelnd, „wie wollte ich ihn von mir treiben: nicht ruhen wollte ich, bis ich die Hörner des Ungeheuers zerbrochen, das mir jüngst noch so liebenswürdig erschien!