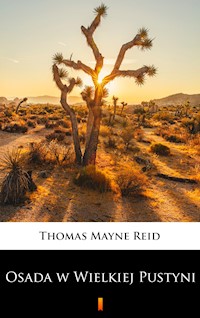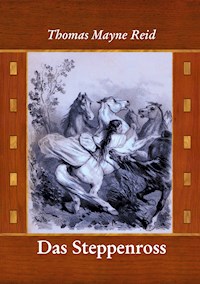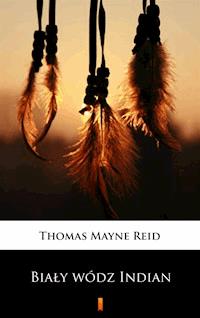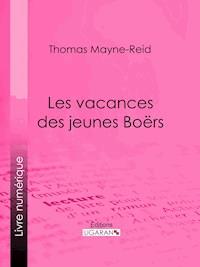Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Vor vielen Jahren entführten Indianer Adele, eine Tochter Seguins. Dieser Schicksalsschlag hat ihn zu einem gefürchteten Skalpjäger werden lassen, der alles unternimmt, um seine Tochter zu befreien. Der Ich-Erzähler Henry Haller, von Seguin aus einer lebensgefährlichen Situation befreit, erholt sich in dessen Haus und verliebt sich in die jüngere Tochter. Zusammen mit einer Schar von Skalpjägern und Fallenstellern ziehen sie los und erleben gefährliche Abenteuer im "Wilden Westen". Wird die Rettung der Tochter gelingen? Im Jahre 1852 erschienen gleich zwei Übersetzungen von Mayne Reids "The Scalp Hunters" in deutscher Sprache. Die vorliegende Ausgabe folgt einer davon. Spätere Ausgaben des Romans sind oft gekürzt und "für die Jugend" bearbeitet. Auch an diesem Roman lässt sich erkennen, dass ihn Karl May offensichtlich kannte: Ein edles indianisches Geschwisterpaar, ein skalpierter Weißer, der eine Perücke trägt, ein Westmann, der seit Ewigkeiten den gleichen geflickten Rock trägt: Winnetou, Nscho-tschi und Sam Hawkens lassen grüßen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Kapitel 1: Der Wilde Westen
Kapitel 2: Prärie-Handelsleute.
Kapitel 3: Das Präriefieber.
Kapitel 4: Der Ritt auf dem Büffel.
Kapitel 5: Eine böse Klemme.
Kapitel 6: Santa Fé.
Kapitel 7: Der Fandango.
Kapitel 8: Seguin, der Skalpjäger.
Kapitel 9: Zurückgeblieben.
Kapitel 10: Der del Norte
Kapitel 11: Die Todesreise.
Kapitel 12: Zoë.
Kapitel 13: Seguin.
Kapitel 14: Liebe.
Kapitel 15: Licht und Schatten.
Kapitel 16: Eine Lebensgeschichte.
Kapitel 17: Den del Norte hinauf.
Kapitel 18: Die Skalpjäger.
Kapitel 19: Schießproben.
Kapitel 20: Ein Tellschuss.
Kapitel 21: Noch ein Schuss.
Kapitel 22: Der Plan.
Kapitel 23: El Sol und La Luna.
Kapitel 24: Die Kriegsstrafe.
Kapitel 25: Drei Tage in der Falle.
Kapitel 26: Die Gräber.
Kapitel 27: Dacoma.
Kapitel 28: Ein Essen mit zwei Gerichten.
Kapitel 29: Eine Jägerlist.
Kapitel 30: Ein Büffeltreiben.
Kapitel 31: Noch ein Fang.
Kapitel 32: Ein bitterer Trank.
Kapitel 33: Die gespenstische Stadt.
Kapitel 34: Das Goldgebirge
Kapitel 35: Navajoa.
Kapitel 36: Ein nächtlicher Hinterhalt.
Kapitel 37: Adele.
Kapitel 38: Der weiße Skalp.
Kapitel 39: Der Kampf in der Gebirgsschlucht.
Kapitel 40: Die Barranca.
Kapitel 41: Der Feind.
Kapitel 42: Neues Leid.
Kapitel 43: Die Friedensfahne.
Kapitel 44: Der Vertrag.
Kapitel 45: Ein Kampf bei verschlossenen Türen.
Kapitel 46: Ein seltsames Zusammentreffen in der Höhle
Kapitel 47: Ausgeräuchert.
Kapitel 48: Eine neue Reitart.
Kapitel 49: Eine dauerhafte Farbe.
Kapitel 50: Verblüffung.
Kapitel 51: Das Rennen.
Kapitel 52: Ein Kampf auf einem Felsen.
Kapitel 53: Ein unerwartetes Zusammentreffen.
Kapitel 54: Die Befreiung.
Kapitel 55: El Paso del Norte.
Kapitel 56: Die Saiten der Erinnerung.
Kapitel 1: Der Wilde Westen.
Rollt die Karte der Erde auf und blickt auf das nördliche Festland Amerikas. Nach dem Wilden Westen, hin nach dem Untergange der Sonne, weit hin über manchen fernen Meridian lasst eure Augen schweifen und sie dort ausruhen, wo goldene Ströme unter Felsen entspringen, die ewiger Schnee deckt.
Ihr blickt auf ein Land, das nicht gefurcht ist durch menschliche Hände, sondern noch an sich trägt die Spuren des Allmächtigen wie an dem Schöpfungsmorgen, ein Land, wo jedem Gegenstande das Bild Gottes aufgeprägt ist. Sein Geist lebt da in der stillen Größe der Gebirge und spricht aus dem Rauschen der gewaltigen Ströme, ein Land voll von Romantik, reich an wirklichen Abenteuern.
Folgt mir mit dem Auge eures Geistes über Schauplätze wilder Schönheit, wilder Erhabenheit.
Ich stehe auf einer freien Ebene, wende mein Gesicht nach dem Norden, dem Süden, dem Osten und Westen und sehe überall, nach allen Seiten hin den blauen Bogen des Himmels sich um mich spannen. Kein Berg, kein Baum unterbricht den Ring des Horizontes. Was bedeckt den breiten Raum dazwischen? Wald? Wasser? Gras? Nein, Blumen! So weit mein Auge schweifen kann, ruht es nur auf Blumen, auf schönen Blumen!
Ich schaue wie auf eine bunt gefärbte Karte, auf ein Emaillebild, das von jeder Farbe des Prismas glänzt.
Dort ist goldenes Gelb, wo die Sonnenblume sich nach der Sonne wendet, dort Scharlach, wo die Malve ihre rote Fahne erhebt, hier liegt ein Beet purpurner Monarda, dort streut die Euphorbie ihre Silberblätter umher, dort herrscht Orange vor in den glänzenden Blüten der Asclepia und weiter hin schweift der Blick unter die rosenroten Blüten der Cleome.
Die Luft bewegt sie. Millionen Blumenkronen schwenken ihre bunten Banner. Die hohen Stängel der Sonnenblume neigen und erheben sich in langen Wellen wie Wogen in einem goldenen Meere.
Wiederum ruhen sie. Die Luft ist erfüllt von Duft, lieblich wie die Wohlgerüche Arabiens und Indiens. Millionen Insekten flattern mit den bunten Flügeln, sie selbst auch Blumen. Die Bienenvögel schwirren umher und blitzen wie vereinzelte Sonnenstrahlen oder wiegen sich auf schwirrenden Flügeln und trinken aus den Nektarbechern, während die wilde Biene mit beladenen Beinen sich an die honigsüßen Pistille hängt oder mit freudigem Summen nach ihrem fernen Stocke fliegt.
Wer pflanzte diese Blumen? Wer wob sie in diese malerischen Beete? Die Natur. Sie sind ihr reichstes Gewand, reicher in Farben als die Tücher von Kaschmir.
Das ist die Unkraut-Prärie, mit Unrecht so genannt, denn es ist – der Garten Gottes.
Der Schauplatz ändert sich. Ich bin in einer Ebene wie vorher und der ununterbrochene Horizont spannt sich um mich her aus. Was sehe ich? Blumen? Nein, nicht eine Blume ist zu sehen, sondern eine weite Fläche lebendigen Grüns! Von Norden nach Süden, von Osten nach Westen erstreckt sich die Wiesen-Prärie, grün wie ein Smaragd und glatt und eben wie die Fläche eines schimmernden Sees.
Der Wind streicht über die feinen Blätter hin. Sie bewegen sich und das Grün zeigt sich in helleren oder dunkleren Tönen, je wie die Schatten von Sommerwolken über die Sonne hinziehen.
Das Auge schweift hin ohne Widerstand. Vielleicht begegnet es den dunklen zottigen Gestalten der Büffel oder erkennt die zierliche Antilope, vielleicht folgt es in gefälliger Verwunderung dem wilden Galopp eines schneeweißen Rosses. Das ist die Gras-Prärie, die grenzenlose Weide des Bisons.
Wiederum ändert sich der Schauplatz. Die Erde ist nicht mehr eine platte Ebene, aber noch immer baumlos und grün. Die Fläche zeigt eine Aufeinanderfolge parallel laufender wellenförmiger Erhöhungen, die hie und da zu platten runden Hügeln anschwellen. Sie ist mit reichem Gras von glänzendem Grün bedeckt. Diese Erdwellen erinnern an das Meer nach einem gewaltigen Sturme, wenn der krause Schaum auf den Wogen zerflossen ist und der dicke Wasserschwall kugelnd einherrollt. Sie sehen aus, als wären sie einmal solche Wogen gewesen und durch einen allmächtigen Willen in Erde verwandelt und zum Stillstehen gebracht worden.
Das ist die Wellen-Prärie oder „Rollprärie“.
Wiederum ändert sich der Schauplatz. Ich bin unter grünem Gras und schönen Blumen, aber die Aussicht wird durch Baumgruppen und einzelnes Gebüsch unterbrochen. Das Laub ist mannigfaltig, seine Farben sind lebhaft und die Formen weich und anmutig. Während ich weiter komme, öffnen sich ununterbrochen neue Landschaftsbilder, parkähnliche malerische Ansichten. Herden von Büffeln, Antilopen und wilden Pferden bewegen sich in der Ferne. Truthühner laufen nach dem Gebüsche und Fasane schwirren von dem Wege auf.
Wo aber sind die Besitzer dieser Ländereien, dieser Herden, dieser Vögel? Wo stehen die Häuser, die Paläste, die zu diesen stattlichen Parks gehören? Ich schaue nach allen Seiten und erwarte die Türme großer Gebäude über die Bäume ragen zu sehen. Aber nein. Hunderte von Meilen umher steigt aus keinem Schornstein Rauch auf. Das Land wird trotz seines Aussehens wie bebautes nur von dem Fuße des Jägers und dem seines Feindes, des roten Indianers, betreten.
Das sind die Mottes, die „Inseln“ in dem Prärie-Meere.
Ich bin in tiefem Walde. Es ist Nacht, das Holzfeuer wirft seinen roten Schein umher und färbt die Gegenstände rund um unsere Lagerstätte. Riesige Baumstämme stehen dicht um uns her und strecken gewaltige graue Äste gleich Armen aus. Ich betrachte ihre Rinde. Sie ist gesprungen und hängt daran in breiten krausen Schuppen. Lange schlangenartige Wucherpflanzen kriechen von Baum zu Baum und umschlingen die Stämme, als wollten sie dieselben erdrücken. Oben sind keine Blätter. Sie sind reif geworden und abgefallen, aber das weiße spanische Moos hängt an den Ästen hin und wieder wie die Draperie an einem Totenbette.
Stämme, viele Ellen im Durchmesser und halb verfault, liegen umher an dem Boden. An den Enden zeigen sich Höhlungen, in denen das Stachelschwein und Opossum Schutz vor der Kälte gesucht haben.
Meine Gefährten liegen im Schlafe, eingehüllt in ihren Decken, ausgestreckt auf den abgefallenen Blättern. Sie liegen mit den Füßen dem Feuer zu und ihre Köpfe ruhen in der Höhlung ihrer Sättel. Die Pferde stehen um einen Baum her, angebunden an seine unteren Äste und scheinen ebenfalls zu schlafen. Ich wache und lausche. Der Wind rauscht und pfeift in den Ästen hoch oben und bewegt die weißen hängenden Fäden des Mooses hin und her. Es ist eine unheimliche schauerliche Musik. Sonst vernimmt das Ohr wenige andere Töne, denn es ist Winter und der Baumfrosch und die Zikade schweigen. Ich höre das Knistern und Prasseln der Knorren im Feuer, das Rascheln des dürren Laubes, in das ein Windstoß fährt, das „cuwu-a“ der weißen Eule, das Bellen des Waschbären und gelegentlich das schauerliche Heulen des Wolfes. Das sind die nächtlichen Stimmen des Winter-Waldes, wilde Töne, aber eine Saite in meinem Herzen erklingt doch unter ihnen und mein Geist träumt und sieht Gestalten, während ich da liege und lausche.
Der Wald im Herbst – noch in vollem Blätterschmucke! Die Blätter sehen aus wie Blumen, so hell sind ihre Farben. Rot sind sie, gelb, goldig und braun. Es ist lau und herrlich im Walde und die Vögel flattern umher auf den Zweigen. Das Auge blickt entzückt in langen Durchsichten hinab und über sonnige Grasplätze. Es wird angezogen von dem bunten Gefieder, von dem Goldgrün des Papageis, von dem Blau des Hähers und dem Orange-Flügel des Oriole. Der rote Vogel fliegt niedriger im Gebüsch von grünen Pawpaws oder unter den bernsteinfarbigen Blättchen des Buchendickichts. Hunderte von winzigen Flügeln schwirren durch die offenen Stellen und flimmern in der Sonne wie blitzende Juwelen.
Die Luft ist erfüllt von Musik, von süßen Liebestönen. Das Bellen des Eichhörnchens, das Girren der Tauben, das Klopfen und Trommeln des Spechts, das ununterbrochene Zirpen der Zikade im Takt, alles klingt durcheinander. Hoch oben, auf einem der äußersten Zweige, schmettert der Spottvogel seine Töne hervor, als wolle er alle Sänger beschämen und zum Schweigen bringen.
Ich bin in einer Gegend dürrer brauner Erde mit zerklüfteten Umrissen. Es gibt da Felsen, Schluchten und Stellen unfruchtbaren Bodens. Seltsame Gewächse stehen in den Schluchten und hängen über die Felsen über. Andere sind rund an Gestalt und ruhen auf der Oberfläche der verbrannten Erde. Andere steigen vertikal hoch in die Höhe gleich geschnitzten und gerieften Säulen. Einige strecken Äste, krumme zottige Äste mit stacheligen eiförmigen Blättern von sich. Eine gewisse Gleichartigkeit haben alle diese Pflanzenformen, in der Farbe, der Frucht, den Blüten, welche anzeigt, dass sie zu einer Familie gehören. Es sind Kakteen. Es ist ein Wald mexikanischer Nepals. Und eine andere seltsame Pflanze findet sich da. Sie treibt lange stachelige Blätter, die sich niederwärts krümmen: die Agave, die weit berühmte Mezcal Mexikos. Hier und da mischen sich unter die Kakteen Akazien und Mezquitebäume, die Bewohner des wüsten Landes. Kein hellfarbiger Gegenstand erquickt das Auge, kein Vogel erfreut mit seinen Tönen das Ohr. Nur die einsame Eule flattert in dem undurchdringlichen Dickicht, die Klapperschlange schlüpft in dem seltenen Schatten hin und der Kojote schweift durch die stillen Räume.
Berge über Berge habe ich erstiegen und noch immer sehe ich Gipfel weit darüber hinausragen, bedeckt mit dem Schnee, der nimmer schmilzt. Ich stehe auf schwindelhohen Klippen und blicke in die Schlünde, die unten gähnen und in öder Stille ruhen. Gewaltige Felstrümmer sind in sie hinabgestürzt und liegen da aufeinandergetürmt. Andere Massen hängen drohend über, als warteten sie nur auf eine Erschütterung der Atmosphäre, die sie aus dem Gleichgewichte schleudere. Finstere Abgründe füllen mich mit Grauen und meinen Kopf erfasst Schwindel. Ich halte mich fest an dem Baumstamm oder der Ecke des festen Gesteins.
Über mir, unter mir, neben mir sind Gebirge auf Gebirge getürmt in chaotischer Verwirrung. Einige sind kahl und bleich, andere zeigen Spuren von Vegetation in den dunklen Nadeln der Föhren und Zedern, deren verkrüppelte Gestalten halb wachsen, halb hängen auf den Felsenzacken. Hier steigt eine kegelförmige Spitze hoch hinauf, bis sie verschwindet in Schnee und Wolken. Da streckt ein Kamm seine scharfe Kante gegen den Himmel, während längs an seinen Seiten hin gewaltige Granitstücke liegen, als wären sie von Titanen-Händen geschleudert worden.
Ein furchtbares Ungetüm, der aschgraue Bär, schleppt sich an den hohen Felsenwänden hin. Der Carcajou kauert auf der vorspringenden Klippe und wartet auf das Elen, das zu dem Wasser unten da vorübergehen muss und das Dickhorn (das Schaf der Felsenberge) springt von Klippe zu Klippe sein schönes Weibchen zu suchen. Auf dem Föhrenaste wetzt der kahlköpfige Bussard seinen schmutzigen Schnabel und der Schreiadler, der über allen schwebt, sticht scharf ab von dem blauen Himmelszelte.
Das sind die Felsenberge, die amerikanischen Anden, das kolossale Rückgrat des Festlandes.
So sieht es aus im Wilden Westen, das ist der Schauplatz unseres Dramas. Lassen wir nun den Vorhang in die Höhe gehen und unsere Personen auftreten.
Kapitel 2: Prärie-Handelsleute.
„New-Orleans, 3. April 18 ..
Lieber St. Vrain!
„Unser Freund, Herr Henry Haller, geht nach St. Louis ‚dem Malerischen nach‘. Nehmen Sie sich seiner an und unterstützen Sie ihn in seinem Bestreben.
Ihr
Louis Valton.“
„Herrn St. Vrain in Planter's Hotel zu St. Louis.“
Mit diesem lakonischen Briefchen in der Westentasche landete ich am 10. April in St. Louis und fuhr in „Planter's Hotel“.
Nachdem mein Gepäck untergebracht und mein Pferd, ein Liebling, den ich mitgebracht hatte, in den Stall geführt war, zog ich ein weißes Hemd an und ging in das „Bureau“ hinunter, um mich nach Herrn St. Vrain zu erkundigen.
Er war nicht zugegen, sondern vor mehreren Tagen den Missouri hinaufgegangen, für mich eine sehr unangenehme Täuschung, da ich sonst keine Empfehlungsschreiben für St. Louis mitgebracht hatte. Ich versuchte indes, geduldig auf die Rückkehr des Herrn St. Vrain zu warten, der in weniger als einer Woche zurückkehren sollte.
Jeden Tag bestieg ich mein Pferd und ritt nach den „Hügeln“ und hinaus in die Prärien. Ich schlenderte an dem Hotel umher und rauchte meine Zigarre. Ich trank Sherry-Cobblers1 und las Zeitungen in dem „Lesezimmer.“
Mit solchen Beschäftigungen vertrieb ich mir die Zeit drei Tage lang.
In dem Hotel befand sich eine Gesellschaft Herren, die einander sehr genau zu kennen schienen. Ich könnte sie eine „Clique“ nennen, aber es ist dies kein gutes Wort und drückt auch nicht aus, was ich eigentlich meine. Sie schienen sehr joviale Leute zu sein, wanderten miteinander durch die Straßen und saßen beisammen an der Table d'Hôte, wo sie meist noch lange sitzen blieben, nachdem die gewöhnlichen Tischgäste sich entfernt hatten. Auch entging es mir nicht, dass sie die teuersten Weine tranken und die besten Zigarren rauchten, welche im Hause zu haben waren.
Sie erregten meine Aufmerksamkeit und es fiel mir ihre eigentümliche Haltung auf, ihr straffer indianerartige Gang, verbunden mit knabenhafter Lustigkeit, wodurch die Amerikaner im Westen sich so auszeichnen.
Sie waren fast gleich gekleidet: Ein feines schwarzes Tuch, weiße Wäsche und Atlaswesten mit Diamantnadeln. Sie trugen volle Backenbärte, waren aber sonst glatt rasiert, einige hatten auch Schnurrbärte. Ihr Haar fiel lockig auf die Schultern und manche trugen die Hemdkragen umgeschlagen, sodass man ihren gesunden, sonnenverbrannten Hals sah. Eigentümlich war die Familienähnlichkeit in ihren Zügen. Sie sahen einander allerdings nicht ähnlich, aber unverkennbar hatte der Ausdruck ihrer Augen etwas, das sich bei jedem fand, ohne Zweifel das Zeichen gleicher Beschäftigung und Lebensweise.
Waren sie Spieler? Nein. Die Hände der Spieler sind weißer. Ein Spieler trägt mehr Ringe an den Fingern, seine Weste ist bunter und sein ganzer Anzug ist auffallender und übertriebener elegant. Auch fehlt ihm der Ausdruck sicheren leichten Selbstvertrauens. Er wagt denselben nicht anzunehmen. Er kann und darf wohl in einem Hotel wohnen, muss sich da aber ruhig verhalten und darf niemandem zur Last fallen. Der Spieler ist ein Raubvogel und deshalb, wie alle Raubvögel, still und einsam. Jene Leute konnten also keine Spieler sein.
„Wer sind die Herren?“, fragte ich einen Mann, der neben mir saß, indem ich auf die zeigte, von welchen ich eben sprach.
„Die Prärie-Männer.“
„Die Prärie-Männer?“
„Ja. Die Santa Fé-Händler.“
„Händler? Kaufleute?“, wiederholte ich verwundert, da ich in meinen Gedanken solche Eleganz mit Handelsverkehr in den Prärien nicht zusammenreimen konnte.
„Ja“, fuhr mein Nachbar fort. „Der große schöne Mann in der Mitte ist Bent, Bill2 Bent, wie er heißt. Der ihm zur Rechten ist der junge Sublette, der andere, der links neben ihm steht, ist einer von den Choteaus, und jener dort, der ruhige, bedächtige Jerry3 Folger.“
„Sie sind also die berühmten Prärie-Handelsleute?“
„Allerdings.“
Ich betrachtete sie mit immer größerer Neugierde und bemerkte endlich, dass sie auch mich ansahen und über mich sprachen.
Gleich darauf trat einer von ihnen, ein eleganter junger Herr, aus ihrem Kreise heraus und dann auf mich zu.
„Erkundigen Sie sich nach Herrn St. Vrain?“, fragte er.
„Allerdings.“
„Charles?“
„Ja, so heißt er.“
„Ich bin es selbst.“
Ich übergab ihm den Brief, den ich für ihn besaß, und er überflog den Inhalt.
„Lieber Freund“, sagte er dann, indem er mir herzlich die Hand drückte, „es tut mir ungeheuer leid, dass ich nicht hier gewesen bin. Diesen Vormittag erst bin ich auf dem Flusse heruntergekommen. Recht dumm von Walton, dass er nicht an Bill Bent geschrieben hat. Wie lange sind Sie schon hier?“
„Drei Tage. Ich kam am 10. an.“
„Bei Gott, Sie haben ja sterben müssen vor Langeweile. Kommen Sie, damit ich Sie vorstelle. Bent! Bill! Jerry!“
Im nächsten Augenblicke hatte ich mit allen den Handelsleuten Händedrücke gewechselt und mich überzeugt, dass mein neuer Freund, St. Vrain, ihnen ebenfalls angehörte.
„Ist das das erste Mal?“, fragte einer als ein lauter Gongschlag durch das Haus schallte.
„Ja“, antwortete Bent, indem er nach seiner Uhr sah. „Also gerade noch Zeit einen zu nehmen. Kommt!“
Der Frühling begann und die junge Münze fing an zu sprossen, ein botanisches Ereignis, welches meinen neuen Bekannten nichts Neues zu sein schien, da ein jeder von ihnen einen „Minze-Trank“ (mint-julep) verlangte. Das Bereiten und Schlürfen dieses Getränkes beschäftigte uns, bis der zweite Schlag auf den Gong zur Tafel rief.
„Setzen Sie sich zu uns, Herr Haller“, sagte Bent. „Es tut mir leid, dass wir Sie nicht früher gekannt haben, Sie sind ganz vereinsamt gewesen.“
Mit diesen Worten ging er voraus nach dem Speisezimmer, wohin ich ihm mit seinen Freunden folgte.
Ich brauche wohl ein Mittagessen in dem Planter's Hotel zu St. Louis mit seinen Wildbraten, Aussetzungen, Prärie-Hühnern und köstlichen Froschkeulen aus Illinois nicht zu beschreiben. Nein. Ich möchte das Essen nicht schildern und das, was darauf folgte, dürfte ich schwerlich schildern können.
Wir blieben sitzen, bis wir ganz allein waren, und fingen an, Regalias zu rauchen und Madeira, die Flasche zu zwölf Dollars, zu trinken. Und einer bestellte nicht etwa eine Flasche auf einmal, sondern gleich ein halbes Dutzend. So weit weiß ich genau, was geschah, auch dass man mir die Weinkarte und den Bleistift sofort wegnahm, wenn ich danach griff.
Ich erinnerte mich, dass ich Erzählungen seltsamer Abenteuer unter den Pawnee, den Comanchen und Schwarzfüßen anhörte, bis mein Interesse in hohem Grade angeregt und heftiges Sehnen nach dem Prärieleben in mir entstanden war. Dann fragte mich einer, ob ich sie nicht auf einem „Ausfluge“ begleiten wolle. Darauf hielt ich eine Rede, erbot mich, meine neuen Bekannten bei ihrem nächsten Zuge zu begleiten, und St. Vrain meinte, ich sei gerade der rechte Mann für ihr Leben, was mir außerordentlich gefiel. Dann sang einer ein spanisches Lied zu einer Gitarre, glaube ich, ein anderer tanzte einen indianischen Kriegstanz und endlich sprangen wir alle auf und sangen von dem Sternenbanner. Von dem, was weiter geschehen ist, weiß ich nichts mehr, bis ich am nächsten Morgen, mir sehr erinnerlich, mit fürchterlichen Kopfschmerzen erwachte.
Ich hatte kaum Zeit, über meine Torheit in vergangener Nacht nachzudenken, denn die Tür wurde geöffnet und St. Vrain trat mit einem halben Dutzend meiner Tischgenossen herein. Ihnen folgte ein Kellner, der mehrere große Gläser mit einer blass bernsteinfarbigen Flüssigkeit trug, auf der oben Eisstücke schwammen.
„Ein Sherry. Cobbder, Herr Haller!“, rief einer. „Das Beste für Ihren Zustand! Ziehen Sie! Es wird Sie in einem Eichhörnchensprunge abkühlen.“
Ich trank von dem erquickenden Getränke, wie man es wünschte.
„Nun, lieber Freund“, fragte St. Vrain, „fühlen Sie sich nicht um hundert Prozent besser? Aber sagen Sie, war es Ihr Ernst, als Sie sagten, Sie wollten uns über die Prärien begleiten? Nach etwa einer Woche brechen wir auf. Es würde mir leidtun, so bald mich von Ihnen trennen zu müssen.“
„Es war mein Ernst. Ich begleite Sie, wenn Sie mir nur angeben wollen, was ich dabei zu tun und wie ich mich einzurichten habe.“
„Da ist nicht viel einzurichten. Kaufen Sie sich ein Pferd.“
„Ich besitze schon eines.“
„Dann einige grobe Kleidungsstücke, eine Büchse, ein paar Pistolen, ein – –“
„Alles das besitze ich bereits und dies meinte ich mit meiner Frage nicht. Sie bringen Waren nach Santa Fé und gewinnen dabei das Doppelte, das Dreifache. Ich habe hier in einer Bank zehntausend Dollars liegen. Hindert mich etwas eine Spekulation mit dem Vergnügen zu verbinden und das Geld ebenso anzulegen wie Sie?“
„Nichts in der Welt – – ein vortrefflicher Einfall!“, sagten einige.
„Wenn einer von Ihnen die Gefälligkeit haben will mit mir zu gehen und mir zu zeigen, in welchen Waren ich das Geld anzulegen habe, so bezahle ich seine Weinrechnung bei Tische, meiner Ansicht nach keine Kleinigkeit.“
Die Prärie-Leute lachten laut und erklärten, sie würden alle mit mir in den Läden umhergehen. Nach dem Frühstück brachen wir wirklich Arm in Arm auf.
Ehe die Tischzeit herankam, hatte ich fast die ganze mir zur Verfügung stehende Summe in gedruckten Baumwollwaren, langen Messern und Spiegeln angelegt und nur so viel übrig behalten, um in Independence, von wo wir nach den „Ebenen“ aufbrechen wollten, Maultierwagen zu kaufen und Fuhrleute zu mieten.
Wenige Tage nachher fuhr ich mit meinen neuen Gefährten auf einem Dampfschiffe den Missouri hinauf auf dem Wege nach den pfadlosen Prärien des „fernen Westen“.
1 Sherry-Cobbler, Getränk aus spanischem Wein, (Sherry Xeres), Eier, Zucker und Zitronen, das durch einen Strohhalm eingesogen wird. Der Übers.
2 Bill, Wilhelm.
3 Jerry, abgekürzt von Jeremy, Jeremias.
Kapitel 3: Das Präriefieber.
Nachdem wir eine Woche lang in Independence verbracht und Maultiere und Wagenzeug gekauft hatten, traten wir die Wanderung an. Wir hatten etwa hundert Wagen bei der Karawane und vielleicht noch einmal so viele Fuhrleute und Gehilfen. Zwei der geräumigen Fuhrwerke enthielten meinen Kram und ich hatte dazu ein paar dürre langhaarige Missourier gemietet sowie einen kanadischen „Voyageur“, namens Godé, zur Aufsicht angenommen.
Von den eleganten Herren in Planter's Hotel war keine Spur geblieben, denn alle erschienen in Jagdhemden und Schlapphüten, der Prärietracht. Um uns den Lesern recht deutlich vorzustellen, will ich mich selbst beschreiben.
Ich trage ein Jagdhemd von gegerbter Hirschhaut, mehr in der Form einer alten Tunika als irgendeiner anderen, von hellgelber Farbe, schön gesteppt und gestickt und an der Kapuze, denn eine Kapuze befindet sich daran, mit Fransen von ebensolchem Leder verziert. Unten herum sind gleiche Fransen angebracht, Beinkleider von Scharlachtuch gehen bis über die Schenkel, darunter befinden sich starke Barchentpantalons, schwere Stiefeln und dicke Messing-Sporen. Ein buntes Kattunhemd, ein blaues Halstuch und ein breitkrempiger Hut vervollständigten den Anzug. Hinter mir auf dem Sattel sieht man einen hellroten länglichen Gegenstand. Das ist mein „Mackinaw“, ein Liebling, denn er bildet in der Nacht mein Bett, bei anderen Gelegenheiten einen Mantel oder Überzieher. In seiner Mitte hat er einen Schlitz, durch den ich in kaltem oder regnerischem Wetter den Kopf stecke. Dann bin ich bedeckt bis zu den Knöcheln.
Wir alle sind ähnlich bewaffnet und ausgestattet. Ich selbst bin bewaffnet „bis an die Zähne“. In meinen Halftern führe ich ein Paar der neuen amerikanischen Pistolen von Colt, Revolver genannt, jede zu sechs Schüssen. In meinem Gürtel befindet sich ein zweites Paar zu fünf Schüssen. Außerdem habe ich eine leichte Büchse, sodass mir im Ganzen dreiundzwanzig Schüsse zu Gebote stehen, die ich in ebenso vielen Sekunden abzufeuern gelernt habe. Verfehle ich mit allen meinen Zweck, so trage ich im Gürtel ein langes glänzendes Bowie-Messer, das mir übrigens zu jedem Gebrauche dient. Außerdem bin ich mit einer Jagdtasche und einem Pulverhorn versehen, die ich umgehangen trage. Ferner besitze ich eine große Korbflasche und einen Tornister mit meinen Lebensmitteln, wie alle meine Begleiter.
Verschieden sind wir dagegen beritten. Einige reiten ein Maultier, andere einen Mustang (wildes Pferd), während andere ihre amerikanischen Pferde mitgebracht haben. Zu diesen gehöre ich. Ich reite einen dunkelbraunen Hengst mit schwarzen Beinen, der ein halber Araber und gut gebaut ist. Er führt den spanischen Namen Moro, den ihm der Pflanzer in Louisiana gegeben, von welchem ich ihn kaufte. Er hört sehr gut darauf. Er gefällt allen und man hat mir ansehnliche Summen für ihn geboten, aber ich lasse ihn nicht, denn ich liebe ihn, mehr noch als meinen Hund Alp, der von der St. Bernhard-Rasse stammt und den ich einem Schweizer in St. Louis abkaufte.
Mehrere Wochen lang zogen wir durch die Prärien, ohne dass uns etwas Ungewöhnliches begegnete. Die Szenerie war mir im höchsten Grade interessant und ich erinnere mich keines merkwürdigeren Bildes, als jenes der langen Wagen-Karawane, der „Prärie-Schiffe“, die langsam dahinkroch und deren weiße Planen von dem dunklen Grün der Erde anmutig abstachen. In der Nacht namentlich gewährte das Lager, die im Kreise zusammengestellten Wagen und die rund umher an eingeschlagenen Pfählen befestigten Pferde, ein seltsames Bild. An den Flüssen standen dichte Gruppen von Baumwollenbäumen, deren säulenartige Stämme dicht mit silberschillernden Blättern besetzt waren. Diese Baumgruppen begrenzten die Aussicht und teilten die Prärien voneinander, sodass wir gleichsam über große Felder zogen, die von riesigen Hecken umgeben waren.
Wir mussten viele Flüsse überschreiten, durch einige wateten wir, über andere, die breiter und tiefer waren, mussten wir die Wagen schwimmen lassen. Gelegentlich sahen wir Hirsche und Antilopen und unsere Jäger schossen einige, aber die Heimat der Büffel hatten wir noch nicht erreicht. Einmal machten wir in einem bewaldeten Tale Halt, in welchem üppiges Gras wuchs und reines Wasser quoll. Gelegentlich mussten wir auch anhalten, um eine zerbrochene Achse zu ersetzen oder einen steckengebliebenen Wagen herauszuschaffen.
Ich für meinen Teil hatte wenig Not und Verdruss. Meine Missourier waren tüchtige Leute.
Das Gras wuchs reichlich und unsere Maultiere und Ochsen magerten auf der Reise nicht nur nicht ab, sondern wurden von Tag zu Tag fetter.
Als wir uns dem Arkansas näherten, erblickten wir gelegentlich in der Ferne Indianer zu Pferd, Pawnee, und mehrere Tage lang umschwirrten Scharen derselben unsere Karawane. Aber sie kannten unsere Stärke und hielten sich in sicherer Ferne vor unseren langen Büchsen.
Godé, der nacheinander Voyageur4, Jäger, Fallensteller und Coureur du Bois gewesen war, hatte mich gesprächsweise mit dem Prärieleben bekanntgemacht, sodass ich unter meinen neuen Kameraden mich recht leidlich benahm. Auch St. Vrain, der bereits mein ganzes Vertrauen gewonnen hatte, sparte keine Mühe, mir den Ausflug angenehm zu machen, sodass alles dies, nebst dem wilden Galopp am Tage und den noch wilderen Erzählungen bei den Wachfeuern abends, für das romanhafte neue Leben mich ganz einnahm. Ich hatte also das „Präriefieber“ bereits.
So sagten lachend die Kameraden, aber ich verstand erst später, was sie damit meinten. Das Präriefieber! Ja, diese seltsame Krankheit, diese Vorliebe für das Leben im Freien, entwickelte sich in mir. Gleichzeitig erstarben die Erinnerungen an die Heimat und mit diesen die Gedanken an manches jugendliche, törichte, ehrgeizige Bestreben. Es verloren die Lockungen der großen Städte ihren Reiz, die Erinnerungen an sanfte Augen und seidenweiches Haar, die Empfindungen der Liebe, die kein menschliches Glück bestehen lassen, alles erstarb in mir, als wäre es nie gewesen.
Meine Körperkraft aber und die Energie meines Geistes nahmen zu bis zu einem Grade, wie ich sie vorher nicht gekannt hatte. Tätigkeit und Bewegung waren meine Lust. Mein Blut schien wärmer und rascher durch meine Adern zu fließen, ich bildete mir ein, meine Augen sähen in weitere Ferne, ja, ich konnte in die Sonne blicken, ohne zu blinzeln.
Das Präriefieber! Ich fühle es in diesem Augenblicke noch. Während ich diese Erinnerungen niederschreibe, zucken meine Finger, um die Zügel zu fassen, zittern meine Knie, um sich an mein edles Ross zu drücken und die Sehnsucht erfasst mich nochmals zu wandern über die grünen Wogen des Prärie-Meeres.
4 Voyageurs ist ein kanadischer Ausdruck und bezeichnet die Boots- oder Kanuführer auf den Flüssen und Seen, auf denen sie die Reisenden befördern, namentlich die im Dienst der Pelzgesellschaften Stehenden. Fallensteller sind die Jäger, welche den Biber jagen und vorzugsweise in Fallen fangen. Seit die Castorhüte nicht mehr häufig getragen werden, machen die Fallensteller schlechte Geschäfte und viele haben sich andere Erwerbszweige gesucht. Namentlich sind viele nach Kalifornien gegangen. Coureurs du Bois (Waldläufer) sind herumziehende Händler, welche in den Einöden Messer, Tabak etc. verkaufen und namentlich die Jäger, Indianer etc. versorgen. Seine Ware hat er auf einem kleinen Wagen.
Kapitel 4: Der Ritt auf dem Büffel.
Wir waren etwa zwei Wochen unterwegs gewesen, als wir die Biegung des Arkansas etwa sechs Meilen unterhalb der „Plum Buttes“5 erreichten. Da lagerten wir.
Bis dahin hatten wir wenig von Büffeln gesehen, höchstens einen einzelnen oder ein paar und diese waren scheu und schüchtern gewesen. Es war die „Laufzeit“, aber noch hatten wir keine der brunsttollen Herden bemerkt.
„Dort gibt es frisches Fleisch zum Abendessen!“, rief St. Vrain.
Wir blickten nach Nordwesten, in der Richtung, welche unser Freund angedeutet hatte. Am Horizont bewegten sich fünf dunkle Gestalten hin: Büffel.
Wir wollten eben unsere Sättel abnehmen, als St. Vrain jene Worte sprach. Augenblicklich wurde nun der Sattelgurt wieder festgeschnallt, die Steigbügel fielen herunter, wir schwangen uns auf und in der nächsten Sekunde jagten wir dahin, etwa sechs von uns, einige gleich mir nur der Jagdlust wegen, andere, alte Jäger, um „Fleisch“ zu holen.
Wir hatten nur eine kurze Tagreise gemacht, unsere Pferde waren also nicht ermüdet und nach wenigen Minuten die drei Meilen, die uns von den Tieren trennten, auf eine heruntergebracht. Da aber bemerkten sie uns. Einige von uns, ich unter ihnen, die noch keine Erfahrung hatten, waren ohne auf guten Rat zu hören, immer geradeaus geritten, sodass uns die Büffel wittern mussten. Einer richtete denn auch bald den zottigen Kopf empor, brummte, scharrte mit den Vorderbeinen, wälzte sich, stand wieder auf und lief fort, so schnell als er laufen konnte. Die anderen vier folgten ihm.
Es blieb uns nichts übrig, als von der Jagd abzustehen oder die Pferde anzutreiben, um die Büffel einzuholen. Wir entschlossen uns zu dem Letzteren und so ging es im gestreckten Galopp weiter, wie es schien nach einer etwa sechs Fuß hohen Lehmmauer hin, die einer Bande zwischen zwei Stühlen glich und sich hinzog, so weit das Auge reichen konnte, ohne eine Stelle zum Ablenken nach rechts oder links.
Das war ein Hindernis, sodass wir anhielten und beratschlagten. Einige drehten ihre Pferde herum und ritten zurück, während andere auf besseren Pferden, darunter St. Vrain und mein Voyageur Godé, die Jagd nicht so wohlfeilen Kaufes aufgeben wollten, die Sporen einsetzten und über die Wand hinwegsetzten.
Von diesem Punkte aus hatten wir fünf (englische) Meilen weit zu galoppieren, sodass unsere Pferde weiß vom Schweiß aussahen, bis wir den letzten Büffel erreichten, eine junge Kuh, die von einer Kugel aus jeder Büchse getroffen niederstürzte.
Da die anderen einen bedeutenden Vorsprung vor uns voraushatten und wir nun Fleisch genug besaßen, hielten wir an und stiegen ab und fingen an, die Haut abzuziehen. Unter den geübten Messern unserer Jäger war das bald geschehen. Wir hatten nun Zeit zurückzublicken und unsere Entfernung von dem Lager zu berechnen.
„Acht Meilen bis auf den Zoll!“, sagte einer.
„Wir sind in der Nähe des Weges“, meinte St. Vrain, indem er auf alte Wagengleise zeigte, welche den Weg der Santa Fé-Händler andeuteten. „Wenn wir in das Lager zurückreiten, haben wir morgen die ganze Strecke noch mal zu machen. Wir wollen also hierbleiben. Es ist Wasser und Gras da. Büffelfleisch haben wir auch. Holz finden wir. Unsere Decken haben wir bei uns, was brauchen wir mehr.“
„Bleiben wir hier!“, stimmten alle bei.
In der nächsten Minute waren die Sattelgurtschnallen gelöst, die Sattel abgenommen und unsere Pferde grasten in dem weichen Prärie-Grün.
Ein kristallheller Bach, Arroyo, wie die Spanier sagen, glitt langsam nach dem Süden hin, dem Arkansas zu. Am Ufer dieses Baches, unter einer Anhöhe, wählten wir unsere Lagerstelle. Das Bois de Dache (Kuhholz, Büffeldünger) wurde gesammelt. Bald brannte das Feuer und in den Flammen an kleinen Spießen brieten die Büffelbraten. Glücklicherweise hatten ich und St. Vrain die Flaschen mit Cognac zur Hand und so hielten wir ein ganz leidliches Abendessen. Die alten Jäger griffen dann nach den Pfeifen und dem Tabak, ich und mein Freund zündeten Zigarren an und so saßen wir rauchend und unter Erzählungen von allerlei Abenteuern bis zu später Stunde an dem Feuer.
Endlich wurden die Wachen verteilt, die Pfählchen, an denen die Pferde angebunden waren, fester geschlagen und die Stricke verkürzt. Meine Kameraden wickelten sich in ihre wollenen Decken, legten den Kopf in die Sattelhöhlung und schliefen.
Unter uns befand sich ein gewisser Hibbets, welcher wegen seiner Schlafsucht den Spitznamen „Schlafratz“ erhalten hatte. Deshalb wurde ihm die erste Wache zugeteilt als die mindest gefährliche, weil die Indianer ihre Angriffe selten eher als kurz vor Tagesanbruch beginnen, wenn der Mensch im tiefsten Schlafe zu liegen pflegt.
Hibbets hatte seinen Posten eingenommen, den Gipfel der Uferhöhe, von wo er weithin über die umliegende Prärie sehen konnte.
Ehe es finster wurde, hatte ich ein besonders schönes Plätzchen am Ufer des Baches bemerkt, etwa zweihundert Ellen von der Stelle, an welcher meine Kameraden lagen. Ich konnte dem Verlangen nicht widerstehen, dort zu schlafen, nahm also meine Büchse, meine wollene Decke, rief „Schlafratz“ zu, mich im Notfalle zu wecken, und ging an das Plätzchen.
Der Boden senkte sich da sanft nach dem Bache hinab und war mit weichem, trockenem Büffelgrase bedeckt, das ein so gutes Bett gab, wie jemals ein Sterblicher eins gefunden. Ich wickelte mich in meine Decke und streckte mich aus mit der Zigarre im Munde, um mich in den Schlaf zu rauchen.
Es war eine herrliche Mondscheinnacht, sodass ich leicht die Farben der Prärieblumen erkennen konnte, die silberweißen Euphorbien, die goldenen Sonnenblumen, die scharlachroten Malven, welche das Ufer des Baches zu meinen Füßen bedeckten. In der Luft lag eine zauberische Ruhe, die nur gelegentlich durch das Geheul des Präriewolfes, das Schnarchen meiner Kameraden in der Ferne und das „Knabbern“ der Pferde unterbrochen wurde, welche das kurze Gras abbissen. Ich lag eine ziemliche Weile wachend da, bis die Zigarre mir an den Lippen brannte – in den Prärien raucht man sie sehr kurz ab – da warf ich den Stumpf von mir, drehte mich herum auf die Seite und befand mich bald im Lande der Träume.
Noch konnte ich nicht viele Minuten geschlafen haben, als sich ein seltsames Getöse mir bemerkbar machte wie ferner Donner oder das Brausen eines Wasserfalles. Auch schien die Erde unter mir zu zittern.
„Wir werden heute ein tüchtiges Donnerwetter bekommen“, dachte ich, halb im Traume, halb wachend, zog die wollene Decke fester um mich und schlief wieder ein.
Bald darauf wurde ich wieder geweckt, und wirklich durch Donner, wie es schien, durch ein Getöse wie von dem Getrappel tausend schwerer Beine, wie von dem Brüllen Tausender von Rindern. Die Erde bebte, ich hörte das Rufen meiner Kameraden, die Stimmen St. Vrains und Godés, welcher letztere schrie:
„Sacr...r..ré! Monsieur, garde les buffles!“ (Herr, sehen Sie sich vor vor den Büffeln.)
Ich sah, dass sie die Pferde losgebunden hatten und sie so schnell als möglich unter das hohe Ufer zogen.
Ich sprang auf und warf die Decke von mir. Ein furchtbares Schauspiel erwartete mich. Weit weit nach dem Westen hin, soweit das Auge reichte, schien die ganze Prärie sich zu bewegen. Schwarze Wogen rollten sich über sie hin, als ob ein brennender Berg seine Lava über die Ebene ausgieße. Tausend helle Punkte blitzten und glitzerten dabei in der beweglichen sich heranwalzenden Masse gleich Feuerfunken. Der Boden zitterte, Menschen schrien, die Pferde bäumten sich und wieherten wie im Entsetzen. Mein Hund bellte und heulte und sprang um mich herum.
Einen Augenblick glaubte ich zu träumen, aber bald wurde das Schauspiel zu greller Wirklichkeit, als dass es für Täuschung hätte gehalten werden können. Ich sah den Rand der schwarzen Woge kaum zehn Schritte vor mir und immer näher und näher kommen. Da erst, da erst erkannte ich die zottigen Köpfe und die glühenden Augen der Büffel.
„Gott im Himmel! Ich bin auf ihrem Wege. Ich werde zertreten werden.“
Zu spät war es zu einem Versuche, durch Flucht der Gefahr zu entgehen. Ich griff nach der Büchse und schoss nach den vordersten des Haufens, aber eine Wirkung der Kugel sah ich nicht. Das Wasser des Baches spritzte mir in das Gesicht, denn ein gewaltiger Stier, der Führer des Haufens, stürzte schnaubend und wütend voran in die Flut und die Erhöhung heran. Ich wurde emporgehoben und hoch in die Luft geschleudert, stürzte rückwärts nieder und fiel auf eine bewegliche Masse. Verletzt oder betäubt war ich nicht. So wurde ich auf dem Rücken mehrerer Tiere fortgetragen, die in dem ungeheuren Haufen dicht aneinandergedrängt liefen. Erschreckt durch die seltsame Last auf ihrem Rücken brüllten sie laut und schossen vor, immer vor, an die Spitze. Da kam mir ein Gedanke in den Kopf. Ich hielt mich fest an dem, was ich unter mir fühlte, streckte die Beine rittlings aus, umfasste den Buckel und packte das lange wollige Haar im Nacken. Das Tier stürmte im Entsetzen weiter und war bald dem ganzen Haufen voran.
Das wollte ich und weiter ging es über die Prärie dahin in sausendem Galopp, denn der Büffel mochte wohl meinen, es sitze ihm ein Panther oder Catamount auf dem Rücken.
Ich hatte gar keine Veranlassung, ihm diesen Glauben zu benehmen, zog vielmehr mein Bowie-Messer, das mir zum Glück im Gürtel geblieben war, und stachelte ihn damit an, sooft er im Laufe zu ermatten schien. Bei jedem solchen Spornstich brüllte er laut auf und stürzte mit doppelter Eile weiter.
Meine Gefahr war noch immer sehr groß. Die Herde, die mir nachjagte, hatte die Breite von mindestens einer (englischen) Meile. Trotzdem musste ich über meine seltsame Lage lächeln. Ich sah gar zu komisch aus auf dem zottigen Büffel an der Spitze vieler Tausender solcher schwarzer Ungetüme.
Weiter ging es durch ein „Dorf“ von „Präriehunden“. Da fürchtete ich, der Büffel werde umkehren, aber diese Tiere laufen stets in schnurgerader Linie. Der Meinige machte keine Ausnahme von der Regel. Er lief weiter und weiter, sank jeden Augenblick bis an die Knie ein, warf den Staub von den kegelförmigen Hügeln der „Hunde“ umher und schnaubte und brüllte vor Wut und Entsetzen.
Die „Plum-Buttes“ lagen gerade in unserer Richtung, wie ich gleich im Anfange bemerkt hatte. Konnte ich sie erreichen, so war ich gerettet. Sie lagen nur drei Meilen von dem Bache, wo wir gelagert, aber bei meinem grausigen Ritte kam mir die Entfernung zehnmal größer vor.
Ein kleiner dieser runden Hügel stand etwa hundert Ellen näher als die Haupthöhen. Dahin trieb und stachelte ich den schäumenden Büffel und er brachte mich bis etwa hundert Ellen an den Fuß.
Nun war es Zeit, das Tier zu verlassen. Ich hätte es erstechen können, denn mein Messer ruhte an der verwundbarsten Stelle seines ungeheuren Körpers. Aber nicht um den Coh-i-nur hätte ich ihm das Leben genommen.
Ich ließ allmählich das Haar an seinem Halse los, glitt an ihm hinten hinab und lief, ohne nur „gute Nacht“ zu sagen, so schnell als möglich die Anhöhe hinauf. Als ich den Gipfel erreicht hatte, setzte ich mich auf ein Felsstück und blickte hin über die Prärie.
Der Mond schien noch hell. Mein Büffel war stehengeblieben, nicht weit von der Stelle, wo ich ihn verlassen hatte, und stierte in höchster Bestürzung und Verwunderung zurück. Er hatte da etwas so Komisches an sich, dass ich laut auflachen musste, als ich so sicher auf meinem Felsenstück saß.
Ich blickte nach dem Südwesten. So weit mein Auge sehen konnte, war die Prärie eine schwarze bewegliche Masse. Die lebendige Woge wälzte sich näher und näher zu mir heran, aber ich konnte sie nun in Ruhe beobachten. Die vielen Tausende von glühenden Augen, die im Phosphorglanze leuchteten, erschreckten mich nicht mehr.
Die Herde war noch etwa eine halbe (englische) Meile entfernt. Zur linken Seite glaubte ich aufleuchtende Blitze zu sehen und Schüsse zu hören, aber gewiss war ich meiner Sache nicht. Ich hatte an das Schicksal meiner Kameraden gedacht und das Schießen, das ich zu hören glaubte, beruhigte mich etwas.
Die Büffel näherten sich dem Hügel, auf dem ich saß: Als sie ihn, das Hindernis in ihrem Wege, erkannten, teilten sie sich in zwei Ströme und jagten rechts und links an ihm vorüber. Das Merkwürdigste dabei war mir, dass mein Büffel nicht etwa wartete, bis die anderen herangekommen, um sich ihnen anzuschließen, sondern mit einem Male den Kopf emporwarf und fortjagte, als sei ein Rudel Wölfe hinter ihm drein. Auch lief er nach der Seite hinaus und erst, als er so weit gekommen war, dass ihn die Herde nicht treffen konnte, schloss er sich derselben wieder an.
Dies seltsame Verhalten meines früheren Gefährten war mir damals unbegreiflich, später aber lernte ich einsehen, dass er sehr klug daran getan hatte. Wäre er da stehengeblieben, wo ich von ihm geschieden, so hätten ihn die heranstürzenden anderen Büffel der Herde für einen aus einer anderen Herde gehalten und unfehlbar niedergestoßen.
Ich saß fast zwei Stunden lang auf meinem Felsenstück und beobachtete den dunklen Strom, der sich vorüberbewegte. Ich war gleichsam auf einer Insel mitten in einem schwarzen Meere voll aufzuckender Flämmchen. Einmal war es mir gar, als bewege ich mich, als schwimme der Hügel fort und als ständen die Büffel still. Mir begann zu schwindeln und ich stand auf, um diese seltsame Täuschung abzuschütteln.
Der Strom wälzte sich weiter und endlich waren die Letzten vorüber. Ich stieg nun von dem Hügel hinunter und fing an, über den schwarzen Boden hinzugehen. Was so kurz vorher ein grüner Rasenteppich gewesen war, hatte nun das Aussehen eines frischgepflügten von Ochsenherden niedergetretenen Feldes.
Eine Schar weißer Tiere, die einer Herde Schafe glichen, kam an mir vorüber. Es waren Wölfe, welche den Büffeln folgten.
Ich wanderte und wanderte weiter nach Süden zu. Endlich hörte ich Stimmen und konnte in dem hellen Mondenschein mehrere Reiter erkennen, die in Kreisen über die Ebene jagten. Ich rief sie an. Eine Stimme antwortete mir und ein Reiter kam auf mich zu. Es war St. Vrain.
„Gott steh mir bei, Haller?“, sagte er, hielt sein Pferd an und bog sich von dem Sattel herab, um mich deutlicher zu sehen. „Sind Sie es oder Ihr Geist? Bei Gott, er ist es selbst und lebendig!“
„Ich habe mich nie wohler befunden.“
„Aber woher kommen Sie? Aus den Wolken? Woher?“ Diese Fragen wiederholten auch die anderen, die herankamen und mir die Hände schüttelten, als hätten sie mich ein ganzes Jahr lang nicht gesehen.
Godé schien sich gar nicht zurechtfinden zu können.
„Mon dieu! Von Millionen Büffel getreten und nicht gestorben! Sacre!“
„Wir suchten nach Ihrem Leichnam oder vielmehr nach den einzelnen Fetzen“, sagte St. Vrain. „Eine Meile im Umkreise haben wir jeden Fuß breit Boden untersucht und waren fast zu der Vermutung gekommen, dass das wilde Vieh Sie gar aufgefressen habe.“
„Monsieur essen auf? Non! Drei Millionen Büffel nicht essen Mensch. Mon dieu! Schlafratz, sacré!“
Die letzteren Worte des Kanadiers galten Hibbets, welcher meinen Kameraden nicht gesagt, wo ich lag, und mich so in die Gefahr gebracht hatte.
„Wir sahen Sie in die Luft schleudern“, fuhr St. Vrain fort, „und dann in den dicken Haufen hineinfallen. Da gaben wir Sie natürlich verloren. Wie, um Gottes willen, sind Sie mit heiler Haut davongekommen?“
Ich erzählte mein Abenteuer meinen verwunderten Gefährten.
„Mon dieu!“, rief Godé aus. „Was ein Mann! Was ein Sach! Mon dieu!“
Von dieser Stunde an galt ich für einen „Capitain“ auf den Prärien.
Meine Kameraden hatten gut gearbeitet, wie ein Dutzend dunkle Gegenstände zeigten, die am Boden lagen. Meine Büchse und meine Decke waren aufgefunden worden, die Letztere in den Boden hineingetreten.
St. Vrain hatte noch einige Tropfen in seiner Flasche. Nachdem ich diese zu mir genommen hatte, kehrten wir zu unseren Prärielagern zurück, stellten wiederum neue Wachen aus und schliefen die ganze Nacht.
5 Buttes heißen die kleinen, einzeln stehenden knollenförmigen Hügel in der Ebene und Plum Buttes „Rosinen-Hügel“ nennt man sie, weil sie etwa aussehen wie Rosinen auf einem flachen Kuchen.
Kapitel 5: Eine böse Klemme.
Einige Tage später hatte ich ein anderes Abenteuer zu bestehen, sodass ich zu glauben anfing, das Schicksal wolle mich zu einem Helden unter den Genossen werden lassen.
Einige der Handelsleute, ich unter ihnen, waren der Karawane vorausgezogen, denn wir wollten in Santa Fé ein paar Tage vor den Wagen ankommen, um mit dem Gouverneur wegen des Einzugs in die Stadt alles zu ordnen.
Unser Weg führte etwa hundert Meilen weit über eine dürre Wüste, ohne Wild und fast ohne Wasser. Die Büffel waren bereits verschwunden und Hirsche zeigten sich ungemein selten. Wir mussten uns deshalb mit gedörrtem Fleische begnügen, das wir mit uns gebracht hatten. Gelegentlich sahen wir eine einzelne Antilope vor uns hinjagen, aber weit aus unserem Bereiche.
Am dritten Tage, nachdem wir uns von der Karawane getrennt hatten, ritten wir in der Nähe des Cimmaron hin, als ich einen gehörnten Kopf hinter einer kleinen Anhöhe in der Prärie verschwinden zu sehen glaubte. Meine Reisegesellschafter glaubten mir nicht und keiner wollte mich begleiten. Ich brach also allein auf. Einer, denn Godé war bei dem Wagen, behielt meinen Hund bei sich, da ich ihn nicht mit mir nehmen wollte, weil ich fürchtete, er könne die Antilopen scheu machen. Mein Pferd war noch frisch und ich wusste, dass ich die Gesellschaft zur Lagerzeit wieder einholen konnte, mochte meine Jagd glücklich sein oder nicht.
Ich ritt gerade auf den Punkt zu, wo ich den Gegenstand bemerkt hatte. Er schien etwa eine halbe englische Meile von unserem Wege entfernt zu sein. Ich täuschte mich aber, wie das in der kristallhellen Luft dieser hochgelegenen Ebenen häufig der Fall ist.
Ein seltsam geformter kleiner Höhenkamm, ein Couteau des Prairies (Präriemesser) in kleinem Maßstabe, zog von Osten nach Westen über die Ebene und war an seinem höchsten Teile dicht mit Kakteen bewachsen. Nach diesem Dickicht hin wendete ich mich.
Unten am Fuße stieg ich ab, führte mein Pferd still unter die Kakteen hin und band es an einen Zweig eines derselben an. Dann kroch ich vorsichtig unter den stacheligen Blättern hin nach der Stelle zu, wo ich das Wild gesehen zu haben glaubte. Zu meiner Freude sah ich nicht bloß eins, sondern ein paar dieser schönen Tiere ruhig weiden, leider in zu weiter Ferne, als dass ich sie mit meiner Büchse hätte erreichen können. Sie waren an einem glatten grasigen Abhange gute dreihundert Ellen entfernt und nicht ein hohes Grasbüschel barg mich, wenn ich hätte versuchen wollen, an sie heranzuschleichen. Was war also zu tun?
Ich lag mehrere Minuten lang da und dachte über die verschiedenen Jägerkunststückchen nach, die angewendet werden, um die scheue Antilope zu erlangen. Sollte ich ihren Ruf nachahmen? Sollte ich mein Taschentuch in die Höhe halten und versuchen sie heranzulocken? Ich sah, dass sie zu scheu waren, denn in kurzen Zwischenräumen richteten sie ihre zierlichen Köpfe empor und sahen sich forschend um. Endlich dachte ich an die rote Decke auf meinem Sattel. Diese konnte ich auf die Kaktusbüsche breiten. Vielleicht trieb sie die Neugierde heranzukommen. Etwas anderes blieb mir nicht übrig und ich wollte eben zurückgehen, um die Decke zu holen, als ich plötzlich einen lehmfarbigen Streifen bemerkte, der über die Prärie lief und über welchem die Antilopen weideten. Es war eine Vertiefung in der Fläche, ein Büffelweg oder das Bett eines Baches, in jedem Falle das Versteck, das ich suchte, denn die Tiere befanden sich nicht hundert Ellen davon und kamen im Grasen näher heran.
Ich kroch aus dem Dickicht wieder heraus und lief an der Seite des Abhanges nach der Stelle hin, wo ich die Vertiefung, die Rinne, bemerkt hatte. Da stand ich zu meiner Verwunderung an dem Ufer eines breiten Baches (Arroyo), dessen helles seichtes Wasser über Sand und Gips hinrauschte.
Die Ufer waren niedrig, nicht drei Fuß über dem Wasserspiegel, ausgenommen an einer Stelle, wo sie ziemlich hoch emporstiegen. Ich trat in den Bach hinein und fing an, darin aufwärts zu waten.
Wie ich vermutet hatte, kam ich bald an eine Krümmung. Da machte ich Halt und schaute vorsichtig über das Ufer. Die Antilopen waren ziemlich nahe an den Bach herangekommen, befanden sich aber noch zu weit oberhalb von mir, als dass ich hätte schießen können. Sie weideten noch immer ruhig, ohne eine Gefahr zu ahnen.
In dieser Weise weiterzugehen, war eine schwere Aufgabe, denn das Bett des Baches war weich und gab nach, ich musste sehr langsam und still gehen, um die Tiere nicht aufmerksam zu machen. Aber die Aussicht auf frischen Wildbraten für das Abendessen erhielt meinen Mut aufrecht.
Nachdem ich mich mühselig einige Hundert Ellen weit geschleppt hatte, gelangte ich an eine Gruppe Wurmholzgebüsch, das am Ufer wuchs. „Es ist hoch genug“, dachte ich, „um mich zu bergen.“
Ich richtete mich langsam auf, bis ich durch die Blätter sehen konnte. Der Platz war vortrefflich. Ich hob deshalb die Büchse an den Backen, zielte nach dem Herzen des Bockes und schoss. Das Tier tat einen gewaltigen Satz in die Höhe und stürzte leblos nieder.
Eben wollte ich hineilen und meine Beute holen, als die Ricke, statt davonzulaufen, wie ich erwartet hatte, zu ihrem gefallenen Gefährten trat und ihn beschnoberte. Sie war nicht über zwanzig Ellen von mir entfernt und ich konnte deutlich ihr fragendes bestürztes Auge sehen. Mit einem Male schien sie die schreckliche Wahrheit zu erkennen, warf den Kopf zurück, gab die jammervollsten Töne von sich und lief dabei im Kreise um den toten Körper herum.
Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Anfangs wollte ich wieder laden und auf die Ricke anlegen. Aber ihre klagende Stimme erweichte mein Herz und entwaffnete meine Hand. Hätte ich ahnen können, ein so ergreifendes Schauspiel zu erleben, ich wäre nicht von den Reisegefährten gewichen. Aber das Böse war einmal getan. „Ich habe ihr weher getan, als hätte ich sie getötet“, dachte ich. „Es wird also am besten sein, wenn ich sie ihrem Gefährten nachsende.“
So lud ich wieder an und schoss. Meine Nerven waren stark genug, um die Tat zu verrichten. Als der Rauch sich verzog, sah ich das kleine Tier blutend im Grase liegen, neben dem bereits gefallenen.
Ich hing meine Büchse um und wollte an Ort und Stelle gehen, als ich zu meinem Erstaunen bemerkte, dass ich an den Füßen festgehalten wurde, so fest, als säßen sie in einem Schraubstocke.
Ich strengte mich an, um loszukommen, noch einmal, noch kräftiger, aber gleich erfolglos. Mit dem dritten Versuche verlor ich gar das Gleichgewicht und fiel auf den Rücken ins Wasser.
Mit Mühe arbeitete ich mich wieder empor, aber nur um mich zu überzeugen, dass ich noch fester gehalten wurde.
Wiederum bemühte ich mich, meine Füße freizumachen. Ich konnte sie weder vorwärts noch rückwärts, weder rechts noch links bewegen und fühlte zugleich, dass ich allmählich tiefer sank. Da wurde mir die schreckliche Wahrheit klar, ich sank in Triebsand ein.
Ein Schauer und Grauen erfasste mich und mit der Kraft der Verzweiflung erneuerte ich meine Anstrengungen. Ich legte mich auf die eine, dann auf die andere Seite und renkte mir die Knie fast aus dem Gelenke. Die Füße blieben so fest wie vorher. Nicht einen Zoll konnte ich sie bewegen.
Der weiche gleichsam sich fest ansaugende Sand reichte bereits bis über meine Reitstiefel und klemmte sie an den Knöcheln zusammen, sodass ich sie nicht auseinanderziehen konnte. Dabei fühlte ich, dass ich tiefer und tiefer einsank, langsam aber sicher, als ob irgendein unterirdisches Ungeheuer mich hinabziehe. Dieser Gedanke regte von neuem Grauen in mir an, sodass es mich kalt überlief und ich laut um Hilfe rief. Ach, wen? Meilenweit rund um mich her gab es kein lebendes Wesen. Ja, das Wiehern meines Pferdes antwortete mir von dem Hügel herab wie meiner Verzweiflung spottend.
Ich bog mich nach vorn, so weit es meine Stellung erlaubte, und begann wie wahnsinnig den Sand um meine Füße her aufzugraben. Kaum erreichte ich die Oberfläche desselben und die kleine Höhlung, die ich machen konnte, füllte sich fast so rasch wieder, als sie entstanden war.
Da fiel mir ein, dass ich mich auf meine Büchse stützen und mich mit ihr herausarbeiten könnte, wenn ich sie quer legte. Ich sah mich nach ihr um, erblickte sie aber nirgends. Sie war bereits in den Sand eingesunken.
Konnte ich mich platt hinlegen und so mein tieferes Einsinken verhindern? Nein. Das Wasser war zwei Fuß tief. Ich wäre sofort ertrunken.
Diese letzte Hoffnung verließ mich also, so bald sie entstanden war. Ich konnte nicht nachsinnen, wie ich mir wohl helfe. Die Gedanken sogar schienen in mir erstarrt zu sein. Nur das wusste ich, dass ich wahnsinnig werden würde, und einen Augenblick war ich es schon.
Nach einiger Zeit kehrte mein Bewusstsein zurück und ich strengte mich sofort an, meine Gedanken zu sammeln, um den Tod, den ich nun für unvermeidlich hielt, als Mann zu ertragen.
Da stand ich. Meine Augen schauten über die weite Prärie hin und ruhten auf den blutenden Opfern meiner Grausamkeit. Ich fühlte bei dem Anblicke Reue und Gewissenspein. Traf mich Gottes Strafe?
Mit demütigen und reuigen Gedanken erhob ich mein Antlitz zum Himmel und fürchtete fast, irgendein Zeichen des Zornes des Allmächtigen auch da zu erblicken. Aber nein, die Sonne schien so hell und glänzend wie je und der blaue Himmel spannte sich wolkenlos über mir aus.
Ich schaute hinauf und betete mit einem Ernst und einer Inbrunst, die nur die Herzen derer kennen, welche in so entsetzlicher Lebensgefahr sind, wie ich es war.
Während ich hinaufschaute, erregte ein Gegenstand meine Aufmerksamkeit. Ich erkannte an dem Himmel einen großen dunkelfarbigen Vogel und wusste sogleich, dass es der hässliche Vogel der Ebene, der Bussard-Geier sei. Woher war er gekommen? Wer weiß es! Weit weit außer dem Bereiche des menschlichen Auges hatte er die getöteten Antilopen gesehen oder gewittert und auf den breiten stillen Flügeln ließ er sich herab, um sich an den Toten zu laben.
Und noch einer, noch einer, immer mehrere zeigten sich an dem blauen Himmelszelte und zogen in weiten Kreisen nach Osten. Dann schoss der erste hernieder auf das Ufer, sah sich eine Zeit lang um und flatterte hin nach seiner Beute.
Nach wenigen Sekunden war die Prärie mit den schmutzigen Vögeln bedeckt, welche die toten Antilopen zerrissen und einander mit den riesigen Flügeln schlugen.
Dann kamen die Wölfe hungrig herangeschlichen, schielten aus dem Kaktusdickicht heraus und sahen feig über die grüne Ebene der Prärie hin. Nach einem Kampfe verjagten sie die Geier, nagten an der Beute und knurrten dabei und bissen nacheinander.
„Gott sei Dank, dem entgehe ich wenigstens!“
Der hässliche Anblick wurde mir bald entzogen. Ich war bereits so tief eingesunken, dass ich nicht mehr über das Ufer hinwegsehen konnte. So hatte ich also das letzte Mal über die schöne grüne Erde geblickt. Ich sah nur noch die Lehmwände, welche den Fluss umschlossen und das Wasser, das an mir vorüberfloß.
Noch einmal schaute ich nach dem Himmel hinauf, betete andächtig und versuchte mich in mein Schicksal zu ergeben.
Trotz meiner Bemühungen aber ruhig zu sein, dachte ich an die irdischen Freuden, an die Heimat, an die Freunde, sodass die Verzweiflung wiederkehrte und mich zu neuen Anstrengungen trieb.
Wiederum wieherte mein Pferd und ein Gedanke gab mir neue Hoffnung. „Vielleicht mein Pferd...“
Keinen Augenblick ließ ich verloren geben. Ich rief, so laut ich rufen konnte, den Namen des Tieres. Ich wusste, dass es auf meinen Ruf kommen würde. Es war auch nur leicht angebunden. Der Kaktuszweig musste bald abbrechen. Ich rief wiederum und wiederholte Worte, die ihm wohlbekannt waren. Mit klopfendem Herzen horchte ich dann. Einen Augenblick war alles still. Dann hörte ich raschen Hufschlag, als bäume sich das Pferd und suche sich loszumachen. Endlich vernahm ich regelmäßigen Galopp.
Näher und näher kam der Schall, näher und näher, bis das prächtige Tier über das Ufer neben mir sprang. Da blieb es stehen, schüttelte die Mähne und wieherte. Es war ängstlich, sah sich nach allen Seiten um und schnaubte.
Ich wusste wohl, dass, sobald es mich gesehen, das Pferd nicht wieder von mir weichen würde, bis es seine Nase an mein Gesicht gedrückt, denn das tat es immer. Ich streckte meine Hände aus und rief die Zauberworte nochmals.
Da sah es nieder zu mir, erblickte mich und kam herein in den Bach. Im nächsten Augenblicke hielt ich es am Zügel.
Es war keine Zeit zu verlieren. Ich sank immer tiefer und tiefer ein. Schon ragte ich nur noch mit dem Oberkörper heraus.
Den Riemen (Lasso), mit dem das Pferd des Abends angebunden wurde, zog ich unter dem Sattelgurte durch und befestigte ihn da mit einem Knoten. Dann schlang ich den übrigen Strickteil um meinen Körper und behielt noch so viel übrig, um damit das Pferd lenken und treiben zu können, im Falle es ihm beschwerlich werden sollte, mich herauszuziehen.
Das Tier stand unterdes dabei und schien zu begreifen, was ich vornehmen wolle. Es kannte auch die Art des Bodens, auf dem es stand, denn es hob abwechselnd die Füße, um nicht einzusinken.
Endlich war ich mit meinen Vorbereitungen zustande und mit entsetzlicher Angst gab ich dem Pferde das Zeichen anzuziehen. Statt einen Satz zu tun, ging das kluge Tier langsam vor, als kenne es meine Lage. Der Strick zog an, ich fühlte, dass mein Körper sich hob und im nächsten Augenblick empfand ich ein Entzücken, das ich nicht zu beschreiben vermag, denn – ich war aus dem Sande herausgezogen.
Mit lautem Freudengeschrei sprang ich auf, schlang meine Arme um den Hals meines Pferdes und küsste es mit einer Wonne, wie ich etwa ein schönes Mädchen geküsst haben würde. Dann sah ich mich nach meiner Büchse um und suchte. Zum Glück war sie noch nicht tief eingesunken und ich fand sie bald. Die Stiefel waren freilich steckengeblieben, aber ich hielt mich nicht auf, nach ihnen zu suchen, da ich die Stelle fürchtete, an welcher ich sie gelassen.
Bald saß ich wieder im Sattel und galoppierte zurück.
Die Sonne war unter, ehe ich das Lager erreichte, in dem mich alle mit Fragen bestürmten. „Trafen Sie die Ziegen?“, fragten einige, denn so prosaisch nennt man hier die reizenden Antilopen. „Wo haben Sie Ihre Stiefel? Haben Sie gejagt oder gefischt?“
Zur Antwort auf diese Frage erzählte ich meine Abenteuer und war so nochmals für diese Nacht der Held am Lagerfeuer.
Kapitel 6: Santa Fé.
Nachdem wir eine Woche lang durch die Felsenberge geklettert waren, stiegen wir in das Tal des del Norte hinab und erreichten die Hauptstadt von New Mexico, das weit und breit berühmte Santa Fé. Am Tage darauf bereits erschien die Karawane selbst, die besseren Weg gefunden hatte als wir.
Wir erlangten ohne Mühe die Erlaubnis, mit den Waren hereinzukommen, wohl verstanden, wenn wir für jeden Wagen fünfhundert Dollars Steuer zahlten. Das war eine bedeutendere Erpressung als gewöhnlich, aber die Handelsleute mussten sich dieselbe gefallen lassen.
Santa Fé ist der Stapelplatz der Provinz und der Hauptsitz des Handels.