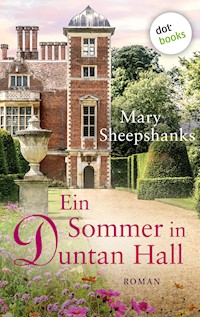4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Eine Frau zwischen Pflicht, Liebe und Tradition: Der bewegende Roman »Die Sterne über Boynton Park« von Mary Sheepshanks jetzt als eBook bei dotbooks. Die Musiklehrerin Flavia Cameron glaubt zu träumen, als der Direktor der ehrwürdigen Winsleyhurst School ihr einen Antrag macht. Doch die sittenstrenge Lady Boynton, die in der kleinen Stadt die Geschicke lenkt, ist mit dieser Wahl ganz und gar nicht einverstanden. Flavia ist viel zu kämpferisch, viel zu schön, viel zu lebenssprühend: Sie liebt es, mit ihrem musikalischen Talent sternengleich jeden Konzertsaal zum Leuchten zu bringen, anstatt bloß die Seite ihres Ehemanns zu zieren. Und obwohl sich vor ihrem neuen Zuhause der blühende Boynton Park mit seinen Mandelbäumen und Seen erstreckt, hat Flavia zunehmend das Gefühl, die Luft abgeschnürt zu bekommen. Erst, als sie Alistair Forbes, dem Vater eines neuen Schülers, begegnet, kann sie endlich wieder atmen. Aber darf sie für dieses zarte Gefühl wirklich alles riskieren? »Voller Weisheit und äußerst unterhaltsam!« The Times Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der berührende Liebesroman »Die Sterne über Boynton Park« von Mary Sheepshanks. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die Musiklehrerin Flavia Cameron glaubt zu träumen, als der Direktor der ehrwürdigen Winsleyhurst School ihr einen Antrag macht. Doch die sittenstrenge Lady Boynton, die in der kleinen Stadt die Geschicke lenkt, ist mit dieser Wahl ganz und gar nicht einverstanden. Flavia ist viel zu kämpferisch, viel zu schön, viel zu lebenssprühend: Sie liebt es, mit ihrem musikalischen Talent sternengleich jeden Konzertsaal zum Leuchten zu bringen, anstatt bloß die Seite ihres Ehemanns zu zieren. Und obwohl sich vor ihrem neuen Zuhause der blühende Boynton Park mit seinen Mandelbäumen und Seen erstreckt, hat Flavia zunehmend das Gefühl, die Luft abgeschnürt zu bekommen. Erst, als sie Alistair Forbes, dem Vater eines neuen Schülers, begegnet, kann sie endlich wieder atmen. Aber darf sie für dieses zarte Gefühl wirklich alles riskieren?
»Voller Weisheit und äußerst unterhaltsam!« The Times
Über die Autorin:
Mary Sheepshanks wurde 1931 geboren und wuchs am Eton College auf, wo ihr Vater arbeitete. Ihre Ferien verbrachte sie jedoch oft im Haus ihrer Großeltern in Wales, wo sie ihre Liebe für das ruhige Landleben und ungezähmte Landstriche entdeckte, die später in ihre Romane einfloss. Ebenfalls Einfluss fanden ihre Jahre in Eton sowie Unterrichtsstunden in Windsor Castle. Mary Sheepshanks lebt und schreibt heute in Schottland. Ihre zahlreichen Enkelkinder nennen sie gern »wild writing granny« – unter diesem Titel erschienen daher ihre Memoiren.
Bei dotbooks veröffentlichte Mary Sheepshanks auch ihre Romane »Der Himmel über Glendrochatt«, »Ein Sommer in Duntan Hall« und »Die Frauen von Longthorpe«.
***
eBook-Neuausgabe September 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1996 unter dem Originaltitel »Facing the Music« bei Random House UK. Die deutsche Erstausgabe erschien 2000 unter dem Titel »Romanze in Moll« bei Bastei Lübbe.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1996 by Mary Sheepshanks
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2000 by Bastei Verlag Gustav H. Lübbe GmbH & Co., Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-111-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Sterne über Boynton Park« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Mary Sheepshanks
Die Sterne über Boynton Park
Roman
Aus dem Englischen von Katharina Woicke
dotbooks.
Anmerkung der Autorin
Eigentlich ist es überflüssig zu sagen, daß sämtliche Personen in diesem Buch frei erfunden sind, auch wenn ich beim Schreiben dieses Romans auf meine persönlichen Kenntnisse über Internate zurückgegriffen habe. Ich möchte mich für ihre Unterstützung bei Nick, Tim und Prue Dawson und dem Kollegium der Sunningdale School bedanken, ebenso bei Richard Foster, Tim und Patricia Piper und den Lehrern der S. Anselm’s School in Derbyshire.
Viele Freunde haben geduldig mit mir über Musik diskutiert, aber mein besonderer Dank gilt Rosemary Pickering vom Young Concert Artists Trust für ihre Hilfe und ihren Rat. Ganz besonders zu Dank bin ich auch meiner Nachbarin Stina Bisengaliev verpflichtet, Erste Flötistin der English Northern Philharmonia, für ihre Hilfe und ihr Interesse. Für eventuelle Fehler bin ich ganz allein verantwortlich.
Ardvrechan ist eine Insel, die meiner Phantasie entsprungen ist, aber ich möchte Colin und Caroline Stroyan danken, daß sie mir erlaubt haben, Pait zu besuchen, und Dougie Lipp, daß er mich in seinem Boot übergesetzt hat.
Und wie stets stehe ich bei meiner Familie in großer Schuld: für ihre Liebe, ihr Lachen, ihre Ermutigung; nicht zu vergessen meine Enkel, die meinen Wortschatz »verjüngt« haben.
Dank auch an Sarah Molloy, meine Agentin, und Kate Perkin, meine Lektorin der englischen Originalfassung.
Kapitel 1
Die Probe an jenem Morgen verlief hervorragend. Alle Mitglieder des Orchesters lächelten Flavia an, als die letzten Töne verklangen und sich endlich die Spannung löste.
»Wenn du heute abend auch so spielst, dann wirst du dem Publikum eine Sensation bieten!« Antoine küßte ihr die Hand; es war kein höflicher Handkuß, sondern eine höchst sinnliche Berührung. Dann schloß er ihre Finger darüber, als hielte sie eine kostbare Münze darin.
Alle im Orchester wußten, daß sie eine Affäre mit dem Dirigenten hatte – Antoines Affären waren niemals ein Geheimnis, und Flavia störte es nicht; am liebsten hätte sie es ja selbst von allen Dächern hinabgeschrien. Es war das Erstaunlichste, Wunderbarste, was ihr bisher in den einundzwanzig Jahren ihres Lebens passiert war. Um so entsetzter wäre sie gewesen, wenn sie gehört hätte, wie Jim Barnard, der allseits geschätzte Leiter des Orchesters, sagte: »Ich gebe der ganzen Angelegenheit sechs Monate, im Höchstfall ein Jahr – und Flavia tut mir jetzt schon leid.« Die Musiker haßten Antoine, obwohl Jim, der schon unter vielen Dirigenten gespielt hatte, zugeben mußte, daß Antoine exzellent war und dem Orchester neuen Schwung verliehen hatte.
Die üblichen Geräusche entstanden, als die Musiker ihre Instrumente und die Noten wegpackten. Antoine beobachtete, wie Flavia die Querflöte in den Kasten legte. Am Morgen hatte eine leichte Spannung zwischen ihnen geherrscht, weil Flavia sich geweigert hatte, Antoine zu verraten, welches Kleid sie an diesem Abend in der Festival Hall tragen würde. Er hatte ziemlich ausgeprägte Vorstellungen, welches Image sie aufbauen sollte, und überhaupt zog er es vor, über alles, was sie betraf, die Kontrolle zu besitzen. Flavia war nicht sicher, ob ihm dieses schwarze, raffinierte Kleid gefallen würde, in das sie sich in Paris auf den ersten Blick verliebt und das sie – für verdammt viel Geld – als Überraschung für ihn gekauft hatte. Doch ihr war es wichtig, wenigstens in diesem Bereich Unabhängigkeit zu zeigen. Sie war hingerissen von Antoine, aber sie hatte nicht vor, seine Marionette oder die eines anderen zu werden.
»Nun, wirst du heute abend das rote oder das hellblaue tragen?« hatte er gefragt, als sie im Bett lag und ihn dabei beobachtete, wie er sein glattes schwarzes Haar, das an den Seiten wie Rabenflügel wirkte, sorgfältig hinter die Ohren kämmte.
»Ich verrat’s dir nicht – es ist ein Geheimnis.«
»Aber natürlich mußt du es mir verraten. Es ist wichtig, daß du dich mit mir berätst.«
»Wart’s einfach ab«, hatte sie ihn geneckt, doch Antoine mochte es nicht, wenn man ihn aufzog – er allein durfte andere necken. Er hatte sich über ihren Widerstand geärgert, hatte sie bedrängt, doch sie hatte nicht nachgegeben. Antoine, der früher zur Probe gehen mußte als Flavia, war mit einem Gesicht wie eine Gewitterwolke aus dem Raum gestürmt. Es war das erste Mal, daß sie sich ihm widersetzt hatte, und er war sicher, daß er ihr das Geheimnis schon noch entlockt hätte, wäre er nicht in solcher Eile gewesen – obwohl es sie auch irgendwie interessanter machte.
Doch nun war er viel zu erfreut über ihr Spiel, um das Thema noch einmal aufs Tapet zu bringen. Sie würde ihm Ehre machen und zeigen, daß die Vorschußlorbeeren, mit denen er sie in den Medien bedacht hatte, gerechtfertigt waren. Antoine du Fosset war stolz auf seine Fähigkeit, schon früh Talente erkennen zu können – nicht nur im musikalischen Bereich, wie die Lästermäuler behaupteten.
Bevor sie gingen, bat er sie, sich ganz hinten in den Saal zu stellen.
»Ich möchte dir etwas vorführen. Glaub mir, du wirst tatsächlich eine Stecknadel fallen hören können.« Flavia sprang die Stufen hinunter und lief den Gang entlang. Sie strahlte vor Glück über sein Lob und sah dem Auftritt am Abend mit neuem Selbstvertrauen entgegen.
»Fertig?« rief er.
Sie schaute lachend zu ihm hin. »Fertig!«
Antoine zog die Nadel aus der Nelke, die er stets im Knopfloch trug – in Gedenken an Malcolm Sargent, wie er selbst zu sagen pflegte –, um sich selbst hervorzuheben, wie andere Leute behaupteten. Antoine hielt die Nadel hoch und ließ sie dann fallen. Deutlich konnte Flavia hören, wie sie auf den Bühnenboden fiel.
»Was für eine Akustik!«
»Tu ferais bien de t’en souvenir – du tätest gut daran, es nicht zu vergessen!«
Flavia kehrte zu ihm zurück, doch bevor sie hinter die Bühne ging, drehte sie sich noch einmal um und warf einen Blick auf die vielen Stuhlreihen und die Logen oben an den Seiten, die ihr vorkamen wie Schubladen, die man herausgezogen hatte. Heute abend würde der Saal mit Menschen gefüllt sein, die alle kamen, um sie spielen zu hören.
»Laß uns jetzt gehen!« Antoine nahm sie an der Hand und führte sie in seine Garderobe, nahm sie in die Arme. Flavia war nicht viel kleiner als er. Doch er war so von Energie und Vitalität erfüllt, daß viele, die ihn beim Dirigieren erlebt hatten, hinterher erstaunt waren, daß er nicht größer war. Flavia schloß die Augen und gab sich seinem Kuß hin.
»Ich bin sehr stolz auf dich«, sagte er, während er sie hinter sich her zu dem Taxi zog, das er bestellt hatte.
Nach dem Mittagessen kehrte Flavia in die Wohnung zurück, die sie mit Tricia teilte – auch wenn sie sich in letzter Zeit nur selten hier hatte sehen lassen. Tricia war gerade dabei, sich die Haare zu waschen.
»Hi, Trish, wie schön, daß du hier bist! Aber was machst du hier um diese Zeit?«
»Na ja, ich wußte, daß du heute nachmittag kommen würdest, und ich hatte die Nase voll von der Galerie.« Tricia verzog das Gesicht und schlang sich ein Handtuch um die Haare. »Die Arbeit ist langweilig, langweilig, langweilig! Und wie bekommt dir unser großer französischer Liebhaber? O Himmel, du strahlst wie ein Weihnachtsbaum! Ich bin schon ganz grün vor Neid. Ich wünschte, Roddy hätte auch mal diese Wirkung auf mich! Ich denke, ich sollte dem Jungen mal ein bißchen Feuer machen!« Tricia nahm sich ständig vor, Roddy Feuer zu geben. »Aber du hast von deinem Dirigenten mehr gelernt, als zu musizieren.«
»Hm.« Flavia streckte sich auf ihrem Bett aus. »O Trish, du ahnst gar nicht, wie glücklich ich bin. Ich hatte doch überhaupt keine Ahnung, wie herrlich das Leben sein kann! Es ist nicht nur der Sex – obwohl auch der einfach toll ist! –, Antoine und ich, wir atmen einfach die gleiche Musik. Er ist der wunderbarste Mann, dem ich je begegnet bin, und er hat mich zu einem ganz anderen Menschen gemacht. Ich würde sterben, wenn ihm irgend etwas passierte!«
Tricia dachte nur, daß ihm bei seinem bekannten Frauenverschleiß unausweichlich etwas passieren würde – mit größter Wahrscheinlichkeit eine andere Frau. Aber es wäre zwecklos, Flavia in ihrem gegenwärtigen Zustand darauf hinzuweisen. Ihr Glück umgab sie wie ein bewehrter Zaun, der alles andere abhielt.
»Und welche Neuigkeiten gibt es von Roddy?« Schuldbewußt stellte Flavia fest, daß sie in letzter Zeit den Kontakt zu ihren Freunden sträflich vernachlässigt hatte – nicht, weil sie sie nicht mehr interessierten, sondern weil sie so erfüllt von Antoine und ihrer Musik gewesen war, daß nichts anderes mehr Raum gefunden hatte. Vor ein paar Monaten wäre sie stets auf dem laufenden gewesen, was Tricias erfülltes Liebesleben betraf; sie hätten endlos darüber diskutiert, ob es fair wäre, den getreuen Roddy hinzuhalten, bis vielleicht ein aufregenderes Exemplar der Gattung Mann auftauchte. Sie hatten damals auch über Guy gesprochen, Flavias Freund, ein schüchterner, ernsthafter Kommilitone, dem sie ihre Jungfräulichkeit geopfert hatte – und der gar nicht so wild darauf gewesen war, dieses Opfer entgegenzunehmen. Er fühlte sich bei seinem Cembalo wesentlich sicherer als in den Armen einer Frau. Tricia hatte ihn den »trübsinnigen Ritter vom schlechten Gewissen« getauft und Flavia damit aufgezogen, daß sie so wenig Abenteuergeist gezeigt hatte. Doch jetzt stellte Flavia fest, daß sie nicht die geringste Neigung verspürte, über Antoine mit ihrer Freundin zu diskutieren. Er war zu kostbar, zu privat; es kam ihr vor, als würde sie damit das Schicksal herausfordern.
Und dennoch erfreute sie sich an Tricias erfrischender Gesellschaft, sie war gerührt, als Tricia ihr sagte, daß auch sie am Abend zu ihrem Konzert kommen würde, obwohl sie nicht viel für klassische Musik übrig hatte.
»Deine Mutter hat mir eine Karte besorgt, so daß ich neben deinen Eltern, Matt und Di sitzen kann. Sie bringen wahrscheinlich tausend Leute mit. Ich habe Matt eine Ewigkeit nicht mehr gesehen.«
Matt war Flavias älterer Bruder. Er und seine Freundin Di arbeiteten als Assistenzärzte im St.-Thomas-Krankenhaus.
Tricia war begeistert von dem engen schwarzen Kleid, und ihr Geplauder wirkte beruhigend auf Flavias Nerven; sie hörte auf, ständig auf die Uhr zu schauen. Flavia war insgeheim erleichtert, daß ihre Eltern keine Zeit haben würden, vor dem Konzert noch schnell bei ihr vorbeizuschauen. Ihre ehrgeizige Mutter zeigte gemischte Gefühle, was Antoine betraf. Einerseits betrachtete sie ihn als wichtigen Meilenstein auf Flavias Weg zu einer großartigen Karriere, andererseits war sie extrem eifersüchtig darauf, welchen Einfluß er auf ihre Tochter hatte. Und da sie, wie ihre Kinder es nannten, in bezug auf Sex und Moral viktorianische Ansichten vertrat, hätte sie über diese Liaison zutiefst empört sein müssen, wenn sie sich selbst erlaubt hätte, einzugestehen, daß diese bestand. Aber wie die Menschen damals im viktorianischen Zeitalter zeigte auch sie doppelte Maßstäbe, und da Antoines Nützlichkeit ihr wichtiger erschien, hatte sie beschlossen, vor seinem Ruf die Augen zu verschließen. Antoine wiederum machte sich gar nicht erst die Mühe, so zu tun, als könne er Hester Cameron leiden. Für Flavia war es stets eine Qual, mit beiden zusammenzusein, und sie dachte schon mit Grauen an das Essen, bei dem sie alle ihren Erfolg feiern würden.
Gerade, als sie die Wohnung verlassen wollte, bekam Flavia einen so heftigen Hustenanfall, daß sie glaubte, sie würde ersticken. Tricia klopfte ihr auf den Rücken und flößte ihr einen Schluck Wasser ein.
»Bist du wieder in Ordnung?« Ängstlich sah Tricia die Freundin an.
»Ich denke, aber es fühlt sich so an, als hätte ich was im Hals stecken.« Sie berührte ihre Brust und hustete vorsichtig noch einmal. Ihre Augen waren groß vor Schreck. Der Anfall hatte nicht lange gedauert, aber sie spürte immer noch einen seltsamen Druck auf der Brust.
»Wir haben zu Mittag Fisch gegessen. Glaubst du, ich habe eine Gräte verschluckt?«
»Unsinn. Dann hättest du das schon längst gemerkt.« Tricia hörte sich sicherer an, als sie sich fühlte. »Das sind nur die Nerven.«
Antoine war bereits da, als Flavia kam.
»Ich habe so ein komisches Gefühl in meiner Brust«, sagte Flavia.
Antoine zeigte kein bißchen Mitgefühl. »Was hast du denn heute nachmittag gemacht?«
»Nichts – ich war nur in meiner Wohnung, habe mit Tricia geplaudert und noch ein bißchen geübt. Da ging’s mir noch gut.«
»Ich habe dir gesagt, du sollst dich ausruhen und nicht mit diesem dummen Ding schwätzen. Reiß dich zusammen.« Seine Stimme klang scharf. »Laß mich bloß nicht im Stich!« fügte er warnend hinzu, und Flavia verspürte plötzlich eine unheilvolle Ahnung.
Als er dann, nachdem sie sich umgezogen hatte, ih ihre Garderobe kam, küßte er sie und versicherte ihr, daß sie in dem neuen Kleid hinreißend aussehe, doch er erkundigte sich nicht, wie es ihr gehe. Er war vor einem Konzert immer so in seine Gedanken versunken, daß Flavia nicht wagte, etwas zu sagen. Der Druck auf ihrer Brust schien ein bißchen nachgelassen zu haben, doch sie war vom Klang ihres Spiels nicht begeistert gewesen, als sie sich eingespielt hatte. Sie holte sich in der Kantine eine Cola, weil sie dachte, daß das prickelnde Getränk ihr helfen könnte, und weil sie ein bißchen frische Luft schnappen wollte. In ihrer Garderobe kam es ihr so drückend vor, und obwohl es kein besonders warmer Tag war, brach ihr der Schweiß aus, als sie in den kleinen Raum zurückkehrte. Ich muß damit aufhören, dachte sie, während sie versuchte, die Panik zu unterdrücken, die in ihr aufstieg. Sie atmete einmal tief ein und aus, um sich zu beruhigen, doch als sie Luft holte, durchfuhr sie ein scharfer Schmerz.
Als der Orchestermanager kam, um ihr mitzuteilen, daß das Konzert begonnen hätte, fühlte sie sich auf einmal sehr einsam. Plötzlich sehnte sie sich danach, ihre Mutter bei sich zu haben.
Nach einer Rossini-Ouvertüre kam Antoine, um sie abzuholen, und als sie die Bühne betraten, wurden sie von donnerndem Applaus empfangen.
Nicht alle im Publikum hatten sie bereits auf der Bühne spielen hören, doch die meisten hatten hingerissen ihren Auftritt im Fernsehen verfolgt, als sie vor einigen Jahren den Jugendmusikwettbewerb gewonnen hatte. Die Juroren damals hatten nicht nur ihr Spiel gewürdigt, sondern auch ihre mitreißende Persönlichkeit.
Während sie vom Oboisten ihre Flöte in Empfang nahm, entdeckte sie ihre Familie, die genau vor dem Orchestergraben saß, keine dreißig Meter entfernt. Ihre Eltern wurden nicht nur von Matt, Di und Tricia begleitet, sondern auch von Peter, Flavias ältestem Bruder, und dessen Frau, sowie einigen Mitgliedern des Kollegiums von Orton Abbey, der Schule, deren Direktor ihr Vater war. Außerdem bemerkte sie Gervaise Henderson, der die Vorbereitungsschule von Orton leitete und ein enger Freund der Familie war. Gervaise war so groß, daß er überall auffiel, und zwischen den Schülern, die er mitgebracht hatte, wirkte er noch größer. Flavia war gerührt, daß so viele Freunde sie unterstützen wollten. Sie sah, wie ihr Vater ihr zuzwinkerte.
Sie gab Antoine durch ein Nicken zu verstehen, daß sie bereit war, und er hielt ihren Blick einen Moment lang fest, jenen Moment der Spannung und des Schweigens, bevor eine Aufführung beginnt. Dann gab er dem Orchester das Zeichen zum Einsatz.
Bei der Probe am Morgen hatte Flavia noch einmal festgestellt, daß sie gut genug spielte, um sich auch auf den Ausdruck und die Interpretation konzentrieren zu können, obwohl das Stück technisch äußerst schwierig war. Sie wußte, daß sie noch besser spielte als vor ein paar Wochen, als sie mit Antoines anderem Orchester, dem Orchestre de l’Opéra de Nîmes, aufgetreten war. Sie liebte es, ein solch virtuoses Stück zu spielen, und hatte mit ihrem Können triumphiert.
Es war eine Erleichterung, daß ihr der Einstieg so gut gelang – sie mußte sich diesen Druck auf der Brust nur eingebildet haben. Doch schon bald bekam sie Schwierigkeiten beim Atmen. Wenn es jetzt schon so schlimm ist, dachte sie, wie soll es dann bei den anderen Passagen werden? Antoine schaute sie verdutzt an. Sein Haar hatte sich gelöst und flatterte an den Seiten wie die Flügel einer aufgeregten Amsel. Als sie halbwegs durch den zweiten Satz waren, lag ein Ausdruck ungläubiger Wut auf seinem Gesicht. Während des dritten Satzes konzentrierte Flavia sich nur noch darauf zu überleben. Spiel den Schmerz nieder, sagte sie sich immer wieder vor; sie konnte an nichts anderes denken als daran, daß sie diesen Auftritt irgendwie hinter sich bringen mußte. Antoine sah aus wie ein Jockey, der verzweifelt sein Lieblingspferd zum Sieg peitschen will.
Hinterher konnte Flavia sich nicht mehr daran erinnern, daß sie sich vor dem Publikum verbeugt hatte. Irgendwie gelangte sie hinter die Bühne und sank Antoine in die Arme, der schon da stand, um noch einmal mit ihr auf die Bühne zurückzukehren.
Wütend schob er sie weg. »Steh gefälligst auf!« zischte er ihr zu, doch sie war nicht in der Lage dazu. Der Orchestermanager hob sie auf, halb trug er, halb schleppte er sie in ihre Garderobe, während Antoine allein auf die Bühne trat. Und schon eilten auch ihre Verwandten herbei, die an ihrem Spiel erkannt hatte, daß etwas Schlimmes passiert sein mußte. Sie waren alle versammelt, als Antoine zurückkehrte und in der Tür stehenblieb. Seine Stimme klang eisig.
»Was war los mit dir? Das war eine entsetzliche Vorstellung! Entsetzlich!«
»O Antoine, es tut mir so leid, so unendlich leid – aber ich fühle mich gräßlich, ich bin krank – aber wenigstens habe ich bis zum Schluß durchgehalten«, flüsterte sie.
»Es wäre viel, viel besser gewesen, wenn du es nicht getan hättest«, antwortete er brutal, weiß im Gesicht vor Zorn und Enttäuschung. »Wenn du auf der Bühne zusammengebrochen wärst, dann hätten die Leute wenigstens eine Entschuldigung gehabt, und uns allen wäre diese gräßliche Mittelmäßigkeit erspart geblieben. Glaub bloß nicht, du könntest noch einmal unter meiner Führung spielen!«
Entsetzt sah Flavia ihn an, zu entsetzt, um etwas zu sagen.
»Das langt!« sagte Andrew Cameron, Flavias Vater. »Würden Sie uns jetzt bitte verlassen, Antoine? Sehen sie nicht, daß meine Tochter krank ist?«
»Keine Bange, ich bin schon weg«, erwiderte Antoine mit einer Kälte, die in Flavias Seele schnitt. »Schließlich habe ich noch eine Symphonie zu dirigieren. Du hast einen kompletten Narren aus mir gemacht, Flavia!«
Er wandte sich auf dem Absatz um, und die Sorgfalt, mit der er die Tür hinter sich schloß, war viel bedrohlicher, als wenn er sie zugeknallt hätte und davongestürmt wäre.
Kapitel 2
Bevor der Ausschuß zusammentrat, rief Gervaise Henderson in Orton Abbey an. Er war den Camerons von Herzen zugetan, und das Drama des vergangenen Abends war ihm sehr nahegegangen. Er wählte die Nummer von Andrews Büro, doch nur die Sekretärin meldete sich.
»Der Direktor gibt gerade eine Stunde«, informierte sie ihn. »Vielleicht kann ich Ihnen weiterhelfen?«
»Ich wollte eigentlich nur wissen, ob es irgendwelche Neuigkeiten von Flavia gibt. Wie geht es ihr?«
»Nun, Mrs. Cameron ist in London geblieben, um bei ihr zu sein. Matt hat sie letzte Nacht direkt ins St.-Thomas-Krankenhaus gebracht, und sie haben sie dortbehalten, um irgendwelche Tests durchzuführen. Sie wissen noch nicht, was genau sie hat, aber es geht ihr offensichtlich sehr schlecht, und alle sind sehr besorgt. Gott sei Dank wird sie von Matts Chef behandelt, sie ist also in guten Händen. Ich werde Mr. Cameron ausrichten, daß Sie angerufen haben.«
Gervaise bedankte sich und sagte, daß er sich wieder melden würde. Er wußte, wieviel von dem Konzert am vergangenen Abend abgehangen hatte. Es war Flavias großes Comeback in England, nachdem sie dank eines Stipendiums ein Jahr in Frankreich verbracht und dort viel Erfolg gehabt hatte. Vor dem Konzert hatte Peter Gervaise anvertraut, daß er persönlich Antoine für einen arroganten Scheißkerl halte – es schien, als hätte er damit recht gehabt.
Gervaise blickte auf seine Uhr und wußte, daß er sich für das gleich beginnende Treffen wappnen mußte. Der Schulausschuß der Winsleyhurst School würde in seinem privaten Eßzimmer tagen. Seit dem Tod seiner Mutter benutzte Gervaise diesen Raum nur zu offiziellen Treffen. Sein Frühstück und das Mittagessen nahm er zusammen mit den Jungen ein, das Abendessen mit den Lehrern seiner Schule. Er stellte fest, daß die Glyzinie schon begann, die Fenster zu überwuchern, und daß sie dringend zurückgeschnitten werden mußte, wenn er nicht wollte, daß sie das ganze Licht wegnahm. Aber wahrscheinlich würde Pamela Boynton sich verpflichtet fühlen, ihm zu erklären, daß es die falsche Jahreszeit für einen Rückschnitt wäre.
Er freute sich nicht unbedingt auf die nächsten Stunden; dies war das erste Mal, daß Pamela Boynton den Vorsitz führte. Obwohl er sie mochte, war sie so etwas wie ein ständiger Stachel in seinem Fleisch, seit ihre Söhne damals in die Schule gekommen waren. Sie hatte zu allem eine höchst ausgeprägte Meinung. Dennoch mußte man anerkennen, daß sie freundlich war und praktisch dachte, aber am meisten ärgerte Gervaise, daß er an all dem selbst schuld war. Schließlich war er selbst derjenige gewesen, der beschlossen hatte, die Schule in eine Privatgesellschaft umzuwandeln, so daß ein Ausschuß nötig geworden war, der die Richtlinien festsetzte.
Wenn er wirklich einen Vorsitzenden seiner Wahl wollte, dann sollte er gut und schnell nachdenken, bevor die restlichen Mitglieder des Ausschusses eigene Vorstellungen entwickelten.
Er hatte eigentlich vorgehabt, Sir Lance Boynton zu bitten, diese Aufgabe zu übernehmen, einen Mann, den er zutiefst respektierte und sehr mochte, dessen finanzielle Situation und gesellschaftliche Verbindungen ihn prädestinierten; jeder wünschte sich, Sir Lance für seine Zwecke einspannen zu können. Man konnte sich darauf verlassen, daß er klugen Rat erteilte und ihm das Wohl der Schule am Herzen lag, ohne daß er sich in die täglichen Angelegenheiten einmischte. Doch Sir Lance hatte abgelehnt; da er zu viele Pflichten hätte, sei es nicht fair, ein solches Angebot anzunehmen.
»Ich bin im Moment kaum zu Hause, und wenn ich einmal am Wochenende da bin, muß ich tausend Dinge erledigen. Fragen Sie mich noch einmal, wenn ich mich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen habe – ich warne Sie, daß ich dann versucht sein werde, anzunehmen!« Alle hatten höflich gelacht. Niemand konnte sich vorstellen, daß Sir Lance je in den Ruhestand ginge. Und dann hatte seine Frau jenen Vorschlag gemacht, den niemand der Anwesenden abzulehnen wagte.
»Wie wär’s denn, wenn ich an deiner Stelle den Vorsitz übernähme!« hatte sie gefragt, mit dem gleichen Ausdruck wie ein Magier, der gerade ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert hat. »Ich könnte doch immer Lance nach seiner Meinung fragen – das wäre doch fast so, als hätte er selbst diese Aufgabe übernommen.« Ein unbehagliches Schweigen folgte. Niemand wußte, was er sagen sollte, und alle hofften, daß den anderen etwas einfiele. Keiner konnte sich vorstellen, daß Lady Boynton jemals jemanden um Rat fragte. Sie litt wahrlich nicht unter mangelndem Selbstbewußtsein, dafür fehlte ihr das Geschick ihres Mannes, gesträubte Federn zu glätten, wenn es um schwierige Entscheidungen ging.
»Vielleicht sollte jemand anderer offiziell diesen Vorschlag machen, damit alles seine Ordnung hat, und dann stimmen wir per Handzeichen ab – aber vielleicht wollen Sie mich ja gar nicht haben?« Diese unwahrscheinliche Möglichkeit war ihr gerade erst in den Sinn gekommen, und einen Moment lang wirkte sie verletzlich.
»Oh, hm, ja, natürlich machen wir es so. Ich selbst werde Sie offiziell vorschlagen. Was für eine hervorragende Idee, Pamela!«
Gervaise hatte sich selbst verachtet: für seinen Mangel an Voraussicht, daß er eine solche Situation nicht einkalkuliert hatte, und außerdem für die Feigheit, mit der er darauf reagierte. Sir Lance hatte ihn amüsiert und mit einem gewissen Mitgefühl betrachtet, doch nichts unternommen, um zu seiner Rettung zu eilen. Er selbst hatte seine Frau gut im Griff; um so mehr Spaß machte es ihm zu beobachten, wie sie weniger robuste Charaktere drangsalierte und wie ein Schneepflug aus ihrem Weg schob. Er fand, daß seine Frau Gervaise nur guttun konnte; obwohl er ihn mochte, konnte er manchmal den Wunsch nicht unterdrücken, ihn kräftig durchzuschütteln. Im Gegensatz zu dem, was alle anderen glaubten, suchte seine Frau nicht nur häufig seinen Rat, sondern handelte auch danach.
Demütig wurden die Hände gehoben, eine andere Entscheidung schien unmöglich. Nicht zum ersten Mal fragte sich Gervaise, ob er richtig gehandelt hatte, als er das Recht aufgab, das Geschick der Schule ganz allein zu lenken. Sein Vater hätte im Leben nicht daran gedacht, aber der war ja auch ein echter Diktator gewesen. Doch Gervaise hatte die Bürde, sämtliche finanziellen Entscheidungen allein treffen zu müssen, als immer schwerer empfunden. Er wußte, daß er ein hervorragender Lehrer und auch ein guter Schulleiter war – was nicht unbedingt ein und dasselbe heißen mußte –, aber er hatte keine Begabung für die kaufmännischen Dinge.
Nachdem alle eingetroffen waren, nahm Lady Boynton auf dem wuchtigen geschnitzten Stuhl Platz, selbst wuchtig genug wirkend, um alle zurechtzustutzen, die nicht spurten, und eröffnete das Treffen. Es mußte eine Entscheidung getroffen werden, ob Winsleyhurst seine Türen auch für Mädchen öffnen sollte, um mehr Schüler anzuziehen und gleichzeitig dem Wunsch einiger Eltern zu entsprechen, ihre Söhne und Töchter in derselben Schule ausbilden zu lassen. Lady Boynton votierte dafür (»Schließlich müssen wir mit der Zeit gehen!«), doch Gervaise war zögerlich. Er mochte keine Veränderungen, aber natürlich war auch ihm bewußt, daß man heutzutage mehr auf die Wünsche der Eltern eingehen mußte. Längst waren die Zeiten vorbei, als Gervaises Vater es sich leisten konnte, Schüler abzulehnen, nur weil ihm die Nase der Eltern nicht paßte.
Jemand schlug vor, daß man Meg Price, der zweiten Betreuerin, eine Gehaltserhöhung und den Posten einer Hausmutter für die Mädchen anbieten könne, doch andere wandten ein, daß dann Sister, die leitende Betreuerin, die sehr viel Wert auf Einhaltung der Hierarchie legte, eifersüchtig werden könnte. Würde man sie vielleicht sogar verlieren? Die beiden waren sowieso nicht immer einer Meinung: Sister hatte die weitergehende medizinische Qualifikation, doch die jüngere Frau verfügte über die bessere Intuition im Umgang mit Kindern – und die Kleinen mochten sie sowieso lieber.
»All diese Fragen würden sich gar nicht erst stellen, wenn Sie verheiratet wären, Gervaise«, sagte Pamela Boynton. »Sie sollten wirklich ernsthaft darüber nachdenken. Als Ihre Mutter noch lebte, gab es keine solchen Schwierigkeiten.«
»Ich glaube nicht, daß wir ein Problem haben«, erwiderte Gervaise milde. Ihm kam es schon lange so vor, als sei die Schule vollkommen in der Hand von Frauen, die sich immer streiten mußten.
»Wußten Sie eigentlich, daß sogar die Jungs schon Mutmaßungen darüber anstellen, warum Sie noch nicht verheiratet sind?« fuhr Lady Boynton fort.
Gervaise hatte sich nie zum eigenen Geschlecht hingezogen gefühlt, und er war entsetzt, daß jemand solche Vermutungen hegen konnte – befand er sich doch als Direktor einer Vorbereitungsschule für Jungen in einer ganz besonderen Position. Vielleicht war wirklich der Zeitpunkt gekommen, allen zu demonstrieren, daß er sich allein zu Frauen hingezogen fühlte. Schließlich hatten in letzter Zeit auch andere wohlmeinende Zeitgenossen darauf hingewiesen, daß es von Vorteil wäre, wenn er eine Ehefrau hätte – Lady Boynton war nur die letzte in dieser Reihe.
Sein zurückhaltender Charme und seine Höflichkeit machten Gervaise durchaus für Frauen attraktiv, vor allem für solche, die ihn bemuttern wollten. Doch bisher hatte weder allumfassende Leidenschaft noch wilde Versuchung zu seinem Wortschatz gehört, keiner Frau war es bis jetzt gelungen, ihn wirklich zu entflammen oder ihm eine feste Bindung abzuringen. Seine gelegentlichen, sehr diskreten Affären hatten niemals lange angehalten, und wenn sie beendet waren, hatte ihm niemals wirklicher Liebeskummer zu schaffen gemacht. Und er war so wenig eitel, daß er sich nicht vorstellen konnte, er selbst könne Herzen gebrochen haben – obwohl er sich da durchaus irrte.
Es hätte ihm sehr mißfallen, wenn Lady Boynton auch nur geahnt hätte, daß er erst vor ein paar Tagen ein Erlebnis gehabt hatte, daß dazu führte, daß er selbst überlegte, ob eine Ehefrau nicht doch wünschenswert und darüber hinaus ein kugelsicherer Schutz für einen Schuldirektor wäre.
Inzwischen gab es wesentlich mehr alleinerziehende Eltern als zu Lebzeiten seines Vaters, aber Gervaise war sicher gewesen, das dies höchstens ein Problem für die betroffenen Kinder, aber niemals für ihn selbst wäre. Bis Rowan Goldberg an seine Schule gekommen war. Einen Mister Goldberg schien es nicht zu geben, überhaupt schienen Männer im Leben des Jungen keine Rolle zu spielen – was allerdings nicht für seine Mutter galt, die gewöhnlich einen männlichen Begleiter im Schlepptau hatte, wenn sie ihren Sohn besuchte. Allerdings schien es nur selten zweimal der gleiche zu sein, und keiner der Herren hatte auch nur das geringste Interesse an dem Jungen bekundet.
Mrs. Goldberg war schwer einzuordnen, ihr Akzent schien schwach skandinavisch, mit einem Hauch Cockney, aber ganz offensichtlich hatte sie keine finanziellen Sorgen. Sie besaß mehrere große Häuser, alle mit Dienerschaft. Und sie hatte eine wilde blonde Mähne, die überhaupt nicht zu ihrem dunklen Typ paßte und so schwungvoll nach hinten flog, daß man sich unwillkürlich fragte, ob wohl gerade ein Hurrikan aufgezogen war. Auch ihre großen Brüste hüpften recht schwungvoll – diese Frau jagte Gervaise schlicht und einfach Angst ein. Doch er mochte ihren Sohn, ein furchtsames, intelligentes Kind, das stotterte und stets einen gehetzten Ausdruck zeigte; der Junge tat ihm von Herzen leid. Nur wegen Rowan nahm er die Einladung an, mit Irina Goldberg in ihrem Haus zu Abend zu essen.
Auf der Einladung hatte »Dunkle Krawatte« gestanden. Begierig, mehr über den Hintergrund des Jungen herauszufinden, war Gervaise nach London gefahren. Er freute sich auf ein gutes Essen, guten Wein, denn er war in gewissem Maße ein Kenner; die anderen Gäste würden ihn wohl kaum interessieren.
Das Essen war wunderbar, dazu gab es Champagner. Das Problem war nur, daß es keine anderen Gäste gab.
Mrs. Goldberg trug einen sehr offenherzigen Hausanzug, der Gervaise von Anfang an einiges Unbehagen bereitete, das sich zu reiner Panik ausweitete, je weiter der Abend fortschritt. Er hatte während der ersten drei Gänge viel zu nahe bei Mrs. Goldbergs bedrohlichem Busen und ihrem betäubenden Moschusduft sitzen müssen; Verzweiflung stand in seinem Blick, als er ihr zu erklären versuchte, daß er früh wieder aufbrechen müsse. Der philippinische Diener, der ihm geöffnet hatte, war nirgendwo zu sehen, und als seine Gastgeberin in der Küche verschwand, um den Nachtisch vorzubereiten, wie sie sagte, fragte er sich, wieviel kalorienreiches Essen er wohl noch würde bewältigen müssen. Doch als sie zurückkehrte und er sah, daß sie nicht nur diesen verwirrenden Hausanzug ausgezogen hatte, sondern nun nichts Verhüllenderes mehr trug als eine Glasschale mit Pralinen, fand er, daß endgültig der Zeitpunkt für einen hastigen Rückzug gekommen sei. Noch nie hatte sein alter Wagen die Strecke nach Winsleyhurst in so kurzer Zeit zurückgelegt.
Pamela hatte die Diskussion noch nicht abgeschlossen. »Und wie viele Eltern erkundigen sich, ob Sie verheiratet sind, wenn sie sich einen Eindruck von der Schule verschaffen wollen?« beharrte sie.
»Nun, etliche«, gab Gervaise zu. »Aber schließlich ist ja Douglas verheiratet.«
Douglas Butler war Senior Master und bei den Jungen wenig beliebt, weil auf strengster Disziplin bestand.
»Ich bitte Douglas und Betty oft dazu, damit sie neue Eltern kennenlernen. Ich glaube nicht, daß es so entscheidend ist, ob ich verheiratet bin oder nicht, und ich versichere den Müttern immer wieder, daß es genug weiblichen Einfluß an unserer Schule gibt.«
Er sprach jedoch nicht aus, daß er sich sehr wohl bewußt war, daß der ehrgeizige Douglas seine unscheinbare Frau absichtlich in den Vordergrund schob. Douglas hatte sich schon mehrere Male um einen Posten als Schuldirektor beworben, war aber niemals angenommen worden und hatte sich nun etwas anderes ausgedacht. Da Winsleyhurst nicht länger im Privatbesitz der Familie Henderson war, könnte es ihm gelingen, irgendwann stellvertretender Direktor zu werden – und Gervaise allmählich die Zügel aus der Hand zu nehmen.
»Betty!« Lady Boynton schnaubte verächtlich. »Statt die Leute zu beruhigen, schreckt sie sie eher ab! Der traut doch niemand zu, daß sie mit kleinen Jungs fertig wird!«
»Nun«, begann Gervaise, »ich trage mich in der Tat mit dem Gedanken zu heiraten, aber da ich das als meine Privatangelegenheit betrachte, werde ich meine Pläne nicht mit diesem Ausschuß diskutieren.«
Er stellte fest, daß er sie damit überrascht und sehr geschickt eine unangenehme Klippe umschifft hatte – obwohl niemand über seine Bemerkung erstaunter hätte sein können als er selbst. Er war ungemein zufrieden mit sich selbst, daß es ihm so leicht gelungen war, Pamela auszutricksen.
Und dann hatte er eine Erleuchtung. Es gab eine Frau in seinem Leben, die nicht nur eine wunderbare Gattin für einen Schuldirektor wäre, sondern die er auch noch sehr gern hatte. Es war eine so geniale Idee, daß er sich wunderte, wieso er nicht schon früher darauf gekommen war.
Erst viel später begann er sich zu fragen, worauf er sich da wohl eingelassen haben mochte. Pamela würde nicht zulassen, daß dieses Thema in Vergessenheit geriet, auch wenn sie es im Moment nicht für angebracht hielt, ihn mit weiteren Fragen zu bedrängen. Die Ausschußmitglieder fuhren mit ihrer Arbeit fort, und Gervaise willigte ein, Meg auszuhorchen, ob sie gern die Verantwortung für einen Mädchenflügel übernehmen würde. Doch natürlich waren sie alle nicht mehr in der Lage, sich richtig zu konzentrieren. Die Neugier machte sie unruhig, und sobald das Treffen beendet war, wurden die ersten Theorien ausgetauscht. Gervaise wäre erstaunt gewesen, wenn er gehört hätte, daß auch die Namen einiger Mütter seiner Schüler ins Spiel gebracht wurden, Irina Goldberg befand sich jedoch nicht unter den Aspiranten für das Rennen zum Traualtar.
»Wer um Himmels willen kann es denn nur sein?« fragte Pamela Boynton ihren Mann, als sie an diesem Abend wie ein Wal in ihrer Badewanne lag. Außer ihr hatte nicht viel anderes Platz darin, was sich enorm günstig auf den Warmwasserverbrauch auswirkte.
»Meg vielleicht?« meinte Sir Lance. »Ich hatte schon immer den Eindruck, daß sie für unseren guten alten Gervaise schwärmt. Sie ist wirklich nett, und sie wäre die ideale Frau für ihn. Aber er hat verdammt lange gebraucht, um sie zu bemerken. Ich hatte schon Angst, er würde es niemals tun.«
»Ja, natürlich! Meg! Wie klug von dir, Lance! Warum bin ich denn nicht von selbst darauf gekommen? Ich werde sie gleich am Sonntag beide zum Mittagessen einladen, damit wir das Ganze ein bißchen beschleunigen können.« Sie packte den Griff und hievte sich hoch, wobei das Wasser aus der Wanne schwappte.
»Oh, an deiner Stelle würde ich noch warten, Liebes«, erwiderte Sir Lance, amüsiert von der Begeisterung seiner Frau und ihrem Mangel an Sensibilität. »Warum lassen wir sie nicht in dem Glauben, wir würden uns nicht einmischen?«
»Du hast vollkommen recht – wie immer. Ich werde mich nur dann einmischen, wenn sie zu lange herumtrödeln. Das kann ich nicht leiden. Aber was für eine Erleichterung! Es wird ein Vergnügen sein, mit Meg zusammenzuarbeiten, ich bin sicher, daß wir in allen Dingen übereinstimmen werden. Ich bin wirklich froh, daß ich den anderen erlaubt habe, mich dazu zu überreden, diesen Job als Vorsitzende anzunehmen!«
Sir Lance blickte seine Frau voller Zuneigung an, als sie ein wenig später die Treppe nach unten gingen, um einen der kostbaren, seltenen Abende zu zweit zu genießen.
Kapitel 3
Verzweifelt hatte Flavia sich auf dem alten Sofa im früheren Kinderzimmer zusammengerollt. Es wurde allmählich kühl, aber sie konnte sich einfach nicht aufraffen, einen Holzscheit aufs Feuer zu legen.
Jenes katastrophale Konzert lag nun schon drei Monate zurück. An schlimmen Tagen wie diesen fragte sie sich, ob sie selbst dann nicht den Versuch machen würde, sich zu retten, wenn die Decke auf sie herabstürzte. Sie sah sich selbst daliegen, unter Schutt gefangen, wie immer mehr Staub herabrieselte, bis sie vollkommen bedeckt und aller Sicht entzogen war. Nach einem Konzert in der Wigmore Hall hatte einmal ein Kritiker ihre »ansteckende Lebensfreude« beschrieben, und Flavia fragte sich nun düster, wohin diese wohl verschwunden sein mochte. Ich löse mich auf, dachte sie. Wenn ich mich nicht bald zusammenreiße und etwas unternehme, werde ich unsichtbar werden. Ein kleiner Funke von Widerstand blitzte in ihr auf.
Nicht ein einziges Mal hatte Antoine sie im Krankenhaus besucht. Jeden Tag hatte sie fest daran geglaubt, daß er endlich kommen würde. Jetzt wo feststand, daß sie eine Herzbeutelentzündung bedingt durch eine Lungenentzündung, hatte, konnte er ihr doch keine Vorwürfe mehr machen?
Freunde und Verwandte hatten sie besucht – Tricia natürlich, aber auch frühere Kommilitonen. Daß auch Jim Barnard sie besuchte, hatte Flavia gerührt. Er hatte eine Karte mitgebracht, auf der sämtliche Mitglieder des Orchesters unterschrieben hatten; sie alle machten sich Sorgen um sie und verurteilten die Art und Weise, wie ihr Dirigent sie behandelt hatte. Selbst Freunde ihrer Eltern wie Gervaise Henderson und etliche andere, die sie niemals erwartet hätte, kamen zu Besuch. Die Stationsschwester fürchtete, der ganze Rummel wäre zuviel für sie; sie sagte, daß sie viel zu viele Besucher hätte, und scheuchte sie alle aus dem Zimmer. Nur der eine, nach dem sie sich so sehnte, ließ sich nicht blicken.
»Seid ihr sicher, daß er weiß, daß ich noch hier bin – habt ihr es ihm gesagt?« fragte sie immer wieder. Nachdem Maurice Fenstein, ihr Agent, eine Mitteilung an die Presse gegeben hatte, erhielt sie unzählige Genesungswünsche und Blumensträuße.
Etliche mitfühlende Artikel waren in den Zeitungen erschienen. »Flötistin Flavia Cameron – Zusammenbruch nach dem Konzert« – so lautete eine Schlagzeile, »Brillante junge Musikerin vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht« eine andere. Maurice, der einer der besten Agenten in London war, meinte, daß die Reaktion der Presse hilfreich bei der Schadensbegrenzung wäre. Er und seine Frau Ina beteten Flavia an, sie war für sie die Tochter, die sie nie gehabt hatten. Er versuchte ihr Mut für die Zukunft zu machen.
»Wenn du wieder gesund bist, veranstalten wir einen Riesenwirbel um dein Comeback«, sagte er, doch als sie versuchte, ihn auf Antoine anzusprechen, wandte er unbehaglich den Blick ab. Antoine sei ungeheuer damit beschäftigt, seine Amerikatournee vorzubereiten, außerdem hätte er überraschend zu einem Treffen nach Frankreich reisen müssen. Natürlich mache er sich Sorgen um sie und würde sich sicherlich bald bei ihr melden. Maurice war schon seit längerer Zeit Antoines Agent, und anfangs hatte er sich nur seinetwegen um Flavia gekümmert. Wenn auch widerstrebend: Immer wieder fragten ihn die Top-Künstler, vor allem die Dirigenten, ob er nicht auch ihre jeweilige Geliebte unter seine Fittiche nehmen könne, und da dies fast immer katastrophal endete, hatte Maurice gelernt, nein zu sagen. Natürlich kannte er Flavia durch ihre berühmte Patin, Dulcie Norman, doch als er sie zum ersten Mal hatte spielen hören, hatte er erkannt, daß sie über jenes gewisse Etwas verfügte, was sie aus der Menge heraushob. Maurice war ziemlich wütend auf Antoine, und Ina hatte erklärt, daß sie ihn nicht mehr in ihrem Haus sehen wollte.
Ein üppiges Blumenbouquet hatte Flavia vorübergehend neue Hoffnung geschenkt.
»Sieh mal einer an, das ist von Antoine«, hatte Tricia gesagt, die gerade bei ihr war, als es abgeliefert wurde. »Wurde aber auch langsam Zeit! – ›Beste Wünsche für eine baldige Genesung. Alles Liebe, Antoine‹« las sie dann vor und hielt Flavia die Karte hin.
»Das ist nicht seine Schrift.«
»Dann hat er den Auftrag eben telefonisch bei Fleurop durchgegeben.«
»Das ist die Schrift von Dan, dem Orchestermanager. Antoine muß es ihm diktiert haben«, flüsterte Flavia. »Wie konnte er nur?« Dann zerriß sie die Karte in kleine Fetzen und bat Tricia, die Blumen auf den Gang hinauszustellen.
Anfangs war es ihr so schlecht gegangen, und sie hatte so starke Schmerzmittel nehmen müssen, daß sie überhaupt nicht darüber nachgedacht hatte, welche Auswirkungen ihre Krankheit auf ihre Karriere haben könnte. Und nun war sie seit einigen Wochen zur Erholung zu Hause und hatte zuviel Zeit zum Nachdenken. Sie hatte zweimal mit Antoine telefoniert – kalte, unpersönliche Gespräche. Er hatte sich so unbeteiligt nach ihrem Gesundheitszustand erkundigt, als wäre sie nicht mehr als eine flüchtige Bekanntschaft.
»Aber wann werden wir uns wiedersehen, Antoine?« hatte sie verzweifelt gefragt, doch er hatte Ausflüchte gemacht. Er würde bald zu einigen Gastauftritten in die Staaten reisen, aber sie würden in Verbindung bleiben, alles hinge davon ab, wie es ihr ging.
»Aber weißt du denn nicht, daß es nicht meine Schuld war? Hast du mir denn immer noch nicht verziehen?«
»Natürlich, natürlich. Dumm, aber solche Dinge passieren eben. Du wirst dich erholen. Ich rufe dich an«, hatte er versprochen – und es nicht getan.
Ihre Mutter drängte sie, auf die Bühne zurückzukehren, obwohl Professor Gibson sie gewarnt hatte, nichts zu überstürzen. Er hatte ihr versichert, daß sie wieder vollkommen gesund werden würde – aber das würde seine Zeit dauern. Und auch Maurice hatte bestätigt, daß es aus künstlerischer Sicht ein schlimmer Fehler wäre, wenn sie auf die Bühne zurückkehrte, ohne wirklich dazu bereit zu sein. Die Kritiker wären nur einmal bereit zu vergeben, bei ihrem nächsten Konzert mußte sie überragend sein.
Obwohl Matt ihr den Rücken stärkte, wäre sie der unausweichlichen Konfrontation mit ihrer Mutter am liebsten aus dem Weg gegangen. Wie sollte sie jemandem, der Antoine so verabscheute wie ihre Mutter, erklären, daß ihr Spiel in ihrer Vorstellung so eng mit Antoine verquickt war, daß sie es nicht ertragen konnte, das eine ohne das andere zu haben? Es war ein schreckliches Gefühl, sich hier in ihrem Zuhause, das sie immer geliebt hatte, wie in einer Falle vorzukommen; eine Falle schien ihr auch die Karriere, die ihr vorbestimmt war, seit sie ein kleines Mädchen gewesen war.
Ihre Lieblingsflöte, eine Louis Lot, lag in ihrem Kasten oben auf dem Klavier. Bis jetzt war sie Flavias größte Freude gewesen, das Spiel darauf einzigartig. Sie sehnte sich unendlich danach, dieses Glück wieder einzufangen, erneut zu empfinden.
»Flavia? Flavia? Bist du dort oben?« rief ihre Mutter, dann hörte Flavia jemanden die Treppe herauflaufen. Die Tür wurde aufgestoßen, das Licht eingeschaltet.
»Es ist ja eiskalt hier drin! Ich kann es nicht ertragen, wenn du so trübsinnig hier oben in der Dunkelheit sitzt – du solltest schön warm verpackt in deinem Bett liegen. Hast du wieder schlimme Schmerzen?«
»Nein, Mum. Danke – mir geht es gut.«
»Dir kann es nicht gutgehen. Kein Wunder, daß du dich schrecklich fühlst, wenn du hier oben im Dunklen sitzt.«
»Laß mich allein, Mum. Bitte!«
»Ich habe dich allein gelassen, aber ich glaube nicht, daß du dich auch nur einen Zentimeter von diesem Sofa bewegt hast, seit ich zum letzten Mal nach dir geschaut habe. Wirst du zum Tee herunterkommen? Bist du schon mit Fudge spazierengegangen?«
»Nein und nein.« Flavia verdrehte die Augen.
»Du wirst nicht gesund werden, wenn du frierst und hungerst. Hör zu, Gervaise kommt heute zum Abendessen. Er will mit deinem Vater ein schulisches Problem besprechen und dann mit ihm Schach spielen. Soll ich dir das Abendessen ans Bett bringen?«
»O nein, ich liebe Swerve. Ich werde runterkommen. Arme Mum – du hast schon genug Tabletts für mich geschleppt.« Flavia streckte versöhnlich eine Hand nach ihrer Mutter aus.
»Du weißt, daß es mir nichts ausmacht, solange es dir hilft. Was ich überhaupt nicht ausstehen kann, ist dieses ewige Grübeln.« Hester Cameron sprach Antoines Namen nicht aus, dieses Thema war zwischen ihnen tabu. Geschäftig lief sie durch den Raum, zog die Vorhänge zu, klopfte Kissen auf, legte Holz im Kaminfeuer nach.
»Okay, okay. Tut mir leid, Mum.« Flavia richtete sich widerstrebend auf, schob die Labradorhündin, die auf ihr gelegen hatte, vom Sofa. »Ich werde jetzt mit Fudge rausgehen.« Und schon lief sie die Treppe hinunter, gefolgt von Fudge, die ebenfalls nicht sonderlich begeistert wirkte. Begeisterung zeigte die Hündin nur, wenn sie allein zu ihrer morgendlichen Forschungsexpedition zu den Mülltonnen bei den Wohnhäusern der Jungen aufbrach. Das Leben an einer Privatschule war für eine gefräßige Hündin das Paradies, und Fudge bei ihrer täglichen Mülltonnen-Runde war allen ein vertrauter Anblick.
Hester hätte vor lauter Frust schreien können, und sie wünschte, sie hätte niemals vom Spazierengehen gesprochen. Sie rannte den beiden hinterher. »Doch nicht jetzt, Flavia! Jetzt ist es doch schon zu spät. Du wirst dich erkälten!« Aber Flavia war schon fort.
Ihre Mutter war mit ihrer Weisheit am Ende. Sie hatte immer geglaubt, daß sie und ihre Tochter sich ganz besonders nahe stünden – bis dieser Antoine du Fosset aufgetaucht war und Flavia mit Haut und Haaren verschlungen hatte. Flavia, ihr kostbares Wunderkind, auf das sie so stolz war, war in letzter Zeit nicht nur beängstigend still, sie schien sich auch auf eine ganz subtile Weise zu verändern. Es war, als befände sich eine Nebelwand zwischen ihnen. Meistens war Flavia so freundlich wie immer, der kleine Ausbruch eben war völlig untypisch für sie. Hester hatte sich immer für begünstigt gehalten, wenn andere Eltern sich über ihre Töchter beklagten. »Natürlich habe ich Glück«, pflegte sie zu sagen. »Flavia und ich sind uns so nahe – sie erzählt mir alles.« Und sie hatte tatsächlich geglaubt, daß das stimmte.
Der Professor hatte ihr gesagt, daß Flavia ihre Karriere für mindestens sechs Monate vergessen und statt dessen einfach Spaß haben sollte. Spaß! Diese Ärzte hatten keine Ahnung, wie wichtig regelmäßiges Üben für einen Musiker war, man konnte die Musik nicht einfach beiseite legen wie eine Stickarbeit und sie erst dann wieder zur Hand nehmen, wenn man Lust dazu hatte. Aber Flavia schien im Moment eh zu nichts in der Lage zu sein, weder dazu, Freude zu empfinden, noch zu ernsthafter Arbeit.
Hester hatte sogar Karten für ein Konzert besorgt, in der Hoffnung, daß es Flavia anspornen würde, wenn sie wieder eine gute Aufführung hören würde. Andrew hatte seine Frau zwar gewarnt und ihr gesagt, daß er dies für einen Fehler hielte, aber Hester hatte nicht hören wollen. Schließlich hatte Flavia sich nicht wohl genug gefühlt, um mitzukommen, und so war Hester gezwungen gewesen, die Frau eines der Hausvorsteher mitzunehmen, damit die Karte nicht verfiel.
Nachdem ihre Mutter an jenem Abend nach London aufgebrochen war – nicht ohne eine Flut von Instruktionen zu hinterlassen – hatte Flavia einen glücklichen Abend verbracht: Sie hatte mit ihrem Vater Kreuzworträtsel gelöst und mit Matt Ding-Bats gespielt, der ausnahmsweise einmal am Wochenende zu Hause war. Sie hatten viel gelacht und sich über Albernheiten amüsiert, und schließlich hatten sie sich eine Mahlzeit zubereitet und vor dem Kamin gegessen. Erst hinterher war Flavia aufgefallen, daß sie an diesem Abend nicht einmal an Antoine gedacht hatte. Merkwürdig, daß sie früher nicht bemerkt hatte, wie wenig sie und Antoine gemeinsam lachten.
Als sie nun nach der alten Schaffelljacke griff, die allgemeines Familieneigentum war, und nach draußen ging, dachte sie wieder über diesen Abend nach. Matt war stets ihr bester Kumpel und ihr Beschützer gewesen, ihr engster Vertrauter. Sosehr sie Di auch mochte, es war schön gewesen, ihn wieder einmal ganz allein für sich zu haben. Matt ließ sich mit glücklicher Lässigkeit durchs Leben treiben, womit er seine Mutter in den Wahnsinn trieb, doch trotz all ihrer düsteren Prophezeiungen hatte er bisher jedes Examen ohne größere Anstrengung bestanden.
»Laß dich nicht von Mum unterkriegen«, hatte er gesagt. »Wenn du barfuß am Strand tanzen willst, dann tu’s. Vielleicht werde ich eine wissenschaftliche Arbeit über dich verfassen, und später werden Ärzte einmal auf meine erstaunlichen Forschungsergebnisse zum Flavia-Syndrom zurückgreifen, wenn sie mit dem Problem der Wunderkinder und ihren herrschsüchtigen Müttern konfrontiert werden. Wahrscheinlich wirst du durch meine Arbeit berühmter, als wenn du mit deiner Flöte auf der Bühne stehst. Mein Professor findet, daß du dich gut erholst. Natürlich hat er sich in dich verliebt.«
Er verschwieg Flavia jedoch, daß Professor Gibson gefragt hatte: »Sind eigentlich Krankheiten in der Welt ihrer Mutter nicht erlaubt?« Und Matt hatte geantwortet: »Doch, schon, sie pflegt einen sogar voller Hingabe – aber nur, wenn man verdammt schnell wieder gesund wird!«
Matt hatte Flavia aufgeheitert – die meisten Leute fühlten sich besser, wenn sie mit ihm zusammen waren. Er hatte sie noch einmal ganz fest umarmt, bevor er in seinem klapprigen Wagen zurück nach London gefahren war, der offensichtlich nur noch durch Draht zusammengehalten wurde und einen Lärm wie ein Betonmischer machte.
»Dir wird es schon bald wieder viel besser gehen, das verspreche ich dir«, rief er noch einmal über den Krach hinweg und drückte auf die verbotene Hupe, die sich anhörte, als wäre eine Jagd in vollem Gange.
Als sie das letzte Mal bei Dr. Barlow gewesen war, ihrem Hausarzt, hatte sie ihn gefragt: »Glauben Sie, daß ich schneller gesund werden könnte, wenn ich mich mehr anstrenge? Mum war wunderbar, als ich richtig krank war. Aber jetzt glaubt sie insgeheim, daß ich mich nur anstelle, obwohl Matt ihr immer wieder sagt, daß ich mehr Zeit brauche.«
»Braver Matt. Er wird eines Tages ein hervorragender Arzt werden. Er hat ein feines Empfinden fürs Gleichgewicht.«
»Gleichgewicht? Macht das einen guten Arzt aus?« Flavia sah im Geiste Dr. Barlow vor sich, wie er in Ballettschuhen über ein schmales Hochseil balancierte.
Er betrachtete sie amüsiert über den Rand seiner Brille. »Das ganze Leben ist eine Frage des richtigen Gleichgewichts. Dein Vater hat es, deshalb ist er auch ein guter Direktor. Deine Mutter hat es nicht, auch wenn ich das vielleicht nicht sagen sollte. Die Frage ist – wie sieht es bei dir aus? Ist dein Leben aus dem Gleichgewicht geraten?«
Schweigend saß Flavia da, blickte aus dem Fenster.
»Ich möchte ja gesund werden, wirklich.«
»Natürlich möchtest du es, und du wirst es auch. Es kann schreckliche Mühe bedeuten, einen solchen Virus loszuwerden, aber wenn jemand in deinem Alter und mit deiner Konstitution so umgehauen wird, dann, denke ich, sollte man schon fragen, ob dein Körper dir nicht etwas sagen will. Was läuft falsch in deinem Leben? Ist dir alles zuviel geworden? Brauchst du eine Veränderung?«
»Vielleicht.«
»All dieser Druck, diese Konzerte – willst du das wirklich? Könntest du dir ein Leben ohne die Musik vorstellen?«
»O nein, nicht ohne Musik, dann würde ich sterben. Ich brauche sie wie die Luft zum Atmen. Ich würde gern Kammermusik machen, meine Freude mit anderen teilen, es soll einfach Spaß machen, und vielleicht könnte ich sogar unterrichten – wahrscheinlich bin ich nicht umsonst die Tochter meines Vaters, aber wenn ich ehrlich bin ...« Ihre Stimme erstarb, und Flavia schien plötzlich von Angst erfüllt.
»Sprich weiter, Flavia.«
»Im Moment ist die Vorstellung, wieder als Solistin bei einem Konzert aufzutreten, einfach nur Horror für mich. Ich habe nicht mehr den Mut dazu. Talent allein genügt ja nicht, man muß auch über die Hingabe verfügen, und ich will jetzt nicht. Aber Mum kann das nicht akzeptieren. Bei ihr muß man immer der Beste sein. Ich glaube nicht, daß ihre eigene Musik ihr wirklich Freude bereitet. Ihre Schüler tun mir echt leid. Sie haßt sie fast alle.« Sie bemühte sich, ihre Stimme unter Kontrolle zu behalten, während der Arzt ihr schweigend zuhörte und ihren Gesichtsausdruck studierte.
»Früher habe ich es geliebt, als Solistin aufzutreten, nicht nur wegen dem Applaus und der Begeisterung der anderen. Man ist dabei so völlig eins mit sich selbst – man ist in der Lage, mit den Menschen auf einer viel tieferen Ebene als der Sprache zu kommunizieren. Es ist ein phantastisches Gefühl. Aber nachdem ich den Jugendmusikwettbewerb gewonnen hatte, wurde der Druck allmählich immer größer. Und Mum biß sich richtig fest, trieb mich immer weiter an. Ein Konzert folgte dem anderen, noch ein Wettbewerb und dann noch ein weiterer. Erst als ich Antoine du Fosset traf, konnte ich wieder ein bißchen Atem schöpfen. Seitdem war mein Leben einfach traumhaft.« Wieder schwieg sie, und Dr. Barlow hatte das Gefühl, daß er gerade Zeuge eines fürchterlichen inneren Kampfes war.
»Ich denke, daß Sie von Antoine gehört haben.« Ihre Stimme war kaum hörbar. »Nun, er hat mich fallenlassen. Mum meint, wenn ich nicht bald wieder auftrete, dann werde ich es nie mehr tun. Es ist so hart für Mum, wegen ihres Unfalls. Sie weiß, das mir das gelingen kann, was ihr versagt geblieben ist. Und ich kann sie doch nicht einfach im Stich lassen.«
»Hm.« Dr. Barlow klopfte mit dem Stift auf seinen Schreibtisch. »Du kannst nicht das Leben deiner Mutter für sie leben, Flavia. Nur weil sie ihre Karriere nicht weiterverfolgen konnte, heißt das doch nicht, daß du um jeden Preis Erfolg haben mußt. Leb dein eigenes Leben. Sei ganz du selbst. Wenn du nicht so weitermachen willst, dann sag es deiner Mutter. Du mußt es. Dein Vater wird hinter dir stehen, egal, wie du dich entscheidest, das weiß ich. Was machen eigentlich die Schmerzen in deiner Brust?«
»Die sind viel besser geworden, ich spüre sie nur noch, wenn ich müde werde oder wenn ich mich vorbeuge.« Sie sagte nicht, daß es eher der Schmerz in ihrem Herzen war, der nicht heilen wollte.
Dr. Barlow stand auf und legte ihr einen Arm um die schmalen Schultern. Er mochte die ganze Familie, aber Flavia hatte er ganz besonders ins Herz geschlossen. Es tat ihm weh, mitansehen zu müssen, wie zerbrechlich und gehetzt sie wirkte.
»Kopf hoch!« sagte er. »Finde dein inneres Gleichgewicht wieder, vergiß das nicht.« Während all der vielen Jahre hatte er immer wieder heftige Zusammenstöße mit ihrer Mutter gehabt, und er war sicher, wenn Flavia sich gegen ihre dominante Mutter durchsetzen würde, dann wäre dies der erste Schritt zu ihrer wirklichen Heilung. Er glaubte auch, daß Flavia über viel mehr Stärke verfügte, als die meisten Leute, einschließlich sie selbst, ihr zutrauten. In manchen Bereichen war sie so beschützt, in anderen so vorangetrieben worden, daß er sie unwillkürlich mit einer zu gutgewässerten Pflanze verglich, die wegen zuviel Aufmerksamkeit welkte.
Die Gebäude rochen nach feuchtem Stein. Im Sommer war es innen stets kühl, doch nun strahlten sie Kälte aus. Die riesigen alten Platanen, die die Sportplätze begrenzten, strömten den Geruch des Herbstes aus. Flavia und Fudge gingen hinunter zu dem schmalen Pfad, der am Fluß entlangführte. Im Sommer wären sie hier immer wieder Schülern und Lehrern auf Fahrrädern begegnet, die nicht darauf achteten, wohin sie fuhren, weil sie über ihre Megaphone den Rudermannschaften Anweisungen zubrüllten, doch nun war der Weg verlassen. Der Himmel war schon dunkel geworden, nur am Horizont war noch ein schmaler Streifen Rosa. Ein Hauch von Frost hing in der Luft, der bald die Blätter von den Bäumen holen würde.
Flavia ging bis zu der alten hölzernen Brücke, die den Fluß überspannte. Als Kinder hatten sie hier immer Zweige ins Wasser geworfen, waren dann am Ufer entlanggerannt und hatten beobachtet, wie sie von der Strömung davongetragen wurden. Flavia beugte sich vor und warf einen kleinen Ast ins Wasser, aber es war schon zu dunkel, um ihm mit dem Blick zu folgen, bald schon war er außer Sicht.
Ich werde den rechten Moment abwarten, dachte sie, und dann werde ich Mum sagen, daß ich nicht mehr als Solistin auftreten will. Ich werde es aufgeben. Dann sagte sie diese Worte laut vor sich hin, schrie sie zum Himmel hinauf, stellte sich vor, daß sie ihrem Entschluß damit Kraft gab und ihrem Leben eine Wende, und plötzlich fühlte sie, wie neue Energie ihren Körper durchströmte.
Als sie zurückkam, durchzog ein appetitlicher Duft das Haus. Hester kochte Tomatensoße.
»Oh, gut – es gibt Pasta zum Abendessen.« Sie hatte überhaupt keinen Hunger, aber sie dachte, daß ihre Mutter sich freuen würde, wenn sie glaubte, ihr Appetit sei zurückgekehrt. Hester kochte mit derselben Disziplin, mit der sie alle Hausarbeiten erledigte, und die Spaghetti Bolognese würden schmecken – gut, aber nicht sensationell. Bei Hester gab es weder kulinarische Triumphe noch irgendwelche Katastrophen, Leidenschaft empfand sie nur für Musik und die Erfolge ihrer Familie.
Flavia, die ein gutes Stück größer war als ihre Mutter, stellte sich hinter sie, lehnte ihr Kinn auf ihren Kopf und schlang die Arme um Hester.
»Kann ich dir helfen, Mum?«
Hester schüttelte sie ab. Sie ließ sich niemals helfen, zog es vor, die Bürde ihrer Pflichten allein zu tragen.
»Nein danke, ich habe schon alles vorbereitet. Gervaise ist schon da, aber dein Vater noch nicht. Wenn du möchtest, kannst du ihm Gesellschaft leisten – oder falls du dich plötzlich viel besser fühlen solltest, könntest du auch ein halbes Stündchen üben.« Sie schüttelte heftig die Pfanne, damit die Minzsoße nicht anbrannte.
»Mum, liebe Mum, ich möchte dir etwas sagen!«
»Ja?« Das klang nicht sehr ermutigend.
Flavia atmete einmal tief durch. »Ich habe nachgedacht.«
»Nun, dazu hattest du ja auch reichlich Zeit.«
»Ich habe beschlossen, die Musik aufzugeben – ich meine, ich will keine Solistin mehr sein.«
»Mach dich nicht lächerlich, Flavia. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, daß irgend jemand zuließe, daß du eine solche Entscheidung triffst!«
»Ich weiß, daß es schlimm für dich ist. Es tut mir wirklich leid. Aber ich werde meine Meinung nicht ändern. Versuch doch bitte, mich zu verstehen.«
»O ja, ich verstehe sehr gut«, erwiderte Hester, wobei sie die Soße fast erschlug. »Das ist alles nur die Schuld dieses verdammten Mannes. Das werde ich ihm nie verzeihen – niemals. Ich werde mit Dr. Barlow über dich reden, und er wird mir bestätigen, daß du überhaupt nicht in der Lage bist, eine solche Entscheidung zu treffen. Hör auf, an der Petersilie zu zupfen, Flavia.«
»Dr. Barlow findet, daß ich recht habe«, erwiderte Flavia, während sie ein paar Petersilienblättchen kaute.
»Dr. Barlow hat keine Ahnung von Musik.« Hester wechselte ihre Taktik.
»Aber er kennt mich.«
»Und ich kenne dich nicht, oder was?« fuhr ihre Mutter sie an. Sie schien gleich platzen zu wollen.
»Du hast dir nie vorstellen können, daß ich jemals etwas anderes machen würde, aber ich möchte andere Sachen ausprobieren.«
»Und was zum Beispiel?«
»Das weiß ich noch nicht.« Flavia wußte, daß sie sich auf schwankendem Grund bewegte. »Ich werde einfach abwarten, was sich anbietet. Bitte, Mum, schau mich nicht so an!«
»Und wie soll ich dich sonst anschauen?« fragte Hester. »Ich habe Jahre damit verbracht, dich dabei zu unterstützen, das zu erreichen, von dem ich weiß, daß du es erreichen kannst – und kaum geht etwas schief, schmeißt du alles hin. Okay, du hast eine erbärmliche Vorstellung gegeben. Aber du warst krank. Das wissen inzwischen alle. Ein so großes Talent ist eine heilige Gabe, nichts, dessen man sich einfach entledigen könnte.« Sie begann die gespülten Töpfe mit einer solchen Geschwindigkeit einzuräumen, daß es aussah, als würden sie vor lauter Angst von ganz allein zurück in die Schränke springen.