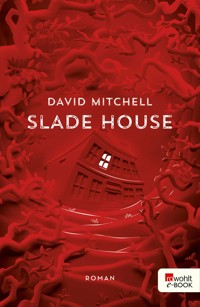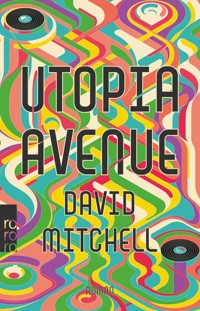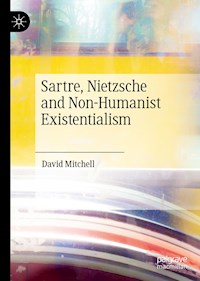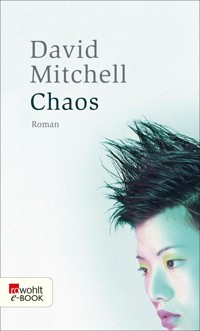9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Ein Schmöker für das 21. Jahrhundert» (DIE WELT) – vom Autor des Weltbestsellers Der Wolkenatlas Ein junger holländischer Kaufmann kommt 1799 nach Dejima, dem einzigen europäischen Handelsposten im hermetisch abgeriegelten Japan. Auf der von Geschäftemachern und zwielichtigen Gestalten bevölkerten künstlichen Insel hofft er, sein Glück zu machen. Durch die Liebe zu einer Japanerin eröffnet sich Jacob de Zoet unversehens eine geheimnisvolle Welt und zeigt ihre Schönheiten. Doch das fremde Land hält auch Schrecken bereit, Verrat, Intrige und Mord ... «David Mitchell gehört zu den besten englischen Romanautoren der Gegenwart.» (Die Zeit) «David Mitchell legt hier seinen bislang mitreißendsten Roman vor ... Ein berührender Schluss unterstreicht seine Meisterschaft nicht nur in Sachen literarisches Feuerwerk, sondern auch in den leiseren Künsten der Einfühlung und des traditionellen Erzählens.» (The New York Times) «Ein literarischer Reisetraum und eine sprachliche Orgie.» (Der Spiegel) «Eine prächtige historische Wunderkammer.» (die tageszeitung)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 838
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
David Mitchell
Die tausend Herbste des Jacob de Zoet
Roman
Über dieses Buch
«Ein Schmöker für das 21. Jahrhundert» (DIE WELT) – vom Autor des Weltbestsellers Der Wolkenatlas
Ein junger holländischer Kaufmann kommt 1799 nach Dejima, dem einzigen europäischen Handelsposten im hermetisch abgeriegelten Japan. Auf der von Geschäftemachern und zwielichtigen Gestalten bevölkerten künstlichen Insel hofft er, sein Glück zu machen. Durch die Liebe zu einer Japanerin eröffnet sich Jacob de Zoet unversehens eine geheimnisvolle Welt und zeigt ihre Schönheiten. Doch das fremde Land hält auch Schrecken bereit, Verrat, Intrige und Mord ...
«David Mitchell gehört zu den besten englischen Romanautoren der Gegenwart.» (Die Zeit)
«David Mitchell legt hier seinen bislang mitreißendsten Roman vor ... Ein berührender Schluss unterstreicht seine Meisterschaft nicht nur in Sachen literarisches Feuerwerk, sondern auch in den leiseren Künsten der Einfühlung und des traditionellen Erzählens.» (The New York Times)
«Ein literarischer Reisetraum und eine sprachliche Orgie.» (Der Spiegel)
«Eine prächtige historische Wunderkammer.» (die tageszeitung)
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel «The Thousand Autumns of Jacob de Zoet» bei Hodder & Stoughton, London.
Redaktion Mirjam Madlung
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juni 2014
Copyright © 2012 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«The Thousand Autumns of Jacob de Zoet» Copyright © 2010 by David Mitchell
Umschlaggestaltung ANZINGER WÜSCHNER RASP, München
nach dem Original von Sceptre/Hodder & Stoughton, UK
(Umschlagabbildung: Joe Wilson at début art)
All Rights Reserved.
ISBN 978-3-644-04471-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Anmerkung des Autors
TEIL 1 Die Braut, für die wir tanzen
I Das Haus von Kawasemi der Konkubine, oberhalb von Nagasaki
II Kapitän Lacys Kajüte auf der Shenandoah, vor Anker im Hafen von Nagasaki
III Auf einem Sampan, festgemacht neben der Shenandoah, Hafen von Nagasaki
IV Beim Abtritt neben dem Gartenhaus auf Dejima
V Speicher Doorn auf Dejima
VI Jacobs Zimmer im Großen Haus auf Dejima
VII Großes Haus auf Dejima
VIII Das Empfangszimmer im Haus des Faktors auf Dejima
IX Sekretär de Zoets Unterkunft im Großen Haus
X Der Garten auf Dejima
XI Speicher Eik
XII Das Empfangszimmer im Haus des Faktors auf Dejima
XIII Der Fahnenplatz auf Dejima
TEIL 2 Eine Bergfestung
XIV Oberhalb des Dorfes Kurozane im Lehen Kyōga
XV Das Haus der Schwestern, Shiranui-Schrein
XVI Die Shirandō-Akademie im Hause Ōtsuki in Nagasaki
XVII Der Altarraum im Haus der Schwestern, Shiranui-Schrein
XVIII Das Behandlungszimmer auf Dejima
XIX Das Haus der Schwestern, Shiranui-Schrein
XX Die zweihundert Stufen zum Ryūgaji-Tempel in Nagasaki
XXI Oritos Zelle im Haus der Schwestern
XXII Shuzais Wohnung in seinem Dōjō in Nagasaki
XXIII Yayois Zelle im Haus der Schwestern, Shiranui-Schrein
XXIV Ogawa Mimasakus Zimmer im Haus der Ogawas in Nagasaki
XXV Die Wohnung des Fürstabts im Shiranui-Schrein
XXVI Hinter der Harubayashi-Herberge, östlich von Kurozane im Lehen Kyōga
TEIL 3 Der Go-Meister
XXVII Dejima
XXVIII Kapitän Penhaligons Kajüte an Bord der Phoebus, Ostchinesisches Meer
XXIX Ein ungewisser Ort
XXX Der Raum der Letzten Chrysantheme in der Residenz des Statthalters von Nagasaki
XXXI Vorschiff der Phoebus
XXXII Der Wachtturm auf Dejima
XXXIII Der Saal der Sechzig Matten in der Residenz des Statthalters
XXXIV Kapitän Penhaligons Schlafkajüte auf HMS Phoebus
XXXV Das Seezimmer im Haus des Faktors auf Dejima
XXXVI Der Raum der Letzten Chrysantheme im Amtssitz des Statthalters
XXXVII Kapitän Penhaligons Kajüte
XXXVIII Der Wachtturm auf Dejima
XXXIX Auf der Veranda vor dem Raum der Letzten Chrysantheme im Amtssitz des Statthalters
TEIL 4 Regenzeit
XL Der Tempel auf dem Berg Inasa, oberhalb der Bucht von Nagasaki
TEIL 5 Die letzten Seiten
XLI Auf dem Achterdeck der Profetes, Bucht von Nagasaki
Danksagung
Personenverzeichnis
Für K, H & N, in Liebe
Anmerkung des Autors
Batavia auf der Insel Java war Hauptsitz der Niederländischen Ostindien-Kompagnie (Vereenigde Oost-Indische Compagnie oder VOC) sowie Abfahrt- und Zielhafen der VOC-Schiffe auf der Nagasaki-Route. Während der japanischen Besetzung Indonesiens im Zweiten Weltkrieg wurde Batavia in Jakarta umbenannt.
Die japanischen Datumsangaben im Roman folgen dem Lunisolarkalender. Dieser lag, je nach Jahr, zwischen drei und sieben Wochen «hinter» dem gregorianischen Kalender. «Der erste Tag im ersten Monat» ist also nicht der 1. Januar, sondern bezeichnet einen wechselnden Tag zwischen Ende Januar und etwa Mitte Februar. Die Jahre werden mit den japanischen Äranamen angegeben.
Bei allen japanischen Namen ist der Familienname vorangestellt.
TEIL 1 Die Braut, für die wir tanzen
Das elfte Jahr der Kansei-Zeit
1799
I Das Haus von Kawasemi der Konkubine, oberhalb von Nagasaki
Die neunte Nacht des fünften Monats
«Fräulein Kawasemi?» Orito kniet auf dem feuchten, muffigen Futon. «Hören Sie mich?»
Im Reisfeld hinter dem Garten bricht lärmend ein Froschkonzert los.
Orito tupft der Konkubine mit einem Lappen den Schweiß vom Gesicht.
«Sie spricht kaum noch», die Zofe hält die Öllampe, «schon seit Stunden …»
«Fräulein Kawasemi, mein Name ist Aibagawa. Ich bin Hebamme. Ich will helfen.»
Kawasemi öffnet mühsam die Augen. Sie seufzt schwach. Ihre Augen fallen wieder zu.
Sie ist so erschöpft, denkt Orito, dass sie sich nicht einmal vor dem Sterben fürchtet.
Dr. Maeno flüstert durch den Musselinvorhang. «Ich wollte die Lage des Fötus selbst untersuchen, aber …», der alte Gelehrte wählt seine Worte mit Bedacht, «… aber das ist anscheinend nicht gestattet.»
«Ich habe klare Befehle», sagt der Kammerherr. «Kein Mann darf sie berühren.»
Orito hebt das blutbefleckte Laken und sieht den Arm des Fötus, der, wie man ihr vorher berichtet hat, bis zur Schulter aus Kawasemis Vagina hängt.
«Haben Sie schon mal eine solche Kindslage gesehen?», fragt Dr. Maeno.
«Ja: auf einer Kupfertafel, in der niederländischen Abhandlung, die mein Vater übersetzt hat.»
«Das habe ich gehofft! Die Beobachtungen von William Smellie?»
«Ja. Dr. Smellie nennt es», Orito wechselt ins Niederländische, «‹Armvorfall›.»
Orito nimmt das schleimbeschmierte Handgelenk des Fötus, um den Puls zu fühlen.
Maeno fragt, diesmal auf Niederländisch: «Wie lautet Ihr Befund?»
Es ist kein Puls vorhanden. «Das Kind ist tot», antwortet Orito in derselben Sprache, «und auch die Mutter wird sterben, wenn sie nicht schnell entbunden wird.» Sie legt die Fingerspitzen auf Kawasemis schwangeren Bauch und tastet den Bereich um den vorgestülpten Nabel ab. «Es war ein Junge.» Sie kniet sich zwischen Kawasemis gespreizte Beine, bemerkt das schmale Becken und hält die Nase an die geschwollenen Schamlippen: Sie riecht die malzige Mischung aus geronnenem Blut und Exkrementen, aber nicht den Gestank eines verwesten Fötus. «Er ist vor ein bis zwei Stunden gestorben.»
Dann fragt sie die Zofe: «Wann ist die Fruchtblase geplatzt?»
Die Zofe ist vor Staunen über die fremde Sprache verstummt.
«Gestern Morgen, in der Stunde des Drachen», sagt der Haushalter mit steinerner Stimme. «Kurz darauf setzten die Wehen ein.»
«Und wann hat das Kind zum letzten Mal gestrampelt?»
«Das muss heute um die Mittagszeit gewesen sein.»
«Dr. Maeno, würden Sie mir zustimmen, dass das Kind» – Orito verwendet die niederländische Bezeichnung – «in Querlage liegt?»
«Vielleicht», antwortet der Arzt in ihrer Geheimsprache, «aber ohne Untersuchung …»
«Der Fötus ist seit zwanzig Tagen überfällig. Mindestens. Er hätte sich drehen müssen.»
«Kind schläft», beruhigt die Zofe ihre Herrin. «Nicht wahr, Dr. Maeno?»
Der wahrheitsliebende Arzt zögert. «Das … wäre möglich.»
«Mein Vater hat erzählt», sagt Orito, «Dr. Uragami habe die Geburt beaufsichtigt.»
«Das hat er auch getan», brummt Maeno, «allerdings bequem von seinen Behandlungsräumen aus. Als das Kind zu strampeln aufhörte, konstatierte Uragami, dass seine Seele sich aus Gründen der Geomantik gegen die Geburt sträube, ein Phänomen, das nur für einen Mann von seinen Geistesgaben zu erkennen sei. Alles hänge daher von der ‹Willenskraft› der Mutter ab.» Der Schweinehund – Maeno braucht es nicht auszusprechen – fürchtet sich davor, seinen Ruf zu schädigen, wenn er das Kind eines so erlauchten Mannes tot zur Welt bringt. «Daraufhin überzeugte Kammerherr Tomine den Statthalter, mich herbeizuholen. Als ich den Arm sah, fiel mir Ihr schottischer Arzt ein, und ich forderte Ihre Hilfe an.»
«Mein Vater und ich fühlen uns durch Ihr Vertrauen tief geehrt», sagt Orito …
… und ich verfluche Uragami, denkt sie, dass er sich in dieser lebensbedrohlichen Situation davor scheut, sein Gesicht zu verlieren.
Die Frösche verstummen, und als hätte sich ein Geräuschvorhang gehoben, hört man plötzlich die Stadt Nagasaki, wo die wohlbehaltene Ankunft des niederländischen Schiffes gefeiert wird.
«Wenn das Kind tot ist», sagt Maeno auf Niederländisch, «müssen wir es sofort herausholen.»
«Ich bin ganz Ihrer Meinung.» Orito bittet den Haushalter um warmes Wasser und Stoffstreifen. Dann hält sie der Konkubine ein Fläschchen Riechsalz unter die Nase, um ihr einen klaren Moment zu verschaffen. «Fräulein Kawasemi, in wenigen Minuten holen wir Ihr Kind auf die Welt. Vorher muss ich wissen, darf ich Sie von innen abtasten?»
Die nächste Wehe setzt ein, und die Konkubine kann vor Schmerz nicht antworten.
Zwei Kupferwannen mit warmem Wasser werden gebracht, und die Wehe lässt nach. «Wir sollten offen sprechen», schlägt Dr. Maeno Orito auf Niederländisch vor, «und ihr sagen, dass der Fötus tot ist. Dann amputieren wir den Arm und holen den Leichnam heraus.»
«Zuerst möchte ich mit meiner Hand ertasten, ob das Kind in Konvex- oder in Konkavlage liegt.»
«Wenn Sie das herausfinden können, ohne den Arm abzuschneiden» – Maeno meint ‹amputieren› –, «dann tun Sie es.»
Orito schmiert sich den Arm mit Rapsöl ein und wendet sich an die Zofe: «Falte einen Stoffstreifen zu einem dicken Stück … ja, gut so. Halte dich bereit, es deiner Herrin zwischen die Zähne zu klemmen. So verhindern wir, dass sie sich die Zunge abbeißt. Lass an den Seiten ausreichend Luft, damit sie atmen kann. Dr. Maeno, ich beginne jetzt mit der Untersuchung.»
«Sie sind meine Augen und meine Ohren, Fräulein Aibagawa.»
Orito schiebt die Finger zwischen den Oberarm des Fötus und die gerissenen Schamlippen der Mutter, bis ihre Hand bis zum Gelenk in Kawasemis Vagina steckt. Die Konkubine zittert und stöhnt. «Verzeihung», sagt Orito, «Verzeihung …» Ihre Finger gleiten zwischen warmer Schleimhaut, von Fruchtwasser glitschigem Muskelgewebe und Haut hindurch, während sie an einen Kupferstich aus dem aufgeklärten, barbarischen Reich Europa denkt …
Wenn das Kind in Konvexlage liegt, ruft sich Orito ins Gedächtnis, das heißt, wenn die Wirbelsäule so stark nach hinten gebogen ist, dass der Kopf wie bei einem chinesischen Akrobaten zwischen den Beinen hindurchschaut, muss sie den Arm amputieren, den Leichnam mit einer spitzen Zange zerlegen und ihn Stück für Stück herausziehen. Dr. Smellie weist darauf hin, dass jeder Überrest, der im Mutterleib verbleibt, verwest und zum Tode der Mutter führen kann. Wenn das Kind hingegen in Konkavlage liegt und die Knie an seine Brust drücken, dann kann sie den Arm vielleicht absägen, den toten Fötus drehen, Haken in die Augenhöhlen einführen und ihn mit dem Kopf voran in einem Stück herausziehen. Ihr Mittelfinger tastet die knubbelige Wirbelsäule, fährt über die Magengegend zwischen der untersten Rippe und dem Beckenknochen und stößt auf ein winziges Ohr, ein Nasenloch, einen Mund, die Nabelschnur und einen winzigen Penis. «Kindslage konkav», meldet Orito an Dr. Maeno, «aber die Nabelschnur hat sich um den Hals gewickelt.»
«Glauben Sie, sie lässt sich lösen?» Maeno vergisst, Niederländisch zu sprechen.
«Ich muss es versuchen. Bitte stecke deiner Herrin jetzt das Tuch in den Mund», sagt Orito zur Zofe.
Als der Ballen fest zwischen Kawasemis Zähnen sitzt, führt Orito die Hand tiefer in ihren Unterleib, legt den Daumen um die Nabelschnur, greift mit vier Fingern von unten in den Kiefer des Fötus, drückt ihm den Kopf nach hinten und schiebt die Nabelschnur über Gesicht, Stirn und Schädel. Kawasemi schreit auf, heißer Urin rinnt an Oritos Unterarm hinunter, aber der Eingriff ist beim ersten Mal erfolgreich: Die Schlinge ist gelöst. Orito zieht die Hand heraus und meldet: «Nabelschnur frei. Hat Herr Doktor vielleicht seine –», es gibt kein japanisches Wort, «– Geburtszange zur Hand?»
«Ich habe sie mitgebracht», Maeno klopft auf seinen Arzneikasten, «für alle Fälle.»
«Vielleicht können wir das Kind holen» – sie wechselt ins Niederländische –, «ohne den Arm zu amputieren. Je weniger Blut, desto besser. Aber ich brauche Ihre Hilfe.»
Dr. Maeno wendet sich an den Kammerherrn: «Wenn wir Fräulein Kawasemis Leben retten wollen, muss ich mich über den Befehl des Statthalters hinwegsetzen und zu der Hebamme vor den Vorhang treten.»
Kammerherr Tomine befindet sich in einer ernsten Zwickmühle.
«Sie können mich dafür verantwortlich machen», schlägt Maeno vor, «dass seine Anweisungen missachtet wurden.»
«Die Entscheidung liegt bei mir», erwidert der Kammerherr. «Tun Sie, was nötig ist, Herr Doktor.»
Der agile alte Mann kriecht mit der Geburtszange in der Hand unter dem Musselin hindurch.
Als die Zofe das fremdländische Gerät sieht, stößt sie einen erschrockenen Schrei aus.
«Geburtszange», antwortet der Arzt ohne weitere Erklärung.
Der Haushalter hebt den Vorhang. «Nein, ich traue dieser Sache nicht! Fremdländer können schneiden und sägen und es ‹Medizin› nennen, aber es ist unvorstellbar …»
«Gebe ich dem Haushalter Ratschläge», knurrt Maeno, «wo er seinen Fisch zu kaufen hat?»
«Die Geburtszange», erklärt Orito, «schneidet nicht – sie dreht und zieht, wie die Finger einer Hebamme, nur kräftiger …» Sie benutzt wieder das Riechsalz. «Fräulein Kawasemi, ich nehme jetzt dieses Instrument», sie hält die Zange hoch, «um Ihr Kind zu holen. Haben Sie keine Furcht und wehren Sie sich nicht. Europäer setzen sie regelmäßig ein – sogar bei Prinzessinnen und Königinnen. Wir ziehen Ihr Kind behutsam und sicher heraus.»
«Tun Sie es …» Kawasemis Stimme ist ein ersticktes Röcheln. «Tun Sie es …»
«Danke, und wenn ich Fräulein Kawasemi bitte, zu pressen …»
«Pressen …» Sie ist bis an die Grenze zur Gleichgültigkeit erschöpft. «Pressen …»
«Wie oft», Tomine späht durch den Vorhang, «haben Sie dieses Gerät schon eingesetzt?»
Zum ersten Mal bemerkt Orito die zertrümmerte Nase des Kammerherrn: eine Entstellung, ebenso schwer wie ihre Brandnarbe. «Oft, und nie musste eine Patientin leiden.» Nur Maeno und seine Schülerin wissen, dass es sich bei den «Patientinnen» um ausgehöhlte Melonen und bei den «Kindern» um eingefettete Flaschenkürbisse handelte. Sie führt ihre Hand wieder in Kawasemis Unterleib ein, zum letzten Mal, wenn alles gutgeht. Ihre Finger ertasten den Hals des Fötus, wenden seinen Kopf zum Gebärmutterhals, rutschen ab, finden besseren Halt und drehen den schwerfälligen Leichnam in die richtige Position. «Jetzt, bitte, Herr Doktor.»
Maeno führt die Zange an dem heraushängenden Arm vorbei bis hinauf zum Gelenk.
Den Zusehern stockt der Atem; Kawasemi entfährt ein heiserer Schrei.
Orito fühlt die gewölbten Zangenlöffel in ihrer Hand: Sie legt sie um den weichen Schädel des Fötus. «Schließen.»
Behutsam, aber entschlossen drückt der Arzt das Instrument zusammen.
Orito nimmt die Zangengriffe in die linke Hand: Der Widerstand ist schwammig und doch fest, wie Konnyaku-Gelee. Ihre rechte Hand, die noch im Uterus steckt, umfasst den Schädel des Fötus.
Dr. Maenos knochige Finger schließen sich um Oritos Handgelenk.
«Worauf warten Sie denn?», fragt der Haushalter.
«Auf die nächste Wehe», sagt der Arzt, «die jeden …»
Kawasemis Atem beschleunigt sich unter der erneuten Schmerzwelle.
«Eins, zwei, drei», zählt Orito, «und – pressen, Kawasemi-san!»
«Pressen, Herrin!», reden die Zofe und der Haushalter ihr zu.
Dr. Maeno zieht an der Zange, und Orito drückt den Kopf des Fötus zum Geburtskanal. Sie weist die Zofe an, den Arm des Kindes zu nehmen und zu ziehen. Orito fühlt, wie der Widerstand größer wird, als der Kopf in den Geburtskanal rutscht. «Eins, zwei … jetzt!» Der verkrustete Wirbel des winzigen Leichnams quetscht sich an der Klitoris vorbei.
«Es kommt!», stößt die Zofe unter den tierischen Schreien von Kawasemi hervor.
Der Kopf kommt zum Vorschein, das von Schleim überzogene Gesicht …
… und dann der glitschige, klebrige, leblose Körper.
«Oh, aber – oh», sagt die Zofe. «Oh. Oh. Oh …»
Kawasemis hohes Schluchzen geht in ein Stöhnen über und verstummt.
Sie weiß es. Orito legt die Zange weg, hebt das leblose Kind an den Füßen hoch und gibt ihm einen Klaps. Sie macht sich keine Hoffnungen auf ein Wunder: Sie handelt aus reiner Disziplin, so wie sie es in der Ausbildung gelernt hat. Nach zehn kräftigen Klapsen gibt sie auf. Das Kind hat keinen Puls. Sie spürt keinen Atem aus Mund oder Nase an ihrer Wange. Es ist unnötig, das Offensichtliche auszusprechen. Sie bindet die Nabelschnur über dem Nabel ab, schneidet den knorpeligen Strang mit dem Messer durch, badet den leblosen Jungen in einem Waschkessel und legt ihn in die Krippe. Eine Krippe als Sarg, denkt sie, und eine Windel als Leichentuch.
Kammerherr Tomine gibt draußen einem Diener Anweisungen. «Melde Seiner Exzellenz, dass sein Sohn tot geboren wurde. Dr. Maeno und seine Hebamme haben ihr Möglichstes getan, aber es stand nicht in ihrer Macht, die Bestimmung des Schicksals zu ändern.»
Oritos Sorge gilt jetzt dem Kindbettfieber. Sie muss die Plazenta herausholen, das Perineum mit Yakumosō einreiben und die Blutung einer Analfissur stillen.
Dr. Maeno zieht sich hinter den Vorhang zurück, um der Hebamme Platz zu machen.
Eine Motte groß wie ein Vogel fliegt herein und verirrt sich auf Oritos Gesicht.
Als sie das Insekt verscheucht, stößt sie die Geburtszange von der Kupferwanne.
Die Zange fällt auf einen Wannendeckel. Das laute Scheppern erschrickt ein kleines Wesen, das irgendwie in diesen Raum gelangt ist: Es wimmert und winselt.
Ein Hundewelpe?, denkt Orito verblüfft. Oder ein Kätzchen?
Das geheimnisvolle Tier stößt ganz in der Nähe einen Schrei aus: unter dem Futon?
«Jag es fort!», befiehlt der Haushalter der Zofe. «Na, wird’s bald!»
Das Wesen fängt wieder an zu wimmern, und Orito begreift, dass das Geräusch aus der Krippe kommt.
Unmöglich. Die Hebamme sträubt sich gegen die Hoffnung. Unmöglich …
Sie reißt das Leintuch weg, und der Mund des Säuglings öffnet sich.
Er holt Luft, einmal, zweimal, dreimal, das knautschige Gesicht verzieht sich …
… und der zitternde schinkenrosa neugeborene Despot brüllt das Leben an.
II Kapitän Lacys Kajüte auf der Shenandoah, vor Anker im Hafen von Nagasaki
Am Abend des 20. Juli 1799
«Wie soll ein Mann», fragt Daniel Snitker, «bei den Demütigungen, die wir täglich von den schlitzäugigen Blutsaugern erdulden müssen, denn sonst zu seinem angemessenen Lohn kommen? ‹Der unbezahlte Diener›, sagen die Spanier, ‹hat ein Recht darauf, sich selber zu bedienen›, und in diesem Punkt, zum Teufel, haben die Spanier ausnahmsweise recht. Wer sagt uns denn, dass es in fünf Jahren überhaupt noch eine Kompanie gibt, die uns bezahlt? Amsterdam ist am Boden, unsere Werften liegen still, die Betriebe ruhen, die Kornspeicher sind geplündert. Den Haag ist eine Bühne mit tanzenden Marionetten am Gängelband von Paris, an unseren Grenzen heulen preußische Schakale und österreichische Wölfe, und Jesus im Himmel: Seit dem Vogelschießen von Kamperduin sind wir eine Seemacht ohne eigene Marine! Die Engländer haben das Kap, die Koromandelküste und Ceylon erobert, ohne mit der Wimper zu zucken, und dass ihre nächste fette Weihnachtsgans Java heißt, ist klar wie Kloßbrühe! Ohne neutrale Schiffe wie» – er blickt verächtlich zu Kapitän Lacy – «diese Yankee-Brigg würde Batavia verhungern. In Zeiten wie diesen, Vorstenbosch, ist die einzige Versicherung eines Mannes ein Speicher voll mit handelsfähiger Ware. Aus welchem Grund, Herrgott noch mal, sind Sie sonst hier?»
Die alte Walöllampe schaukelt und zischt.
«War das», fragt Vorstenbosch, «Ihr Schlusswort?»
Snitker verschränkt die Arme. «Ich pfeife auf Ihr Standgericht.»
Kapitän Lacy entfährt ein gewaltiges Rülpsen. «Der Knoblauch, meine Herren.»
Vorstenbosch wendet sich an seinen Sekretär: «Dann können wir wohl unser Urteil festhalten.»
Jacob de Zoet nickt und taucht die Feder ein: «… Standgericht.»
«Kraft der mir von Seiner Exzellenz P. G. van Overstraten, Generalgouverneur von Niederländisch-Indien, übertragenen Vollmachten spreche ich, Unico Vorstenbosch, designierter Faktor der Handelsstation Dejima vor Nagasaki, heute, am 20. Juli 1799, im Beisein von Kapitän Anselm Lacy von der Shenandoah, Daniel Snitker, amtierender Faktor der oben genannten Handelsstation, in folgenden Punkten für schuldig: schwere Vernachlässigung der Dienstpflicht …»
«Ich habe meine Dienstpflicht», fällt Snitker ihm ins Wort, «in allen Bereichen erfüllt!»
«‹Dienstpflicht›?» Vorstenbosch gibt Jacob ein Zeichen, innezuhalten. «Unsere Speicher sind zu Asche verbrannt, während Sie sich im Bordell mit Huren vergnügt haben! – Ein Umstand, der in dem Lügensammelsurium, das Sie als Ihr Journal bezeichnen, keine Erwähnung findet, und ohne die zufällige Bemerkung eines japanischen Dolmetschers …»
«Dreckiges Geschmeiß, das mich verleumdet, weil ich den Hunden auf die Schliche gekommen bin!»
«Ist es auch eine Verleumdung, dass in der Brandnacht auf Dejima die Feuerspritze verschwunden war?»
«Vielleicht hat der Beschuldigte sie mit ins Haus der Glyzinien genommen», merkt Kapitän Lacy an, «um die Damen mit seinem dicken Schlauch zu beeindrucken.»
«Die Feuerspritze», protestiert Snitker, «gehörte in van Cleefs Verantwortungsbereich.»
«Ich richte Ihrem Stellvertreter aus, wie loyal Sie ihn verteidigt haben. Zum nächsten Anklagepunkt, Herr de Zoet: ‹Missachtung der Vorschrift, die Frachtbriefe der Octavia von den drei höchsten Beamten der Faktorei unterzeichnen zu lassen.›»
«Ach, Herrgott noch mal. Eine bürokratische Unachtsamkeit, weiter nichts.»
«Eine ‹Unachtsamkeit›, die es korrupten Faktoreileitern ermöglicht, die Kompanie auf hundertfache Weise zu prellen, nicht umsonst besteht Batavia auf dreifache Bestätigung. Nächster Punkt: ‹Unterschlagung von Kompaniegeldern zur Bezahlung privaten Frachtguts›.»
«Also das», faucht Snitker zornig, «das ist eine glatte Lüge!»
Vorstenbosch entnimmt der Reisetasche zu seinen Füßen zwei Porzellanfiguren im fernöstlichen Stil. Die eine stellt einen Henker dar, der die Axt schwingt, um die zweite zu enthaupten, einen knienden Gefangenen mit gefesselten Händen, den Blick schon in die nächste Welt gerichtet.
«Warum», fragt Snitker dreist, «zeigen Sie mir diesen Tinnef?»
«Zwei Gros davon wurden in Ihrem privaten Frachtgut gefunden, das heißt – fürs Protokoll – ‹vierundzwanzig Dutzend Figuren aus Arita-Porzellan›. Meine verstorbene Frau hatte eine Schwäche für japanische Kuriositäten, daher kenne ich mich ein wenig aus. Kapitän Lacy, seien Sie so nett und schätzen Sie ihren Wert in, sagen wir, einem Wiener Auktionshaus.»
Kapitän Lacy überlegt. «Zwanzig Gulden pro Stück?»
«Allein die kleinen hier sind fünfunddreißig Gulden wert; die blattvergoldeten Kurtisanen, Bogenschützen und Adeligen fünfzig. Welchen Preis erzielen also zwei Gros? Wir wollen niedrig schätzen – Europa befindet sich im Krieg, die Märkte schwanken – und fünfunddreißig pro Figur veranschlagen … multipliziert mit zwei Gros, de Zoet?»
Jacob hat den Abakus schon zur Hand. «Zehntausendundachtzig Gulden, Herr Vorstenbosch.»
Lacy wiehert beeindruckt auf.
«Ein stolzer Gewinn», stellt Vorstenbosch fest, «für Ware, die auf Kosten der Kompanie erworben wurde, in den Frachtbriefen aber – selbstverständlich unbeglaubigt – als ‹privates Porzellan des amtierenden Faktors› verzeichnet ist, und zwar in Ihrer Handschrift, Snitker.»
«Mein Vorgänger, Gott hab ihn selig», Snitker ändert seine Geschichte, «hat sie mir vor dem Empfang bei Hofe vermacht.»
«Dann hat Herr Hemmij sein Ableben auf der Rückreise von Edo also vorausgesehen?»
«Gijsbert Hemmij war nun mal ein außerordentlich weitsichtiger Mensch.»
«Dann zeigen Sie uns sein außerordentlich weitsichtiges Testament.»
«Das Testament», Snitker wischt sich über den Mund, «wurde beim Brand vernichtet.»
«Wer kann das bezeugen? Herr van Cleef? Fischer? Der Affe?»
Snitker seufzt angewidert. «Das ist doch kindische Zeitverschwendung. Schneiden Sie sich Ihren Zehnten ab – aber nicht ein Fitzchen mehr, oder, bei Gott, ich schmeiße den ganzen Krempel ins Hafenbecken!»
Der Lärm eines Zechgelages hallt von Nagasaki herüber.
Kapitän Lacy schnäuzt sich die fleischige Nase mit einem Kohlblatt.
Jacobs fast verbrauchte Feder schließt auf. Seine Hand schmerzt.
«Was, frage ich mich …», Vorstenbosch macht ein ratloses Gesicht, «hat es nur mit diesem ‹Zehnten› auf sich? Herr de Zoet, können Sie uns vielleicht Aufschluss geben?»
«Herr Snitker versucht, Sie zu bestechen, Herr Vorstenbosch.»
Die Lampe fängt heftig an zu schaukeln; die Flamme rußt, zuckt und erholt sich wieder.
Im Unterdeck stimmt ein Matrose seine Fiedel.
«Glauben Sie etwa», Vorstenbosch sieht Snitker scharf an, «ich und meine Ehrenhaftigkeit seien käuflich? Wie ein syphiliszerfressener Hafenmeister auf der Schelde, der von den Butterkähnen illegale Abgaben erpresst?»
«Dann von mir aus ein Neuntel», knurrt Snitker. «Aber ich schwöre, das ist mein letztes Angebot.»
«Ergänzen Sie die Anklageliste» – Vorstenbosch wendet sich mit einem Fingerschnipsen an seinen Sekretär – «um ‹Versuchte Bestechung eines Finanzprüfers›, und dann schreiten wir zur Urteilsverkündung. Sehen Sie mich an, Snitker: Das betrifft Sie. ‹Punkt eins: Daniel Snitker wird hiermit seines Amtes enthoben, und ihm wird jede› – ja, jede – ‹Vergütung abgesprochen, und zwar rückwirkend bis 1797. Zweitens: Nach Ankunft in Batavia wird Daniel Snitker im Alten Fort inhaftiert, wo er für seine Taten Rechenschaft ablegen wird. Drittens: Sein privates Frachtgut wird versteigert. Der Erlös fließt der Kompanie zu.› Wie ich sehe, sind Sie ganz Ohr.»
«Sie» – Snitkers Trotz ist dahin – «machen einen armen Mann aus mir!»
«Dieser Prozess soll ein abschreckendes Beispiel für jeden schmarotzerischen Faktor sein, der sich am Busen der Kompanie nährt: ‹Daniel Snitker ist Gerechtigkeit geschehen›, so lautet die Warnung dieses Urteils, ‹und Gerechtigkeit wird auch dich ereilen.› Kapitän Lacy, ich danke Ihnen, dass Sie bei dieser unerfreulichen Angelegenheit mitgewirkt haben: Herr Wiskerke, bitte weisen Sie Herrn Snitker eine Hängematte auf dem Vorderdeck zu. Er wird sich die Rückreise nach Java wie eine Landratte verdienen und sich der allgemeinen Disziplin fügen. Außerdem …»
Snitker stößt den Tisch um und stürzt sich auf Vorstenbosch. Jacob sieht Snitkers Faust über dem Kopf seines Mentors aufblitzen und schreitet ein: Flammende Pfauen tanzen vor seinen Augen, die Kajütenwände drehen sich um neunzig Grad, der Fußboden schlägt an seine Rippen, und der metallische Geschmack in seinem Mund stammt ganz gewiss von Blut. Über ihm wird gegrunzt, geächzt und schmerzvoll gestöhnt. Als Jacob aufblickt, landet der Erste Offizier einen Schlag in Snitkers Magengrube, so heftig, dass der niedergestreckte Sekretär vor Mitgefühl unweigerlich zusammenzuckt. Zwei weitere Seeleute stürmen in die Kajüte, als Snitker wankend zu Boden geht.
Unterdecks spielt der Geiger Mein schwarzäugiges Mädchen aus Twente.
Kapitän Lacy schenkt sich ein Glas Johannisbeerwhisky ein.
Vorstenbosch bearbeitet Snitkers Gesicht mit dem Silberknauf seines Stockes, bis er erschöpft von ihm ablässt. «Legt den Engerling in Eisen, und dann ab mit ihm in die schmutzigste Ecke auf dem Kojendeck.» Der Erste Offizier und die beiden Matrosen schleifen den stöhnenden Snitker hinaus. Vorstenbosch kniet neben Jacob und klopft ihm auf die Schulter. «Danke, dass Sie den Schlag abgefangen haben, mein Junge. Ich fürchte, Ihre Birne ist ganz schön Matsch …»
Der Schmerz in Jacobs Nase lässt auf einen Bruch schließen, aber die Schmiere an seinen Händen und Knien ist kein Blut. Tinte, erkennt der Sekretär, als er sich mühsam aufrappelt.
Tinte, aus dem zerbrochenen Tintenfass, indigoblaue Bäche und tröpfelnde Deltas …
Tinte, aufgesogen von durstigem Holz und in die Ritzen sickernd …
Tinte, denkt Jacob, du fruchtbarste aller Flüssigkeiten …
III Auf einem Sampan, festgemacht neben der Shenandoah, Hafen von Nagasaki
Am Morgen des 26. Juli 1799
Jacob de Zoet, ohne Hut und unter dem blauen Frack schweißgebadet, ist in Gedanken bei dem Tag vor zehn Monaten, als die rachgierige Nordsee gegen die Deiche von Domburg stürmte und die Gischt durch die Kerkstraat schwappte, vorbei am Pfarrhaus, wo sein Onkel ihm eine geölte Segeltuchtasche überreichte. Darin befand sich ein abgewetzter, in Hirschleder gebundener Psalter, und Jacob kann die Rede seines Onkels mehr oder minder aus dem Gedächtnis wiedergeben. «Du hast die Geschichte dieses Buches weiß Gott oft genug gehört, Neffe. Dein Ururgroßvater war in Venedig, als dort die Pest ausbrach. Froschgroße Beulen bedeckten seinen Leib, aber er betete aus diesem Psalter, und Gott heilte ihn. Vor fünfzig Jahren diente dein Großvater Tys in der Pfalz, als sein Regiment aus dem Hinterhalt überfallen wurde. Der Psalter bewahrte ihn davor, dass diese Musketenkugel» – er berührte die bleierne Kugel, die noch immer im Buchdeckel steckt – «ihm das Herz zerfetzte. Die Wahrheit ist, dass wir – ich, dein Vater und auch du und Geertje – diesem Buch unser Leben verdanken. Wir sind keine Papisten: Wir schreiben krummen Nägeln und alten Lumpen keine Zauberkräfte zu, aber du weißt, dass dieses heilige Buch durch unseren Glauben fest mit unserem Stammbaum verbunden ist. Es ist ein Geschenk deiner Ahnen und eine Leihgabe deiner Nachkommen. Was dir in den kommenden Jahren auch widerfahren mag, vergiss eines nie: Dieser Psalter» – er berührte die Segeltuchtasche – «ist dein Ausweis, um nach Hause zurückzukehren. Davids Psalmen sind eine Bibel in der Bibel. Bete sie, befolge, was sie dich lehren, und du wirst nicht vom rechten Weg abkommen. Beschütze das Buch mit deinem Leben, auf dass es deine Seele nähren möge. Und nun geh, Jacob, und Gott sei mit dir.»
«‹Beschütze es mit deinem Leben›», murmelt Jacob vor sich hin …
… und ebendas, denkt er, ist mein Dilemma.
Vor zehn Tagen, die Shenandoah ankerte vor Papenberg – benannt nach den Märtyrern des wahren Glaubens, die von den Felsen der Insel hinabgestoßen wurden –, hatte Kapitän Lacy den Befehl ausgegeben, dass alle christlichen Zeugnisse in einem Fass zu deponieren und bis zur Abreise der Brigg an die Japaner zu übergeben seien. Nicht einmal der designierte Faktor Vorstenbosch und sein Protegé de Zoet waren von der Anordnung ausgenommen. Anfangs murrten die Matrosen der Shenandoah, lieber würden sie ihre Hoden als ihre Kruzifixe hergeben, aber als die japanischen Inspektoren und die wohlbewaffneten Wachleute die Decks durchsuchten, waren sämtliche Kreuze und Christopherus-Anhänger in geheimen Winkeln verschwunden. Das Fass wurde mit Rosenkränzen und Gebetsbüchern gefüllt, die Kapitän Lacy eigens zu diesem Zweck mitgebracht hatte: Der Psalter der de Zoets war nicht darunter.
Wie könnte ich meinen Onkel hintergehen, denkt Jacob sorgenvoll, wiemeine Kirche und meinen Gott?
Der Psalter liegt unter den anderen Büchern in der Seemannskiste, auf der er sitzt.
So groß, beruhigt er sich, kann die Gefahr nicht sein … Der Psalter enthält keine Zeichnungen oder andere Darstellungen, anhand derer er sich als christliche Schrift identifizieren ließe, und das Niederländisch der Dolmetscher reicht gewiss nicht aus, um alte Bibelsprache zu verstehen. Schließlich stehe ich im Dienst der Niederländischen Ostindien-Kompanie, denkt Jacob. Welche Strafe könnten die Japaner im schlimmsten Fall über mich verhängen?
Jacob weiß es nicht, und die Wahrheit ist, Jacob fürchtet sich.
Eine Viertelstunde verstreicht; Faktor Vorstenbosch und seine beiden Malaien sind nirgends zu sehen.
Jacobs helle sommersprossige Haut brutzelt in der Sonne wie Speck.
Ein Fliegender Fisch schießt aus dem Wasser und tanzt über die Oberfläche.
«Tobiuo!», sagt der eine Ruderer zum anderen und zeigt auf den Fisch. «Tobiuo!»
Jacob wiederholt das Wort, und die beiden Ruderer lachen so schallend, dass das Boot zu schaukeln anfängt.
Ihr Passagier stört sich nicht daran. Er beobachtet die Wachtboote, die ihre Kreise um die Shenandoah ziehen, die Fischer mit ihren Fangkörben, ein japanisches Frachtschiff vor der Küste, gedrungen wie eine portugiesische Karacke, aber dickbäuchiger, das Vergnügungsboot eines Adeligen mit mehreren Begleitschiffen, verhängt in den Herzogsfarben Schwarz und Himmelblau, und eine Dschunke mit schnabelförmigem Bug, ganz ähnlich den Dschunken der chinesischen Kaufleute in Batavia …
Nagasaki, holzgrau und schlammbraun, wirkt, als wäre es zwischen den gespreizten Zehen der grünen Berge hervorgequollen. Die Gerüche nach Seetang, Reichtum und dem Rauch aus unzähligen Ofenrohren werden über das Wasser getragen. Die Berge sind fast bis hinauf zu den gezackten Gipfeln von terrassenförmig angelegten Reisfeldern bedeckt.
Ein Wahnsinniger, denkt Jacob, könnte dem Glauben verfallen, er säße in einer gesprungenen Jadeschüssel.
Das Ufer wird beherrscht von seinem Zuhause des nächsten Jahres: Dejima, eine von Palisaden umschlossene, künstlich angelegte, fächerförmige Insel, an der äußeren Krümmung gut zweihundert Schritte lang und etwa achtzig Schritte breit, schätzt Jacob, und wie ein Großteil Amsterdams auf Pfählen errichtet. Als er in der vergangenen Woche die Faktorei vom Vormast der Shenandoah aus zeichnete, zählte er rund fünfundzwanzig Dächer: die nummerierten Speicher der japanischen Kaufleute, die Residenzen des Faktors und des Kapitäns, das Haus des Stellvertreters, auf dessen Dach sich der Wachtturm befindet, die Dolmetscherzunft, ein kleines Krankenhaus. Von den vier niederländischen Speichern – Roos, Lelie, Doorn und Eik – haben nur die beiden letztgenannten den Brand, den Vorstenbosch «das Snitker-Feuer» nennt, überstanden. Lagerhaus Lelie wird gerade wiederaufgebaut, aber das gänzlich niedergebrannte Roos muss warten, bis es um die Schuldenlast der Faktorei besser bestellt ist. Von der Landpforte führt eine schmale steinerne Brücke über einen kleinen Kanal aufs Festland. Die Seepforte, am Ende einer kurzen Rampe gelegen, wo die Sampans der Kompanie be- und entladen werden, ist nur während der Handelszeiten geöffnet. Daneben befindet sich ein Zollhaus, wo mit Ausnahme des amtierenden Faktors und des Kapitäns alle Niederländer auf verbotene Gegenstände untersucht werden.
Eine Liste, denkt Jacob, auf der an oberster Stelle «christliche Artefakte» stehen.
Er wendet sich seiner Zeichnung zu und beginnt, mit Kohle das Meer zu schattieren. Die Ruderer schauen ihm neugierig über die Schulter. Jacob zeigt ihnen das Blatt:
Der ältere verzieht anerkennend das Gesicht.
Ein Ruf von einem der Wachtboote schreckt die beiden auf: Sie kehren an die Ruder zurück.
Der Sampan schwankt unter Vorstenboschs Gewicht: Eigentlich ist er von schlankem Wuchs, aber sein seidener Surtout ist prall gefüllt mit «Einhorn» oder Narwalzahn, das in Pulverform in Japan als Allheilmittel geschätzt wird. «Diesem Possenspiel» – der künftige Faktor klopft mit den Fäusten auf den ausgebeulten Rock – «werde ich ein Ende bereiten. ‹Warum›, fragte ich diese Natter Kobayashi, ‹wird die Fracht nicht ganz regulär in Kisten verpackt, an Land gebracht, ganz regulär, und bei der Privatauktion ganz regulär verkauft?› Seine Antwort? ‹Das hat es noch nie gegeben.› ‹Wie wäre es›, schlug ich ihm vor, ‹wenn wir jetzt damit anfangen?› Er glotzte mich an, als hätte ich behauptet, der Vater seiner Kinder zu sein.»
«Herr Vorstenbosch?», ruft der Erste Offizier. «Sollen Ihre Sklaven Sie an Land begleiten?»
«Schickt sie mit den Kühen. In der Zwischenzeit soll mir Snitkers Schwarzer dienen.»
«Sehr wohl – und Dolmetscher Sekita bittet darum, mit an Land zu dürfen.»
«Dann lassen Sie den Schwachkopf herunter, Herr Wiskerke …»
Sekitas breites Hinterteil ragt über die Reling. Die Schwertscheide verfängt sich in der Leiter: Für dieses Missgeschick erntet sein Diener einen kräftigen Hieb. Als Herr und Diener sicher Platz genommen haben, zieht Vorstenbosch den feschen Dreispitz. «Ein himmlischer Morgen, Herr Sekita, nicht wahr?»
«Ah.» Sekita nickt, ohne zu verstehen. «Wir Japaner sind Inselvolk …»
«Wahrhaftig. Meer, wohin das Auge reicht: unendliches Dunkelblau.»
Sekita sagt einen weiteren auswendig gelernten Satz auf: «Hohe Kiefern sind tiefe Wurzeln.»
«Warum müssen wir unser knappes Geld eigentlich für Ihr dickes Gehalt verschwenden?»
Sekita spitzt den Mund, als würde er nachdenken. «Wie geht es Ihnen, mein Herr?»
Wenn er meine Bücher inspiziert, denkt Jacob, sind all meine Befürchtungen umsonst gewesen.
Vorstenbosch ruft den Ruderern «Los!» zu und zeigt auf Dejima.
Unaufgefordert und überflüssigerweise übersetzt Sekita den Befehl.
Die Ruderer treiben den Sampan zur Melodie eines rauchig gesungenen Seemannsliedes mit schlangenartigen Ruderbewegungen durchs Wasser.
«Ob sie wohl», denkt Vorstenbosch laut, «Rück dein Gold raus, o stinkender Holländer singen?»
«Doch gewiss nicht in Anwesenheit eines Dolmetschers!»
«Eine sehr nachsichtige Bezeichnung für diesen Herrn. Aber er ist mir lieber als Kobayashi: Dies könnte für eine ganze Weile die letzte Gelegenheit für eine private Unterhaltung sein. Sobald wir an Land sind, muss ich alles daransetzen, dass die Handelszeit so viel Ertrag bringt, wie unsere schäbige Fracht es zulässt. Sie, de Zoet, haben eine völlig andere Aufgabe: Sie prüfen die Bücher der Faktorei, sowohl auf die Geschäfte der Kompanie als auch auf die privaten, und zwar ab dem Jahr vierundneunzig. Wenn wir nicht genau wissen, was die Beamten gekauft, veräußert und ausgeführt haben und zu welchem Preis, erfahren wir nie, mit welchem Ausmaß von Korruption wir es zu tun haben.»
«Ich werde mein Bestes tun, Herr Vorstenbosch.»
«Snitkers Verhaftung ist meine Absichtserklärung, aber wenn wir jedem Schmuggler auf Dejima dieselbe Behandlung zukommen ließen, blieben am Ende nur wir beide übrig. Nein, wir müssen zeigen, dass ehrliche Arbeit mit Beförderung belohnt und Diebstahl mit Schmach und Gefängnis bestraft wird. So, nur so, kann es uns gelingen, diesen Augiasstall auszumisten. Ah, da kommt van Cleef, um uns zu begrüßen.»
Der amtierende Stellvertreter kommt die Rampe der Seepforte hinunter.
«‹Jede Ankunft›», zitiert Vorstenbosch, «‹ist ein ganz besonderer Tod.›»
Stellvertreter Melchior van Cleef, geboren vor vierzig Jahren in Utrecht, zieht seinen Hut. Sein dunkles, bärtiges Gesicht hat etwas Piratenhaftes: Ein Freund würde die schmalen Augen vielleicht als «wachsam», ein Feind als «mephistophelisch» bezeichnen. «Guten Morgen, Herr Vorstenbosch – und herzlich willkommen auf Dejima, Herr de Zoet.» Sein Händedruck könnte Steine zerquetschen. «Ihnen einen angenehmen Aufenthalt zu wünschen, wäre allzu hoffnungsfroh …» Er bemerkt die frische Beule auf Jacobs Nase.
«Verbindlichen Dank, Stellvertreter van Cleef.» Der feste Boden schwankt unter Jacobs Seebeinen. Kulis haben seine Seemannskiste ausgeladen und tragen sie durch die Seepforte. «Es wäre mir lieb, wenn ich mein Gepäck im Auge behalten könnte …»
«Das sollten Sie auch. Bis vor kurzem haben wir die Schauerleute mit Hieben bestraft, aber der Statthalter hat bestimmt, dass ein geschlagener Kuli eine Beleidigung für ganz Japan sei, und uns die Hiebe verboten. Jetzt kennt die Dreistigkeit der Schurken keine Grenzen mehr.»
Dolmetscher Sekita springt im falschen Augenblick vom Bug des Sampans auf die Rampe und landet bis zu den Knien im Wasser. Als er auf trockenem Boden ist, zieht er seinem Diener den Fächer über die Nase und eilt den drei Niederländern voraus: «Gehen Sie! Gehen Sie! Gehen Sie!»
Stellvertreter van Cleef erklärt: «Er meint ‹Kommen Sie›.»
Sie passieren die Seepforte und werden ins Zollhaus gebracht. Hier fragt Sekita die Ausländer nach ihren Namen, schreit diese einem alten Verwaltungsbeamten zu, der sie an einen jüngeren Gehilfen weitergibt, der sie in sein Buch schreibt. «Vorstenbosch» wird als Bōrusu Tenbōshu transkribiert, aus «van Cleef» wird Bankureifu und «de Zoet» wird in Dazūto umgetauft. Eine Gruppe von Inspektoren sticht mit Spießen in die Käselaibe und Butterfässer, die von der Shenandoah entladen wurden. «Die Lumpen», murrt van Cleef, «sind berühmt dafür, dass sie sogar eingelegte Eier aufbrechen, für den Fall, dass die Hühner ein, zwei Dukaten hineingeschmuggelt haben.» Ein stämmiger Wachmann kommt auf sie zu. «Das ist der Abgreifer», erklärt der Vize. «Der Faktor bleibt verschont, Sekretäre leider nicht.»
Eine Gruppe junger Männer versammelt sich: Sie haben dieselben rasierten Scheitel und Haarknoten wie die Inspektoren und Dolmetscher, die in dieser Woche auf der Shenandoah gewesen sind, aber ihre Gewänder sind weniger eindrucksvoll. «Ranglose Dolmetscher», erklärt van Cleef. «Sie nehmen Sekita die Arbeit ab, in der Hoffnung, seine Gunst zu erwerben.»
Der Abgreifer wendet sich an Jacob, und die jungen Männer rufen im Chor: «Arme heben! Taschen öffnen!»
Sekita befiehlt ihnen zu schweigen und weist Jacob an: «Arme heben. Taschen öffnen.»
Jacob gehorcht; der Abgreifer fasst ihm unter die Achseln und durchsucht seine Taschen.
«Wachmann Schuhe zeigen!», sagen die flinkesten Hausdolmetscher.
Sekita rümpft die Nase. «Schuhe zeigen jetzt.»
Jacob sieht, dass sogar die Schauerleute die Arbeit unterbrochen haben und zusehen.
Einige zeigen schamlos auf den Sekretär und rufen: «Kōmō, kōmō.»
«Sie meinen Ihr Haar», erklärt van Cleef. «Europäer werden oft als kōmō tituliert: kō bedeutet rot, und mō heißt Haar. Tatsächlich können sich nur wenige von uns Ihrer Haarfarbe rühmen – ein rothaariger Barbar wird gerne ausgiebig begafft.»
«Sie studieren die japanische Sprache, Herr van Cleef?»
«Die Gesetze verbieten es, aber ich schnappe das ein oder andere bei meinen Ehefrauen auf.»
«Wenn Sie Ihre Kenntnisse an mich weitergäben, wäre ich Ihnen tief verbunden.»
«Ich bin kein sonderlich guter Lehrer», räumt van Cleef ein. «Dr. Marinus schwatzt mit den Malaien, als wäre er mit schwarzer Haut geboren, aber selbst er sagt, dass die japanische Sprache äußerst mühsam zu erlernen ist. Jeder Dolmetscher, der dabei erwischt wird, dass er uns Unterricht erteilt, riskiert, als Verräter bestraft zu werden.»
Der Abgreifer gibt Jacob die Schuhe zurück und erteilt einen neuen Befehl.
«Kleiderstücke aus!», sagen die Dolmetscher. «Kleiderstücke aus!»
«Kleiderstücke bleiben an!», erwidert van Cleef scharf. «Sekretäre ziehen sich nicht aus, Herr de Zoet; das Stinktier will uns nur mal wieder die Würde nehmen. Wenn Sie ihm jetzt gehorchen, muss bis zum Jüngsten Tag jeder Sekretär, der nach Japan kommt, dasselbe tun.»
Der Abgreifer protestiert, der Chor ruft: «Kleiderstücke aus!»
Dolmetscher Sekita merkt, dass er in Schwierigkeiten steckt, und verdrückt sich.
Vorstenbosch schlägt mit dem Stock auf den Boden, bis Ruhe herrscht. «Nein!»
Der Abgreifer gibt sich widerwillig geschlagen.
Ein Zollbeamter klopft mit seiner Lanze auf Jacobs Seemannskiste und sagt etwas.
«Bitte aufmachen», übersetzt ein Dolmetschereleve. «Große Kiste aufmachen!»
Die Kiste, höhnt eine Flüsterstimme in Jacob, mit deinem Psalter.
«Bevor wir alle alt und grau sind, de Zoet», sagt Vorstenbosch.
Mit flauem Magen schließt Jacob wie befohlen die Kiste auf.
Einer der Wachleute sagt etwas. Der Chor übersetzt: «Zurück! Treten Sie zurück!»
Gut zwanzig Hälse recken sich neugierig, als der Abgreifer den Deckel hebt und Jacobs fünf Leinenhemden auseinanderfaltet. Er nimmt Jacobs Wolldecke aus der Kiste, Strümpfe, ein Säckchen mit Knöpfen und Schnallen, eine schäbige Perücke, einen Satz Federkiele, vergilbte Unterwäsche, den Kompass aus Jacobs Kinderzeit, ein halbes Stück Windsorseife, die zwei Dutzend Briefe von Anna, zusammengebunden mit einer Locke ihres Haars, ein Rasiermesser, eine Delfter Pfeife, ein gesprungenes Glas, einen Folianten mit Notenblättern, eine mottenzerfressene flaschengrüne Samtweste und einen Teller mit Messer und Löffel aus Zinn, bis nur noch gut fünfzig Bücher verschiedenster Art in der Kiste liegen. Der Abgreifer spricht mit einem Untergebenen, der eilig das Zollhaus verlässt.
«Diensthabenden Dolmetscher holen», sagt einer der Dolmetscher. «Um Bücher zu sehen.»
«Wird die Sektion», Jacobs Brust ist wie zusammengeschnürt, «denn nicht von Herrn Sekita durchgeführt?»
Van Cleefs bärtiges Gesicht verzieht sich zu einem gelben Grinsen. «Sektion?»
«Inspektion, meine ich: die Inspektion meiner Bücher.»
«Sekitas Vater hat ihm den Platz in der Zunft erkauft, aber das Verbot des» – van Cleef flüstert lautlos «Christentums» – «ist zu bedeutend für Dummköpfe. Ein Klügerer wird die Bücher überprüfen: Iwase Banri vielleicht oder einer der Ogawas.»
«Wer sind die …», Jacob würgt an seinem Speichel, «… Ogawas?»
«Ogawa Mimasaku ist einer der vier Oberdolmetscher. Sein Sohn, Ogawa Uzaemon, gehört zum dritten Rang und – » Ein junger Mann betritt den Raum. «Ah! Wenn man vom Teufel spricht und auf seine Schritte horcht! Einen herzlichen guten Morgen, Herr Ogawa.»
Ogawa Uzaemon, Mitte zwanzig, hat ein offenes, intelligentes Gesicht. Die ranglosen Dolmetscher verbeugen sich tief. Er verbeugt sich vor Vorstenbosch, van Cleef und zum Schluss vor dem Neuankömmling. «Willkommen an Land, Herr de Zoet.» Seine Aussprache ist hervorragend. Er streckt die Hand zu einem europäischen Gruß aus, während Jacob sich nach asiatischer Sitte verbeugt, worauf der Dolmetscher die Verbeugung erwidert, während Jacob ihm die Hand hinstreckt. Alle Anwesenden schmunzeln über diese amüsante Szene. «Man sagte mir», sagt der Dolmetscher, «Herr de Zoet bringt viele Bücher … und da sind sie …», er zeigt auf die Kiste, «… viele, viele Bücher. Eine ‹Fülle› von Büchern, sagt man so?»
«Ein paar Bücher», sagt Jacob, der sich vor Aufregung übergeben könnte. «Oder ziemlich viele: ja.»
«Darf ich Bücher herausnehmen und ansehen?» Ohne die Antwort abzuwarten, greift Ogawa begierig in die Kiste. Jacobs Welt wird zu einem engen Tunnel zwischen ihm und seinem Psalter, der zwischen den zwei Bänden der Sara Burgerhart-Ausgabe hervorschaut. Ogawa runzelt die Stirn. «Viele, viele Bücher. Ein wenig Zeit, bitte. Wenn fertig, ich gebe Bescheid. Ist das genehm?» Er missversteht Jacobs Zögern. Bücher sind sicher. «Ich» – Ogawa legt sich die Hand aufs Herz – «auch bin bibliophil. Ist das richtiges Wort? Bibliophil?»
Auf dem Wiegeplatz glüht die Sonne wie ein Brandeisen.
Gleich, denkt der Schmuggler wider Willen, finden sie meinen Psalter.
Vorstenbosch wird von einem Grüppchen japanischer Beamter erwartet.
Ein malaiischer Sklave verbeugt sich, in der Hand einen Bambussonnenschirm für den Faktor.
«Kapitän Lacy und ich», sagt der Faktor, «haben bis zum Mittagessen allerlei Verpflichtungen im Empfangszimmer zu erfüllen. Sie sehen nicht wohl aus, de Zoet: Lassen Sie sich von Dr. Marinus einen Viertelliter abzapfen, wenn Herr van Cleef Ihnen alles gezeigt hat.» Er nickt seinem Stellvertreter zum Abschied zu und geht auf sein Haus zu.
In der Mitte des Wiegeplatzes steht ein zwei Mann hohes Dreibein mit einer Waage. «Heute wiegen wir Zucker», sagt van Cleef, «um festzustellen, was der Mist wert ist. Batavia hat uns den Ausschuss aus seinen Speichern geschickt.»
Auf dem kleinen Platz drängen sich über hundert Kaufleute, Dolmetscher, Inspektoren, Diener, Spitzel, Lakaien, Sänften- und Gepäckträger. So, denkt Jacob, sehen also die Japaner aus. Haarfarbe – schwarz oder grau – und Hautfarbe sind einheitlicher, als es bei einer vergleichbaren Anzahl Niederländer der Fall wäre, und Kleidung, Schuhwerk und Haartracht scheinen je nach Rang streng vorgeschrieben zu sein. Fünfzehn bis zwanzig nahezu nackte Zimmerleute hocken auf dem Gerüst eines neuen Speichers. «Fauler als eine Horde Gin saufender Finnen …», murmelt van Cleef. Vom Dach eines der Zollhäuser sieht ein rosagesichtiger, schwarz-weiß gefleckter Affe in Segeltuchjacke dem Treiben zu. «Wie ich sehe, haben Sie William Pitt schon entdeckt.»
«Verzeihung?»
«König Georgs oberster Minister. Er hört auf keinen anderen Namen. Ein Matrose brachte ihn vor sechs oder sieben Jahren mit, aber an dem Tag, als sein Besitzer absegelte, war der Affe plötzlich verschwunden. Erst am nächsten Tag tauchte er wieder auf, als befreiter Sklave von Dejima. Apropos Affen, das da drüben …», van Cleef zeigt auf einen hohlwangigen Mann mit Rattenschwanz, der Zuckerkisten öffnet, «… ist Wybo Gerritszoon, einer unserer Arbeiter.» Gerritszoon steckt die wertvollen Nägel in die Jackentasche. Die Zuckersäcke werden an einem japanischen Inspektor und einem auffälligen fremdländischen Jüngling von siebzehn oder achtzehn Jahren vorbeigetragen: Er hat das goldene Haar eines Engels, die breiten Lippen eines Javaners und fernöstliche Schlitzaugen. «Ivo Oost: ein Kind der Liebe mit einem ordentlichen Schuss Mestizenblut.»
Die Zuckersäcke werden auf einem improvisierten Tisch neben der Waage abgestellt.
Das Wiegen wird von drei weiteren japanischen Beamten, einem Dolmetscher und zwei Europäern in den Zwanzigern überwacht. «Der linke», van Cleef zeigt auf ihn, «ist Peter Fischer, ein Preuße aus Magdeburg …», Fischer ist braun wie eine Nuss und hat dunkles, schon schütteres Haar, «… und geprüfter Revisor – womit wir eine reiche Auswahl haben, da Sie, wie Herr Vorstenbosch sagt, ebenso qualifiziert sind. Der Mann neben Fischer ist Con Twomey, ein Ire aus Cork.» Twomey, in grobes Segeltuch gekleidet, hat ein halbmondförmiges Gesicht, kurzgeschorenes Haar und ein gewitztes Lächeln. «Ärgern Sie sich nicht, wenn Sie die Namen wieder vergessen: Sobald die Shenandoah absegelt, beginnt die Ewigkeit der Langeweile, in der wir alles übereinander erfahren können.»
«Schöpfen die Japaner denn nicht Verdacht, dass einige unserer Männer gar keine Niederländer sind?»
«Wir erklären Twomeys scheußlichen Akzent damit, dass er aus Groningen stammt. Wann hat es schon genügend echte Niederländer gegeben, um die Kompanie zu bestücken? Gerade jetzt» – die Betonung spielt auf die heikle Angelegenheit von Daniel Snitkers Inhaftierung an – «müssen wir nehmen, was wir kriegen können. Twomey ist unser Zimmermann, aber an Wiegetagen springt er als Inspektor ein, denn wenn man die verdammten Kulis nicht mit Falkenaugen bewacht, lassen sie blitzschnell einen Sack Zucker verschwinden. Mit den Wachen ist es dasselbe – und die Kaufleute sind die Gerissensten von allen: Gestern hat einer von den Hurensöhnen heimlich einen Stein in einen Sack gesteckt. Dann hat er den ‹Beweis› entdeckt, um so das Durchschnittsgewicht zu drücken.»
«Soll ich jetzt mit der Arbeit beginnen, Herr van Cleef?»
«Zuerst soll Dr. Marinus Sie zur Ader lassen. Wenn Sie sich eingerichtet haben, können Sie sich ins Getümmel stürzen. Sie finden Marinus in seiner Praxis am Ende der Langen Straße – dieser hier –, beim Lorbeerbaum. Sie werden sich nicht verlaufen. Niemand hat sich je auf Dejima verlaufen, es sei denn, er hatte den Kanal voll Grog.»
«Ein Glück, dass ich hier zufällig vorbeistiefel», schnauft eine Stimme zehn Schritte weiter. «Auf Dejima hat man sich in null Komma gar nix verlaufen. Arie Grote mein Name, und Sie» – er klopft Jacob kräftig auf die Schulter – «sind Jacob de Zoet, der tapfere Zeeländer: Donnerwetter, Snitker hat Ihnen ja ordentlich den Zinken poliert.»
Arie Grote hat ein Grinsen voller Zahnlücken und einen Hut aus Schlangenleder.
«Gefällt Ihnen, mein Hut, hä? War mal ’ne Boa Constrictor im Dschungel von Ternate. Eines Nachts hat sie sich in meine Hütte geschlichen, wo ich mit meinen drei Eingeborenenmädchen hauste. Erst dachte ich, eine von meinen Bettgenossinnen will mich zärtlich wecken, aber nichts da: Plötzlich wird zugedrückt, ich krieg keine Luft mehr, und drei von meinen Rippen machen popp!,knack!,krk!. Im Sternenlicht seh ich, wie das Ungeheuer mir in die vorquellenden Augen glotzt – und das, Herr de Z., war sein Verderben. Meine Arme waren in seinem Würgegriff, aber die Zähne hatte ich frei, und ich hab dem Mistvieh, so fest ich konnte, in den Kopf gebissen. Ah … der Schrei von ’ner Schlange ist ein Geräusch, das vergisst man nicht so schnell! Das Teufelstier hat noch fester zugedrückt – es war noch nicht erledigt –, also bin ich ihm an die Halsschlagader und hab sie mit einem Biss durchtrennt. Die dankbaren Dorfbewohner haben mir aus der Haut ’nen Mantel gemacht und mich zum, äh, König von Ternate gekrönt – die Schlange war nämlich der Schrecken des Dschungels gewesen – tja …», Grote seufzt, «… das Herz eines Matrosen ist das Spielzeug der See. In Batavia ließ ich aus dem Mantel Hüte schneidern, die zehn Reichstaler pro Stück einbrachten … aber nichts kann mich von dem letzten hier trennen, außer vielleicht, ich tu einem jungen Neuankömmling, der ihn nötiger braucht als ich, ’nen Gefallen. Das Prachtstück gehört Ihnen, nicht für zehn Reichstaler, nein, nein, nein! Auch nicht für acht, sondern für unschlagbar günstige fünf Stuiver!»
«Leider hat der Hutmacher Ihre Boa gegen schlecht gegerbtes Haileder ausgetauscht.»
«Ich wette», Arie Grote macht ein zufriedenes Gesicht, «Sie stehen mit prall gefüllter Börse vom Kartentisch auf. Wir Arbeiter treffen uns abends auf ein bisschen Glücksspiel und Geselligkeit in meinem bescheidenen Quartier, und da ich sehe, dass Sie kein aufgeblasener feiner Pinkel sind, warum kommen Sie nicht dazu?»
«Ich fürchte, ein Pastorenneffe wie ich würde Sie nur langweilen: Ich trinke kaum und spiele noch weniger.»
«Spielt im wunderbaren Fernen Osten nicht jeder ums eigene Leben? Von zehn Männern, die aussegeln, überleben sechs und machen kräftig Reibach, aber vier enden in einem sumpfigen Grab, und vierzig-sechzig ist ’ne verdammt miese Quote. Und übrigens, von zwölf Edelsteinen und Dukatonen, die im Mantelfutter eingenäht sind, werden elf an der Seepforte beschlagnahmt. Das Beste ist, man schiebt sie sich in den Hintereingang, und nur so nebenbei, falls Ihre Kimme entsprechend präpariert ist, Herr de Z., kann ich einen Spitzenpreis für Sie aushandeln …»
An der Kreuzung bleibt Jacob stehen: Vor ihm setzt die Lange Straße ihre Biegung fort.
«Das ist die Knochengasse», Grote zeigt nach rechts, «die auf die Uferstraße führt, und da lang», er zeigt nach links, «ist die Kurze Straße mit der Landpforte …»
… und hinter der Landpforte, denkt Jacob, liegt das verschlossene Kaiserreich.
«Für unsereins öffnet sich die Pforte nicht einen Spalt, Herr de Z.! Der Chef, der Vize und Dr. M. dürfen ab und zu nach draußen, aber wir nicht. ‹Die Geiseln des Shōguns›, so nennen uns die Einheimischen, und genauso ist es. Aber hören Sie», Grote schiebt Jacob weiter, «ich handle nicht nur mit Münzen und Juwelen. Erst gestern», er flüstert, «hab ich einem exklusiven Kunden auf der Shenandoah eine Kiste reinstes Kampfer besorgt, und das für ein paar lausige Dudelsäcke, die Sie zu Hause nicht aus der Gracht fischen würden.»
Er will mich ködern, denkt Jacob und erwidert: «Ich schmuggle nicht, Herr Grote.»
«Nicht im Traum würde ich dran denken, Sie der Untreue zu bezichtigen, Herr de Z.! Ich teile Ihnen nur unverbindlich mit, dass meine Provision ein Viertel vom Verkaufspreis beträgt: Aber ein schlauer junger Kerl wie Sie darf sieben von zehn Stücken Kuchen behalten, denn ich habe eine Schwäche für mutige Zeeländer. Es wird mir ein Vergnügen sein, mich auch um Ihr Syphilispulver zu kümmern» – Grote spricht in dem beiläufigen Ton eines Menschen, der etwas Entscheidendes verbirgt –, «denn gerade jetzt, Herr de Z., gerade jetzt, treiben gewisse Kaufleute, die mich ‹Bruder› nennen, den Preis schneller in die Höhe, als ein Hengst sein Rohr ausfährt, und warum?»
Jacob bleibt stehen. «Woher wissen Sie von meinem Quecksilber?»
«Ah, Sie lauschen meiner frohen Botschaft! Einer der zahllosen Söhne des Shōguns», Grote senkt die Stimme, «hat sich im Frühling einer Quecksilberkur unterzogen. Die Behandlung ist hier seit zwanzig Jahren bekannt, aber man traut ihr nicht. Aber die Gurke von dem Prinzlein war so verfault, dass sie grün geleuchtet hat: Ein Zyklus mit niederländischem Syphilispulver, und, gelobt sei der Herr, er war geheilt! Die Geschichte hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer: Jeder Apotheker im Land schreit nach dem wundersamen Elixier, und hier stehen Sie mit acht Kisten! Überlassen Sie das Verhandeln mir, und Sie verdienen so viel, dass Sie sich tausend Hüte kaufen können; verhandeln Sie selber, und die ziehen Ihnen das Fell über die Ohren und machen einen Hut aus Ihnen, mein Freund.»
«Wer», Jacob geht weiter, «hat Ihnen von meinem Quecksilber erzählt?»
«Ratten», flüstert Arie Grote. «Jawohl, Ratten. Ich füttere sie ab und zu mit Leckerbissen, und sie geben mir Bescheid. Voilà! Hier ist das Krankenhaus: Geteilte Reise ist halbe Reise, hä? Verträge und so weiter sind überflüssig: Ein Ehrenmann steht zu seinem Wort. Bis später …»
Arie Grote dreht um und geht zurück zur Kreuzung.
Jacob ruft ihm hinterher: «Aber ich habe Ihnen mein Wort doch gar nicht gegeben!»
Hinter dem Eingang zum Krankenhaus liegt ein schmaler Flur. Am Ende führt eine Leiter hinauf zu einer offenen Falltür, rechts gelangt man ins Behandlungszimmer, ein großer Raum, der von einem altersfleckigen Skelett beherrscht wird, das wie gekreuzigt an seinem Gestell hängt. Jacob versucht, nicht daran zu denken, dass Ogawa den Psalter findet. Der Operationstisch ist mit Riemen und Öffnungen versehen und voller Blutflecken. Es gibt Ablagen für die chirurgischen Sägen, Skalpelle, Scheren und Meißel, eine gewaltige Vitrine, in der, so vermutet Jacob, materia medica verwahrt werden, Mörser und Stößel, Blutauffangschalen, und mehrere Tische und Bänke. Der Geruch von frischen Sägespänen mischt sich mit Wachs, Kräutern und dem leicht lehmigen Gestank nach Leber. Durch eine Tür geht es ins Krankenzimmer mit drei leeren Betten. Wasser in einem Tonkrug führt Jacob in Versuchung: Er trinkt aus der Schöpfkelle – es ist kalt und süß.
Warum ist niemand hier, denkt er, um den Ort vor Dieben zu schützen?
Ein hübscher junger Diener oder Sklave erscheint mit einem Besen: Er ist barfuß und trägt ein schönes Chorhemd mit weiten indischen Hosen.
Jacob sieht sich genötigt, seine Anwesenheit zu rechtfertigen. «Dr. Marinus’ Sklave?»
«Der Doktor beschäftigt mich», das Niederländisch des Jungen ist gut, «als seinen Assistenten.»
«Ach so? Ich bin der neue Sekretär, de Zoet: Und du heißt?»
Die Verbeugung des Mannes ist nicht unterwürfig, sondern höflich. «Ich heiße Eelattu.»
«Aus welchem Teil der Welt kommst du, Eelattu?»
«Ich wurde in Colombo geboren, auf der Insel Ceylon.»
Seine gewandte Art verunsichert Jacob. «Wo ist dein Herr?»
«Oben, beim Studieren: Wünschen Sie, dass ich ihn hole?»
«Das ist nicht nötig – ich gehe hinauf und stelle mich selbst vor.»
«Jawohl, Herr de Zoet, aber der Doktor empfängt nicht gerne Besuch …»
«Oh, er wird nichts dagegen haben, wenn er erfährt, was ich ihm mitgebracht habe …»
Jacob späht durch die Falltür in eine lange, wohlmöblierte Dachstube. In der Mitte steht Marinus’ Cembalo, von dem Jacobs Freund Herr Zwaardecroone vor vielen Wochen in Batavia erzählt hat: Angeblich ist es das einzige Cembalo, das je die Reise nach Japan angetreten hat. Ganz am Ende des Raumes erblickt er einen rotgesichtigen, bärenhaften Europäer von ungefähr fünfzig Jahren mit grauen, zum Zopf gebundenen Haaren und aufgeknöpftem Hemd. Er sitzt im Lichtkegel auf dem Fußboden an einem niedrigen Tisch und zeichnet eine Orchidee in leuchtendem Orange. Jacob klopft an die Falltür. «Guten Tag, Dr. Marinus.»
Der Arzt antwortet nicht.
«Dr. Marinus? Ich freue mich sehr, endlich Ihre Bekanntschaft zu machen …»
Der Arzt zeigt keine Reaktion.
Der Sekretär hebt die Stimme: «Dr. Marinus? Verzeihen Sie die Störung …»
«Aus welchem Mauseloch», Marinus starrt ihn finster an, «sind Sie denn gekrochen?»
«Ich bin vor einer Viertelstunde angekommen, mit der Shenandoah. Mein Name ist …»
«Habe ich Sie nach Ihrem Namen gefragt? Nein: Ich habe nach Ihrem fons et origo gefragt.»
«Domburg, Dr. Marinus, eine Küstenstadt auf Walcheren in Zeeland.»
«Walcheren, sagen Sie? Ich bin mal in Middelburg gewesen.»
«In Middelburg wurde ich erzogen!»
Marinus stößt ein bellendes Gelächter aus. «Niemand wird in diesem Sklaventreiberkaff ‹erzogen›.»
«Vielleicht kann ich Ihre Meinung über die Zeeländer in den nächsten Monaten zum Besseren ändern. Ich wohne im Großen Haus, das heißt, wir sind fast Nachbarn.»
«Sie sind also der Meinung, erzwungene räumliche Nähe führe zu einem guten Nachbarschaftsverhältnis?»
«Ich …» Jacob ist verwundert über Marinus’ offene Angriffslust. «Ich … nun ja …»
«Diese Cymbidium koran wurde im Ziegenfutter gefunden: Während Sie überlegen, welkt sie dahin.»
«Herr Vorstenbosch schlug vor, dass Sie mir vielleicht etwas Blut abzapfen …»
«Mittelalterliche Quacksalberei! Aderlass – und die Lehre von den Temperamenten, auf denen er beruht – wurden vor zwanzig Jahren von Hunter als Humbug entlarvt.»
Aber Blut abzuzapfen, denkt Jacob, ist das Brot eines jeden Arztes. «Aber …»
«Aber, aber, aber? Aber, aber? Aber? Aber, aber, aber, aber, aber?»
«Die Welt ist voll mit Menschen, die darauf schwören.»
«Was nur beweist, dass die Welt voll mit Schwachköpfen ist. Ihre Nase sieht geschwollen aus.»
Jacob streicht über die Beule. «Der ehemalige Faktor Snitker hat mir einen Faustschlag verpasst und …»
«Sie haben nicht die richtige Statur, um sich zu schlagen.» Marinus steht auf und humpelt mit Hilfe eines dicken Stocks auf die Falltür zu. «Baden Sie Ihre Nase zweimal täglich in kaltem Wasser, provozieren Sie einen Streit mit Gerritszoon und halten Sie ihm die Seite mit der Beule hin, damit er sie flach hämmert. Einen schönen Tag noch, Domburger.» Er schlägt mit einem gezielten Stockschlag die Stütze weg, und die Klappe fällt zu.
Der verärgerte Sekretär tritt hinaus ins grelle Sonnenlicht. Sofort ist er von Dolmetscher Ogawa, seinem Diener und zwei Inspektoren umringt: Alle vier sind verschwitzt und machen grimmige Gesichter. «Herr de Zoet», sagt Ogawa, «ich wünsche zu sprechen über ein Buch, das Sie mitgebracht. Es ist wichtige Angelegenheit …»
Jacob wird von Übelkeit und Angst ergriffen, und ihm entgeht der nächste Satz.
Vorstenbosch wird mich nicht retten können, denkt er, und warum sollte er auch?
«… und darum so ein Buch zu finden ist große Überraschung … Herr de Zoet?»
Meine Laufbahn ist zerstört, denkt Jacob, meine Freiheit dahin und Anna verloren …
«Wo», krächzt der Gefangene mühsam, «wird man mich einkerkern?»
Die Lange Straße schlingert. Der Sekretär schließt die Augen.
«‹Ein Kern-kern›?» Ogawa macht sich über ihn lustig. «Mein schlechtes Niederländisch lässt mich im Stich.»
Das Herz des Sekretärs schlägt wie eine defekte Pumpe. «Ist es menschlich, so mit mir zu spielen?»
«Spielen?» Ogawas Verblüffung wird immer größer. «Ist das Sprichwort, Herr de Zoet? In Herrn de Zoets Kiste ich fand Buch von Herrn … Adamu Sumissu.»
Jacob öffnet die Augen: Die Lange Straße steht still. «Adam Smith?»
«‹Adam Smith› – bitte um Verzeihung. Der Wohlstand der Nationen … Sie kennen?»
Ich kenne es, ja, denkt Jacob, aber noch wage ich nicht zu hoffen. «Das englische Original ist ein wenig schwierig zu lesen, darum habe ich mir in Batavia die niederländische Übersetzung gekauft.»
Ogawa sieht ihn erstaunt an. «Dann Adam Smith ist kein Niederländer, sondern Engländer?»
«Darüber wäre er nicht sehr erfreut, Herr Ogawa! Smith war Schotte und lebte in Edinburgh. Aber sprechen Sie wirklich über den Wohlstand der Nationen?»
«Worüber anderes? Ich bin rangakusha – Gelehrter der Hollandkunde. Vor vier Jahren ich habe Der Wohlstand der Nationen von Faktor Hemmij geliehen. Ich fing an zu übersetzen, um –», Ogawas Lippen bereiten sich auf die schwierigen Wörter vor, «Theorie der politischen Ökonomie nach Japan zu bringen. Aber Fürst von Satsuma bot Faktor Hemmij viel Geld, und ich gab zurück. Buch wurde verkauft, bevor ich fertig.»
Ein leuchtender Lorbeerbaum verdeckt die weiß glühende Sonne.
Gott, denkt Jacob, rief ihn aus dem Busch …
Krummschnäbelige Möwen und dürre Milane fliegen kreuz und quer über den blau glasierten Himmel.
… und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich.
«Ich versuche, anderes zu bekommen, aber –», Ogawa zaudert, «aber Schwierigkeiten sind groß.»
Jacob widersteht der Regung, laut aufzulachen wie ein Kind. «Ich verstehe.»
«Dann heute Morgen ich finde Adam Smith in Ihrer Bücherkiste. Sehr große Überraschung, und um aufrichtig zu sprechen, Herr de Zoet, ich möchte kaufen oder für Gebühr mieten …»
Im Garten auf der anderen Straßenseite kreischen Zikaden in klapperndem Kanon.
«Adam Smith ist weder zu kaufen noch zu mieten», sagt der Niederländer, «aber Sie dürfen ihn sich gern – sehr gern sogar – so lange ausleihen, wie Sie möchten.»