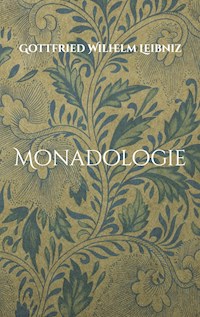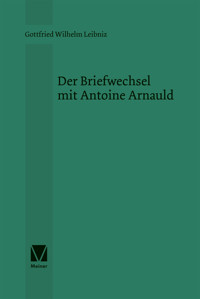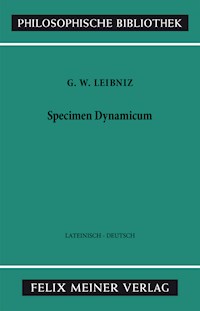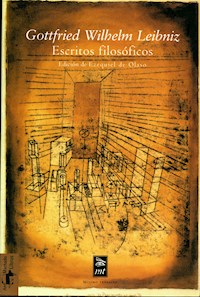Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Theodizee heißt "Rechtfertigung Gottes". Gemeint sind verschiedene Antwortversuche auf die Frage, wie das Leiden in der Welt zu erklären sei vor dem Hintergrund, dass Gott einerseits allmächtig, andererseits gut sei. Konkret geht es um die Frage, warum Gott das Leiden zulässt, wenn er doch die Potenz ("Allmacht") und den Willen ("Güte") besitzen müsste, das Leiden zu verhindern. Der Begriff 'Theodizee' geht auf den Philosophen und frühen Aufklärer Gottfried Wilhelm Leibniz zurück, die Fragestellung selbst existierte aber schon in der Antike. Leibniz unterscheidet drei Arten des Übels: - das malum metaphysicum, das metaphysische Übel, d. h. das Geschaffene ist notwendig unvollkommen, da es sonst mit Gott identisch wäre, - das malum physicum, das physische Übel. Das bedeutet, Schmerz und Leid sind notwendig, da sie vom Schädlichen abhalten und zum Nützlichen drängen und - das malum morale, das moralische Übel, das bezeichnet die zur Abwendung von Gott führende Sünde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 878
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Theodizee
Essais de théodicée sur la bonté de dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal
Gottfried Wilhelm Leibniz
Inhalt:
Gottfried Wilhelm Leibniz – Biografie und Bibliografie
Die Theodizee
Vorrede
Abhandlung über die Uebereinstimmung des Glaubens mit der Vernunft
Abhandlung über die Güte Gottes, die Freiheit des Menschen und den Ursprung des Uebels
Erster Theil
Zweiter Theil
Dritter Theil
Anhang I - Kurze Darstellung der Streitfrage, auf förmliche Schlüsse zurückgeführt
Anhang II - Betrachtungen über das Werk, welches Herr Hobbes im Englischen über die Freiheit, die Nothwendigkeit und den Zufall veröffentlicht hat
Anhang III - Bemerkungen zu der Schrift vom Ursprung des Uebels, welche vor kurzem in England erschienen ist
Anhang IV - Die Sache Gottes vertheidigt durch die Versöhnung seiner Gerechtigkeit mit seinen übrigen Vollkommenheiten und mit all seinen Handlungen
Die Theodizee, G. W. Leibniz
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849618667
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Gottfried Wilhelm Leibniz – Biografie und Bibliografie
Seit 1709 Freiherr von, einer der vielseitigsten Gelehrten und scharfsinnigsten Denker aller Zeiten, geb. 1. Juli 1646 in Leipzig, gest. 14. Nov. 1716 in Hannover. Nachdem er die Nikolaischule in Leipzig, wo sein Vater, ein Jurist, Professor der Moralphilosophie war, besucht hatte, bezog er in seinem 15. Jahr die Universität daselbst, um Rechtswissenschaft zu studieren, widmete sich aber daneben mit Vorliebe philosophischen Studien, besonders unter Leitung des Jakob Thomasius, und veröffentlichte schon 1663 eine Abhandlung: »De principio individui« (wieder hrsg. von Guhrauer, Bresl. 1837), in der er die Prinzipien des Nominalismus verfocht, schloss sich hierauf in Jena dem Mathematiker E. Weigel an, verfasste die Abhandlungen »Specimen difficultatis in jure« (1664) und »De arte combinatoria« (1666), wurde mit seiner Bewerbung um die juristische Doktorwürde von der Universität seiner Vaterstadt seiner Jugend wegen zurückgewiesen, weshalb er Leipzig für immer verließ. Nachdem er noch in demselben Jahr mit der Abhandlung »De casibus perplexis in jure« zu Altdorf promoviert hatte, schloss er sich 1667 dem kurmainzischen Minister Baron J. Chr. von Boyneburg an, für den er mehrere publizistische Schriften ausarbeitete, unter andern 1669 bei Boyneburgs Gesandtschaft nach Polen das »Specimen demonstrationum politicarum pro rege Polonorum eligendo«, dann das »Bedenken, welchergestalt securitas publica interna et externa und status praesens im Reich auf festen Fuß zu stellen«, und das »Consilium aegyptiacum«, das Ludwigs XIV. Ehrgeiz zu einem (nachher von Napoleon I. unternommenen) Zug nach Ägypten anstacheln sollte, um ihn von Deutschland abzulenken. In diesen und in andern Schriften zeigte sich L. als guter deutscher Patriot. In Paris, wohin er 1672 gesandt wurde, und bei einem Ausflug nach London kam L. in persönlichen Verkehr mit den berühmtesten Mathematikern und Naturforschern jener Zeit, namentlich mit Huygens, Rob. Boyle, Collins (mit Newton wechselte er nur Briefe), und die Anregung zur Wiederaufnahme seiner mathematischen Studien, die er dadurch erhielt, führte zur Erfindung der Differentialrechnung, wobei er vielleicht nicht ganz unabhängig von Newton war. Doch veröffentlichte L. sie früher als Newton, verbesserte die Methode wesentlich und machte den Grundgedanken erst recht fruchtbar. Auf einer Reise durch Holland hatte L. eine längere Unterredung mit Spinoza. 1676 trat er als Bibliothekar und Historiograph in hannoversche Dienste, verfasste im Auftrag und Interesse des braunschweigischen Hauses die Schrift »Caesarini Fuerstenerii de jure suprematus ac legationis principum Germaniae« (1677), sammelte Material zur Geschichte des Hauses, zu welchem Zweck er 1687 Wien und Italien besuchte, und arbeitete die Werke: »Codex juris gentium diplomaticus« (Hannov. 1693 bis 1700, 2 Bde.), »Accessiones historicae« (Leipz. u. Hannov. 1698–1700, 2 Bde.), »Scriptores rerum Brunsvicensium illustrationi inservientes« (das. 1707–11, 3 Bde.) und die »Annales imperii occidentis Brunsvicenses« aus, welch letztere damals ungedruckt blieben und erst lange nach seinem Tode von Pertz (das. 1843–45, 2 Bde.) aus L.' Handschriften herausgegeben wurden. Zum Zwecke dieser historischen Arbeiten unternahm er auch Reisen nach Wien und Rom. Seine durch die Jesuiten bis nach China reichenden Verbindungen benutzte er zu etymologischen Forschungen, denen wir die »Collectanea etymologica« (Hannov. 1717) verdanken. Bis 1694 korrespondierte er unter Vermittlung des katholisch gewordenen Landgrafen Ernst von Hessen-Rheinfels fruchtlos mit Pélisson und Bossuet über eine Vereinigung der protestantischen und katholischen Kirche und verfasste zu diesem Zweck das konziliatorische »Systema theologicum« (Par. 1819; deutsch von Räß und Weis, Mainz 1820), das ihn in den Verdacht des Kryptokatholizismus brachte (vgl. Schulz, Über die Entdeckung, dass L. ein Katholik gewesen, Götting. 1827; Kiefl, Der Friedensplan des L. zur Wiedervereinigung der getrennten christlichen Kirchen, Paderb. 1904). Wie er selbst in seiner Person eine »Akademie« darstellte, ohne in irgend einer der Wissenschaften, für die er arbeitete, nur Liebhaber zu sein, so strebte er dahin, seine Verbindungen mit den Höfen in Berlin, Wien und Petersburg zur Gründung von Akademien der Wissenschaften nach dem Muster der Pariser und Londoner an diesen Orten zu benutzen. Durch seinen Einfluss auf die geistreiche Königin Sophie Charlotte, die Großmutter Friedrichs d. Gr., bei der er sich öfter in Charlottenburg aufhielt, setzte er 1700 die Stiftung der Akademie der Wissenschaften in Berlin durch und wurde deren erster Präsident. In Wien unterstützte der ihm gewogene Prinz Engen von Savoyen L.' Plan, der jedoch an dem Widerstand der Jesuiten scheiterte und erst 1846 zur Ausführung kam. In Petersburg gründete Peter d. Gr., der L. 1711 im Lager zu Torgau kennen lernte, die noch heute bestehende Akademie nach L.' Entwurf. Vom Kaiser Karl VI. wurde L. zum Freiherrn und Reichshofrat ernannt, von andern Fürsten durch Titel und Jahrgehalte ausgezeichnet. Er soll in der Neustädter Hofkirche zu Hannover beigesetzt worden sein, wo ihm ein einfaches Monument mit der Aufschrift »Ossa Leibnitii« errichtet wurde. Ein größeres Denkmal am Waterlooplatz in Hannover trägt die von Heyne angegebene Inschrift »Genio Leibnitii«. 1883 ward ihm ein Standbild, von Hähnel modelliert, in seiner Geburtsstadt errichtet. Sein Bildnis s. Tafel »Deutsche Philosophen I«. 1846 wurde das 200jährige Fest seiner Geburt gefeiert und in demselben Jahr die königlich sächsische Gesellschaft der Wissenschaften in Leipzig und die kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien eröffnet.
L.' gelehrte schriftstellerische Tätigkeit äußerte sich vielfach gelegentlich in Briefen und kurzen Aufsätzen, die sich in den Zeitschriften: »Acta Eruditorum«, »Miscellanea Berolinensia«, »Journal des Savants« sowie in den Briefsammlungen von Kortholt (Leipz. 1734–42, 4 Bde.), Gruber (Hannover u. Götting. 1745, 2 Bde.), Michaelis (Götting. 1755), Beesenmeyer (Nürnb. 1788), Feder (Hannov. 1815) und Cousin (im »Journal des Savants«, 1844), in »L.' und Huygens' Briefwechsel mit Papin« (hrsg. von Gerland, Berl. 1881), dem »Briefwechsel mit dem Minister von Bernstorff« (hrsg. von Döbner, Hannov. 1882) und in weitern Veröffentlichungen von Distel, Gerland u.a. finden. Sein philosophisches System stellte er kurz darin der sogen »Monadologie« (1714) sowie in den für den Prinzen Eugen von Savoyen geschriebenen »Principes de la nature et de la grâce« (1717). Ausführliche philosophische Werke von ihm sind die auf Veranlassung der philosophischen Königin Sophie Charlotte von Preußen geschriebenen »Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal« (zuerst Amsterd. 1710, 2 Bde.; hrsg. von Jaucourt, das. 1747, 2 Bde.; von Erdmann, Berl. 1840, 2 Bde.; lat., Tübing. 1771; deutsch, Mainz 1820, ferner in der »Philosophischen Bibliothek« von J. H. v. Kirchmann, Berl. 1877, und in Reclams Universal-Bibliothek von Habs, Leipz. 1884) und »Nouveaux essais sur l'entendement humain« (deutsch von Schaarschmidt, 2. Aufl., Leipz. 1904), eine in Form eines Dialogs durchgeführte Prüfung des Lockeschen Werkes über das Erkenntnisvermögen, die erst lange nach L.' Tod bekannt wurde und den wichtigsten Teil der von Raspe herausgegebenen »Œuvres philosophiques de feu M. de L.« (Amsterd. u. Leipz. 1765) ausmacht. Die erste (unvollständige) Ausgabe der Leibnizschen Werke besorgte Dutens (Genf 1768, 6 Bde.); neuere Gesamtausgaben auf Grundlage der Handschriften der hannoverschen Bibliothek wurden begonnen von Pertz (erste Folge: »Historische Schriften«, Hannov. 1843–47, 4 Bde.; zweite Folge: »Briefwechsel mit Arnauld und dem Landgrafen Ernst von Hessen-Rheinfels«, das. 1846; dritte Folge: »Mathematische Schriften«, Berl. u. Halle 1849–1862, 7 Bde., hrsg. von Gerhardt, der auch L.' »Briefwechsel mit Mathematikern« herausgab, Bd. 1, Berl. 1898) und von O. Klopp (Hannov. 1862–84; 11 Bde.), beide unvollendet. Die philosophischen Schriften gaben Erdmann (Berl. 1839, 2 Bde.), Janet (St.-Cloud 1866, 2 Bde.) heraus und am vollständigsten Gerhardt (Berl. 1875–90, 7 Bde.). L.' »Deutsche Schriften« gab Guhrauer (Berl. 1838–40, 2 Bde.), »Lettres et opuscules inédits de L.«, darunter eine »Réfutation inédite de Spinoza par L.« (Par. 1854), Foucher de Careil heraus, der ebenfalls eine auf 20 Bände berechnete Gesamtausgabe begonnen hat, von der aber nur 7 Bände (1859–75) erschienen sind; den Briefwechsel L.' und die Leibniz-Handschriften in der königlichen Bibliothek in Hannover hat Bodemann beschrieben (Hannov. 1889 u. 1895). In der »Philosophischen Bibliothek« begann Cassirer eine Ausgabe der »Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie« (Leipz. 1903 f.). Eine vollständige Ausgabe der Werke ist von den Akademien in Paris und Berlin in Aussicht genommen.
Der Grundzug von L.' ganzem Wesen, auch von seiner wissenschaftlichen Tätigkeit, ist das Streben nach Vereinigung des Verschiedenen, nach »Harmonie«, indem er in allen Lehren etwas Wahres erblickte. Wie er auf religiösem Gebiet Einheit zu schaffen versuchte, so wollte er auch auf philosophischem die scheinbar entgegengesetzten Weltanschauungen miteinander verbinden, in ähnlicher Weise, wie das Platon und Aristoteles schon versucht hatten. Er erzählt selbst von sich, bereits als 15jähriger Jüngling, nachdem er mit den alten Philosophen und den Scholastikern schon bekannt gewesen sei, habe er sich in einem Wäldchen bei Leipzig, das Rosental genannt, einsam ergangen, um bei sich zu erwägen, ob er der teleologischen Anschauung des Aristoteles oder der mechanischen Demokrits sich zuwenden solle. Damals habe der Mechanismus bei ihm die Oberhand bekommen, später aber beim Aufsuchen der letzten Gründe für die Bewegungsgesetze sei er zur Metaphysik des Aristoteles zurückgekehrt. So zeigte sich zwar auch der Gegensatz bei ihm, aber er ist durch die Harmonie bald überwunden. L. knüpft in seiner Philosophie an den Cartesianischen Dualismus an, durch den jede direkte Einwirkung des Geistes auf die Materie und umgekehrt unmöglich gemacht wird. Es kommt darauf an, den einen Gegensatz auf den andern zurückzuführen. Der Körper (Materie) ist seinem Wesen nach (in seinen letzten Bestandteilen, den einfachen Substanzen, aus denen er zusammengesetzt ist) vom Geist nicht verschieden, dessen Wesen darin besteht, dass er eine einfache Substanz, und dass er als solche tätige, lebendige Kraft ist. Der »Körper« (Materie) als »Ausdehnung« ist als solcher nicht wirklich, sondern bloßes »Phänomen«, und das einzige, was wahrhaft existiert, sind die einfachen Substanzen, die »Monaden« (Einheiten), die »wahren Atome der Natur«. Dieselben sind (als »einfache«) sämtlich einerlei Art und, da der uns bekannte Geist, unsre eigne Seele, selbst eine einfache Substanz ist, sämtlich »geistiger« Natur und werden von L. ausdrücklich als »Seelen« (âmes) bezeichnet.
Sowohl der quantitative Monismus Spinozas, der nur eine einzige Substanz, als der qualitative Dualismus des Cartesius, der zweierlei Arten von Substanzen, geistige und materielle, kennt (vgl. Monismus und Dualismus), ist dadurch beseitigt; jenem setzt L. den Pluralismus (der unzählige), diesem den Spiritualismus (der nur geistige Substanzen kennt) entgegen. Jede einfache Substanz (»Monade«) ist unteilbar; das Allgemeine (Geist wie Materie) hat als solches keine, und nur die Individuen besitzen wirkliche Existenz. Eine Bestätigung dafür, dass die ausgedehnte Materie als solche nicht existiere, fand L. in der mittels des Mikroskops durch Leeuwenhoek und Swammerdam gemachten Entdeckung der Infusorien im Wassertropfen, die beweise, dass auch in dem anscheinend Leblosen noch zahllose lebendige Wesen enthalten seien. Sie gehört als »phaenomenon bene fundatum« lediglich der Erscheinungs-, keineswegs aber der Welt des an sich Seienden (der Monadenwelt) an, die als die Gesamtheit immaterieller, einfacher Substanzen selbst immateriell (eine Geisterwelt) ist. Die Monaden, obgleich sämtlich gleichartig, sind einander doch keineswegs gleich; vielmehr ist nach dem von L. aufgestellten Prinzip de identitate indiscernibilium (von der Einerleiheit des Nichtzuunterscheidenden) jede von jeder unterschieden. Da dieselben aber als immaterielle Wesen keine äußerlich wahrnehmbaren Verschiedenheiten besitzen können, ihre Natur jedoch nur darin besteht, dass sie wirksame Kräfte sind, so kann ihre Verschiedenheit nur eine innere, und zwar nur in dem verschiedenen Grad ihrer Wirksamkeit gelegen sein. Sämtliche Monaden stellen eine Reihe stufenweise, höher und niedriger, entwickelter Kraftwesen dar, deren unterste den niedrigsten, deren höchste den höchsten Erscheinungen der wirklichen (Körper- und Geistes-) Welt zugrunde liegen. Auch der menschliche Leib ist als solcher ein Aggregat von Monaden, die zu einer solchen (der Seele) in dem Verhältnis niedriger zur höheren stehen. So ständen der gegenseitigen Einwirkung von Seele und Leib auseinander von Seiten der Qualität, da sie gleichartig sind, nichts mehr entgegen; aber L. sagt: Die Wirksamkeit jeder Monas als einer »wirksamen Kraft« kann keine auf andre »übergehende« (transeunte), sondern nur eine auf das Innere der Monas selbst beschränkte sein; die Monaden, Kraftwesen, haben keine Fenster, es kommt nichts aus ihnen heraus und nichts in sie hinein. Da nun dasjenige, was innerhalb eines immateriellen Wesens geschieht, selbst nicht anders als immateriell sein kann, so muss auch alles, was wahrhaft geschieht, immaterieller (geistiger) Natur sein. Geistige Wesen und deren (gleichfalls) geistige Zustände machen allein die wahrhafte Welt aus, welche die wirkliche Grundlage der sinnlich erscheinenden Welt bildet. Die in dem Innern jeder Monade nacheinander ablaufenden Zustände bilden eine Reihe, in der jedes folgende Glied (nach dem von L. zuerst aufgestellten Prinzip des »zureichenden Grundes«) seinen Grund in dem vorhergegangenen hat und zugleich selbst den Grund für die nachfolgenden enthält, so dass »die Gegenwart schwanger mit der Zukunft« ist. Allein da keine Monade eine Anregung von außen empfangen kann, so gleicht jede einzelne Monade einem »geistigen Automaten«, der seine Bewegungen unabhängig von allem, was außer ihm ist und sich selbst bewegt, vollzieht. Eine Verschiedenheit unter den Monaden wird dabei dadurch begründet, dass ihre Perzeptionen, Vorstellungen, sämtlich dunkle oder wenigstens teilweise klare oder durchaus klare Bewußtseinsakte sind. Jene nehmen als »schlummernde« (Stein-, Pflanzen-, Tier-) Seelen die tiefste, letztere, die »göttliche« Seele, die höchste, die menschliche Seele aber nimmt als teilweise klares, teilweise dunkles Bewusstsein eine mittlere Stellung ein. Die Möglichkeit einer Übereinstimmung zwischen den Zuständen zweier oder mehrerer Monaden, z. B. der Seele und den Monaden des Leibes, hängt davon ab, ob auch die Bewegungen zweier oder mehrerer »Automaten« in Harmonie gebracht werden können. Dies kann dadurch bewirkt werden, dass Gott (wie der »ungeschickte« Uhrmacher die Zeiger seiner Uhren) die Zustände des einen gelegentlich nach jenen des andern regulierte, wodurch er zum »deus ex machina« herabgewürdigt würde, oder dadurch, dass Gott (wie der »geschickte« Uhrmacher seine Uhrwerke) die Natur jeder einzelnen Monas von Ewigkeit an so in Übereinstimmung mit der Natur aller übrigen angelegt hätte, dass ihre inneren Zustände mit jenen aller übrigen für alle Ewigkeit hinaus im Einklang bleiben müssten, was seiner als des zugleich intelligentesten und mächtigsten Wesens vollkommen würdig wäre. Es ist anzunehmen, dass Gott, wenn er überhaupt existiert, diese Harmonie aller Monaden und ihrer inneren Zustände untereinander nicht nur von Anfang an erkannt, sondern gewollt und hergestellt, d.h. dass er eine prästabilierte (universelle) Harmonie zwischen denselben geschaffen habe. Dass Gott aber existiert, folgt nach L. direkt aus seinem Begriff als dem eines Wesens, das alle Eigenschaften (also auch die Realität) im höchsten Grad in sich vereinigt, in dem sie nebeneinander möglich sind. Letzterer Zusatz ist notwendig, weil es Eigenschaften gibt (z. B. Heiligkeit und Allmacht), die zugleich im höchsten Grade nicht möglich sind. So verträgt es sich mit Gottes Heiligkeit nicht, das Böse zu tun, während dies aus seiner Allmacht als möglich folgen müsste. Aus dieser Selbsteinschränkung der göttlichen Eigenschaften folgt, dass Gott zwar alle möglichen Welten denken, aber nur die beste unter ihnen wollen und demgemäß schaffen kann. Die Existenz der bestehenden Welt als der besten unter allen möglichen (Optimismus) folgt daher unmittelbar aus Gottes eigner Existenz; er ist die Urmonas, zu der sich alle übrigen Monaden wie »Effulgurationen« verhalten. Durch die Behauptung, dass jede andre mögliche Welt notwendig unvollkommener wäre als die wirklich vorhandene, wird das Vorhandensein mannigfacher Übel und Unvollkommenheiten (z. B. der Sünde und des Bösen) in dieser keineswegs geleugnet, sondern nur die Annahme, dass eine Welt ohne diese überhaupt möglich wäre. Die Realisierung der besten Welt erfolgt dem göttlichen Weltplan gemäß (teleologisch) nach Zweck-, aber zugleich (mechanisch) durch wirkende Ursachen; jene, das Reich der Gnade, nach dem der Weltlauf willkürlich (von Gottes »Gnade« abhängig), diese, das Reich der Natur, nach dem er notwendig (von seinem Willen unabhängig) erscheint, sind beide wesentlich eins. Zwischen Freiheit und Notwendigkeit (Moral- und Naturgesetz) herrscht dieselbe prästabilierte Harmonie wie zwischen den einzelnen Monaden. Die Natur führt zur Gnade, und diese vervollkommnet die Natur, indem sie sich ihrer bedient; Gott als »Monarch« und Gott als »Architekt« der Welt stehen miteinander von Ewigkeit her in vollkommenster Übereinstimmung.
L. erkannte zuerst die Bedeutung der Zeichen und der Bezeichnung für die Mathematik, er erfasste ihr innerstes Wesen als Symbolik und sah ein, dass die bloße Kombination der Symbole von selbst zu neuen Entdeckungen führen müsse. Unsre ganze heutige Bezeichnung geht auf L. zurück (Punkt als Multiplikations-, Doppelpunkt als Divisionszeichen, die Indexbezeichnung etc.). Man kann L. als den Entdecker des Operationskalküls bezeichnen, denn er war sowohl der erste Entdecker der Determinanten, als er auch den Gedanken eines Logikkalküls gefasst hat. Auch den geometrischen Kalkül hat er mehrfach behandelt und seinem Wesen nach richtig erfasst. Das Kongruenzaxiom in der Fassung Bolzanos kommt bei L. wiederholt vor. Viele heute ganz geläufige Fachausdrücke gehen auf L. zurück (Funktion, Exponentialgröße, Analysis, Äquipollenz etc.). Über die Differentialrechnung s. oben. Erwähnenswert sind noch die Entwürfe einer Universalsprache und Universalschrift, die L. sein ganzes Leben hindurch beschäftigten. Die eigentliche Tiefe seiner Gedanken ist von seinem unmittelbaren Nachfolger, dem nüchternen Systematiker Christian Wolff, nicht voll erkannt und erst von Späteren, wie Lessing, Schelling, Hegel, Herbart, Lotze u.a., richtig gewürdigt worden.
Über L. haben unter andern geschrieben: Fontenelle (1716), Bailly (1769), v. Eccard (hrsg. von Murr, 1779), Jaucourt (1757), Kästner (1769), am gründlichsten Guhrauer (»G. W. Freiherr von L., eine Biographie«, Bresl. 1842, 2 Bde.; mit Nachträgen 1846), E. Pfleiderer (»L. als Patriot, Staatsmann und Bildungsträger«, Leipz. 1870), Kirchner (»G. W. L., sein Leben und Denken«, Köthen 1877) und J. Th. Merz (Lond. 1884; deutsch, Heidelb. 1886). Über seine Philosophie vgl. Ludw. Feuerbach, Darstellung, Entwickelung und Kritik der Leibnizschen Philosophie (Ansb. 1837); folgende Schriften von Robert Zimmermann: L.' Monadologie (Wien 1847), L. und Herbart (das. 1849), Das Rechtsprinzip bei L. (das. 1852), Über L.' Konzeptualismus (das. 1854), L. und Lessing (das. 1855); Kuno Fischer, L. und seine Schule (4. Aufl., Heidelb. 1902); Pichler, Die Theologie des L. (Münch. 1869, 2 Bde.); Stein, L. und Spinoza (Berl. 1890); Dillmann, Eine neue Darstellung der Leibnizschen Monadenlehre (Leipz. 1891); Vahlen, L. als Schriftsteller (Berl. 1897); Hahn, Die Entwickelung der Leibnizschen Metaphysik und der Einfluss der Mathematik auf dieselbe bis zum Jahre 1686 (Halle 1899); Hohenemser, Die Lehre von den kleinen Vorstellungen bei L. (Heidelb. 1899); Sticker, Die Leibnizschen Begriffe der Perzeption und Apperzeption (Bonn 1900); Cassirer, L.' System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen (Leipz. 1902); H. Hoffmann, Die Leibnizsche Religionsphilosophie in ihrer geschichtlichen Stellung (Tübing. 1903).
Die Theodizee
Vorrede
Zu allen Zeiten hat die grosse Masse der Menschen ihre Gottesverehrung in Formalitäten verlegt; die wahre Frömmigkeit, d.h. das Licht und die Tugend ist niemals das Erbtheil der Menge gewesen; darüber darf man sich nicht wundern, denn nichts stimmt mehr zur menschlichen Schwachheit. Das Aeussere drängt sich uns auf; das Innere verlangt dagegen Erwägungen, zu denen nur Wenige sich die Fähigkeit erwerben. Die wahre Frömmigkeit besteht in Grundsätzen und deren thätiger Befolgung; die Formalitäten der Gottesverehrung ahmen jener nur nach und sind von zweierlei Art; die einen bestehen in ceremoniellen Handlungen, die anderen in Glaubensformeln. Die Ceremonien ähneln den tugendhaften Handlungen und die Glaubensformeln sind gleichsam Schatten der Wahrheit und nähern sich mehr oder weniger dem reinen Lichte. Alle diese Formalitäten wären löblich, wenn die, welche sie erfunden haben, sie so eingerichtet hätten, dass sie im Stande wären, das zu bewahren und auszudrücken, wovon sie die Abbilder sind, und wenn die religiösen Ceremonien, und die kirchliche Zucht, so wie die Regeln der Gemeinschaften und die menschlichen Gesetze dem göttlichen Gesetze gleichsam als eine Art Einhegung dienten, welche uns von der Annäherung an das Laster zurückhielte, uns an das Gute gewöhnte und uns mit der Tugend vertraut machte. Dies war das Ziel von Moses und von andern guten Gesetzgebern; es war das Ziel der weisen Begründer der religiösen Orden und vor allen das Ziel von Jesus Christus, des göttlichen Stifters der reinsten und aufgeklärtesten Religion. Ebenso verhält es sich mit den Glaubensformularen; man könnte sie zulassen, wenn sie überall mit den Heilswahrheiten übereinstimmten, selbst wenn sie die Wahrheit, um die es sich handelt, auch nicht ganz enthielten. Allein nur zu oft trifft es sich, dass die Gottesverehrung in äusserlichen Handlungen erstickt wird und dass das göttliche Licht durch die Meinungen der Menschen verdunkelt wird.
Die Heiden, welche die Erde vor der Gründung des Christenthums bewohnten, hatten nur eine Art von Formalitäten; sie hatten Ceremonien in ihrer Gottesverehrung, aber sie kannten keine Glaubensartikel und sie hatten nie daran gedacht, aus ihrer dogmatischen Gotteslehre Formeln zurecht zu machen. Sie wussten nicht, ob ihre Götter wirkliche Personen oder nur Symbole von Naturmächten, wie von der Sonne, den Planeten und den Elementen waren. Ihre Mysterien bestanden nicht aus schwer verständlichen Glaubenssätzen, sondern nur in gewissen geheimen Verrichtungen, von welchen die weltlichen Leute, d.h. die nicht Eingeweihten, ausgeschlossen waren. Diese Verrichtungen waren oft lächerlich und widersinnig und man musste sie geheim halten, um sie vor Verachtung zu schützen. Die Heiden hatten ihren Aberglauben; sie rühmten sich der Wunder; alles war bei ihnen voll von Orakeln, Vogelschauen, Prophezeihungen und Offenbarungen; die Priester erfanden Zeichen von dem Zorne und von der Liebe der Götter, deren Dolmetscher zu sein sie behaupteten. Sie beabsichtigten, die Geister durch Furcht und Hoffnung in Bezug auf die menschlichen Ereignisse zu leiten; aber die grosse Zukunft eines jenseitigen Lebens war dabei kaum in Aussicht genommen; man gab sich nicht die Mühe, den Menschen wahre Ansichten von Gott und der Seele beizubringen.
Von allen Völkern des Alterthums waren es nur die Hebräer, welche öffentliche Glaubenssätze in ihrer Religion hatten. Abraham und Moses haben den Glauben an einen einzigen Gott begründet, welcher die Quelle alles Guten und der Urheber aller Dinge ist. Die Hebräer sprechen von ihm in einer, der erhabenen Substanz würdigen Weise und man staunt, die Bewohner eines kleinen Stückes der Erde aufgeklärter als den übrigen Theil der Menschheit zu sehen. Die Weisen bei den übrigen Völkern haben vielleicht über Gott mitunter dasselbe ausgesprochen, aber sie sind nicht so glücklich gewesen, dass man ihnen genügend gefolgt wäre und dass ihre Lehre zum Gesetz erhoben worden wäre. Indess hatte Moses die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele in seinem Gesetze nicht aufgenommen. Diese Lehre stimmte mit seinen Ansichten, sie ging von Hand zu Hand, aber sie war in keiner gemeinverständlichen Weise anerkannt; erst Jesus lüftete den Schleier und obgleich ohne Macht in seinen Händen, lehrte er doch mit der ganzen Macht eines Gesetzgebers, dass die unsterblichen Seelen in ein anderes Leben übergehen, wo sie den Lohn für ihre Thaten erhalten sollen. Schon Moses hatte gute Vorstellungen von der Grösse und Güte Gottes geäussert, mit denen viele der gebildeten Völker heute übereinstimmen; aber erst Jesus Christus sprach alle daraus sich ergebenden Folgesätze aus und er liess erkennen, dass die göttliche Güte und Gerechtigkeit vollständig aus dem erhelle, was Gott für die Seelen bereite.
Ich will hier nicht auf die übrigen Punkte der christlichen Lehre eingehen, sondern nur zeigen, wie Jesus Christus es erreichte, dass die natürliche Religion zum Gesetz erhoben wurde und sie das Ansehn öffentlicher Glaubenssätze erhielt. Er allein vollbrachte das, was viele Philosophen vergeblich versucht hatten und als die Christen endlich die Oberhand in dem Römischen Reiche erlangt hatten, welches den bessern Theil der bekannten Erde befasste, ward die Religion der Weisen zur Religion der Völker. Auch Mahomed entfernte sich demnächst nicht von diesen grossen Lehrsätzen der natürlichen Religion und seine Anhänger verbreiteten sie unter die entferntesten Völker Asien's und Afrika's, zu denen das Christenthum noch nicht gebracht worden war. Sie zerstörten in vielen Ländern den heidnischen Aberglauben, welcher der wahrhaften Lehre von der Einheit Gottes und der Unsterblichkeit der Seelen entgegenstand.
Es erhellt, dass Jesus Christus in Vollendung dessen, was Moses begonnen, verlangt hat, dass die Gottheit nicht blos der Gegenstand unserer Furcht und Verehrung, sondern auch unserer Liebe und Zuneigung sei. Damit machte er die Menschen schon im Voraus glücklich und gab ihnen einen Vorgeschmack von der kommenden Seligkeit; denn nichts ist angenehmer, als das zu lieben, was der Liebe würdig ist. Die Liebe ist derjenige Gemüthszustand, welcher sich an den Vollkommenheiten des geliebten Gegenstandes erfreut und Gott ist dieser vollkommenste und erfreulichste Gegenstand. Es genügt, um ihn zu lieben, dass man seine Vollkommenheiten betrachte und dies ist leicht, weil wir deren Vorstellungen in uns selbst vorfinden. Die Vollkommenheiten Gottes sind dieselben, wie die unserer Seele, nur dass Gott sie in unbegrenztem Maasse besitzt. Er ist der Ozean, von dem wir nur Tropfen empfangen haben; in Uns wohnt einige Macht, einiges Wissen, einige Güte; aber in Gott sind sie in aller Fülle vorhanden. Die Ordnung, das Ebenmaass, die Uebereinstimmung entzücken uns; die Malerei und die Musik sind Funken davon; aber Gott ist ganz Ordnung, er bewahrt stets die Richtigkeit der Verhältnisse und er bewirkt die allgemeine Uebereinstimmung. Alles Gute ist eine Ausbreitung seiner Strahlen.
Hieraus erhellt, dass die wahre Frömmigkeit und selbst das wahre Glück in der Liebe zu Gott besteht, aber in einer verständigen Liebe, deren Kraft mit Einsicht verbunden ist. Diese Art der Liebe lässt an den guten Handlungen jenes Vergnügen finden, welches der Tugend eine Stütze gewährt und welches indem es alles auf Gott, wie auf den Mittelpunkt bezieht, das Menschliche in das Göttliche überführt. Denn indem man seine Pflicht thut und der Vernunft gehorcht, erfüllt man die Vorschriften der höchsten Vernunft; man richtet alle seine Absichten auf das gemeine Beste, welches von dem Ruhme Gottes nicht verschieden ist. Man findet alsdann, dass nichts den eigenen Interessen mehr entspricht, als die allgemeinen Interessen zu den seinigen zu machen und man sorgt für sich selbst, wenn man mit Freuden den wahren Vortheilen der Menschheit dient. Mag unser Streben Erfolg haben oder nicht, so sind wir doch mit dem, was geschieht, zufrieden, sobald wir uns in den Willen Gottes ergeben und wir wissen, dass das, was er will, das Bessere ist. Aber schon ehe Gott seinen Willen durch die Ereignisse erkennbar macht, trachtet man, ihm entgegen zu kommen, indem man das thut, was seinen Vorschriften am meisten zu entsprechen scheint. Bei einer solchen Gemüthsverfassung, werden wir durch den schlechten Erfolg nicht entmuthigt und beklagen nur unsere Fehler. Trotz der Undankbarkeit der Menschen lassen wir in der Uebung unserer auf das Wohlthun gerichteten Neigungen nicht nach. Unsere Liebe ist demüthig und voll Maass; sie strebt nicht nach der Herrschaft. Gleich aufmerksam auf unsere Fehler, wie auf die Talente Anderer, sind wir immer bereit, unsere Handlungen zu prüfen und die der andern zu entschuldigen und wieder gut zu machen, lediglich um uns selbst zu vervollkommnen und Niemandem Unrecht zu thun. Ohne Mildthätigkeit giebt es keine Frömmigkeit und man kann keine aufrichtige Gottesfurcht zeigen, wenn man nicht dienstfertig und wohlthätig ist.
Gute Anlagen, eine vortheilhafte Erziehung, der Verkehr mit frommen und tugendhaften Personen können viel dazu beitragen, dass unsere Seele zu solcher schönen Verfassung gelangt; aber das was sie darin am meisten befestigt, sind die guten Grundsätze. Ich habe es schon gesagt; man muss die Einsicht mit dem Eifer verbinden; die Vervollkommnung unseres Geistes muss der unseres Willens die Vollendung geben. Das tugendhafte Handeln kann ebenso wie das lasterhafte Handeln die Wirkung einer blosen Gewohnheit sein; man kann daran Geschmack finden; wenn aber die Tugend vernünftig ist, wenn sie sich auf Gott, als die höchste Vernunft der Dinge bezieht, so ist sie auf die Erkenntniss gegründet. Man könnte Gott nicht lieben, wenn man seine Vollkommenheiten nicht kennte und diese Kenntniss schliesst die Grundsätze der wahrhaften Frömmigkeit in sich. Das Ziel der wahren Religion soll dahin gehn, dass sie dem Gemüthe der Menschen eingepflanzt werde. Dennoch haben sich sonderbarer Weise die Menschen und die Lehrer der Religion oft weit von diesem Ziele entfernt. Gegen den Willen unseres göttlichen Herrn ist die Andacht oft in Ceremonien umgewandelt und die Lehre mit Formeln überladen worden. Sehr oft waren diese Ceremonien nicht dazu angethan, um die Uebung der Tugend zu stützen; und die Formeln waren oft nicht klar und verständlich. Sollte man es glauben, die Christen haben gemeint gottergeben sein zu können, ohne doch ihren Nächsten zu lieben, und fromm, ohne Gott zu lieben. Ja man hat wohl auch gemeint, seinen Nächsten lieben zu können, ohne ihm nützlich zu sein und Gott zu lieben, ohne ihn zu kennen. Mehrere Jahrhunderte sind verflossen, ohne dass die öffentliche Meinung diesen Mangel bemerkt hat und noch sind grosse Ueberreste von dem Reiche der Finsterniss vorhanden. Man hört oft Leute, die selbst mit dem Unterricht zu thun haben, viel von der Frömmigkeit, von der Hingebung, von der Religion sprechen, aber man findet sie sehr wenig von den göttlichen Vollkommenheiten unterrichtet. Sie haben falsche Vorstellungen von der Güte und Gerechtigkeit des Herrn der Welt; sie bilden sich einen Gott, der weder der Liebe, noch der Nachahmung werth ist.
Dergleichen ist nach meiner Meinung mit gefährlichen Folgen verknüpft, weil es von ausserordentlicher Wichtigkeit ist, dass die unmittelbare Quelle der Frömmigkeit nicht verunreinigt werde. Die alten Irrthümer derer, welche die Gottheit angeklagt und einen schlechten Herrscher aus ihr gemacht haben, sind in unsern Tagen mitunter wieder hervorgesucht worden; man beruft sich auf die unwiderstehliche Macht Gottes, während man vielmehr seine erhabene Güte hätte darlegen sollen; man hat eine despotische Gewalt dahingestellt, wo man sie als eine von der höchsten Weisheit geleitete Macht hätte begreifen sollen. Diese Ansichten, die so grosses Unheil stiften können, werden, so viel ich bemerkt habe, vorzüglich auf die verworrenen Begriffe gestützt, welche man sich von der Freiheit, Nothwendigkeit und dem Schicksal gebildet hat, und ich habe mehr als einmal, wo die Gelegenheit sich dazu bot, zur Feder gegriffen, um diese wichtigen Begriffe deutlicher zu machen. Indess habe ich zuletzt mich genöthigt gesehen, meine Gedanken über all diese, mit einander verknüpften Dinge zu sammeln und dem Publikum mitzutheilen. Dies ist in den Abhandlungen geschehen, welche ich hier dem Publikum übergebe und welche über die Güte Gottes, über die Freiheit des Menschen und den Ursprung des Bösen handeln.
Es giebt zwei Labyrinthe, in denen unsere Vernunft sich sehr oft verirrt; das eine betrifft die grosse Frage von der Freiheit und der Nothwendigkeit, insbesondere in Bezug auf die Hervorbringung und den Ursprung des Uebels; das andere besteht in der Behandlung der Stetigkeit und der untheilbaren Dinge, welche deren Elemente zu sein scheinen und wo die Untersuchung des Unendlichen mit hinzutreten muss. Das erste Labyrinth umfasst beinahe das ganze menschliche Geschlecht, während das letzte nur die Philosophen beschäftigt. Vielleicht habe ich ein andermal die Gelegenheit, mich über das letztere auszusprechen und zu zeigen, dass in Folge mangelhaften Verständnisses der Natur der Substanz und des Stoffes, man falsche Sätze aufgestellt hat, die dann zu unübersteiglichen Schwierigkeiten führen, während letztere vielmehr zur Verwerfung jener Sätze benutzt werden sollten. Wenn jedoch die Erkenntniss der Stetigkeit für die philosophische Untersuchung von Wichtigkeit ist, so ist die Erkenntniss der Nothwendigkeit es nicht weniger für das Handeln und sie bildet sammt den mit ihr verknüpften Dingen über die Freiheit des Menschen und die Gerechtigkeit Gottes den Gegenstand dieser Schrift.
Zu allen Zeiten hat die Menschen ein Trugschluss beunruhigt, welchen die Alten die faule Vernunft nannten, weil er dahin führt, nichts zu thun oder wenigstens sich um nichts zu kümmern und nur seinen Neigungen zum unmittelbaren Genusse zu folgen. Denn, sagte man, wenn das Zukünftige nothwendig ist, so wird das, was kommen muss, eintreten, gleichviel, was ich auch thun mag. Nun ist das Kommende nothwendig, sagte man, entweder weil die Gottheit alles voraussieht und sie selbst bei Leitung der Dinge dieser Welt es vorausbestimmt hat, oder weil vermöge der Verknüpfung der Dinge alles nothwendig eintritt, alles in Folge der Natur der Wahrheit selbst, die in den Aussprüchen, welche man über die kommenden Ereignisse machen kann, so bestimmt ist, wie es in allen andern Aussprüchen der Fall ist. Denn der Ausspruch an sich muss immer entweder wahr oder falsch sein, wenn man auch nicht immer weiss, welches von beiden er ist. Alle diese bestimmenden Gründe treffen, trotz ihrer anscheinenden Verschiedenheit, gleich Linien in einen Mittelpunkt zusammen; denn es giebt eine Wahrheit für die kommenden Ereignisse, welche durch deren Ursachen voraus bestimmt und indem Gott diese Ursachen angeordnet hat, hat er auch im Voraus die Ereignisse mit bestimmt.
Die falsche Auffassung des Begriffes der Nothwendigkeit, hat in ihrer Anwendung auf das Handeln, zu dem sogenannten Mohamedanischen Schicksal, dem Schicksal bei den Türken, Anlass gegeben, weil man von den Türken meint, dass sie den Gefahren nicht aus dem Wege gehen und selbst die Orte nicht verlassen, wo die Pest herrscht und zwar aus Gründen, welche den erwähnten gleichen. Denn das sogenannte Schicksal bei den Stoikern war nicht so schwarz, als man es macht; es entband die Menschen nicht von der Sorge für ihre Angelegenheiten, sondern wollte ihnen in Bezug auf die Ereignisse vielmehr nur eine Seelenruhe vermittelst der Betrachtung der Nothwendigkeit einflössen, welche unsere Sorgen und Kummer als nutzlos erscheinen lässt. In diesem Punkte entfernten diese Philosophen sich nicht ganz von der Lehre unseres Herrn, welcher auch von dieser Sorge für den nächsten Tag abräth und sie mit den nutzlosen Anstrengungen vergleicht, durch welche ein Mensch sich abmüht, um seine Körpergrösse zu verlängern.
Allerdings können diese Lehren der Stoiker (und vielleicht auch die von einigen berühmten Philosophen unserer Zeit), welche sich auf diese angebliche Nothwendigkeit beschränken, nur eine erzwungene Ruhe gewähren, während unser Herr erhabenere Gedanken einflösst und uns selbst das Mittel für unsere Zufriedenheit lehrt, indem er uns versichert, dass der allgütige und allweise Gott für alles sorgt und selbst kein Haar auf unserem Kopfe vernachlässigt und wir ihm also voll vertrauen können. Denn, wenn wir ihn zu begreifen vermöchten, so würden wir einsehen, dass wir nichts besseres (in unbeschränktem Sinne für uns) zu wünschen brauchten, als das, was er thut. Dies ist genau so, als wenn man den Menschen sagte: Thut eure Pflichten und seid mit dem, was kommt, zufrieden, nicht blos deshalb, weil ihr der göttlichen Vorsehung oder der Natur der Dinge keinen Widerstand leisten könnt (was allerdings für unsere Ruhe zureichen möchte, aber nicht für unsere Zufriedenheit), sondern auch deshalb, weil ihr es mit einem guten Herrn zu thun habt. Man könnte dies das christliche Schicksal nennen.
Indess zeigt sich, dass die Mehrzahl der Menschen und selbst der Christen bei ihren Handeln auch etwas Mischung mit dem türkischen Schicksal eintreten lassen, wenn sie sich dessen auch nicht genügend bewusst sind. Sie verharren allerdings bei offenbaren Gefahren, oder bei sichern und grossen Glücksfällen nicht in Unthätigkeit und Nachlässigkeit; denn sie werden z.B. nicht versäumen, ein einstürzendes Haus zu verlassen oder sich von einem Abgrunde, der auf ihrem Wege sich öffnet, wegzuwenden; sie werden auch in der Erde nach dem Schatz graben, der schon halb entdeckt ist, und nicht warten, bis das Schicksal ihn vollends hervortreten lässt; ist dagegen das Gute oder das Uebel noch entfernt und zweifelhaft und das Schutzmittel beschwerlich oder nicht genehm, so gilt uns die faule Vernunft für gut. Handelt es sich z.B. um die Erhaltung unserer Gesundheit und selbst unseres Lebens vermittelst einer zuträglichen Lebensweise, so entgegnen die Leute, denen man einen solchen Rath giebt, sehr oft, dass unsere Tage gezählt seien und dass es vergeblich sei, gegen das zu kämpfen, was Gott uns bestimmt habe. Dabei ergreifen aber dieselben Leute mit Hast die lächerlichsten Mittel, wenn das vernachlässigte Uebel sich nähert. Ebenso bringt man ähnliche Gründe da hervor, wo das Ueberlegen etwas schwierig wird; z.B. wenn man sich fragt, quod vitae sectabor iter? welchen Beruf man wählen solle? oder wenn es sich um eine Heirath handelt, oder um einen Krieg, den man unternehmen soll, oder um eine Schlacht, die es geben wird; denn in allen diesen Fällen werden Manche die Mühe des Ueberlegens zu vermeiden gern geneigt sein, und vorziehen, sich dem Schicksal oder ihrer Neigung zu überlassen, als wenn sie ihre Vernunft nur in jenen leichten Fällen zu gebrauchen hätten. Man wird dann oft wie ein Türke denken (obgleich man dies sehr verkehrter Weise ein Ergeben in die Vorsehung nennt, denn dies passt nur da, wo man das Seinige gethan hat) und man wird die faule Vernunft benutzen, welche sich auf das unvermeidliche Schicksal stützt, um damit sich die Ueberlegung, welche sich gehört, zu ersparen. Man bedenkt nicht, dass wenn ein solcher Einwand gegen den Gebrauch der Vernunft begründet wäre, er immer gelten müsste, mag die Ueberlegung leicht oder schwer sein. Diese Faulheit ist auch zum Theil die Quelle für das abergläubische Handwerk der Wahrsager, auf welches die Leute sich ebenso, wie auf den Stein der Weisen verlassen; denn sie mögen gern einen kurzem Weg, auf dem sie ohne Mühe das Glück erreichen können.
Ich spreche hier nicht von denen, welche ihrem Glück blind vertrauen, weil sie bisher glücklich gewesen sind, als wenn hier etwas Beharrliches bestände. Ihre Folgerungen von dem Vergangenen auf das Kommende sind so wenig begründet, wie die Lehren der Astrologie und andere Voraussagungen. Sie bedenken nicht, dass das Glück seine Ebbe und Fluth hat, una manca, wie die Bassette spielenden Italiener es zu nennen pflegen. Sie machen hierbei ihre besonderen Beobachtungen, auf die ich Niemanden rathen möchte, zu fest sich zu verlassen. Indess steigert allerdings ein solches Vertrauen auf das eigene Glück oft den Muth dieser Menschen, insbesondere bei den Soldaten. In Wahrheit macht oft das besondere Glück, was sie sich zuschreiben, wie ja auch Voraussagungen dies oft bewirken, dass das Vorausgesagte eintrifft. So nimmt man ja auch an, dass die Meinung der Mahomedaner vom Schicksal sie entschlossener mache. In dieser Weise haben selbst Irrthümer mitunter ihren Nutzen, indess meist nur insofern, als sie andere Irrthümer verbessern; aber die Wahrheit ist unbedingt mehr werth.
Man treibt jedoch mit dieser vorgeblichen Nothwendigkeit des Schicksals hauptsächlich Missbrauch, um damit seine Laster und sein ausgelassenes Leben zu entschuldigen. Ich habe oft aufgeweckte junge Leute, die als starke Geister sich zeigen wollten, sagen hören, dass es unnütz sei, die Tugend zu predigen, das Laster zu tadeln und auf Lohn zu hoffen oder Strafen zu fürchten, weil man von dem Buche des Schicksals behaupten könne, dass es bei dem, was darin geschrieben stehe, verbleibe und dass unser Verhalten darin nicht das Mindeste andern könne. Deshalb sei es das Beste, seinen Neigungen zu folgen und nur an das sich zu halten, was für die gegenwärtige Zeit uns befriedige. Sie bedenken die sonderbaren Folgerungen nicht, welche an einen solchen Grund sich knüpfen, welcher zu viel beweist, weil er z.B. beweisen dürfte, dass man einen süssen Trank auch dann trinken solle, wenn man wisse, dass er Gift enthalte. Mit demselben Grunde (wenn er ein gültiger wäre) könnte ich auch behaupten, dass wenn es in dem Buche der Parzen geschrieben stehe, dass das Gift jetzt mich tödten oder mir Schaden zufügen werde, dies auch eintreten werde, wenn ich den Trank nicht trinke; und dass wenn dies in diesem Buche nicht geschrieben stehe, es auch nicht geschehen werde, selbst wenn ich das Gift trinken würde. Mithin könnte ich ungestraft meinen Neigungen folgen und das wählen, was angenehm ist, wenn es auch noch so schädlich ist. Indess sind solche Behauptungen eine offenbare Verkehrtheit. Wenn ein solcher Einwurf jene Leute auch ein wenig stutzig macht, so kommen sie doch immer auf ihre Reden zurück, welche sie in mancherlei Weise so lange hin und her wenden, bis man ihnen den Fehler ihres Trugschlusses begreiflich macht. Es ist nämlich falsch, dass das Ereigniss eintrete, gleichviel was man thue; vielmehr tritt es ein, weil man das thut, was dahin führt und wenn das Ereigniss in jenem Buche geschrieben steht, so ist auch die Ursache darin verzeichnet, welche es eintreten macht. Anstatt dass also die Verknüpfung der Wirkungen und Ursachen die Lehre von einer das Handeln beschädigenden Nothwendigkeit bestätigte, dient sie vielmehr zu deren Widerlegung.
Aber auch abgesehen von schlechten Absichten und unsittlichen Neigungen, kann man auch in anderer Weise die bedenklichen Folgen einer solchen Schicksals-Nothwendigkeit einsehen, wenn man bedenkt, dass sie die Freiheit des Willens aufhebt, welche dem sittlichen Handeln so unentbehrlich ist; denn das Gerechte und Ungerechte, das Lob und der Tadel, die Strafe und der Lohn finden auf nothwendige Handlungen keine Anwendung und Niemand ist verbunden, das Unmögliche zu thun oder das unbedingt Nothwendige nicht zu thun. Man wird vielleicht solche Gründe nicht dazu missbrauchen, dass man das Unsittliche begünstigt, allein man wird doch mitunter in Verlegenheit gerathen, wenn man ein Urtheil über fremde Handlungen fällen soll, oder vielmehr wenn man Einwänden begegnen soll, unter denen es auch solche giebt, welche sich auf die Handlungen Gottes beziehen und von denen ich bald sprechen werde. Da die Annahmen einer unüberwindlichen Nothwendigkeit aller Gottlosigkeit die Thür öffnet, sei es in Folge der Straflosigkeit, die man daraus ableiten kann, oder sei es, weil es nutzlos sei, einem, alles mit sich fortreissenden Strome zu widerstehen, so ist es wichtig, dass man auf die verschiedenen Grade der Nothwendigkeit hinweise, um zu zeigen, dass es Grade derselben hier giebt, die unschädlich sind, aber auch andere, die man nicht zulassen kann, wenn man nicht schlechten Folgerungen Raum geben will.
Manche gehen selbst noch weiter und benutzen die Nothwendigkeit nicht blos als Vorwand dafür, dass die Tugend und das Laster weder schaden noch nützen, sondern sie sind sogar so kühn, die Gottheit zur Mitschuldigen ihrer Fehler zu machen. Sie folgen den alten heidnischen Völkern, welche den Göttern die Ursachen ihrer Verbrechen zuschoben, als wenn eine Gottheit sie zu dem Unrechtthun hintriebe. Die christliche Philosophie, welche besser, als die alte, die Abhängigkeit aller Dinge von den ersten Urheber und dessen Mitwirkung zu allen Handlungen der Geschöpfe erkannt hat, scheint diese Verlegenheit nur zu steigern. Manche kluge Leute sind in unsern Tagen dahin gelangt, dass sie den Geschöpfen alles Handeln absprechen und Herr Bayle, welcher ein wenig zu diesen aussergewöhnlichen Ansichten hinneigte, hat sie zur Wiederaufrichtung jenes gefallenen Lehrsatzes von den zwei Prinzipien oder von den zwei Göttern benutzt, einem guten und einem schlechten, als wenn dieser Lehrsatz besser die Schwierigkeiten über den Ursprung des Bösen beseitigte. Indess erkennt er doch im Uebrigen an, dass diese Ansicht sich nicht aufrecht erhalten lasse, und dass der Satz, wonach es nur ein Prinzip giebt, unbestreitbar in der Vernunft a priori begründet sei. Aber er will doch daraus folgern, dass unsere Vernunft sich verwirrt, die Einwürfe nicht zu widerlegen vermag und dass man deshalb sich fest an die offenbarten Wahrheiten halten müsse, wonach nur ein Gott besteht, der allweise, allmächtig und allgütig ist. Indess dürften viele seiner Leser in der Ueberzeugung von der Unwiderleglichkeit seiner Einwürfe, sie mindestens für ebenso stark halten, wie die Beweise für die Wahrheit der Religion und daher gefährliche Folgerungen daraus ziehen.
Wenn es auch keine Mitwirkung Gottes bei schlechten Handlungen gäbe, so würde man doch Schwierigkeiten deshalb hier finden, weil er dieselben voraussieht und geschehen lässt, obgleich er sie doch durch seine Allmacht verhindern könnte. Deshalb haben manche Philosophen und selbst manche Theologen ihm lieber die Kenntniss der Einzelheiten in den Dingen abgesprochen, namentlich in den zukünftigen Ereignissen, als dass sie das einräumten, was nach ihrer Meinung seine Güte erschüttern könnte. Die Socinianer und namentlich Conrad Vorstius neigen zu dieser Ansicht und Thomas Bonartes, der falsche Name eines englischen Jesuiten, eines sehr gelehrten Mannes, welcher ein Buch über die Uebereinstimmung der Wissenschaft mit dem Glauben geschrieben hat, über welches ich nachher sprechen werde, scheint auch diese Ansicht zu billigen.
Sie haben offenbar ganz Unrecht, aber nicht minder Andere, welche in der Ueberzeugung, dass nichts ohne den Willen und die Macht Gottes geschehe, ihm Absichten und Handlungen unterschieben, welche so unwürdig des grössten und besten der Wesen sind, dass man behaupten möchte, diese Schriftsteller hätten wirklich den Lehrsatz von der Gerechtigkeit und Güte Gottes aufgegeben. Sie haben angenommen, dass Gott als Herr der Welt, ohne allen Nachtheil für seine Heiligkeit sündigen könne, weil es ihm so gefalle oder um sich an der Bestrafung zu erfreuen und dass er selbst Vergnügen darin finden könne, Unschuldige in Ewigkeit zu betrüben, ohne damit eine Ungerechtigkeit zu begehen, weil Niemand das Recht oder die Macht habe, seine Handlungen zu beaufsichtigen. Manche sind so weit gegangen, zu behaupten, dass Gott wirklich so verfahre und indem sie vorgeben, dass wir in Vergleich zu ihm nur ein Nichts seien, stellen sie uns den Würmern der Erde gleich, welche die Menschen bei ihren Schritten zu zertreten sich nicht scheuen oder überhaupt den Geschöpfen von anderer als unserer Art, die man ohne Bedenken misshandelt.
Selbst Manche, mit guten Gesinnungen, neigen zu solchen Meinungen, weil sie deren Folgen nicht genügend erkennen. Sie sehen nicht ein, dass damit eigentlich die Gerechtigkeit Gottes vernichtet wird; denn was soll man von solch einer Gerechtigkeit denken, die nur ihr Belieben zur Regel nimmt, d.h. wo der Wille nicht mehr durch die Regeln des Guten geleitet wird und sich geradezu dem Schlechten zuwendet; stimmt dies nicht ganz mit der tyrannischen Definition des Thrasimachus bei Plato, welcher das für gerecht erklärte, was dem Mächtigern gefalle. Darauf kommen Alle zurück, welche die Pflichten auf den Zwang gründen und folgeweise die Macht als Maassstab des Rechts aufstellen. Man wird indess so sonderbare Grundsätze, die so wenig geeignet sind, die Menschen durch Nachahmung Gottes gut und liebevoll zu machen, bald aufgeben, wenn man wohl bedacht haben wird, dass ein Gott, der sich an dem Schlechten eines Anderen erfreut, von dem schlechten Prinzip der Manichäer sich nicht unterscheiden würde, vorausgesetzt, dass dieses Prinzip zum alleinigen Herrn der Welt geworden wäre. Deshalb muss man dem wahren Gott Gesinnungen beilegen, die ihn würdig machen, das gute Prinzip zu heissen.
Glücklicherweise bestehen solche übertriebene Lehrsätze unter den Theologen beinah nicht mehr; aber geistvolle Männer, die gern Schwierigkeiten erregen, holen sie wieder hervor. Sie suchen unsere Verlegenheit zu steigern, indem sie die Streitsätze, welche die christliche Theologie hervorgerufen hat, mit den Zeugnissen der Philosophie verbinden. Die Philosophen haben die Fragen der Nothwendigkeit, der Freiheit und vom Ursprung des Uebels erörtert und die Theologen haben diesen Fragen die weiteren über die Erb-Sünde, über die Gnade und die Vorherbestimmung hinzugefügt. Die ursprüngliche Verdorbenheit des Menschengeschlechts, welche von der ersten Sünde gekommen ist, scheint uns eine natürliche Nothwendigkeit zu sündigen aufgelegt zu haben, wenn die Gnade Gottes uns nicht beistehe. Weil aber die Notwendigkeit sich mit der Bestrafung nicht vertrage, so müsse man folgern, dass ein genügender Grund von Gnade allen Menschen hätte mitgetheilt werden sollen; allein dies stimmt nicht recht mit der Erfahrung.
Diese Schwierigkeit ist jedoch gross, vorzüglich in Bezug auf die Bestimmung Gottes über das Heil der Menschen. Es giebt nur wenig Gerettete oder Auserwählte; Gott hat also nicht den beschliessenden Willen, viele zu erwählen und da man einräumt, dass die von ihm Erwählten dies nicht mehr als die andern verdienen und sie im Grunde nicht weniger schlecht, als diese, sind, weil das Gute an ihnen nur von dem ihnen zugefallenen Geschenke Gottes kommt, so ist die Schwierigkeit dadurch nur vergrössert. Wo bleibt da seine Güte? Die Partheilichkeit oder die Begünstigung einzelner Personen widerstreitet der Gerechtigkeit und wer ohne Grund seiner Güte Schranken setzt, kann keine genügende Güte besitzen. Allerdings sind die Nicht-Erwählten durch ihre eigenen Fehler verloren; es fehlt ihnen der gute Wille oder der lebendige Glaube; allein es hat doch nur von Gott abgehangen, ihnen diesen Willen und Glauben zu geben. Man macht geltend, dass neben der innern Gnade es gewöhnlich äussere Anlässe sind, welche die Unterschiede unter den Menschen herbeiführen und dass die Erziehung, der Umgang, das Beispiel oft die natürliche Anlage verbessere oder verschlechtere. Wenn nun Gott für die Einen günstige Anlässe entstehen lässt und Andere in Verhältnisse gerathen lässt, die ihr Unglück befördern, sollte man da keinen Grund haben, sich zu erstaunen? Auch genügt es nicht (wie es scheint), dass man mit Einigen sagt, die innere Gnade sei allgemein und gleich für alle; denn dieselben Männer müssen wieder auf die Aussprüche des heiligen Paulus zurückgehen und sagen: Welche Tiefe! wenn sie bedenken, wie viele Menschen durch äussere Gnaden so zu sagen ausgezeichnet sind, d.h. durch solche Gnaden, welche auf dem Unterschied der Umstände beruhen, die Gott hat entstellen lassen und über welche die Menschen keine Macht haben, die aber doch einen grossen Einfluss auf das haben, was sich auf ihr Heil bezieht.
Man braucht auch nicht weiter vorgeschritten zu sein, um mit dem heiligen Augustinus zu sagen, dass alle Menschen durch die Sünde Adams in der Verdammniss befasst seien und Gott sie deshalb alle in ihrem Elende lassen könnte; es sei deshalb eine reine Güte, wenn er einige daraus befreie. Denn abgesehen davon, dass es sonderbar ist, wie die Sünde eines Fremden Jemanden zur Verdammniss bringen solle, bleibt immer die Frage, weshalb Gott nicht Alle befreit habe, weshalb er nur den kleinem Theil befreit und weshalb er die Einen vor den Anderen vorziehe. Es ist wahr, dass er deren Herr ist, aber er ist ein guter und gerechter Herr; seine Macht ist zwar unbeschränkt, aber seine Weisheit erlaubt ihm nicht, sie in einer willkürlichen und despotischen Weise zu üben, die in Wahrheit tyrannisch sein würde.
Ueberdem ist der Sündenfall des ersten Menschen nur eingetreten, weil Gott es gestattet hat und Gott kann dessen Gestattung nicht beschlossen haben, ohne dessen Folgen vorhergesehen zu haben, nämlich das Verderben des ganzen Geschlechts der Menschen und der Auswahl einer kleinen Zahl, während alle andern verlassen wurden. Deshalb hilft es nichts, die Schwierigkeit dadurch zu verhüllen, dass man sich auf die schon verdorbene Menge beschränkt; denn man muss trotzdem auch die Kenntniss der Folgen der ersten Sünde mit berücksichtigen, welche Kenntniss dem Beschlusse vorausging, durch welchen Gott diese erste Sünde gestattete und wodurch er gleichzeitig gestattete, dass die Nicht-Auserwählten in die Summe der Verderbniss mit einbegriffen wurden und daraus nicht befreit werden würden; denn Gott und der Weise beschliessen nichts ohne die Folgen zu bedenken.
Ich hoffe alle diese Schwierigkeiten beseitigen zu können, und werde darlegen, dass die unbedingte Nothwendigkeit, die man auch die logische oder metaphysische und manchmal auch die geometrische nennt, und die man allein hier zu fürchten hätte, bei den freien Handlungen nicht besteht und dass somit die Freiheit nicht blos dem Zwange, sondern auch der wahren Nothwendigkeit entnommen ist. Ich werde darlegen, dass selbst Gott zwar immer das Beste wählt, aber doch nicht vermöge einer unbedingten Nothwendigkeit handelt und dass die Gesetze über das Angemessene, welche Gott der Natur vorgeschrieben hat, die Mitte zwischen den geometrischen, unbedingt nothwendigen Wahrheiten und den rein willkürlichen Beschlüssen halten, was Herr Bayle und andere neuere Philosophen nicht genügend begriffen haben. Ich werde auch darlegen, dass es eine Unentschiedenheit in der Freiheit giebt, weil bei ihr keine unbedingte Nothwendigkeit für die eine oder die andere Seite besteht, aber dass trotzdem niemals eine Unentschiedenheit mit vollkommenem Gleichgewicht der beiden Seiten in ihr besteht. Ich werde auch zeigen, dass bei den freien Handlungen eine vollständige Selbstbestimmung besteht, die über alles bisher begriffene hinaus geht. Ich werde endlich erkennen lassen, dass die bedingte und die moralische Nothwendigkeit, welche bei den freien Handlungen angetroffen werden, nichts Unpassendes enthalten und dass die faule Vernunft in Wahrheit ein Trugschluss ist.
Ebenso werde ich in Betreff des Ursprungs des Uebels und seiner Beziehung auf Gott eine Vertheidigung von Gottes Vollkommenheiten bieten, die ebenso seine Heiligkeit, Gerechtigkeit und Güte, wie seine Grösse, seine Macht und seine Unabhängigkeit aufrecht erhält. Ich werde zeigen, wie es möglich ist, dass alles von Gott abhängt, dass seine Mitwirkung bei allen Handlungen der Geschöpfe statt hat, und dass, wenn man will, er sogar die Geschöpfe ununterbrochen erschafft und dass er trotz dem nicht der Urheber der Sünde ist, wobei ich auch zeige, wie man die beraubende Natur des Uebels zu verstehen habe. Ja ich thue noch mehr; ich zeige, dass das Uebel aus einer andern Quelle, als dem Willen Gottes entspringt und dass man deshalb mit Recht von dem moralischen Uebel sagen kann, dass Gott es nicht wolle, sondern nur gestatte. Aber ich zeige auch, und dies ist das allerwichtigste, dass Gott die Sünde und das Elend hat gestatten können, und dass er dazu hat mitwirken und mit beitragen können, ohne Schaden für seine höchste Weisheit und Güte, obgleich er, unbedingt gesprochen, alle diese Uebel hätte vermeiden können.
Und was die Gnade und die Vorherbestimmung anlangt so rechtfertige ich die bedenklichsten Aussprüche, wie z.B. den, dass wir nur durch die vorausgehende Gnade Gottes bekehrt werden und dass wir das Gute nur mit seinem Beistand vollbringen können; feiner dass Gott das Heil aller Menschen will und dass er nur die mit bösen Willen verdammt und dass er allen eine genügende Gnade gewährt, vorausgesetzt, dass sie davon Gebrauch machen wollen, und dass Jesus Christus der Anfang und der Mittelpunkt der Erwählung ist und dass Gott die Erwählten zum Heil bestimmt hat, weil er voraussah dass sie in einem lebendigen Glauben sich der Lehre Jesu Christi anschliessen würden. Allerdings ist es richtig, dass dieser Grund für die Erwählung nicht der letzte Grund ist und dass selbst dieses Voraussehen noch eine Folge seines vorhergegangenen Beschlusses ist; ebenso ist der Glaube ein Geschenk Gottes und Gott hat die Gläubiger aus Gründen eines höheren Beschlusses im voraus bestimmt, welcher die Gnade und die unterstützenden äusseren Umstände in Gemässheit der Tiefe seiner Allweisheit vertheilt.
Da nun einer der ausgezeichnetsten Männer unserer Zeit, dessen Beredtsamkeit so gross, wie sein Scharfsinn ist und welcher grosse Beweise von seiner ausgebreiteten Gelehrsamkeit gegeben hat, in Folge einer Richtung, die ich nicht weiter bezeichnen mag, unternommen hat, alle Schwierigkeiten in dieser Materie, die ich nur im Umriss hier angedeutet habe, zu beseitigen, so habe ich ein vortreffliches Feld um mich zu üben gefunden, indem ich mit ihm in die Einzelheiten eingehe. Ich erkenne an dass Herr Bayle (denn man wird leicht bemerken, dass ich ihn meine) den Vortheil ganz auf seiner Seite hat, wenn man nicht auf die tiefere Grundlage der Sache eingeht; aber ich hoffe, dass die nackte Wahrheit (die nach seinem eigenen Anerkenntniss mir zur Seite steht) mich über allen Schmuck der Beredtsamkeit und der Gelehrsamkeit wird siegen lassen, sofern nur diese Wahrheit so, wie es sich gehört, dargelegt wird. Ich hoffe um so mehr, dass mir dies gelingen wird, als ich die Sache Gottes vertrete und als einer der Sätze, die ich vertheidige, dahin lautet, dass Gottes Beistand denen nicht mangelt, denen es nicht an guten Willen fehlt.
Von letzterem glaubt der Verfasser dieser Abhandlung den Beweis durch die Sorgfalt geliefert zu haben welche er auf diesen Gegenstand verwendet hat. Er hat seit seiner Jugend darüber nachgedacht; er hat sie mit mehreren der einsichtigsten Männer dieser Zeit besprochen und er hat sich darüber durch das Studium guter Schriftsteller unterrichtet. Der Erfolg, welchen Gott ihm bei einigen anderen Untersuchungen (nach dem Urtheil mehrerer urtheilsfähiger Richter) gewährt hat, welche von grossem Einfluss auf den vorliegenden Gegenstand sind, lässt ihn wohl mit Recht auf die Aufmerksamkeit derjenigen Leser hoffen, welche die Wahrheit lieben und zu deren Aufsuchung geeignet sind.
Der Verfasser hatte überdem noch besondere und gewichtige Gründe, um die Feder zur Untersuchung dieses Gegenstandes in die Hand zu nehmen. Wiederholt haben ihn dazu die Unterhaltungen veranlasst, welche er darüber mit Gelehrten und Hofleuten in Deutschland und Frankreich und besonders mit einer der bedeutendsten und vollendetsten Fürstin gepflogen hat. Ich habe die Ehre gehabt, dieser Fürstin meine Ansichten über mehrere Stellen des vortrefflichen Wörterbuches des Herrn Bayle auseinandersetzen zu können, wo die Vernunft und die Religion als Kämpfer gegen einander auftreten und wo Herr Bayle der Vernunft erst zu schweigen heisst, nachdem er sie zu laut hat sprechen lassen. Er nennt dies den Triumph des Glaubens. Ich habe bereits erklärt, dass ich anderer Ansicht bin; aber ich freue mich, dass ein so grosser Geist mir damit die Gelegenheit verschafft, um diesen eben so wichtigen wie schwierigen Fragen auf den Grund zu gehen. Ich gestehe, dass ich sie seit lange geprüft habe, und dass ich mehreremale Bedenken gehabt, meine Gedanken hierüber zu veröffentlichen, die nur diejenige Erkenntniss Gottes fördern sollen, welche die Frömmigkeit erweckt und die Tugend nährt. Jene Fürstin ermahnte mich indess, diese lang gehegte Absicht auszuführen und manche Freunde thaten dasselbe. Ich war um so mehr versucht, diesen Wünschen nachzugeben als ich in Folge meiner Untersuchungen hoffen konnte, dass die Einsicht und die Kenntnisse des Herrn Bayle mir dabei helfen würden, um den Gegenstand so klar darzulegen, als unserer beider gemeinsamen Sorgfalt möglich sein würde. Indess kamen manche Abhaltungen dazwischen; der Tod der unvergleichlichen Königin war nicht der geringste. Inmittelst geschah es, dass Herr Bayle von ausgezeichneten Männern angegriffen wurde, welche die Untersuchung derselben Fragen unternahmen. Herr Bayle antwortete ihnen ausführlich und immer geistreich. Ich verfolgte diesen Streit und hätte beinah mich selbst hineingemischt. Es kam dies in folgender Weise:
Ich hatte ein neues System veröffentlicht, das mir geeignet schien, die Verbindung zwischen Seele und Körper zu erklären. Es fand selbst bei denen Beifall, welche nicht ganz damit einverstanden waren und viele geschickte Männer versicherten mich, dass sie schon ähnliche Ansichten gehabt, aber zu keiner scharfen Auffassung gelangt seien, ehe sie meine Schrift gelesen gehabt. Herr Bayle beurtheilte die Schrift in seinem historischen und kritischen Wörterbuche in dem Artikel: Rorarius. Er meinte, dass meine Aufklärungen eine weitere Pflege verdienten; er zeigte deren Nützlichkeit in mehreren Beziehungen und er hob auch die Punkte hervor, wo noch Schwierigkeiten sich ergeben dürften. Ich musste auf solche verbindliche Aeusserungen und solche belehrende Betrachtungen natürlich antworten, und wegen des grösseren Nutzens für mich, veröffentlichte ich einige Erläuterungen in der Gelehrten-Geschichte, Juli 1680. Herr Bayle antwortete darauf in der zweiten Ausgabe seines Wörterbuchs. Ich sandte ihm sodann eine Entgegnung, die noch nicht erschienen ist und ich weiss nicht, ob er darauf zum dritten Male geantwortet hat.
Inmittelst hatte Herr Le Clerc in seiner »auserwählten Bibliothek« einen Auszug aus dem »System des Verstandes« des verstorbenen Herrn Cudworth geliefert und darin gewisse formende Naturen erläutert, welche dieser ausgezeichnete Schriftsteller bei der Bildung der Thiere benutzt hatte. Herr Bayle glaubte (man sehe die Fortsetzung seiner »Mancherlei Gedanken«, Kapitel 21, Artikel 11), dass, da diese Naturen des Bewusstseins ermangelten, man durch ihre Annahme den Grund erschüttere, welcher aus der wunderbaren Gestaltung der Dinge darlegt, dass die Welt eine vernünftige Ursache gehabt haben müsse. Herr Clerc entgegnete (Art. 4, Band 5 seiner »ausgewählten Bibliothek«), dass diese Naturen der Leitung durch die göttliche Weisheit bedürften. Herr Bayle blieb dabei (Art. 7 der »Gelehrten-Geschichte«, August 1704), dass eine blose Leitung bei einer des Wissens unfähigen Ursache nicht genüge, man müsste sie denn für ein bloses Werkzeug Gottes ansehen, in welchem Falle sie nichts erklären würde. Herr Bayle berührte dabei nebenbei meine Ansicht und dies veranlasste mich, dem berühmten Verfasser der »Gelehrten-Geschichte« einen kleinen Aufsatz zu übersenden, welchen er im Mai 1705 im Artikel 9 veröffentlichte und worin ich zu zeigen suchte, dass in Wahrheit der Mechanismus zur Herstellung der organischen Körper der Thiere genüge, ohne noch besonderer bildender Kräfte zu bedürfen, sofern man zu ihnen die schon ganz organische Vorausgestaltung in dem Samen der entstehenden Körper hinzunehme, welcher in den Körpern, aus denen sie entstehen, bis hinauf zu dem ersten Samen enthalten ist. Dies kann nur von dem unendlich mächtigen und unendlich weisen Urheber aller Dinge herrühren, welcher von Anfang an alles in Ordnung erschafft und hier im Voraus jedwede zukünftige Ordnung und Kunst eingerichtet hat. Es giebt kein Chaos in dem Innern der Dinge und der Organismus ist überall in dem Stoffe, dessen Einrichtung von Gott ausgeht; dies wird sich hier um so mehr zeigen, je grössere Fortschritte man in der Anatomie machen wird und man würde sie immer weiter erkennen, selbst, wenn man bis zu dem Unendlichen fortschreiten könnte, wie die Natur dies thut und wenn man die weitere Theilung in unserm Erkennen so fortsetzen könnte, wie die Natur sie in Wirklichkeit fortgesetzt hat.
Da ich zur Erklärung dieser wunderbaren Bildung der Geschöpfe eine im Voraus angeordnete Harmonie benutzte, d.h. das nämliche Mittel, dessen ich mich zur Erklärung eines andern Wunders, nämlich des Verkehrs der Seele mit dem Körper