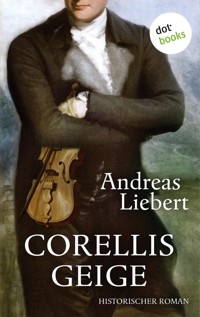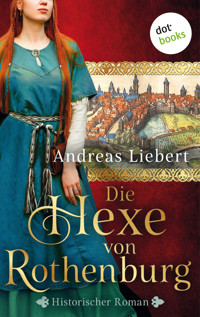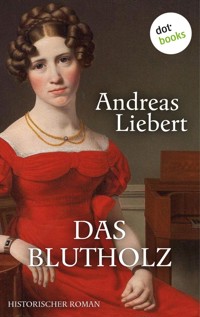Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwischen Liebe und Intrigen: Die Familiensaga "Die Töchter aus dem Elbflorenz" von Andreas Liebert jetzt als eBook bei dotbooks. Dresden im späten 19. Jahrhundert: Während ihr gewissenhafter, aber spröder Mann das renommierteste Bankhaus der Stadt leitet, sehnt sich die schöne und lebenshungrige Carola Lewenz nach leidenschaftlichen Abenteuern – ein Verlangen, das gefährlich wird, als sie einem jungen Adligen begegnet. Sie verstricken sich rasch in ein Netz aus Lügen und Verrat, in das auch Banklehrling Kurt und seine geliebte Marina hineingezogen werden. Bald blühen hinter den prächtigen Fassaden der schönen Elbstadt Gier und Verderben bis hin zum Mord … Verbotene Liebe und beängstigende Geheimnisse: Drei Familien – für immer durch das Schicksal miteinander verbunden. Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Die Töchter aus dem Elbflorenz" von Erfolgsautor Andreas Liebert. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 753
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Dresden im späten 19. Jahrhundert: Die schöne und lebenshungrige Carola Lewenz findet keine Erfüllung in der Ehe mit ihrem Mann Heinrich, dem Inhaber eines renommierten Bankhauses. Als ihr der um einige Jahre jüngere Fritz von Spener nahekommt, entdeckt sie eine ungeahnte Leidenschaft in sich. Aus Liebe zu ihm ist sie sogar dazu bereit, einen Mord zu decken. Währenddessen trägt Banklehrling Kurt einen ganz anderen Kampf aus. Als Spross einer bankrotten Industriellenfamilie hat er nur ein Ziel vor Augen: den gesellschaftlichen Aufstieg. Und dafür geht er über Leichen.
Hinter der gediegenen Fassade eines Dresdner Bankhauses lauern Machtkämpfe, Intrigen und Leidenschaft.
Über den Autor:
Andreas Liebert, geboren 1960, ist Kulturwissenschaftler, Lehrer und Schreibcoach für eine bundesweite Romanwerkstatt. Sein besonderes Interesse gilt dem 18. und 19. Jahrhundert.
Bei dotbooks erschienen bereits Andreas Lieberts historische Romane DasBlutholz, Der Hypnotiseur und Die Handheilerin.
***
Neuausgabe Dezember 2013
Copyright © der Originalausgabe 2003 Droemer Knaur, München
Copyright © der Neuausgabe 2013 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Atelier Nele Schütz, München
Titelbildabbildung: Gemälde von John Smibert
ISBN 978-3-95520-455-6
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Im Schatten der Frauenkirche an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
www.gplus.to/dotbooks
Andreas Liebert
Im Schatten der Frauenkirche
Historischer Roman
dotbooks.
1867
1
Es war der Donnerstag vor Karneval, ein goldener, klirrend kalter Nachmittag. Seit zehn Stunden schufteten Männer, Frauen und Kinder im kleinstädtischen Limbach bei Chemnitz für ihren Manufakturherren. Die meisten Gesichter waren müde und abgespannt, in einigen war auch Wut zu lesen. Gerade hatte sich milde lächelnd der »Herr Fabrikant« blicken lassen, nur schien er nicht in der Lage, auch nur ein freundliches Wort fallen zu lassen. Stattdessen hatte er befremdlich abgeklärt einigen Arbeitern über die Schulter geschaut und war dann wieder gegangen.
So guckt der Kapitalist, wenn er Urlaub nehmen oder was gut machen will, fuhr es Christoph Wezel durch den Kopf, der den »Herrn Fabrikant« begleitete. Er war der Maschinenmeister und kam in der Hierarchie gleich hinter dem Direktor, war also die Nummer drei der Manufakturfabrik.
»Heute sollten wir eine halbe Stunde weniger machen«, sagte der Fabrikant vor seinem Kontor und lächelte seinen Maschinenmeister an wie einen langjährigen Freund.
»Jawohl.«
Ah, so sieht des modernen Ausbeuters Karnevalsgeschenk aus, dachte Christoph Wezel bitter und erinnerte sich an die ohnmächtige Verzweiflung der Frauen, als der Direktor vor genau zwei Wochen die Lohnkürzungen verkündet hatte.
Er war auch davon betroffen. Der Direktor dagegen nicht.
Christoph Wezel zog los, um die frohe Botschaft zu verkünden.
An den Handwirkstühlen zu ebener Erde saßen die Erwachsenen, die Masche für Masche exklusive Seidenstrümpfe und Handschuhe produzierten. Im Stock darüber, in der »Spinnetage«, zogen Frauen und Kinder an langen Tischen aus den Seidenraupenfadenbüscheln Fäden, die der Länge nach dreimal zusammengelegt wurden, bevor sie auf Spulen zu einem verwertbaren Faden versponnen werden konnten. Über ihnen, unter dem Dach auf dem »Strohboden«, waren die Kinder anzutreffen. Sie saßen an den »Hüten«, was bedeutete, sie nähten unter der Aufsicht einer Direktrice Strohhüte. Aus einem Bund Stroh machten sie drei bis vier Hüte, die Arbeit eines halben Tages. Das Nähgarn, das sie dazu brauchten, wurde selbstverständlich von ihrem Lohn abgezogen und wenn die Direktrice je nach Laune befand, der Hut habe einen Fehler, gab's für ihn bloß halbes oder gar kein Geld.
Am meisten freuten sich die Kinder über diese geschenkte halbe Stunde. Nicht wenige jubelten, als die Direktrice die Nachricht in den Saal rief.
Christoph Wezel dachte an seine Frau und seine Tochter. Ein Gefühl der Angst überkam ihn. Was würde werden, wenn die Fabrik schließt? Wer würde ihn einstellen?
Marina würde ihre Pianistinnenkarriere aufgeben müssen. Das ersparte Geld fürs Dresdener Konservatorium, auf das sie sich so intensiv vorbereitete, brauchten sie dann für Essen und Trinken. Damit wäre es aus mit der Musik. Vorbei der Traum.
Es war der Donnerstag vor Karneval. Ein goldener, klirrend kalter Nachmittag hatte so gut wie alle Zöglinge der ehrwürdigen Fürstenschule und des Internats St. Afra auf die zugefrorene Elbe gelockt. Endlich war mal etwas los im verschlafenen Meißen! Die Schulleitung war so gnädig gewesen, den Nachmittag freizugeben, womit sie ihren Afranern vier büffelfreie Stunden bescherte. Von zwei bis sechs. Halb sieben war Abendessen.
Natürlich war auch an einem solchen Tag das Internat nicht völlig verwaist. Einige Schüler hatten Haushaltsdienst, außerdem saßen zwei Tertianer im Karzer ein. Und selbstverständlich gab es auch in St. Afra ein paar Streber, denen die Bücher wichtiger schienen als das Eis auf der Elbe. Sie waren die einzigen Freiwilligen, wenn man von denjenigen absah, die krank auf der Station lagen – oder etwas im Schilde führten wie Fritz von Spener, ein siebzehnjähriger, nicht uneitler Sekundaner aus Konrektor Peters' Klasse.
Fritz war auf dem Weg in die Schulbibliothek. Allerdings nicht, weil er lateinische Klassiker lesen wollte, sondern verbotene Bücher. Denn er besaß einen Schlüssel für den sogenannten Giftschrank, in dem so köstliche pornographische Bücher wie Marquis de Sades »Justine« oder »Die Memoiren einer Sängerin« aufbewahrt wurden.
Voller Vorfreude auf die Lektüre fuhr sich Fritz durchs Haar, da bog Konrektor Peters mit einem Packen Hefte unter dem Arm um die Ecke.
»Da schau an, unser schnieker Landedelmann«, berlinerte der Klassenlehrer. »Wenn Sie den Tacitus mal bloß ebenso elegant übersetzen würden, wie Sie sich die Locken richten, Spener! Dann flöge Ihnen auch meine Sympathie zu. Aber wenigstens treffen wir uns schon mal vor der Bibliothek. Das ist ein Anfang. Eigentlich hätte ich Sie auch auf dem Eis vermutet.«
Fritz wurde flau. Das Herz rutschte ihm in die Hose und exekutierte sämtliche Lustgefühle. Es war zum Heulen! Wieder hatte er eine Lateinarbeit verhauen! Die vierte in Folge. Womit die Fünf im Halbjahreszeugnis besiegelt war. Wäre es jetzt Juli, er würde nicht versetzt werden und hätte als Wiederholungstäter St. Afra verlassen müssen. Und das bedeutete: keine Prima und damit keine Matura. Onkel Raoul, der die Hälfte der Internatskosten zahlte, würde sagen: Fritze, du taugst nichts. Wie dein Saufvater. Und damit bist du für mich verloren.
Die Enttäuschung nahm derart überhand, dass Fritz für einen Moment schwindlig wurde. Beinahe wäre er in die Knie gegangen und mit dem Rücken an der Wand nach unten gerutscht. Dabei war dieser jung gebliebene Graubart vor ihm durchaus kein Teufel. Aber er pflegte nun mal von sich zu behaupten, dass er sogar lateinisch träume – und damit war eigentlich alles gesagt.
Andererseits – was hatte Onkel Raoul ihm zum Abschied eingeschärft? »Erstens: Je verlorener die Schlacht, desto glücklicher der gewonnene Krieg! Zweitens: Eine Fünf in Latein ist weniger schlimm als eine Fünf in Betragen. Womit ich sagen will: Sei konziliant! Glück im Leben hast du nur, wenn du aufzutreten weißt. Schulnoten verstauben, dein Charakter darf so etwas nicht. Vergiss nie deinen Stolz! Immerhin bist du ein >von< Spener !«
Fritz klammerte sich an diese Worte wie an den sprichwörtlich letzten Strohhalm. Statt vor seinem Lateinlehrer die Wand zu polieren, nickte er nur resigniert und suchte trotz der niederschmetternden Aussichten nach wohlklingenden Ausflüchten. »Entschuldigung, Herr Professor«, presste er schuldbewusst hervor. »Das war nicht meine Absicht. Ich verspreche, noch mehr zu arbeiten. Wahrscheinlich war es immer noch nicht genug. Ich werde mich anstrengen. Dies war jetzt bestimmt die letzte Fünf, die ich ihnen zugemutet habe.«
Er schaute Konrektor Peters geradewegs in die Augen. So unglücklich er war, so zufrieden war er mit seiner Antwort. Denn wenn er etwas konnte, dann schmeicheln. Zusammen mit den schwarzen Locken und seinem weltmännischen Gesicht war dies sein größtes Kapital.
»Eine Fünf, Fritz? So schätzen Sie sich ein, Sie Süßholzraspler? Famos! Diesmal ist es jedoch eine Drei. Zugegeben, eine schwache Drei. Aber was anderes: Vorhin kam ein dringender Brief für Sie. Den ich Ihnen hiermit überreiche.«
Professor Peters fingerte einen stempelstrotzenden Umschlag aus der Rocktasche – was Fritz' anschwellende Glücksgefühle sofort abtötete. Wieder wurden ihm die Knie weich. Denn diese übertrieben steile Schrift auf dem Umschlag, die konnte nur einem gehören: seinem Vater.
»Mein lieber Sohn«, begann er auf der Stube zu lesen, »mir geht es schlecht. Ich bin ein Säufer und schlechter Vater, ein Versager und Spieler. Und Letzterer hat leider verloren. Womit dein Schulgeld für das nächste Halbjahr ein nicht mehr existentes ist. Du musst Onkel Raoul bitten. Ich sehe keine andere Lösung. Von Mama soll ich dich lieb grüßen. Selbstverständlich schimpft sie mit mir. Ach, mein armer Sohn ...
Dein Dich stets liebender Vater
Freiherr von Spener.«
Es roch nach Bohnerwachs und war so still, dass Fritz sich atmen hörte. Tatsächlich hatte er jede Woche mit einem derartigen Brief gerechnet. Trotzdem konnte er sich jetzt nicht von den Zeilen losreißen. Erwartung und Wirklichkeit waren eben doch zwei Paar Stiefel. Dumpf brütete er über dem Blatt Papier, das schief auf dem frisch gescheuerten Stubentisch lag. Generationen von Schülern hatten ihre Initialen und zweifelhaften Schnitzkünste darauf verewigt. Fritz' Blick fiel auf die Teufelsfratze, unter die er geritzt hatte: »Mementote! Sic omnia sumus!« Erinnert euch! So sind wir alle!
»Stimmt«, murmelte er. »Vater ist ein armer Teufel, Mama ein vergnügungssüchtiges Teufelsweib, und du, Onkel Raoul, bist ein geiler Bock.«
Fritz dachte im Stillen an seinen Vater. Weißt du eigentlich, Onkel Raoul, dass Vater erst da richtig zu saufen begann, als du anfingst, Mama den Hof zu machen? Und wenn er spielt, doch auch nur, weil er hofft, Mama dasselbe bieten zu können wie du mit deinen vollen Kassen.
Fritz seufzte tief auf und erhob sich so schwerfällig, als trüge er alle Last der Welt. Was zu tun war, musste getan werden. Schon hundertmal hatte er diesen Brief im Geiste geschrieben. Er ging zu einem der beiden Doppelflügelschränke und zog das flache Holzfach heraus, in dem die Zöglinge das internatseigene Briefpapier aufbewahrten.
St. Afra war eine Schule mit langer Tradition, bereits vom sächsischen Herzog Moritz von Sachsen gegründet. Die bedeutendsten Afraner waren der Satiriker Rabener und die Dichter Gellert und Lessing. Schon zu ihrer Zeit hatte der Kurfürst die sprachwissenschaftliche Orientierung der Schule gelockert. Zwar war Latein neben Mathematik, Geografie, Geschichte, Griechisch und Französisch noch immer das Fach der Fächer, immerhin aber gab es zum Ausgleich Zeichen- und Turnunterricht, und im Sommer war sogar das Baden in der Elbe erlaubt.
Aber Internat war Internat. So fortschrittlich sich St. Afra auch wähnte, es gab absurde Regeln. Wie zum Beispiel die mönchische Schweigepflicht bei den Mahlzeiten. Oder noch absurder, dass das Tintenfass bei der freitäglichen Schrankkontrolle genau dreiviertelvoll zu sein hatte und jeder Schüler mindestens zwei funktionstüchtige Schreibfedern vorzeigen musste. Aber jeder hier lernte irgendwann, sich damit zu arrangieren.
War im Tintenfass noch genug Tinte? Fritz hielt es gegen das Licht, grunzte und schlurfte zurück an den Tisch.
Die Feder kratzte über das Papier. Fritz schrieb, ohne nachzudenken. Die Zeilen füllten sich wie von selbst.
»Um mehr, lieber Onkel, bitte ich Dich nicht«, schloss er. »Nicht mehr, aber leider auch nicht weniger. Doch eines sei gewiss: Irgendwann werde ich Dir alles vergelten. Dein guter, aber verzweifelter Neffe Fritz.«
Er faltete den Brief, ohne ihn noch einmal zu lesen. Mit jeder Bewegung wurde es ihm leichter ums Herz. Was machte er sich Sorgen! Natürlich würde Onkel Raoul das Schulgeld zahlen. Erstens war er flüssig und zweitens ein von Spener. Niemals würde er zulassen, den Namen von Spener wegen einer Schulgeldlappalie zu blamieren.
Die Freude über die gelungene Lateinarbeit kehrte zurück. Das Gemüt wurde wieder leicht. Geschmeidig erhob er sich von seinem Stuhl und schob ihn wieder an den Tisch. Noch so eine Regel. Leere Stühle hatten so am Stubentisch zu stehen, dass ihre Lehnen eine Fingerbreite von der Tischkante entfernt waren.
Stühle, richt euch!, hieß dies in St. Afra.
Fritz tastete nach der Hosentasche mit dem Schlüssel. Die Lust meldete sich wieder und damit das Bedürfnis, im Giftschrank zu stöbern.
Aber erst der Brief. Erst zur Post.
Die Sonne war fast untergegangen, es war kurz nach halb sechs. Fritz schlüpfte in seinen Mantel. Wollte er wirklich noch an den Giftschrank, musste er sich beeilen. Aber Rennen war verboten. Mit Riesenschritten ging er durch die lausig kalten Flure des ehemaligen Augustiner-Chorherrenstifts, nahm zwei, drei Stufen auf einmal.
Es roch nach Petroleum.
»Platz!«, rief er dem Lampendienst zu, zwei Quartanern, die mit Petroleumkanne und Feuerzeug durch die Schule patroullierten und für Licht sorgten.
Die Jungen schauten überrascht hoch, wer da so selbstherrlich die Treppe herunterkam. Dabei standen sie so dämlich beieinander, dass ein Anrempeln unvermeidlich war. Fritz ließ es darauf ankommen. Er war der Ältere, kam von oben und hatte nach der Schulordnung das Recht auf seiner Seite.
»Sieh da, der Spener-Fritz!«, sagte das erste Früchtchen des Lampentrupps übertrieben und fragte seinen Kompagnon: »Wollen wir ihn durchlassen?«
»Ja können wir das überhaupt?«, fragte der überinteressiert zurück und stellte sich prompt so hin, dass nun ein Frontalzusammenstoß unausweichlich war.
Nur wenige Stufen noch. Fritz war um keinen Preis in der Welt bereit, nachzugeben und sein Tempo zu bremsen. Die beiden St. Afraner Quartaner jedoch blieben ebenfalls stur. Sich zwischen ihnen durchzurammen hätte für Fritz bedeutet, seinem Knie die Bekanntschaft mit einer vollen Petroleumkanne zu verschaffen – was auf der Gegenseite dem Kanne tragenden Pickelhering die Gesetze von Masse und Geschwindigkeit höchstwahrscheinlich genickbruchreif demonstriert hätte.
Fritz dachte nach, die Quartaner glotzten.
Da leuchtete sein Gesicht auf. Als wolle er jemanden aufhalten, schnellte sein rechter Arm hoch, und sein Blick rutschte unmissverständlich über die frechen Opponenten hinweg. »Professor Peters!«, rief er wichtigtuerisch. »Entschuldigen Sie bitte! Ich soll ihnen ausrichten ...«
Mehr brauchte er gar nicht zu erfinden. Die Quartaner zogen die Köpfe ein und fuhren herum. Keine Sekunde später huschte Fritz zwischen ihnen hindurch. Unnötig zu sagen, dass die vier Augen der Jüngeren ins Leere starrten. Fritz' Finte war ein voller Erfolg.
»In der Quarda, da stehste dumm da«, reimte er hämisch in breitestmöglichem Sächsisch.
»Und in der Sekunda kannst mich ma!«, pöbelte der mit der Petroleumkanne hinterher.
Fritz lachte nur, dann schlug schon die schwere Schultür ins Schloss. Draußen empfing ihn das wortlose Geprotze der ersten Elbrückkehrer, Tertianer. Einer tänzelte, der andere erging sich in Schattenboxen, und wieder ein anderer wiegte mit offenem Mund unablässig den Kopf hin und her. Leute, ihr habt Hirnhochwasser, dachte Fritz und verschwand in den steilen Freiheitshohlweg, den ein Trio Primaner hinaufschnaufte. Sie schoben eine Wolke aus Tabak und Schnaps vor sich her, waren im Übrigen aber schweigsame Gesellen, allesamt mit olivfarbenen Schals bekleidet, und hatten die Fäuste tief in die Manteltaschen gestemmt.
Liebesprobleme. Sie haben Liebesprobleme, wusste Fritz und begann vor Übermut zu hüpfen, was bei dem Gefälle und dem überfrorenen Pflaster lebensgefährlich war. Doch plötzlich wurde er wieder ernst. Konnte er sich wirklich sicher sein, dass Onkel Raoul zahlte?
»Gewiss doch«, sagte er ärgerlich und überquerte einen kleinen Platz, über den er auf die Burgstraße kam. Rechter Hand ging's zum Markt mit seinen vornehmen Bürgerhäusern. Dort befand sich die königlich-sächsische Poststelle. Es war kurz vor Schalterschluss.
Wenn er schon der Letzte sei, rief Fritz und wedelte mit dem Brief, wolle er wenigstens die schnellste Sendung aufgeben. »Nach Chemnitz? Geht heute noch weg«, sagte der Postbeamte. »Schließlich geht's ja um Geld.«
»Warum nehmen Sie das an?«, fragte Fritz pikiert.
»Weil's bei euch Afranern um diese Zeit immer um Geld geht«, sagte der Postbeamte gemütlich.
»Aha. Da lerne ich was dazu.«
»Eben, junger Mann. Sie haben's Leben vor sich, ich die Pension. Aber auch in Ihrem Alter war das zu meiner Zeit mit dem Geld immer dasselbe: Schnell her damit und viel her damit.« »Sehr tröstlich.«
Fritz zahlte und wünschte einen guten Abend. Der Alte hat Recht, dachte er. Geld und Geschwindigkeit hängen zusammen. Ergo musst du immer schnell sein, damit die Börse voll bleibt.
2
Am Himmel waren noch die letzten Reste der Februarsonne zu erkennen. Ein glutroter Schimmer kündigte eine strenge Frostnacht an, schon blitzten ein paar Sterne auf. Im Limbacher Teichgebiet war es still. Selbst die Krähen ließen sich nur selten über den steif gefrorenen Mooren und Feuchtwiesen hören. Kaum vorstellbar, dass hier im Sommer eine reiche Vogelwelt ihre Brut- und Rastgebiete hatte und brave Limbacher und Chemnitzer Bürger hier angelten und Spaziergänge unternahmen.
Ein Mann in feinem Jägerloden durchquerte das Gebiet – er sah aus, als strebe er auf eine der Lichtungen zu, um dort auf Schnepfen oder Rohrweihen zu lauern. Doch der Mann trug kein Gewehr, und statt auf die Lichtung marschierte er ins Unterholz. Er stieg über umgestürzte Erlen und Pappeln, bahnte sich seinen Weg durch Gestrüpp und schiefe Kopfweiden und machte schließlich vor einer knorrigen toten Eiche Halt. Sie stand auf einer winzigen Insel, um sie herum lugten strohiges Gras und Binsen aus dem grau gefrorenen Sumpfwasser. Ihre borkenlosen Äste stachen wie ein gigantisches Knochengeweih in die Luft, und unter der Krone ragten etliche Asttrümmer aus dem Sumpf, auf denen man jetzt sitzen konnte.
»Schöner Baum«, sagte der vermeintliche Jäger leise zu sich selbst. »Romantisch. Wie auf einem Bild von Caspar David Friedrich. Bequem raufkommen tust du auch.«
Er blickte sich um, was aussah, als ob er sich vergewissern wollte, ob ihn jemand gehört hatte. Aber natürlich war weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Zufrieden nickte der Mann und seufzte dann so laut, als wäre er mit sich, Gott und der Welt vollkommen im Reinen. Daraufhin begann er, die Eiche näher zu inspizieren. Langsam, den Kopf ein wenig in den Nacken gelegt, schritt er um sie herum. Schließlich zog er seinen Jägerrock aus, ließ ihn achtlos fallen, ging zu dem Stamm ünd setzte den rechten Fuß auf einen gut kniehohen Wulst. Darüber war ein Ast, an dem er sich bequem hochziehen konnte.
Nach einer zweiten Anstrengung gelangte er auf einen die Krone teilenden Hauptast, und der erste Höhenmeter war geschafft. Der Mann machte weiter, indem er sich auf den Knien auf einem massiven Astausläufer vorarbeitete. Irgendwann richtete er sich vorsichtig auf, um sich mit dem Unterleib an einem darüber liegenden, aber schräg nach unten kreuzenden Ast abzustützen. Ohne Pause drückte er sich mit dem rechten Knie hoch und hatte damit die nächste Baumetage erreicht. Von hier reichte ein einfacher Grätschschritt, um auf einen weiteren Leitast zu gelangen, der mäßig steil weit nach außen ragte. Idealerweise folgte diesem Leitast in Brusthöhe ein in die gleiche Richtung ragender Ast, sodass der Mann sich bequem weit nach vorne arbeiten konnte – so weit, bis zwischen seinen Füßen und dem binsengespickten Eis knapp vier Meter Höhenunterschied lagen.
»Wer sagt's denn«, murmelte der Mann und schaute nach unten. »Wenn das keine Einladung ist.«
Also ist gut, was du tust.
Es ist besser so.
Du hast ja doch keine Wahl.
Und es blitzten die Sterne ...
3
Für den Giftschrank war es nun zu spät. Während in Meißens Häusern und Straßen die Lichter angingen, überlegte Fritz, womit er sich die nächsten Tage die Zeit würde vertreiben können. Ab morgen Abend nämlich hatte er die Stube für sich allein. Die Schulleitung hatte den Rosenmontag und Faschingsdienstag freigegeben. Wer wollte, durfte nach Hause. Die meisten fuhren nach Dresden oder Leipzig, andere wohnten in Zwickau, Pirna, Freiberg.
Fritz' Zuhause war das elterliche Gut im erzgebirgischen Oelsnitz an der Würschnitz, wo er noch im letzten Sommer selbstvergessen Flussperlmuscheln gekeschert hatte. Das Gebäude war aus Fachwerk und Sandstein, mit gemütlichem Kaminzimmer, Sesseln und Tapeten aus dem letzten Jahrhundert. Die Gärten waren trotz der umliegenden Zechen und Abraumhalden herrlich – was Fritz' Vater Friedrich von Spener freilich alles nichts mehr bedeutete.
1842, vor fünfundzwanzig Jahren, hatte er noch frohlockt, weil er das prächtige Haupthaus samt Wirtschaftsgebäuden als Erbe zugesprochen bekommen hatte, sein Bruder Raoul dagegen sich mit den Wäldern und Wiesen zufrieden geben musste. Aber diese Wälder und Wiesen machten den Löwenanteil des großväterlichen Besitzes aus, und auf ihnen waren zwei Jahre später die Steinkohleflöze entdeckt worden – womit Raoul von Spener seinem Bruder die lange Nase zeigen und seinen Aufstieg beginnen konnte.
Anstatt allein auf die Einnahmen aus dem Grundverkauf zu setzen, war Onkel Raoul so klug gewesen, sich einen Teil der Schürfrechte zu sichern. Er begann, in die Bergbauindustrie zu investieren, und zog schließlich auch eine Fabrik für Landwirtschaftsmaschinen hoch. Friedrich von Spener bearbeitete die Äcker mit seines Bruder Raouls Maschinen, was sein Stolz spätestens dann nicht mehr ertragen konnte, als der Bruder begann seiner Frau den Hof zu machen. Er begann zu trinken, vor ein paar Jahren sogar zu spielen. Mittlerweile waren das Porzellan verkauft, ein paar Uhren, etliche Möbel. Hypotheken drückten. Bislang zahlte Onkel Raoul Zins und Tilgung. Schließlich ist es auch mein Elternhaus, pflegte er seinem Bruder gegenüber zu sagen. Was kann es dafür, dass sein Besitzer ein Versager ist? Und wenn der Name von Spener ehrbar bleiben soll, muss ich doch zahlen, oder?
Wenn, wenn ... dachte Fritz. Wenn das Wörtlein wenn nicht wär', wär' mein Vater Millionär. Und auf jeden Fall gilt: In Oelsnitz gibt's ken Karneval!
Denn was erwartete ihn dort? Onkel Raoul würde Mama abholen und ausführen, Papa aber würde trinken und dann trübsinnig auf dem verstimmten Flügel phantasieren. Trude, ihr letztes Mädchen, würde wieder heulen, und er, wenn er auf dem Gut herumstreunte, die bitteren Gesichter der Knechte ertragen müssen, die darauf warteten, dass Säufervater von Spener ihnen den ausstehenden Lohn zahlte.
Fritz trat durch die Tür von St. Afra und verzog das Gesicht. Es roch nach Petroleum, Scheuersand und Bratkartoffeln.
Nach Hause fahren ist nicht, sinnierte er, Geld aber hast du auch nicht. Was bleibt also? Lernen! Latein. Griechisch. Französisch. Mathematik. Ein schaler Geschmack machte sich in seinem Mund breit. Nein, das wäre dann doch des Guten und Entbehrungsreichen zu viel. Versetzung ja, Strebertum nein. Schließlich hatte er Charakter.
Nichtsdestotrotz, es war zum Aus-der-Haut-Fahren!
Voller Neid dachte Fritz an seine Stubenkameraden Kurt Zacharias und Max und Georg Lewenz. Kurts Vater besaß eine gediegene Strumpfwirkermanufaktur bei Chemnitz, die Dresdener Max und Georg waren Söhne eines Bankiers. Geld hatten alle, die Lewenz natürlich ganz besonders. Als König Johann vor drei Jahren die Konzession zur Errichtung von Privatbanken gegeben hatte, waren Senior Martin Lewenz und sein Sohn Heinrich mit ihrem bereits existierenden Bankhaus in den Schatten der Dresdener Frauenkirche gezogen. Seitdem gehörten ihre Adressen zu den Ersten in der Stadt.
Die Lewenz machten Geld, Geld und noch mal Geld.
Georg und Max lebten wie die Maden im Speck. Dabei waren beide noch schlechtere Schüler als Fritz von Spener, Georg im Prinzip sogar ein echter Versager. Aber selbst ohne Abitur würde sein Leben dahinrollen wie ein Zug auf sauber verlegten Gleisen: Lehrling, Prokurist, eigenverantwortliche Teilhaber, schließlich Eigentümer. Und Millionär.
Pickel hin oder her, die Mädchen würden ihm zufliegen. »Fritze«, dröhnte ihm Onkel Raouls Stimme im Gedächtnis, »machste Geld, dann haste Weiber!«
»Hollahe!«, rief er übermütig, als er die Tür zur Stube aufriss. »Stellt euch vor, ich könnt tanzen!«
»Ach, hast dich in der Bibliothek in die Grammatik verliebt?«, frotzelte Kurt Zacharias und trompetete in sein Taschentuch.
»Unsinn, Kurti«, sagte Max Lewenz ruhig, während er seine Brillengläser polierte. »Unser Spinner-Fritz hat im Giftschrank eine Hoffmannsche Automatenpuppe entdeckt. Olympia zwo.« Sein teurer Kamelhaarmantel lag mit den Mänteln der anderen auf dem Tisch und dampfte feuchte Kälte aus. Genauso stark duftete es aber auch nach Glühwein, der auf den Elbwiesen verkauft wurde. Ihn zu trinken war zwar verboten, aber die Lewenz-Brüder hatten offenbar mal wieder beschlossen, sich bei Kurt mit einer kleinen Ungesetzlichkeit für dessen Hausaufgabenhilfe zu revanchieren.
Bedächtig setzte Max seine Brille auf und schaute um sich. Aber niemand lachte über seinen Scherz. Aber so war das meistens. Max war ganz einfach der Feingeist der Lewenz-Brüder. Seine sensiblen Künstlerhände taten nichts so gern wie malen. Wenn er im Zeichenunterricht mit abwesendem Blick über einer Arbeit saß, wirkte er wie ein meditierender Mönch. Neben ihm nahm sich sein Bruder Georg fast schon wie ein Bauer aus. Klobiger, größer und »mit einem Gesicht wie unserer Köchin gärender Hefeteig«, wie er sich einmal selbstironisch charakterisiert hatte. Tatsächlich litt er an unreiner Haut, was ihn im Verbund mit seinem zerquälten Mondgesicht nicht gerade zu einem Schönling machte.
»Quatsch!«, rief Fritz. »Weder Grammatik noch Olympia! Viel verwegener! Meine Liebe gilt Massa Pet. Denn er gewährte der Spenerschen Version des Tacitus ein Befriedigend. Diese frohe Botschaft bekam ich gerade vor der Bibliothek.«
Massa Pet war niemand anderes als Konrektor Professor Peters. Seit Wochen war es in der Sekunda Mode, alle Professoren als »Massa« zu bezeichnen. Sie waren in St. Afra die Herren, ihre Schüler waren die Neger.
»Du bei Massa Pet 'ne gute Drei?«, fragte Georg ungläubig und schluckte. »Mensch, dann bist du aus dem Schneider. Glückwunsch.«
»Stimmt.« Fritz nickte zufrieden und plumpste auf seinen Stuhl. »Zumindest, was dieses Halbjahr betrifft.«
Georg schaute seinen Freund bewundernd an. Er dagegen, meinte er bitter, habe sich mit dieser letzten Klassenarbeit Massa Pets Sympathie garantiert für alle Ewigkeit verscherzt. Denn so schlimm sei noch keine Übersetzung gelaufen. Er habe es nicht mal bis zu Ende geschafft.
»Stattdessen ließ ich mich hinreißen, ein Männchen zu malen, dem der Kopf abgeschlagen wird.«
»Georgus Lewenzus decapitabatur«, sagte Kurt Zacharias, der Primus der Klasse, pathetisch. »Georg Lewenz wurde enthauptet. Sic transit gloria mundi.«
»Hör auf, Kurti!«, rief Fritz ärgerlich.
»Mit Vergnügen, Herr von Spener! Aber du solltest jetzt mal langsam Tacheles reden, was da so im Giftschrank steht.« Kurt und Fritz gerieten gerne wegen Nichtigkeiten in Streit. Sie respektierten einander, mochten sich aber nicht wirklich. Für Kurt war Fritz zu unaufrichtig, und Fritz wiederum ärgerte Kurts überlegene Intelligenz. Was Kurt letztlich Vorteile verschaffte. Vor allem, wenn er für Fritz mal schnell ein paar Gleichungen löste oder ihn gnadenhalber eine Übersetzung abschreiben ließ.
Jetzt aber hatte Fritz den Trumpf in der Hand. Erst hielt er Kurt den Schlüssel unter die Nase, dann legte er ihn provozierend in die Mitte des Tisches. Sofort wurde es still – als habe er eine Reliquie aus der Hosentasche gezaubert, deren Besitz seinem Eigentümer ein Stück Glückseligkeit bescherte. Dabei war alles reiner Zufall. Fritz' barocker Kleiderschrank zu Hause war schlicht mit demselben Schloss bestückt wie der Giftschrank von St. Afra.
»Nun, es steht so allerhand drin«, begann er wichtigtuerisch. »Bücher schlüpfrigen und anstößigen Inhalts. Ich glaube sogar, mich an Koloraturen erinnern zu können.«
»Zur Hölle mit dir, du Teufel!«, rief Kurt. »Namen. Titel. Bilder. Red endlich Tacheles!«
»Tacheles «, äffte Fritz ihn nach. »Bist du so scharf?« Seine Hand schnellte vor, und der Schlüssel verschwand wieder in seiner Hosentasche. »Nichts da. Irgendwann, es würde durchsickern. Eine zufällige Bemerkung von einem von euch, selbst ganz unbeabsichtigt, und unsere würdigen Massas würden mich unweigerlich in die Zange nehmen und zu Wühlmäusen in der Affäre »Giftschrank« avancieren. Was bedeutete: Ich müsste den Schlüssel rektal verstecken. Versteht also bitte: Der status quo belässt alles im Stadium der Gerüchte. Keine Titel, keine Beweise.«
»Da hast du schon Recht«, sagte Georg in das betretene Schweigen hinein und schaute seinen Freund gekränkt an. »Nur, damit wirst du zum Kameradenschwein.«
Scheiße, stöhnte Fritz innerlich auf. Jetzt hast du dir was versaut! Georg sieht aus wie ein verwundetes Tier.
Was war mit Max?
Fritz linste zu ihm hinüber. Max mimte den Gleichgültigen und beschäftigte sich mit den nicht existenten Trauerrändern unter seinen Fingernägeln. Kurt aber war richtig wütend. Er hatte seine schönen weichen Lippen zu einem Strich zusammengekniffen und die Stirn in Falten gelegt. Seine Mundwinkel waren verzogen, als sei ihm übel.
»Ach, Freunde«, seufzte er versöhnlich. »Gönnt mir doch wenigstens dieses bisschen Spaß. Was hab ich denn sonst? Was glaubt ihr, was ich vorhin für einen Brief bekommen habe! Demütigung pur. Von meinem Vater! Was da drinstand, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ehrlich!«
»Geht's um Geld?«, fragte Kurt lauernd.
»Genau Kurti!«, rief Fritz gereizt. »Kannst du dir nicht vorstellen, wie? Als ob ein >von< bedeutet, irgendwo in der Familiengruft Schatztruhen zu haben. Und damit ihr's wisst: Mir wird tatsächlich die Kohle knapp. Verdammt knapp sogar. Will heißen, ich muss die tollen Tage hier bleiben, während ihr euch daheim amüsieren dürft. Zufrieden?«
Fritz sah, dass er getroffen hatte. Kurt starrte ihn überrascht und erschrocken an, Georg und Max schauten betreten zur Seite. Niemand brachte einen Ton über die Lippen. Allen wurde die Stube zu eng. Wie giftiges Gas dehnte sich die Spannung zwischen ihnen aus.
Zum Glück läutete es zum Abendessen.
»Hab ich einen Hunger«, murmelte Max.
»Und wie«, pflichtete Georg seinem Bruder bei. »Wir halten wohl alle jetzt besser unsere Klappe. Erst mal dem Ranzen geben, was des Ranzens ist.«
»Wohl gesprochen«, fügte Kurt brüchig hinzu. »Lasst uns Bratkartoffeln mit Sülze essen.«
Alle erhoben sich gleichzeitig – merkwürdig gemessen, als machten sie sich daran, eine wichtige Arbeit in Angriff zu nehmen. Und natürlich schoben sie die Stühle, wie es sich gehörte, an den Tisch. Es polterte auf dem gebohnerten Dielenboden, und als die Kameraden aus dem Zimmer waren, ächzte es in der Stube, als wolle sie sich von der Anspannung befreien. Die Stühle standen, als wäre nichts geschehen – mit einer Fingerbreite Luft zwischen Tischkante und Armlehne.
4
Und es blitzten die Sterne. Du bist nicht der erste Fabrikant und wirst nicht der Letzte sein, dachte der Mann auf dem Baum und zurrte das eine Ende des daumendicken Seils, das ihm von der rechten Schulter hing, am Ast fest. Das andere, ungefähr zwei Meter lange Ende mit der Schlinge warf er probeweise in die Tiefe und zog es dann wieder hoch.
an, legte sich die Schlinge um den Wohl ein gutes Dutzend Mal hatte Heinrich Zacharias, Kurts Vater, alles durchgerechnet. Verkaufte seine Frau die Fabrik zum Mindestpreis, wären alle Unternehmensschulden getilgt, sie und Kurt würden aber ohne einen Heller auf der Straße stehen, und die Arbeiter hätten die letzten beiden Wochen umsonst gearbeitet. Bei einem mittleren Erlös, den er eigentlich erwartete, würde es für eine bescheidene Rente in Dresden reichen, und Kurt könnte auch noch eine gewisse Summe auf die Seite legen. Der Maximalpreis würde sogar die ausstehenden Löhne decken und Kurt vielleicht auch noch ermöglichen, weiter St. Afra zu besuchen und dort die Matura zu machen. Fang bloß nicht an, nachzudenken, ermahnte sich Heinrich Zacharias.
Er hielt die Luft Hals und sprang. Dabei stieß er sich kräftig in die Höhe. Gut zwei Meter fiel er ins Leere, dann zerquetschte ihm die Schlinge den Adamsapfel und brach ihm zwei Halswirbel. Da das Seil sich leicht dehnte, schlug er mit den Stiefelspitzen aufs Eis. Aber da war er bereits vollständig gelähmt. Trotzdem hatte er noch länger zu leiden, was daher resultierte, dass der Knoten am Ast nach unten rutschte. Doch dann verlor der Seidenwirkermanufakturist das Bewusstsein.
Der Atmungsreflex war stärker als jeder Wille, und für einen kurzen Augenblick bekam Heinrich Zacharias wieder Luft –aber er starb trotzdem. Weil seine gelähmten Beine sein Gewicht nicht mehr trugen, wurde er langsam vom Gewicht seines Körpers erdrosselt.
Als man ihn am Mittag des nächsten Tages fand, war sein Körper zu einer bizarren Figur gefroren.
5
Massa Peters, der Lateinlehrer, war ein humaner Mann. Er bildete sich viel darauf ein, dass er zuerst die Arbeiten zurückgab und sich dann an deren Besprechung machte. Seine Kollegen machten es allesamt umgekehrt. Sie waren konservativ. Rückschrittlich, wie Massa Peters meinte, der seine Klasse schon mal zum Lachen brachte, indem er ihnen erotische Verse Catulls derbdeutsch übersetzte.
Mit lockerem Schwung warf er die Hefte auf die Schulbänke. Nachdem das Jubeln und Ächzen abgeklungen war, fragte er, ob der Text zu schwierig gewesen sei. Aufmerksam schaute er in die Runde, fasste dabei einzelne Schüler ins Auge. In diesen Momenten wirkte er wie ein liebenswürdiger Patriarch, der wissen wollte, ob seine Zöglinge sich bei ihm auch wohl fühlten. Doch es wusste jeder, Massa Pet hatte auch seine dunklen Seiten, die vielleicht sogar die hellen dominierten. So wiegten seine Schüler eher vorsichtig die Köpfe und murmelten vor sich hin, als sich klar zu äußern.
»Die Arbeit war angemessen, Herr Professor«, sagte Fritz. Er war der Klassensprecher. »Vielleicht, wenn ich dies so ausdrücken darf, ein, zwei Sätze zu lang.«
»Angemessen. Aha«, wiederholte Professor Peters zufrieden. »Setzen Sie sich, Spener.«
Fritz sank auf seinen Stuhl und boxte seinem Banknachbarn Georg Lewenz in die Seite. Der saß mit glasigen Augen auf seinem Platz und starrte ins Nirgendwo. Sein aufgeschlagenes Klassenarbeitsheft zeigte keinerlei Korrekturen. Nur zwei rote Striche, diagonal über beide Seiten. Georgs Arbeit war ein »ungenügend«, wie Massa Pet in seiner unverwechselbaren Linkswinkelung unter das Strichmännchen geschrieben hatte. »Glotz nicht so blöd«, zischelte Fritz seinem Freund zu. »Nächstes Halbjahr ist noch alles drin.«
Konrektor Professor Peters räusperte sich und schritt langsam durch die Bankreihen. Im Kanonenofen knallte ein Holzscheit, draußen strahlte die Sonne, und der Himmel wölbte sich in makellosem Blau über die Stadt. Die Reihe vor Fritz' und Georgs Bank blieb er stehen. Alle Augen waren auf ihn gerichtet, die Schüler der vorderen Bankreihen drehten sich um. Es war mucksmäuschenstill. Jeder wusste, wenn Massa Pet so durch die Bankreihen schlenderte, stand ein Ausbruch bevor. Ein Ausbruch freilich, der gleichzeitig immer Vorführung und Vernichtung war.
»Stehen Sie auf, Georg«, bellte er ungeduldig.
Georg schnellte in die Höhe, den Hals fleckig und das Gesicht so weiß, dass die Pickel darauf leuchteten. Er schluckte und schaute seinen Lehrer mit angstgeweiteten Augen an.
Massa Pet liebte Cicero. Und erging sich in der nächsten Minute, wie jeder recht bald begriff, im Stil von dessen erster Rede gegen Catilina. Der Professor begann leise, leidend. Doch schnell wurde seine Stimme gefühlvoll, dann kraftvoll und zusehends zornig, bis sie in ein kalkuliertes Dröhnen mündete, um schließlich abrupt zu enden:
»Wie lange noch, Georg Lewenz, willst du meine Geduld missbrauchen? Bis wann willst du mich mit deiner Miserabilität noch verhöhnen? Und wie weit glaubst du, deine zügellose Dreistigkeit eigentlich treiben zu können? Erschüttert dich deine ungenügende Substanz kein bisschen? Dieses impertinente Stümpertum, das selbst deinen Mitschülern peinlich ist? Warum glaubst du, ihnen noch immer dein Versagen zumuten zu dürfen? Dein Stammeln? Debilen Schaum? Hoffnungslos bist du, Georg Lewenz! Schlechter, als ein Guter erstklassig sein kann. Verloren. Aber zu unser aller Glück wirst du nichts weiter sein als ein schlechter Wind, der einst durch St. Afra wehte.«
Georg blickte wie ausgelöscht an die Wand. Er stand kerzengerade, ohne jede Bewegung. Nicht einmal seine Brust hob sich. Er war wie tot. Als wenig später die Schulglocke bimmelte und alle stillschweigend ihre Sachen packten, ragte er wie versteinert ins Klassenzimmer.
Fritz tat sein Freund aufrichtig Leid. Er wartete, bis sich der Unterrichtsraum geleert und die Tür geschlossen hatte. Dann zog er seinen Freund stumm an sich und barg dessen Kopf an seiner Schulter. Georg begann wieder zu atmen. Irgendwann seufzte er. Fritz wagte nicht, die Umarmung zu lockern. Von Minute zu Minute wurde sie ihm unangenehmer, lästig, geradezu peinlich. Als er glaubte, in der nächsten Sekunde aufschreien zu müssen, wurde er leidenschaftlich von Georg umarmt. Er presste Fritz so fest an sich, als wolle er ihn erdrücken.
Es war ein einzigartiger, magischer Moment. Fritz begriff, Georg und er würden ihn nie mehr vergessen. Es war, als ob das Schicksal sie aneinander schweißen wollte. Und zwar im Schmerz. Denn Georgs Hände verkrampften sich und schnitten wie Klauen durch Fritz' Weste.
Endlich ließen sie los. Fritz standen Schweißperlen auf der Stirn.
»Danke«, sagte Georg heiser. »Bist wirklich ein Freund.«
»Hast du etwa daran gezweifelt?«
Georg zuckte mit den Schultern, schüttelte dann aber den Kopf.
»Und du willst wirklich hier bleiben?«, fragte er zweifelnd. »Warum nicht?«, entgegnete Fritz launig. »Ich hab doch meinen Giftschrank!«
»Ja, wie konnte ich das vergessen!«, ging Georg bemüht auf den jovialen Sekundaner-Ton ein. »Der Giftschrank und
Spinner-Fritzens Schlüsselchen!«
Auf der Stube klopften Max und Kurt Georg tröstend auf die Schulter. Er werde das Ruder bestimmt noch herumreißen, meinte Kurt. Im Übrigen sei Massa Pets Ausbruch wenig originell gewesen. Geradezu unter seinem Niveau.
»Cicero nachzuäffen! Lächerlich!«, rief er kopfschüttelnd und erinnerte Georg an Massa Pets legendäre Rede gegen Felix Rosenow, letzten Sommer, woraufhin dieser St. Afra verlassen hatte.
»Genau«, pflichtete Max ihm bei. »Du kamst vorhin ja noch richtig gut weg. Denk doch mal daran, wie er Rosenow gegenüber resümierte: >Ihre Leistungen, Rosenow, verhalten sich zur Schönheit Ihres Namens wie der Inhalt der Latrinen zu ihrem Gestank.«
Selbst Georg verzog das Gesicht und grinste. Max hatte Recht. Ein schlechter Wind war eher auszuhalten als eine volle Latrine.
Langsam fing sich Georg wieder. Schließlich half er sogar mit, die Stube zu putzen. Es wurde gefegt, gefeudelt und gebohnert. Kurt und Fritz polierten das Fenster mit Zeitungspapier, die Lewenz-Brüder die messingfarbene Petroleumlampe. Die Schränke wurden entstaubt, Hemden neu zusammengelegt, und die Kleiderstange wurde gewischt. Als es klingelte, stellte sich jeder vor seinen Stuhl und wartete auf die Stubenkontrolle.
»Stube drei vollzählig und mit vier Mann belegt«, meldete Kurt Rektor Professor Franke. »Gelüftet und gereinigt. Mängel: keine.«
Rektor Franke, ein Kahlkopf mit viel zu roter Nase, verzichtete auf die Durchsicht der Schränke. Er schaute kurz um sich, zwinkerte mit den Augen und wünschte frohe Tage. Die Freunde setzten. sich. Noch eine Viertelstunde. Ruhe kehrte ein. Jeder genoss diese müßigen Minuten, zu wenige, um sich in seinen Gedanken zu verlieren oder um noch irgendwelche Gespräche zu beginnen. Fünfzehn Minuten reine, schlicht geschenkte Zeit. Man streifte den anderen mit den Blicken, wich ihm wieder aus, lauschte auf Türenschlagen und Schritte.
Es klopfte.
»Ja bitte!«
Die Jungs schnellten von ihren Stühlen.
»Mama?«
»Überraschung!«
Frisch und belebend wie eine Quelle rauschte Carola Lewenz ins Zimmer. Sie war die hinreißendste Frau, die Fritz bislang gesehen hatte. Eine rosenduftende Schönheit mit nachtblauem, eng geschnürtem Kleid, das sündhaft straff unter ihrem offenen Nerzmantel hervorlugte. Ihre großen, dunklen Augen sprühten vor Vergnügen, was zusammen mit ihrem Lächeln einfach umwerfend wirkte. Ihr kastanienbrünettes Haar mit den adretten Korkenzieherlocken schimmerte seidig – mit einem Wort, Fritz hatte noch nie eine Frau mit einer solch erotischen Ausstrahlung getroffen.
Flüchtig, aber herzlich umarmte die Bankiersgattin ihre beiden Jungs, wobei Fritz nicht der forschende Blick entging, den sie Georg zuwarf.
»Ich dachte, wenn ich schon mal die Meißener Porzellanmanufaktur besuche, dann auch St. Afra und die Stube drei. Sie beide, meine Herren, müssen demnach Herr von Spener und Herr Zacharias sein. Aber wer ist nun Kurt und wer Fritz?«
»Mama, das ist Kurt ...«, begann Max,
»... und das Fritz«, beendete Georg die Vorstellung.
Fasziniert und gebannt rührte sich Fritz nicht von der Stelle. Kurt dagegen streckte Carola Lewenz so ostentativ die Hand hin, als begrüße er einen Burschenschaftler. Zum Glück war Georgs Mutter nicht zimperlich, obwohl Kurts Händedruck, vorsichtig formuliert, ungalant war. Aber auch Fritz griff viel zu heftig zu. Wenigstens gelang ihm eine geschmeidige Verbeugung, wohingegen Kurt sich so linkisch anstellte, dass es aussah, als lege er seinen Kopf aufs Schafott.
»Ich freue mich, Herr Zacharias. Max äußerte mehrfach, dass Sie in der Klasse unangefochten der Primus sind. Sie waren so gütig, meinen Herren Söhnen sozusagen ein paar Mal die Aufgaben zu machen. Meinen aufrichtigen Dank.«
»Er half nicht nur Max und Georg, Frau Lewenz«, fügte Fritz launig hinzu. »Auch mir. Insgesamt halten wir natürlich alle nach Kräften zusammen. Jeder wie er kann.«
»Das ist wahr, Mama«, sagte Georg. »Und was der Kurt auf dem Kasten hat, das macht der Fritz mit dem Herzen.«
»So?«
Carola Lewenz' Augen wurden noch größer, ihr Lächeln
dagegen mütterlich. Fritz senkte bescheiden die Augen. So unsinnig es war, er hoffte, dass Georgs Mutter ihn mit einer winzigen Aufmerksamkeit bedachte, ihn gleichsam mit einem. Stäubchen Weiblichkeit beglückte, und sei dies noch so gering. Schließlich würde er in ein paar Minuten allein hier zurückbleiben, während Kurt, Georg und Max zur Bahnstation schlenderten, zwischen sich diese sinnliche Frau, unter deren Kleid sich ein Körper verbergen musste, der schöner war als jeder erotische Traum.
Die Schulglocke ertönte. Sofort wurde es laut. Lachen, Pfiffe, Stiefelscharren und Absatzknallen tobten durch die Flure.
»Nun denn, auf jeden Fall wünsche ich Ihnen frohe, lustige Stunden, Frau Lewenz«, sagte Fritz.
»Klar Jungs, euch auch!«
»Höre ich da etwas Trauriges in Ihrer Stimme, Herr von Spener?«, fragte Carola Lewenz.
»Bravo, Mama«, sagte Georg eifrig. »In der Tat, Fritz ist ein Missgeschick passiert. Er ist gezwungen, hier zu bleiben. Denn er war so großzügig, einem Afraner was zu pumpen. Dieser Schuft allerdings kam bis heute seinen Verbindlichkeiten nicht nach. Und weil unserem guten Fritz vor ein paar Tagen auf den Elbwiesen noch seine Börse abhanden kam, steht er jetzt so blitzeblank da, dass es nicht mal für die Zugfahrkarte reicht.« Die Lügen gingen Georg so glatt von den Lippen, als lese er sie vom Spickzettel ab. Seiner Mutter freilich konnte er nichts vormachen. Carola Lewenz war mitnichten weltfremd. Doch weil Max bedächtig nickte und sich auf Fritz' weltmännischen Zügen Scham und Betroffenheit zeigten, war Carola Lewenz geneigt, ihrem Sohn wenigstens die Hälfte seiner Geschichte zu glauben.
Hat sich der geschmeidige Herr von Spener also finanziell verausgabt, dachte sie amüsiert. Er und seine adelige Seele wollten wohl ein wenig glänzen und gehörig freigebig sein. Wie tief Georg wohl in seiner Schuld steht? Sie verstand nur nicht, warum er diesen Umweg nahm. Wenn Georg mit seinem Freund gerne feiern wollte, hätte er es doch frank und frei sagen können. Sie hatte wahrlich nichts dagegen. Dieser Fritz von Spener war schließlich ein Bursche mit Manieren. Einer, den man gerne ansah.
»Das klingt ja richtig karnevalesk!«, rief sie. »Fritz, ich ahne die Intention meines Sohnes: Erweisen Sie uns also die Ehre, Sie über Karneval bei uns als Gast begrüßen zu dürfen.«
»Die Ehre ist ganz auf meiner Seite!«, rief Fritz freudig und versuchte sich an einem Kratzfuß. »Danke, Frau Lewenz. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hatte mich schon mit dieser tatsächlich traurigen Lage abgefunden, richtete mich darauf ein, lediglich diverse Grammatiken als Gesellschaft zu haben.«
Kurt hustete. Max zog sein Taschentuch, um sich zu
schnäuzen. Georg dagegen strahlte wie ein kleines Kind.
»Überhaupt Mama, weißt du«, fuhr er scheinheilig fort, »so ein Ungenügend in Latein, da braucht man wirklich einen Freund ...«
Weiter kam er nicht, denn Rektor Franke stand in der Tür. Er hüstelte und machte ein betretenes Gesicht. Seine rote Nase war überraschend blass, sein Kahlkopf aber voller roter Flecken.
»Gestatten Sie, Frau Lewenz«, begann er mit brüchiger Stimme, »dass ich Ihnen den Herrn Zacharias entführe.« Der Rektor wandte sich Kurt zu und lächelte ihn seltsam bemüht an. »In mein Büro bitte, Kurt. Sie werden erwartet.«
Ohne sich zu verabschieden, verließ Rektor Franke mit Kurt die Stube. Mit Riesenschritten ging es durch St. Afra, vorbei an Stuben und Unterrichtsräumen, Lehrerzimmern und der Aula. Schließlich erblickte Kurt die Tür mit der großen, goldblitzenden Klinke. Rektor Franke öffnete, Kurt trat ein.
»Setz dich, mein Junge«, hörte er die milde Stimme und wurde vom Rektor sanft in einen Armlehnstuhl gedrückt.
Rektor Franke verschwand einen kurzen Moment ins Nebenzimmer, aus dem kurz darauf ein Schluchzen drang. Kurts Magen zog sich zusammen. Sein Herz schlug schneller, er ballte die Fäuste. Weinte da ... war das nicht seine Mutter? Also doch, schoss es ihm durch den Kopf. Papa hat bankrottiert! Du musst das Internat verlassen. Er sprang sofort hoch, als Rektor Franke mit seiner Mutter zu ihm kam.
»Mama! Was ist passiert?«
»Dein Vater!«, schluchzte Kurts Mutter auf. »Er hat sich was angetan! Er ist tot!«
6
Marina Wezel, die hübsche sechzehnjährige Tochter des Maschinenmeisters Christoph Wezel, ereiferte sich darüber, dass sie Chopins cis-Moll-Etude op. 25, 7 viel inniger spiele als die große Clara Wieck. Sie saß in der elterlichen guten Stube an ihrem Klavier und freute sich, dass ihr die schwierigen Läufe der linken Hand alle geglückt waren. In den schwenkbaren Kerzenhaltern zu beiden Seiten des Klaviers brannten frische Kerzen, deren Licht kaum merklich auf den Noten zitterte. »Lies doch selbst, Mama«, rief sie begeistert, während sie mit der Linken noch einmal das elegische Thema hervorhob, »Chopin fordert Lento, und das heißt langsam, aber auch locker. Doch was hat die Wieck daraus gemacht? Ein Andante, und dann war es natürlich nicht mehr locker, sondern trocken.«
»Ja, Liebes«, sagte ihre Mutter Johanna sanft. »Diese Etüde lag ihr nicht. Seine Revolutionsetüde aber, das musst du zugeben, war eine richtige Schlacht. Ein Tastengebraus, wie ich es noch nie gehört und gesehen habe.«
»I wo, dieses Tempo schaff ich auch noch!«, rief Marina zuversichtlich, drehte sich kurz zu ihrer Mutter um und begann, die ersten Läufe dieses Prachtstücks zu spielen, das sie sich für die Prüfung am Dresdener Konservatorium ausgesucht hatte.
Wie immer, wenn sie nervös war, wischte sich Johanna Wezel mit ihrem Taschentuch über die Nase. Hinter Marina stehend, versuchte sie, sich auf das Klavierspiel ihrer Tochter zu konzentrieren, schaute sogar mit in die Noten. Aber Johanna Wezel besaß nicht mehr die Kraft, sich darüber zu freuen. So wenig sie die Muße hatte, die Musik mitzulesen, so wenig fesselte sie Chopins Revolutionsetüde – woran einzig die Gerüchte schuld waren. Sie machten ihr Angst und vergällten ihr alle Lebensfreude.
Gestern Abend hatte ihr Mann berichtet, dass in der Fabrik noch vor Ostern die Lichter ausgehen könnten – trotz der Lohnkürzungen vor zwei Wochen. So schlecht stand es um Heinrich Zacharias Fabrik! Johanna Wezel lief ein Schauer über den Rücken, ihre Zähne schlugen aufeinander. Wovon sollten sie leben, wenn Christoph arbeitslos wurde? Wie sollten sie die Miete für das Häuschen aufbringen? Reserven hatten sie für gerade mal für zwei Monate. Und untervermieten – wohin dann mit Marina und dem Klavier? Wenn Christoph nicht schnell woanders eine Anstellung fand ... wie viel brachte eigentlich der Hausrat? Wenn sie das Spinnrad entmotten würde ... oder doch besser gleich putzen gehen? Was war demütigender?
Andere Frauen, hatte sie gehört, würden sich vorübergehend in den Städten verkaufen!
»Nun?«
Johanna Wezel applaudierte, ohne sich an einen Ton zu erinnern – was ihr in all den Jahren, seit Marina spielte, noch nie passiert war. Schließlich war sie stolz auf Marina! Aber jetzt, in dieser Situation, da bereitete ihr Marinas Begeisterung fürs Klavier zusätzliche Sorgen. Das Konzert mit der Wieck lag jetzt schon Wochen zurück, aber Marina tat noch immer, als sei es gestern gewesen. Seitdem übte sie jeden Tag vier bis sechs Stunden, weil sie es sich in den Kopf gesetzt hatte, Pianistin zu werden. Die Begabung dafür hatte sie. Aber wenn man kleiner Leute Kind war, dann war das eine Belastung, eine richtige Last!
Johanna Wezel fuhr sich mit dem feuchten, völlig zerdrückten Taschentuch über ihre rote Nase und zwang sich ein Lächeln ab. »Es war gut, Liebes«, sagte sie ins Blaue hinein. »Hier und da fehlt noch etwas Sauberkeit, und selbstverständlich darf nicht der geringste Patzer ...«
»Patzer?«, brauste Marina auf. »Gerade war es das erste Mal völlig ohne! Jetzt fehlt bloß noch das letzte bisschen Pfeffer, das Tempo! Hast du überhaupt zugehört?«
»Kind ... ja, doch.«
»Nein, hast du nicht.«
Marina ballte die Hände zu Fäusten und stemmte sie in ihre Hüften. Den Mund zu einer Schnute verzogen, senkte sie den Kopf und starrte auf ihre Fußspitzen. Die Standuhr schlug Viertel, eine Diele ächzte. Marina bockte, Johanna Wezel aber begann vor Empörung zu zittern. Am liebsten hätte sie ihre Tochter angeschrien: Ich bange um unsere Existenz, um Sein oder Nichtsein! Aber du, du hast nichts als deine Musik im Kopf! Was maßt du dir an? Wie undankbar du bist!
»Entschuldige Mama. Du hast andere Sorgen. Ich weiß.« Marina hob den Kopf. Jetzt saß sie da, als hätte sie eine Gerte verschluckt.
»So? Als ob du ...«
Johanna Wezel schlug sich die Hand vor den Mund, so sehr erschrak sie vor ihrer aggressiven Stimme. Aber es war zu spät. Tief verletzt schaute Marina ihre Mutter von der Seite an. Sofort machte Johanna Wezel sich große Vorwürfe. Mitleid überkam sie, wurde so stark, dass ihr ein Kloß im Hals wuchs. Sie erkannte, wie falsch es gewesen war, Marina in ihrem Wolkenkuckucksheim leben zu lassen. Wie grausam war es jetzt für sie, wenn alles zerbrach.
Marina holte tief Luft.
»Ich weiß, dass Papa und du Sorgen haben. Begründete Sorgen. Glaubt nicht, euer Getuschel und eure Mienen entgingen mir. Ich bin doch nicht dumm. Also ... es ist das Geld. Ich bin zu teuer.«
»Kind, so ein Unsinn!«
Um sie zu trösten, schlang Johanna Wezel ihre Arme um Marinas Oberkörper und begann, ihre Tochter sanft hin und her zu wiegen – was sie immer tat, wenn Marina traurig oder wütend war. Johanna Wezel liebte ihre Tochter und wünschte nichts so sehr, als dass Marina in der Gesellschaft aufstieg. Deshalb ja auch der Klavierunterricht, damit Marina eines Tages eine gute Partie machte. Johanna Wezel träumte davon, Marina mit einem Regierungsbeamten oder Universitätsprofessor zu verheiraten, sah sich als Großmutter von Enkeln in Matrosenanzügen ...
Die Haustür wurde aufgeschlossen. Johanna Wezel stockte der Atem, Marina versteifte sich.
Die Schritte waren hart, hektisch.
»Johanna!«
»Ja!«
Christoph Wezel riss die Tür zur Stube auf.
»Aufgehängt hat er sich, der Hund! Dieses Schwein! Sich einfach davongemacht!«
»Wer?«
Aber Johanna wusste genau, wen ihr Mann meinte. Und was das bedeutete ...
»Heute war mein letzter Arbeitstag«, flüsterte Christoph Wezel.
Er stand im Mantel da, an dem einzelne Härchen golden im Kerzenlicht schimmerten. Wieder ächzte eine Diele. Draußen schlug verspätet die Kirchturmuhr. Christoph Wezel senkte den Kopf. Zu Marinas großem Entsetzen schluchzte er plötzlich leise auf.
»Aber Christoph!«
Mit zwei Schritten war Johanna Wezel bei ihm. Hilflos ließ Christoph Wezel seinen Kopf auf ihre Schulter sinken. Er begann zu zittern, schluchzte noch einmal und fing an zu weinen. Marina glaubte, sterben zu müssen vor Scham. Papa hatte noch nie geweint! Also war das jetzt das Ende. Sie sah, wie ihre Mutter ihrem Vater übers Haar strich und dessen Hände sich um deren Taille krampften.
Nie würde sie dieses Bild vergessen!
»Es tut mir so Leid«, flüsterte Christoph Wezel. »Alles ist meine Schuld.«
»Nein, Christoph«, hauchte Johanna Wezel und begann ebenfalls zu weinen. »Das ist nicht wahr. Du bist doch so gut. So gut.«
Marina wünschte sich, in Ohnmacht zu fallen. Doch ihr Herz schlug nur hart gegen ihre Brust. Statt dass ihr schwindelig oder schwarz vor Augen wurde, wurde sie von Sekunde zu Sekunde wacher. Mit einem Mal stand ihr alles klar vor Augen: Sie würde fortgehen. Und zwar noch an diesem Abend!
Du wohnst ein paar Tage bei Tante Irmgard und suchst dir in der Zwischenzeit eine Anstellung. Klavier studieren tust du nebenbei.
Die Uhr schlug halb. In dreißig Minuten ging der Abendzug nach Dresden.
Und die Prüfung?
Marina biss sich auf die Lippen.
Fragen ... einfach irgendwo fragen, wo du spielen kannst.
Sie erhob sich vom Klavierhocker, hielt die Luft an. Wie ein Automat stakste sie auf die Tür zu und drängte sich an ihren eng umschlungen dastehenden Eltern vorbei. Wenn sie bloß keiner ansprach ... Es würde ihren Entschluss ins Wanken bringen. Die Treppe krachte. Mit jeder Stufe schien irgendwo ein Geist wach zu werden. Aber Mutter und Vater schwiegen.
Ihr Zimmer. Die blauen Vorhänge, das Bett mit der rosenbestickten Tagesdecke über dem Plumeau. Ihr Schreibtisch. Das unbeschriebene Blatt Papier lag da, als habe es die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie diesen einen Satz schrieb:
Ich bin bei Tante Irmgard. Adieu.
Eure Marina.
Schweren Schritts ging sie die Treppe wieder nach unten. Wenn das Schicksal es anderes wollte, konnte es jetzt noch etwas tun. Marina ging an den Garderobenschrank. Die Tür quietschte laut. Sie hielt die Luft an, lauschte. So ungeschickt wie möglich schlüpfte sie in ihren Mantel. Es raschelte und rauschte. Als sie die Tür des Garderobenschranks schloss, quietschte diese noch lauter als zuvor.
Es ist tatsächlich dein Los!, schoss es ihr durch den Kopf, als sie die Haustür öffnete. Rauch schlug ihr entgegen und eisige Kälte. Die Uhr schlug drei Viertel. Marina knallte die Tür ins Schloss. Niemand rief nach ihr. Langsam lief sie los. Wurde schneller. Schließlich rannte sie.
Punkt acht Uhr plumpste sie auf die harte Bank des Dritte-Klasse-Abteils. Als der Zug losfuhr, schlug sie die Hände vors Gesicht und weinte, wie sie noch nie in ihrem Leben geweint hatte.
7
Niemand in Dresden sagte: Ich bin Kunde des Bankhauses Lewenz – dafür hatte das Haus mit der offiziellen Adresse Töpfergasse 1 eine viel zu bekannte Lage, eine Lage, wie sie Vertrauen erweckender und ehrenvoller nicht sein konnte: nämlich gegenüber der Dresdener Frauenkirche.
Deutschlands größte protestantische Kirche überragte das dreigeschossige Eckgebäude mit dem vielfenstrigen Mansardendach erhaben und schützend, aber auch mahnend und Respekt fordernd – ein Eindruck, der vom einen der beiden Gründer des Bankhauses Lewenz durchaus beabsichtigt war und beizeiten dazu geführt hatte, dass die Kunden sagten: Mein Geldinstitut ist das »Bankhaus Frauenkirche«. Der Name hatte sich vor drei Jahren quasi über Nacht etabliert – wer sicher gehen wollte, einen anderen an der Frauenkirche nicht zu verpassen, verabredete sich hier.
Er werde für diese neue Adresse einmal dankbar sein, hatte Samuel Goldhagen seinem Teilhaber Martin Lewenz zugeflüstert und sterbend prophezeit, diese Lage unter den Fittichen der Kirche werde dem Bankhaus in Notzeiten nützlich sein. Mit einem wissenden Lächeln auf den Lippen entschlief der Bankier, und Martin Lewenz hatte sich geschworen, in dunklen Zeiten auf diese Prophezeiung zu vertrauen.
Gott bewahre, dass sie jemals in Erfüllung ging!
Bislang prosperierte das Geschäft von Monat zu Monat, und das ihm anvertraute Kapital der Kunden erwirtschaftete Zinsen. Ganz wie Samuel Goldhagen es sich vor gut drei Jahren vorgestellt hatte, spendete die Frauenkirche der Geldwirtschaft zu ihren Füßen ihren Segen und sorgte für ständig wachsende Reputation. Der gute Ruf des Bankhauses wurde zum Rückgrat aller Geschäfte und war wie die Geldeinlagen selbst ein Teil des von der Bank verwalteten Kapitals und der darauf zu erwartenden Gewinne.
Dieses imaginäre Kapital nun galt es genauso zu mehren wie das materielle Kapital. Es zu verspielen hätte irgendwann den wirtschaftlichen Ruin zur Folge gehabt. Somit war verständlich, dass Martin Lewenz und sein Sohn Heinrich sorgsam darum bemüht waren, Bank und Familie von jedweden Skandalen freizuhalten.
Fritz von Spener wusste wenig von der Familie seiner Klassenkameraden. Georg und Max erzählten so gut wie nie von zu Hause, und weder Fritz' Vater noch dessen Bruder Raoul standen in Geschäftsbeziehungen zu den Lewenzen.
So viel hatte Fritz allerdings in Erinnerung: Wenn sein Onkel auf das Bankhaus zu sprechen kam, lag in seiner Stimme stets ein eigentümlicher, tief sitzender Groll. Er jedenfalls würde »dieser Brut« keinen Heller anvertrauen, obwohl er auch erwähnt hatte, dass er niemanden kenne, der mit vergleichsweise geringem Kapital so viel erreicht habe wie das Gespann Lewenz Goldhagen.
»Lewenz hatte zweitausend Taler Startkapital plus seinen Sohn, Goldhagen dreitausend plus seine Tochter. Indem beide ihre Kinder miteinander verkuppelten, sicherten sie sich den Teilhaberfrieden. Die Früchte der Alten sind schwarze Zahlen, die ihrer Kinder deine Stubenkameraden Max und Georg.«
Am besagten Karnevalsfreitag des Jahres 1867 war Fritz freilich mit anderen Dingen beschäftigt, als über die Geschichte des Bankhauses Frauenkirche nachzugrübeln. Die giftige Bemerkung seines Onkels war das Einzige, was ihm einfiel, als er an der Seite Carola Lewenz' in einer Droschke über die Dresdener Augustusbrücke fuhr.
Fritz war seit Jahren nicht mehr in der Elbestadt gewesen, deren Lichterglanz sich festlich in der träge dahinfließenden Elbe spiegelte. Noch köstlicher als diesen Anblick empfand Fritz jedoch die duftende Frau neben sich. Sie saßen in der engen Droschke auf Tuchfühlung, in den Kurven aber drückten sich ihre Körper aneinander, als berührten sich die Pole zweier Magneten. Carola Lewenz machte keine Anstalten, sich gegen die Fliehkräfte zu stemmen, vielmehr lachte sie, als gehöre diese Kutschenfahrt bereits zum diesjährigen Karneval. »Sind die Dresdner Kutscher etwa ausgemusterte Eilkuriere?«, fragte Fritz, als die Droschke am Ausgang der Brücke über den Schlossplatz jagte und so scharf in die Augustus-Straße einbog, dass Carola Lewenz regelrecht gegen ihn fiel.
»Der hier muss einer sein«, lachte Carola Lewenz. »Im Ernst, Fritz, so schnell bin ich noch nie vom Bahnhof in die Töpfergasse gekommen.«
Eine köstliche erotische Sekunde lang kitzelten ihre Locken Fritz' Wange. Schon ihr Rosenparfüm hatte es ihm angetan, jetzt kam er noch in den Genuss, dass sogar ihr Oberkörper gegen den seinen gedrückt wurde. Vor Wonne sträubten sich ihm die Nackenhaare.
Wenn das noch einmal passiert, frohlockte er, könntest du ihr glattweg den Hals küssen.
Fritz malte sich Ohrfeige und Beschimpfungen aus. Dann fiel ihm ein, wie Georg einmal erzählt hatte, dass es bei ihnen zu Hause eher puritanisch zugehe. Er hatte noch gut Georgs drastische Schilderung im Ohr: Wir saufen fast immer nur Blümchentee und fressen Zwieback und Graubrot. Würzen tun wir mit Speckstippe und Elbaal, ergo scheißen wir kein Pfund mehr als die kleinen Leute in der Dresdener Neustadt. Ihr Ärmsten, hatte Kurt Zacharias gefrotzelt. Muss ich jetzt für euch sammeln gehen?
Fritz konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Kurt, der damals gerade seine Schuhe polierte, funktionierte einen von ihnen kuzerhand zur Sammelbüchse um, trat in Socken aus der Stube und bettelte den nächstbesten Schüler auf dem Flur um eine Spende für die armen Bankierssöhne an.
Wie hatten sie alle gelacht!
Weshalb er wohl ins Büro des Rektors kommen sollte? War etwas in der Familie passiert?
Sie waren am Ziel. Der Kutscher riss den Wagenschlag ebenso forsch auf, wie er fuhr, und so wunderte es niemanden, dass er die Hand an die Mütze legte, als Georg und Max ausstiegen. Fritz ließ es sich nicht nehmen, den Kavalier zu spielen. Er bot Carola Lewenz den Arm und fühlte sich sehr geschmeichelt, als sie sich auf ihn stützte. Im selben Augenblick hatte er das Gefühl, diesen Moment schon einmal erlebt zu haben. Klassisches Déjà-vu-Erlebnis, sagte er sich, dann fiel ihm die sarkastische Bemerkung seines Onkels ein, dass wer im Schlafsaal sein Bett zwischen zwei Bankern habe, sich später im Leben keine Sorgen mehr machen bräuchte.
Wenn ich Onkel Raoul erzähle, dass es Carola Lewenz selbst war, die mich eingeladen hat, wird er Vaters Anteil für St. Afra doppelt so gern übernehmen.
Fritz kam es vor, als sei er ein Stück vorangekommen im Leben. Fortuna war ihm hold, es konnte nur aufwärts gehen.
Er bog den Kopf in den Nacken und schaute um sich. Hinter den Fenstern der barocken Bürgerhäuser brannte anheimelndes Licht. Die Laternen des Neumarkts überzogen das gen Himmel ragende, schwärzliche Steingebirge der Frauenkirche mit einem beruhigenden Schimmer. Im fahlen Glas ihrer Kassettenfenster spiegelten sich einzelne tröstliche Lichtpunkte wider. Je länger Fritz sie anschaute, desto gebieterischer erschien ihm die Kirche.
Fast schon unheimlich, dachte er. So triumphal sie die Kulisse der Stadt beherrscht und sie wegen ihrer Kuppel als Sankt Peter der evangelischen Religion gilt, Gott fühlt sich hier bestimmt auch nicht wohler als in einer Dorfkirche.
»In der Tat, unsere Frauenkirche strahlt nicht unbedingt Liebreiz aus«, sagte Max. »Aber wenn in den Adventstagen in der Kirche die Kerzen brennen, die Orgel spielt und es hier draußen nach Pfefferkuchen duftet, dann ist es wie in einem Märchen. Vor allem wenn Schnee liegt. Dann musst du kommen, Fritz.« »Gerne.«
»So, nu aber lass mer die Kärche unsrer liewen Frauen, wo sie is«, sächselte Georg. »Unser Haus war nämlich zuerst da.«
Ein Diener mit Laterne öffnete. Neugierig trat Fritz hinter Carola Lewenz ins Bankhaus Frauenkirche. Die Haustür war eher unscheinbar. Eine zweiflügelige Holztür mit Ringklopfer, deren bernsteinfarbener Lack im Licht der Laternen allerdings kostbar golden schimmerte.
Georg spielte den Führer.
»Das Haus stammt aus der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts. Gebaut vom einstigen Ratsmaurermeister Heinrich Christian Fehre. Hier links geht es in den Geschäfts- und Schalterraum. Ums Eck, zur Kirche hin, ist der eigentliche Kundeneingang. Von Anfang Frühling bis gegen Ende Herbst liegt er morgens in der Sonne. Großvater meint, das bringe uns Glück.«
»So?«, mischte sich Carola Lewenz ein. »Deine Schulleistungen, mein Guter, sind bisher eher ein Unglück.«
Über ein schmuckloses Treppenhaus ging es in den zweiten Stock.
»Da sind wir schon«, sagte Georg. »Da staunst du, wie? Alles ein paar Quadratmeter kleiner als bei euch.«
»Was bedeutet das schon«, antwortete Fritz ausweichend. »Ein Gut ist groß, weil es auf dem Land ist. Befände sich unser Besitz von der Fläche her hier in der Altstadt, suggerierte dies, wir wären die Nummer zwei hinter der Königsfamilie.«
»Sie sind ja ein Diplomat!«, rief Carola Lewenz. »Damit werden Sie es zu etwas bringen, Fritz!«
»Oh ja«, antwortete der gedehnt und in einem Ton, der keine Zweifel daran ließ, dass er selbst nicht daran glaubte.
So schlicht sich das Treppenhaus präsentierte, so schlicht war auch das Interieur der Diele. Es herrschte gediegene Bürgerlichkeit vor, aber beileibe kein Luxus. Auf schmucklosem Schiffsbodenparkett lagen eher zu kleine Teppiche, die, damit man nicht über sie stolperte, mit Messingnägeln fixiert waren. Statt großer Gemälde schmückten kleine Bücherborde sowie unkolorierte Merian-Kupferstiche die Wände. Die Stadtansichten waren mit breiten, vergoldeten Holzleisten umrahmt, was ihnen zusammen mit den taubenblauen Passpartouts eine beeindruckende Wirkung verlieh.