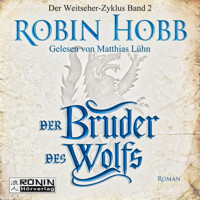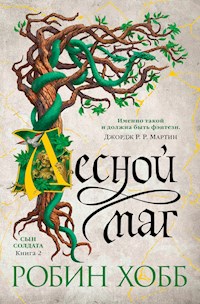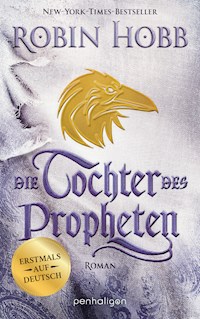
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Kind des Weitsehers
- Sprache: Deutsch
Die beste Art, seine Tochter vor Schaden zu bewahren, ist, ihr beizubringen, sich selbst zu schützen.
Biene, die Tochter des ehemaligen königlichen Assassinen Fitz Weitseher, wurde entführt. Die Diener von Clerres wollen sie unbedingt unter ihre Kontrolle bringen, und dafür ist ihnen jedes Mittel Recht. Denn sie haben längst erkannt, wovor Fitz die Augen verschlossen hat. Biene ist die Erbin des Narren und damit die nächste Weiße Prophetin.
Doch Biene wäre nicht Fitz Tochter, wenn sie die Entführung tatenlos über sich ergehen lassen würde. Sie plant bereits ihre Flucht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1593
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Biene, die Tochter des ehemaligen königlichen Assassinen Fitz Weitseher, wurde entführt. Die Diener von Clerres wollen sie unbedingt unter ihre Kontrolle bringen, und dafür ist ihnen jedes Mittel recht. Denn sie haben längst erkannt, wovor Fitz die Augen verschlossen hat. Biene ist die Erbin des Narren und damit die nächste Weiße Prophetin.
Doch Biene wäre nicht Fitz’ Tochter, wenn sie die Entführung tatenlos über sich ergehen lassen würde. Sie plant bereits ihre Flucht …
Autorin
Robin Hobb wurde in Kalifornien geboren, zog jedoch mit neun Jahren nach Alaska. Nach ihrer Hochzeit zog sie mit ihrem Mann nach Kodiak, einer kleinen Insel an der Küste Alaskas. Im selben Jahr veröffentlichte sie ihre erste Kurzgeschichte. Seither war sie mit ihren Storys an zahlreichen preisgekrönten Anthologien beteiligt. Mit Die Gabe der Könige, dem Auftakt ihrer Serie um Fitz Chivalric Weitseher, gelang ihr der Durchbruch auf dem internationalen Fantasy-Markt. Ihre Bücher wurden seither millionenfach verkauft. Robin Hobb hat vier Kinder und lebt heute in Tacoma, Washington.
Die Chronik der Weitseher von Robin Hobb bei Penhaligon:
1. Die Gabe der Könige
2. Der Bruder des Wolfs
3. Der Erbe der Schatten
Das Erbe der Weitseher von Robin Hobb bei Penhaligon
1. Diener der alten Macht
2. Prophet der sechs Provinzen
3. Beschützer der Drachen
Das Kind der Weitseher von Robin Hobb bei Penhaligon
1. Die Tochter des Drachen
2. Die Tochter des Propheten
3. Die Tochter des Wolfs
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Robin Hobb
Die Tochter des Propheten
Das Kind der Weitseher 2
Roman
Deutsch von Maike Claußnitzer
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Fool’s Quest (The Fitz and The Fool Trilogy, Book 2)« bei DelRey, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Copyright der Originalausgabe © 2015 by Robin Hobb
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2019 by Penhaligon in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München.
Redaktion: Alexander Groß
Covergestaltung: © Isabelle Hirtz, Inkcraft, unter Verwendung eines Motivs von Refluo/Shutterstock.com
Karte: © Andreas Hancock
HK · Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN 978-3-641-17763-8V002www.penhaligon.de
Karte
Für Rudyard.
Nach all den Jahren immer noch mein Herzallerliebster.
Kapitel 1
WINTERFESTABENDINBOCKSBURG
Ich liege warm und sicher mit meinen zwei Geschwistern im Bau. Sie sind beide draufgängerischer und stärker als ich. Ich bin als Letzter geboren und der Kleinste. Meine Augen haben sich erst spät geöffnet, und ich bin weniger abenteuerlustig als die anderen Welpen. Mein Bruder und meine Schwester haben es beide schon gewagt, meiner Mutter an den Eingang des Baus zu folgen, der tief ins Steilufer des Flusses gegraben ist. Jedes Mal hat sie die beiden angeknurrt und nach ihnen geschnappt, um sie zurückzuscheuchen. Sie lässt uns allein, wenn sie auf die Jagd geht. Es sollte ein Wolf hier sein und auf uns aufpassen, ein jüngeres Rudelmitglied, das bei uns bleibt. Aber unsere Mutter ist alles, was vom Rudel noch übrig ist, und so muss sie allein jagen, und wir müssen dort bleiben, wo sie uns lässt.
Eines Tages schüttelt sie uns ab, lange bevor wir genug von ihrer Milch getrunken haben. Sie verlässt uns, geht auf die Jagd, schlüpft aus dem Bau, während der Abend sich allmählich über das Land senkt. Wir hören ein einziges Jaulen von ihr. Das ist alles.
Mein Bruder, der Größte von uns, ist ängstlich und neugierig zugleich. Er winselt laut und versucht, sie zu uns zurückzurufen, aber es ertönt keine Antwort. Er macht Anstalten, zum Eingang des Baus zu laufen, und meine Schwester folgt ihm, aber im nächsten Augenblick kommen sie zurückgeeilt, um sich furchtsam neben mich zu kauern. Vor dem Bau gibt es seltsame Gerüche, böse Gerüche, Blut und Geschöpfe, die wir nicht kennen. Während wir uns winselnd verstecken, wird der Blutgeruch stärker. Wir tun das Einzige, worauf wir uns verstehen: Wir ducken uns und rücken an der hinteren Wand des Baus eng zusammen.
Wir hören Geräusche. Etwas gräbt am Eingang unserer Höhle. Keine Pfoten. Es klingt wie ein großer Zahn, der in die Erde beißt, beißt und reißt, beißt und reißt. Wir ducken uns noch tiefer, und mein Bruder sträubt das Nackenfell. Wir hören wieder Geräusche und erkennen, dass mehr als ein Wesen sich vor unserer Höhle aufhält. Der Blutgeruch wird stärker und vermischt sich mit dem Duft unserer Mutter. Die Grabgeräusche gehen weiter.
Dann dringt noch ein Geruch zu uns. In späteren Jahren werde ich wissen, worum es sich handelt, aber in dem Traum ist es noch kein Rauch. Es ist ein Gestank, den keiner von uns versteht, und er wird in Schwaden in den Bau hineingefächelt. Wir heulen, denn er brennt uns in den Augen und saugt uns die Luft aus der Lunge. Der Bau wird heiß und stickig, und am Ende kriecht mein Bruder zum Höhleneingang. Wir hören sein wildes Aufjaulen, das nicht abreißt, und riechen den Uringestank der Angst. Meine Schwester kauert sich hinter mich und wird immer kleiner und stiller. Und dann atmet sie nicht mehr und versteckt sich nicht mehr. Sie ist tot.
Ich sinke nieder, lege mir die Pfoten über die Schnauze und bin vom Rauch geblendet. Die Grabgeräusche setzen sich fort, und irgendetwas packt mich. Ich jaule und wehre mich, aber es hält mein Vorderbein umklammert und zerrt mich aus dem Bau.
Meine Mutter ist ein Pelz und ein blutiger roter Kadaver, den man beiseite geworfen hat. Mein Bruder kauert verängstigt auf dem Boden eines Käfigs auf der Ladefläche eines zweirädrigen Karrens. Sie werfen mich neben ihn und ziehen dann den Leichnam meiner Schwester ins Freie. Sie sind böse, dass sie tot ist, und versetzen ihr Tritte, als könnte ihr Zorn sie irgendwie zwingen, noch Schmerzen zu empfinden. Dann häuten sie sie, während sie sich über die Kälte und die aufziehende Dunkelheit beschweren, und legen ihren kleinen Pelz zu dem meiner Mutter. Die beiden Männer steigen auf den Karren und peitschen auf ihr Maultier ein, während sie schon Berechnungen anstellen, welchen Preis ihnen Wolfswelpen auf dem Hundekampfmarkt einbringen werden. Von den blutigen Fellen meiner Mutter und meiner Schwester steigt mir der Gestank des Todes in die Nase.
Das ist nur der Anfang einer Marter, die ein Leben lang andauert. An manchen Tagen füttert man uns, an anderen nicht. Wir werden nicht vor dem Regen beschirmt. Die einzige Wärme geht von unseren Körpern aus, wenn wir uns aneinanderschmiegen. Mein Bruder stirbt, dünn und von Würmern befallen, in einer Grube, in die man ihn wirft, um die Wildheit der Kampfhunde anzustacheln. Und dann bin ich allein. Man füttert mich mit Schlachtabfällen, mit Essensresten oder mit gar nichts. Meine Pfoten werden wund, weil ich am Käfig kratze, meine Krallen spalten sich, und meine Muskeln schmerzen von der Enge. Sie schlagen mich und versetzen mir Stöße, um mich zu verleiten, mich gegen die Gitterstäbe zu werfen, die ich nicht durchbrechen kann. Sie reden vor meinem Käfig von ihren Plänen, mich in die Kampfgruben zu verkaufen. Ich höre die Worte, aber ich verstehe sie nicht.
Oh doch, ich verstand die Worte. Ich erwachte zuckend, und einen Moment lang war alles falsch und fremd. Ich lag zitternd zu einer Kugel zusammengerollt, und mein Fell war abgestreift, um bloße Haut freizulegen; meine Beine waren im falschen Winkel gekrümmt und von irgendetwas eingeengt. Meine Sinne waren so betäubt, als wäre ich in einen Sack gewickelt. Ringsum roch es nach den Kreaturen, die ich verabscheute. Ich bleckte die Zähne und kämpfte mich knurrend aus meinen Fesseln frei.
Selbst nachdem ich, gefolgt von der Bettdecke, auf dem Boden gelandet war und mein Körper mir bestätigte, dass ich wirklich einer der verhassten Menschen war, sah ich mich verwirrt in dem dunklen Zimmer um. Es fühlte sich an, als sollte es Morgen sein, aber der Boden unter mir bestand nicht aus den glatten Eichendielen meines Schlafzimmers, und der Raum roch nicht, als würde er mir gehören. Ich kam langsam auf die Beine, während meine Augen sich anstrengten, sich an das schwache Licht zu gewöhnen. Mühsam erspähte ich das Blinzeln winziger roter Augen und übersetzte es dann in die ersterbende Glut eines Feuers. In einem Kamin.
Als ich mich durch die Kammer tastete, kam die Welt um mich herum wieder ins Lot. Chades alter Schlupfwinkel in Bocksburg löste sich aus der Schwärze, als ich die Glut schürte und ein paar kleine Holzscheite nachlegte. Wie betäubt suchte ich frische Kerzen und zündete sie an. Das Zimmer erwachte zu seinem ewigen Zwielicht. Ich sah mich um und ließ mich von meinem Leben einholen. Meiner Einschätzung nach war die Nacht vergangen und jenseits der dicken, fensterlosen Mauern der Tag heraufgedämmert. Die entsetzlichen Geschehnisse des Vortags brachen wie eine Springflut über mich herein: Ich hatte den Narren beinahe getötet, mein Kind in der Obhut von Leuten zurückgelassen, denen ich nicht völlig traute, und Sieber dann in gefährlichem Maße Gabenkraft entzogen, um den Narren nach Bocksburg zu bringen. Diese neuen Erinnerungen vereinten sich mit den allumfassenden älteren an all die Abende und Nächte, die ich in dieser fensterlosen Kammer verbracht hatte, um die Fertigkeiten und Geheimnisse zu erlernen, über die man verfügen musste, um Assassine des Königs zu sein. Als die Scheite endlich in Brand gerieten und den matten Kerzenschein im Raum verstärkten, fühlte ich mich, als hätte ich eine lange Reise unternommen, um zu mir selbst zurückzukehren. Der Wolfsalbtraum von der entsetzlichen Gefangenschaft verblasste. Ich fragte mich kurz, warum er mit solcher Wucht zu mir zurückgekehrt war, und verdrängte den Gedanken dann. Nachtauge, mein Wolf, mein Bruder, weilte schon längst nicht mehr auf dieser Welt. Ein Echo von ihm lebte in meinem Verstand, meinem Herzen und meinem Gedächtnis weiter, aber dem, was mir nun bevorstand, musste ich mich ohne seine Rückendeckung stellen. Ich war allein.
Bis auf den Narren. Mein Freund war zu mir zurückgekehrt. Übel zugerichtet, zerschlagen und womöglich nicht ganz bei Verstand, aber er war wieder an meiner Seite. Ich hielt eine Kerze erhoben und wagte mich an das Bett zurück, das wir uns geteilt hatten.
Der Narr schlief noch tief und fest. Er sah schrecklich aus. Sein narbenübersätes Gesicht wies Spuren der Folter auf. Fährnisse und Hunger hatten seine Haut aufgeraut und abgeschürft und sein Haar zu brüchigem Stroh ausdünnen lassen. Dennoch sah er schon besser aus als bei unserer gestrigen Begegnung. Er war sauber, satt und warm, und seine ruhige Atmung war die eines Mannes, dem neue Kraft zugeflossen ist. Ich wünschte, ich hätte sagen können, ich hätte sie ihm geschenkt. Völlig unwillkürlich hatte ich sie stattdessen Sieber entzogen und sie während unserer Gabenreise durch die stehenden Steine an meinen Freund weitergegeben. Es tat mir leid, dass ich Sieber in meiner Unwissenheit so zugesetzt hatte, aber ich konnte die Erleichterung nicht leugnen, die ich verspürte, als ich den stetigen Atem des Narren hörte. Gestern Abend hatte er die Kraft gefunden, mit mir zu sprechen, und das weit ausführlicher, als ich es von dem geprügelten Bettler erwartet hätte, den ich zuerst in ihm erblickt hatte.
Aber geborgte Stärke ist keine echte Stärke. Die hastige Gabenheilung, die ich an ihm vollzogen hatte, hatte ihm seine spärlichen körperlichen Reserven geraubt, und die Lebenskraft, die ich Sieber abgezapft und ihm verliehen hatte, konnte ihn nicht lange nähren. Hoffentlich hatten die Speisen und die Ruhe, die ihm gestern vergönnt gewesen waren, schon begonnen, seinen Körper wiederaufzubauen. Ich sah zu, wie er tief und fest schlief, und wagte zu hoffen, dass er überleben würde. Behutsam sammelte ich das Bettzeug auf, das ich bei meinem Sturz zu Boden gerissen hatte, und steckte es warm um ihn fest.
Er hatte sich so verändert. Er war ein Mann gewesen, der Schönheit in jeder Form geliebt hatte. Seine maßgeschneiderten Gewänder, der Zierrat in seinen Gemächern, die Vorhänge seines Bettes und seiner Fenster, sogar das Band, das sein tadellos frisiertes Haar zurückgehalten hatte – alles war unter den Gesichtspunkten der Harmonie und Mode ausgewählt gewesen. Aber diesen Mann gab es nicht mehr. Er war als zerlumpte Vogelscheuche zu mir zurückgekehrt, so vom Fleisch gefallen, dass sein Gesicht nur noch aus Haut und Knochen bestand. Geprügelt und geblendet trug er die Narben der Folter und war von all seinem Leid so gewandelt, dass ich ihn erst nicht wiedererkannt hatte. Der geschmeidige, gelenkige Possenreißer mit dem spöttischen Lächeln war verschwunden. Genau wie der elegante Fürst Leuenfarb mit seinen feinen Kleidern und seinem aristokratischen Gebaren. Mir blieb nur dieses erbarmenswerte Gerippe.
Seine blinden Augen waren geschlossen. Der Mund stand ihm einen Fingerbreit offen. Zischend atmete er ein und aus. »Narr?«, fragte ich und stieß ihn sacht an der Schulter an. Seine einzige Antwort bestand in einem leichten Stocken seines Atems. Dann seufzte er, als würde er Schmerz und Angst von sich geben, bevor seine Atmung wieder in die gleichmäßige des tiefen Schlafs überging.
Er war vor Martern geflohen und hatte eine Reise voller Unbilden und Entbehrungen in Kauf genommen, um mich wiederzufinden. Seine Gesundheit war angeschlagen, und er hatte mörderische Verfolger fürchten müssen. Ich konnte nicht fassen, wie ihm das gebrochen und geblendet gelungen war. Aber er hatte es geschafft, und das zu einem einzigen Zweck. Gestern Abend hatte er mich, bevor er der Bewusstlosigkeit erlegen war, gebeten, für ihn zu töten. Er wollte, dass wir nach Clerres zurückkehrten, an seine alte Schule und zu den Leuten, die ihn gefoltert hatten. Und er hatte mich um den besonderen Gefallen gebeten, meine alte Assassinenkunst zum Einsatz zu bringen, um sie alle zu ermorden.
Er wusste, dass ich jenen Teil meines Lebens hinter mir gelassen hatte. Ich war nun ein anderer Mensch, ein achtbarer Mann, der Verwalter des Anwesens meiner erwachsenen Tochter, der Vater eines kleinen Mädchens. Kein Assassine mehr. Das Töten war für mich Vergangenheit. Es war Jahre her, dass ich sehnig gewesen war, mit Armmuskeln, die hart wie das Herz eines Mörders waren. Ich war jetzt ein Landedelmann. Wir hatten uns beide sehr verändert.
Ich konnte mich noch an das spöttische Lächeln und den funkelnden Blick erinnern, die ihn einst ausgezeichnet hatten und die einen zugleich bezauberten und rasend machten. Er hatte sich gewandelt, aber ich vertraute darauf, dass ich ihn auf die wichtigsten Arten immer noch kannte – die, die über oberflächliche Einzelheiten wie seinen Geburtsort oder die Frage, wer seine Eltern gewesen waren, hinausgingen. Ich kannte ihn, seit wir beide jung gewesen waren. Unwillkürlich verzog ich den Mund zu einem bitteren Lächeln. Nicht, seit wir Kinder gewesen waren. In mancherlei Hinsicht bezweifelte ich, dass auch nur einer von uns je wirklich ein Kind gewesen war. Aber die langen Jahre tiefer Freundschaft waren ein Fundament, an dem ich nicht zweifelte. Ich kannte seinen Charakter. Ich wusste um seine Loyalität und Ergebenheit. Ich kannte mehr seiner Geheimnisse als irgendjemand sonst und hatte diese Geheimnisse so sorgsam gehütet, als wären es meine eigenen. Ich hatte ihn verzweifelt und starr vor Angst gesehen. Ich hatte ihn gebrochen vor Schmerz und bis zur Rührseligkeit betrunken erlebt. Und darüber hinaus hatte ich ihn tot gesehen und war er als Toter gewesen, hatte ich seinen Körper zurück ins Leben geführt und seinen Geist zurückgerufen, um wieder in diesem Körper zu wohnen.
Also kannte ich ihn. Bis in die Knochen.
Das hatte ich zumindest geglaubt.
Ich holte tief Luft und atmete seufzend aus, aber das linderte die Anspannung nicht, die ich empfand. Ich war wie ein Kind und fürchtete mich, in die Dunkelheit zu spähen, weil ich solche Angst vor dem hatte, was ich erblicken mochte. Ich verleugnete etwas, von dem ich wusste, dass es wahr war. Ich kannte den Narren bis in die Knochen. Und ich wusste, dass der Narr tun würde, was immer er tun zu müssen glaubte, um die Welt auf die rechte Bahn zu lenken. Er hatte mich auf Messers Schneide zwischen Tod und Leben tanzen lassen, er hatte von mir verlangt, Schmerz, Ungemach und Verlust zu ertragen. Er hatte sich selbst einem Martertod anheimgegeben, den er für unvermeidlich gehalten hatte. Alles um seiner Zukunftsvision willen.
Wenn er also glaubte, dass jemand getötet werden musste, und die betreffende Person nicht selbst zu töten vermochte, würde er es von mir verlangen. Und er würde die Bitte mit jenen fürchterlichen Worten beschließen: »Für mich.«
Ich wandte mich von ihm ab. Ja. Er würde es von mir verlangen. Das Letzte, was ich je wieder tun wollte. Und ich würde ja sagen. Weil ich ihn nicht, gebrochen und voller Verzweiflung, vor mir sehen konnte, ohne dass eine Flut des Zorns und des Hasses über mich hereinbrach. Niemand, niemand durfte ihn so übel zurichten und danach weiterleben. Keiner, dem es so an Einfühlungsvermögen mangelte, dass er systematisch einen anderen foltern und körperlich zugrunde richten konnte, durfte am Leben bleiben. Ungeheuer hatten ihm dies angetan. Ganz gleich, wie menschlich sie wirken mochten, ihr Werk sprach für sich.
Sie mussten getötet werden. Und ich sollte es tun.
Ich wollte es auch tun. Je länger ich ihn ansah, desto mehr wollte ich ausziehen und sie töten, nicht schnell und stumm, sondern dreckig und lautstark. Ich wollte, dass die Leute, die ihm dies angetan hatten, wussten, dass sie sterben würden – und warum. Ich wollte, dass sie Zeit fanden zu bereuen, was sie getan hatten.
Aber ich konnte es nicht. Und das machte mir zu schaffen.
Ich würde nein sagen müssen. Denn so sehr ich den Narren auch liebte, so tief unsere Freundschaft auch ging, so lodernd heiß mein Hass auch brannte, Bienes Anrecht auf meinen Schutz war größer. Und auf meine Ergebenheit. Ich hatte ihr dieses Anrecht schon verwehrt, als ich sie in der Obhut Dritter zurückgelassen hatte, um meinen Freund zu retten. Mein kleines Mädchen war alles, was mir jetzt noch von meiner Frau Molly blieb. Biene war meine letzte Gelegenheit, ein guter Vater zu werden, und in letzter Zeit hatte ich mich dabei nicht besonders geschickt angestellt. Vor Jahren hatte ich bereits an meiner älteren Tochter Nessel versagt. Ich hatte sie in dem Glauben gewiegt, ein anderer Mann wäre ihr Vater, und es ihm überlassen, sie großzuziehen. Nessel zweifelte jetzt schon an meiner Fähigkeit, für Biene zu sorgen. Sie hatte davon gesprochen, Biene meiner Fürsorge zu entziehen und hierher, nach Bocksburg, zu holen, wo sie selbst die Aufsicht über ihre Erziehung führen konnte.
Das durfte ich nicht zulassen. Biene war zu klein und zu seltsam, um inmitten der Palastintrigen zu überleben. Ich musste sie zu Hause behalten, bei mir, auf Weidenhag, in einem ruhigen und sicheren Herrenhaus auf dem Lande, wo sie so langsam heranwachsen und so merkwürdig sein durfte, wie sie wollte. Und so wunderbar. Obwohl ich sie also alleingelassen hatte, um den Narren zu retten, war es nur dieses eine Mal und nur für kurze Zeit. Ich würde zu ihr zurückkehren. Vielleicht, so tröstete ich mich, konnte ich den Narren mitnehmen, wenn er sich genug erholte – ihn in die Ruhe und Behaglichkeit von Weidenhag bringen, um ihn dort Heilung und Frieden finden zu lassen. Er war nicht in der Verfassung, die Rückreise nach Clerres anzutreten oder mir gar dabei zu helfen, diejenigen zu töten, die ihm dies angetan hatten. Rache konnte man, wie ich wusste, aufschieben, aber das Leben eines heranwachsenden Kindes nicht. Ich hatte eine einzige Gelegenheit, Bienes Vater zu sein, und der Zeitpunkt dafür war jetzt. Dagegen konnte ich jederzeit als Assassine für den Narren tätig werden. Für den Augenblick war das Beste, was ich ihm anbieten konnte, eine friedliche Genesung. Ja. Das würde Vorrang haben müssen.
Eine Zeitlang spazierte ich leise durch den Assassinenschlupfwinkel, in dem ich in meiner Kindheit viele glückliche Stunden verbracht hatte. Das Durcheinander eines alten Mannes war Hochdame Rosmarins ordnungsliebendem Organisationstalent gewichen. Sie führte nun in diesen Gemächern das Regiment. Sie waren sauberer und wohnlicher als früher, aber irgendwie vermisste ich Chades willkürliche Experimente und das Chaos aus Schriftrollen und Heilkräutern. Die Regale, die einst alles von einem Schlangenskelett bis hin zu einem versteinerten Knochenstück enthalten hatten, boten nun eine fein säuberliche Aufreihung verkorkter Flaschen und Töpfe dar.
Alle waren in der eleganten Handschrift einer Dame ordentlich etikettiert. Hier gab es Tragmich und Elfenrinde, Baldrian und Eisenhut, Minze und Bärenfett, Sumach und Fingerhut, Cindin und Rauchkraut aus Tilth. Ein Topf trug die Aufschrift Fernholmer Elfenrinde, wahrscheinlich, um den Inhalt von dem weit milderen Kraut aus den Sechs Provinzen zu unterscheiden. Eine Glasphiole enthielt eine dunkelrote Mixtur, die bei der geringsten Berührung unheimliche Wirbel bildete. Darin waren Silberfäden, die sich nicht mit dem Rot mischten, aber auch nicht wie Öl auf Wasser schwammen. Solch eine Mischung hatte ich noch nie gesehen. Sie trug kein Etikett, und ich stellte sie vorsichtig in den Holzständer zurück, der sie aufrecht hielt. Manche Dinge rührte man besser nicht an. Ich hatte keine Ahnung, worum es sich bei Karugwurz und Blutstrom handelte, aber auf beide Schildchen war neben dem Namen mit roter Tinte ein winziger Schädel gezeichnet.
Auf dem Regal darunter lagerten Mörser mit Stößeln, Messer zum Hacken, Siebe zum Seihen und mehrere kleine schwere Tiegel zum Auskochen. Fleckige Metalllöffel waren ordentlich in einem Ständer aufgereiht. Unter ihnen stand eine Reihe kleiner Tongefäße, die mich zunächst verwirrten. Sie waren nicht größer als meine Faust und glänzend braun glasiert, ebenso wie ihre fest abschließenden Deckel. Sie waren mit Teer versiegelt, bis auf ein Loch in der Mitte jedes Deckels. Ein Schwänzchen aus gewachster Leinenkordel ragte aus jedem Loch hervor. Ich hob einen Topf vorsichtig hoch und verstand dann. Chade hatte mir erzählt, dass seine Experimente mit explosivem Pulver Fortschritte machten. Das hier waren seine neuesten Errungenschaften zum Menschentöten. Ich stellte den Topf sacht wieder ab. Die Gerätschaften des Mordhandwerks, das ich mittlerweile nicht mehr ausübte, standen wie treue Soldaten vor mir stramm. Ich seufzte, aber nicht vor Bedauern, und wandte mich von ihnen ab. Der Narr schlief weiter.
Ich räumte die Teller unseres nächtlichen Mahls auf ein Tablett und brachte das Zimmer auch sonst in Ordnung. Es blieben die Wanne voller Badewasser und das ekelhaft verschmutzte Untergewand, das der Narr getragen hatte. Ich wagte nicht einmal, es im Kamin zu verbrennen, aus Angst vor dem Gestank, den es verströmen würde. Ich verspürte keinerlei Abscheu, nur Mitleid. Meine eigene Kleidung vom Vortrag war noch von Blut bedeckt, das von einer Hündin und vom Narren stammte. Erst redete ich mir ein, dass es auf dem dunklen Stoff nicht allzu sehr auffallen würde. Dann dachte ich noch einmal darüber nach und ging daran, den alten, mit Schnitzereien verzierten Schrank zu erkunden, der schon immer neben dem Bett gestanden hatte. Früher hatte er lediglich Chades Arbeitskittel enthalten, die samt und sonders aus zweckmäßiger grauer Wolle bestanden und dank seiner ewigen Experimente überwiegend fleckig oder angesengt waren. Jetzt hingen dort nur noch zwei Kittel, beide blau gefärbt und zu klein für mich. Zu meiner Überraschung fand ich auch ein Frauennachthemd und zwei schlichte Kleider sowie schwarze Beinlinge, die an mir lächerlich kurz gewirkt hätten. Aha. Das waren Hochdame Rosmarins Sachen. Für mich gab es hier nichts.
Es widerstrebte mir, mich leise aus den Gemächern davonzuschleichen und den Narren schlafen zu lassen, aber ich hatte viel zu erledigen. Ich vermutete, dass man jemanden herschicken würde, um zu putzen und den Raum aufs Neue mit allem Notwendigen auszustatten, und es war mir nicht lieb, ihn bewusstlos und verwundbar dort allein zu lassen. Aber mittlerweile wusste ich, dass ich Chade Vertrauen schuldete. Er hatte uns am Vorabend trotz seiner drängenden Verpflichtungen mit allem versorgt.
Die Sechs Provinzen und das Bergreich waren bestrebt, Bündnisse auszuhandeln, und zu dem Zweck waren mächtige Gesandte für die Winterfestwoche nach Bocksburg eingeladen worden. Doch inmitten eines Abends voller Feiern, Musik und Tanz hatten Chade und sogar König Pflichtgetreu und seine Mutter, Fürstin Kettricken, sich die Zeit genommen, sich davonzustehlen und den Narren und mich zu begrüßen. Chade hatte sogar einen Weg gefunden, dieses Gemach mit allem zu versehen, was wir benötigten. Er würde nicht leichtsinnig mit meinem Freund umgehen. Wen auch immer er herschickte, der Betreffende würde diskret sein.
Chade. Ich holt Luft und griff mit der Gabenmagie nach ihm aus. Unsere Gedanken streiften sich. Chade? Der Narr schläft, und es gibt einiges, was ich gern erledigen wür…
Ja, ja, schon gut! Nicht jetzt, Fitz. Wir sprechen gerade über die Zustände in Kelsingra. Wenn man dort nicht bereit ist, seine Drachen zu kontrollieren, müssen wir vielleicht ein Bündnis formen, um der Kreaturen Herr zu werden. Ich habe Vorkehrungen für dich und deinen Gast getroffen. Auf dem blauen Regal liegt ein Geldbeutel, falls du ihn brauchst. Aber jetzt muss ich meine ganze Aufmerksamkeit diesem Gespräch widmen. Bingstadt behauptet, dass Kelsingra womöglich ein Bündnis mit der Herzogin von Chalced anstrebt!
Oh. Ich zog mich zurück. Mit einem Schlag kam ich mir wie ein Kind vor, das die Erwachsenen dabei unterbrochen hat, über wichtige Dinge zu sprechen. Drachen. Ein Bündnis gegen Drachen. Ein Bündnis mit wem? Bingstadt? Und was konnte irgendjemand gegen Drachen zu unternehmen hoffen, wenn man sie nicht mit genug Fleisch bestechen wollte, um sie abstumpfen zu lassen? Wäre es nicht besser gewesen, sich mit den arroganten Fleischfressern anzufreunden, statt sie herauszufordern? Unvernünftigerweise fühlte ich mich übergangen, weil niemand nach meiner Meinung gefragt hatte.
Und im nächsten Augenblick tadelte ich mich selbst dafür. Sollten Chade, Pflichtgetreu, Elliania und Kettricken doch sehen, wie sie mit den Drachen fertigwurden! Geh schon, Fitz.
Ich hob einen Wandteppich an und schlüpfte in das Labyrinth aus Geheimgängen hinaus, das sich hinter den Mauern der Bocksburg entlangschlängelte. Einst hatte ich die Spitzelgänge so gut gekannt wie den Weg zu den Ställen. Obwohl so viele Jahre vergangen waren, hatte sich der schmale Korridor, der durch die Innenwände der Burg führte oder sich an ihren Außenmauern entlangwand, nicht verändert.
Ich aber sehr wohl. Ich war kein schmächtiger Junge mehr, auch kein Jüngling. Ich war ein Mann von sechzig Jahren, und obwohl ich mir schmeichelte, dass ich einem harten Arbeitstag immer noch gewachsen war, war ich nicht mehr gelenkig und geschmeidig. An den engen Ecken, an denen ich früher gedankenlos vorbeigewieselt war, musste ich mich nun etwas vorbeizwängen. Ich erreichte den alten Eingang in der Speisekammer, kauerte mich an die verborgene Tür und drückte ein Ohr an die Wand, um einen ruhigen Augenblick abzuwarten, bevor ich mich hinter einem Fleischregal voll baumelnder Würste hervorwagte.
Nur das freundliche Durcheinander des Winterfests rettete mich. Als ich aus der Speisekammer auf den Flur trat, verlangte eine kräftige Frau in mehlbestäubter Schürze von mir zu wissen, weshalb ich so lange brauchte: »Hast du nun das Gänseschmalz für mich gefunden oder nicht?«
»Ich … ich habe es nicht gesehen«, antwortete ich.
»Das liegt daran, dass du in die falsche Speisekammer gegangen bist«, entgegnete sie spitz. »Geh zwei Türen weiter und die Treppe hinunter, nimm dann die zweite Tür in den Kühlraum und such es dort, in einem großen braunen Tontopf auf dem Regal. Beeil dich!«
Sie wirbelte herum und ließ mich stehen. Während sie davoneilte, schimpfte sie hörbar darüber, dass so kurz vor einem Festtag neue Helfer eingestellt worden seien.
Ich stieß den Atem aus, den ich angehalten hatte, und sah, als ich mich umdrehte, einen Burschen ungefähr meiner Größe und meines Körperbaus mit einem schweren braunen Tontopf den Korridor entlangkeuchen. Ich folgte ihm, huschte, als er in die Küche abbog, vorbei an der Tür und dem daraus hervorwabernden Duft nach frischem Brot, dampfender Suppe und bratendem Fleisch und trat ins Freie.
In der Geschäftigkeit, die auf dem Hof der Bocksburg an einem Wintertag herrschte, war ich nur ein Mann wie alle anderen, der in dringenden Angelegenheiten dahineilte. Erstaunt sah ich zum Himmel auf. Es war schon nach Mittag. Ich hatte viel länger geschlafen, als ich beabsichtigt hatte. Eine kurze Unterbrechung des stürmischen Wetters hatte die Sonne hinter den Wolken hervorbrechen lassen, doch es war gewiss mehr Schnee auf dem Weg zu uns.
Zuerst ging ich ins Lazarett und hoffte, mich unter vier Augen bei Sieber entschuldigen zu können. Aber dort herrschte mehr Betrieb als gewöhnlich, denn anscheinend waren einige unserer Gardisten gestern Nacht in eine kleine Schlägerei verwickelt gewesen. Niemand hatte großen Schaden davongetragen, bis auf einen Burschen, dem in die Wange gebissen worden war. Das sah hässlich genug aus, jeden zusammenschrecken zu lassen. Erneut waren Lärm und Unordnung meine Freunde, als ich schnell feststellte, dass Sieber nicht mehr hier war. Ich ging und hoffte, dass er wieder auf den Beinen war, vermutete aber eher, dass er sich noch irgendwo erholte, wo größere Ruhe herrschte. Dann blieb ich vor dem Lazarett stehen, um zu einem Schluss darüber zu gelangen, was ich als Nächstes tun sollte.
Ich wog den Geldbeutel in der Hand, den Chade mir dagelassen hatte. Die Münzen, die ich hatte ausgeben wollen, um meiner kleinen Tochter eine Freude zu machen, lasteten schwer und waren nun noch um das ergänzt, was Chade mir hatte zukommen lassen. Ich hatte auf Weidenhag meine Geldbörse gut bestückt, weil ich geglaubt hatte, Biene am Markttag in Eichenbach auf jede nur erdenkliche Weise verwöhnen zu können. War das wirklich erst gestern gewesen? Trostlosigkeit brach über mich herein. Was ich als einen Tag voller Vergnügen und Genuss geplant hatte, war in Gewalt und Blutvergießen zu Ende gegangen. Um dem Narren das Leben zu retten, hatte ich Biene allein nach Hause geschickt, in die zweifelhafte Obhut von Schreiber Fitz-Vigilant und Hochdame Ungelitten. Die kleine Biene, die erst neun Jahre alt war und eher wie eine Sechsjährige aussah. Ich fragte mich, was für einen Tag sie wohl verlebte. Nessel hatte versprochen, ihr einen Vogel zu schicken, um sie wissen zu lassen, dass ich sicher in Bocksburg eingetroffen war, und ich wusste, dass ich mich diesbezüglich auf meine ältere Tochter verlassen konnte. Also würde ich nachher Briefe an Fitz-Vigilant und Rummel schreiben, aber ganz besonders und vor allem an Biene. Ein fähiger Bote auf einem guten Pferd konnte sie in drei Tagen nach Weidenhag bringen – oder in vieren, wenn noch mehr Schnee fiel. Für den Augenblick würde die Vogelbotschaft reichen müssen. Und da ich gerade Zeit hatte, würde ich nach Burgstadt hinuntergehen, nicht nur, um mir mit dem Geld, das ich von Chade erhalten hatte, neue Kleidung zu kaufen, sondern auch, um Geschenke für Biene zu besorgen. Winterfestgeschenke, so beschloss ich, um ihr zu zeigen, dass ich an sie gedacht hatte, obwohl ich nicht bei ihr sein konnte. Ich würde mich selbst verwöhnen, indem ich sie verwöhnte, auch wenn die Geschenke mehrere Tage zu spät kamen.
Ich entschied mich, zu Fuß in die Stadt zu gehen, statt Pflichtgetreu oder Nessel durch die Gabe zu bitten, mir in den Ställen ein Pferd bereitstellen zu lassen. Pferde kamen mit den steilen kopfsteingepflasterten Straßen nicht gut zurecht, und Pflichtgetreu war zweifellos immer noch vollauf damit beschäftigt, seinen Handelsgesandtschaften ein guter Gastgeber zu sein. Nessel war wahrscheinlich noch sehr verärgert über mich, was ich voll und ganz verdient hatte. Es würde nicht schaden abzuwarten, bis ihr Zorn verraucht war.
Ich stellte fest, dass die Straße breiter war, als ich sie in Erinnerung hatte. Die Bäume beiderseits davon waren zurückgeschnitten worden, und es gab weitaus weniger Schlaglöcher und morastige Stellen als früher. Und die Stadt lag nun näher, da eine Fülle von Häusern und Läden nach und nach an der Straße zur Burg emporgewachsen war. Ein Gebiet, in dem einst ein Wald gelegen hatte, war nun eine Vorstadt. Hier gab es Krämerläden aller Arten, eine billige Kaschemme namens Zur Bockswache und dahinter etwas, das mir verdächtig nach einem Hurenhaus aussah. Die Tür der Schlüpfrigen Forelle war aus den Angeln gerissen, und ein finster blickender Wirt war damit beschäftigt, sie zu reparieren. Dahinter war das alte Burgstadt für den nahenden Feiertag mit Girlanden, Tannenzweigen und leuchtend bunten Wimpeln geschmückt. Auf den Straßen wimmelte es nicht nur von Lieferanten, die zu Tavernen und Gasthäusern wollten, sondern auch von Reisenden und Kaufleuten, die während der Festtage immer gute Geschäfte machten.
Ich brauchte eine Weile, um alles zu finden, was ich benötigte. In einem Laden, der offensichtlich auf Gardisten und Seeleute als Kundschaft ausgelegt war, fand ich zwei billige Hemden, die beinahe passten, eine lange braune Wollweste, einen schweren Umhang und eine Hose, die für eine Weile genügen würde. Ich musste lächeln, als mir klar wurde, dass ich mittlerweile an Kleidung weit besserer Qualität gewöhnt war. Nachdem ich kurz darüber nachgedacht hatte, ging ich in eine Schneiderwerkstatt, wo man rasch Maß nahm und mir versprach, binnen zweier Tage Kleider anzufertigen. Ich befürchtete, dass ich mindestens so lange in Bocksburg sein würde, erwähnte aber, dass ich eine Zulage zahlen würde, wenn meine Garderobe schneller fertig war. Mit Müh und Not schätzte ich die Körpergröße und den sehr geschrumpften Leibesumfang des Narren, und man sagte mir, dass ich, wenn ich am Nachmittag wiederkäme, Unterwäsche und zwei zweckmäßige Hausgewänder für ihn abholen könne. Ich wies darauf hin, dass er krank sei und weiche Stoffe zu schätzen wissen würde. Die Münzen, die ich in der Werkstatt ließ, erkauften mir zügige Arbeit.
Nachdem die notwendigen Einkäufe erledigt waren, begab ich mich in die Straßen hinunter, auf denen Musik und fröhliches Durcheinander herrschten. Hier gab es noch das Winterfest meiner Jugend: Puppenspieler und Jongleure, Gesang und Tanz, Händler, die Süßigkeiten und herzhafte Spezialitäten anboten, Krudhexen, die Tränke und Amulette verkauften, Mädchen mit Stechpalmenkränzen und all die lärmende Seligkeit, die ein Herz sich nur wünschen konnte. Ich vermisste Molly und sehnte mich brennend danach, Biene an meiner Seite zu haben, um das Erlebnis mit ihr zu teilen.
Ich kaufte Geschenke für sie: Bänder mit Glöckchen, Zuckerstangen, eine silberne Halskette mit drei Bernsteinvögeln, ein Paket gewürzter Nüsse, einen grünen Schal mit eingewobenen gelben Sternen, ein kleines Gürtelmesser mit gutem Horngriff und schließlich eine Leinwandtasche, um alles zu tragen. Mir kam der Gedanke, dass ein Bote ihr diese Tasche ebenso mühelos wie einen schlichten Brief bringen konnte, und so füllte ich sie. Eine Kette aus gefleckten Muscheln von einem fernen Strand, eine Duftkugel für ihre Winterkleidertruhe mit den Wollgewändern und dergleichen mehr, bis sich die Tasche kaum noch schließen ließ. Einen Augenblick lang war es ein Tag mit blauem Himmel und frischem Wind, der nach dem Ozean schmeckte. Ein Juwel von einem Tag, und ich genoss es, mir Bienes Entzücken über all die Kleinigkeiten auszumalen, die sie in dieser Tasche entdecken würde. Während ich inmitten der Festfreude herumbummelte, dachte ich daran, welche Worte ich dem Begleitbrief anvertrauen würde, in klar und deutlich geschriebenen Buchstaben, damit sie meine Gedanken selbst lesen konnte und erfahren würde, wie sehr ich es bedauerte, sie zurückgelassen zu haben. Doch bald ließ der Wind eine neue dunkelgraue Schneewolkenbank heranjagen. Es wurde Zeit, auf die Burg zurückzukehren.
Ich machte auf dem Rückweg einen Abstecher in die Schneiderwerkstatt und wurde mit Kleidern für den Narren belohnt. Als ich ging, stahlen sich die immer tiefer hängenden Wolken heran, die vorhin am Horizont gedräut hatten. Schnee begann zu fallen, und der Wind bleckte die Zähne, während ich die steile Straße hinauf zurück zur Burg eilte. Am Tor wurde ich so mühelos eingelassen, wie ich hinausgelangt war: Die Handelsgesandtschaft und die Winterfestfreude hatten bewirkt, dass man den Wachen befohlen hatte, beim Einlass großzügig zu sein.
Aber das rief mir ins Gedächtnis, dass es noch ein Problem gab, das ich bald würde lösen müssen. Ich brauchte eine Identität. Nachdem ich mir den Bart abrasiert hatte, um meiner Tochter einen Gefallen zu tun, hatten nicht nur das Gesinde von Weidenhag, sondern auch Sieber über mein jugendliches Erscheinungsbild gestaunt. Nach all den Jahren, die ich fern von Bocksburg verbracht hatte, fürchtete ich mich davor, mich als Tom Dachsenbless vorzustellen, und das nicht nur, weil die weiße Haarsträhne, die mich auf den Namen hatte verfallen lassen, längst verschwunden war. Die Leute, die sich noch auf Tom Dachsenbless besannen, würden mit einem Mann von sechzig Jahren rechnen, nicht mit einem, der aussah, als wäre er Mitte dreißig.
Statt den Kücheneingang zu nehmen, ging ich bis zu einem Seitenflur und trat durch eine Tür ein, die überwiegend Kurieren und höherrangigen Dienern vorbehalten war. Meine bis zum Bersten gefüllte Tasche verschaffte mir Einlass, und dem einen Unterverwalter, der mich nach meinem Begehr fragte, antwortete ich, dass ich ein Paket für Gabenmeisterin Nessel hätte, und durfte passieren.
Die Wandbehänge und Möbel der Burg hatten sich über die Jahre verändert, aber die grundlegende Abfolge der Gemächer war noch so wie in meiner Kindheit. Ich stieg eine Dienertreppe hinauf, erreichte das Stockwerk, das dem niederen Adel vorbehalten war, und verbrachte eine kurze Zeitspanne damit, so zu tun, als würde ich darauf warten, dass jemand mich dort in eine Zimmerflucht einließ. Sobald der Flur menschenleer war, verschaffte ich mir erfolgreich Zutritt zum nächsten Geschoss und zu der Tür zu Hochdame Quendels alter Bleibe. Der Schlüssel drehte sich geschmeidig, und ich betrat das Zimmer. Der verborgene Zugang zu Chades alter Kammer führte durch einen Schrank voll muffiger alter Frauenkleider.
Ich kroch so unbeholfen durch den Schrank wie in der vergangenen Nacht und ertappte mich bei der Frage, ob Chades ganze Geheimniskrämerei wirklich nötig war. Ich wusste, dass der Narr um diese Gemächer gebeten hatte, weil er immer noch Verfolgung fürchtete, aber ich vertraute darauf, dass unser Weg durch die Steine jedem einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, der ihm auf den Fersen gewesen war. Dann erinnerte ich mich daran, wie das weiße Mädchen gestorben war, dessen Augen von Parasiten gefressen worden waren, und kam zu dem Schluss, dass Vorsicht stets der bessere Weg war. Den Narren gut versteckt zu halten konnte nicht schaden.
Einer von Chades heimlichen Handlangern hatte die Räume aufgesucht, während ich fort gewesen war. Ich musste ihn kennenlernen. Oder sie. Die schmutzigen Kleider des Narren waren entfernt worden, und man hatte die Wanne geleert und in die Ecke geschoben. Die Teller und Gläser von gestern Abend waren weggeräumt. Ein schwerer Steinguttopf mit Deckel stand tief im Kamin, aber der Duft nach geschmortem Rindfleisch war unter der Abdeckung hervorgedrungen und lag im ganzen Zimmer in der Luft. Ein Tuch war über den Tisch gebreitet, und ein Brotlaib lag in eine saubere gelbe Serviette gewickelt neben einem kleinen Teller mit blasser Winterbutter. Eine staubige Flasche Rotwein und zwei Becher nebst Tellern und Besteck waren ebenfalls vorhanden.
Vermutlich zeichnete Kettricken für die zwei zweckmäßigen Leinennachthemden verantwortlich, die über dem Stuhl hingen. Zwei weite Hosen in derselben Webart lagen daneben. Bettstrümpfe aus Lammwolle waren ordentlich zu Kugeln zusammengerollt. Ich lächelte, da ich es durchaus für möglich hielt, dass die einstige Königin ihren eigenen Schrank geplündert hatte, um diese weichen Gewänder zur Verfügung zu stellen. Ich hob sie auf und legte sie ans Fußende des Betts des Narren.
Die Kleider, die man auf dem zweiten Stuhl zurückgelassen hatte, verwirrten mich weitaus mehr. Ein himmelblaues Gewand mit geschlitzten Ärmeln und Dutzenden Knöpfen, mehr, als erforderlich waren, um irgendein Kleidungsstück zu schließen, ruhte auf der Rückenlehne. Auf der Sitzfläche lag eine beinahe vernünftige schwarze Wollhose, deren Beine in Gamaschen mit blau-weißen Streifen ausliefen. Die Hausschuhe daneben ähnelten einem Paar kleiner Boote, mit hochgezwirbelten Spitzen und dickem Absatz. Ich glaubte, dass sie dem Narren zu groß gewesen wären, selbst wenn es ihm gut genug gegangen wäre, um in Bocksburg herumzuspazieren.
Seine tiefe und stetige Atmung war mir schon bewusst, seit ich das Zimmer betreten hatte. Es war gut, dass er noch immer schlief, und ich unterdrückte den jungenhaften Drang, ihn zu wecken und zu fragen, wie er sich fühlte. Stattdessen suchte ich mir Papier und ließ mich an Chades altem Arbeitstisch nieder, um meine Nachricht an Biene zu verfassen. Ich quoll über vor Worten, brachte einen Gruß zustande und starrte das Papier dann eine Weile an. Es gab so viel, was ich sagen musste, von Versicherungen, dass ich rasch zurückkehren würde, bis hin zu Ratschlägen für ihren Umgang mit Fitz-Vigilant und Ungelitten. Konnte ich sicher sein, dass ihre Augen die einzigen sein würden, die lasen, was ich schrieb? Ich hoffte es, und doch gewann meine alte Ausbildung wieder die Oberhand, sodass ich beschloss, dem Papier keine Worte anzuvertrauen, die Unmut gegen Biene hervorrufen konnten. Also schrieb ich nur, dass ich hoffte, dass sie ihre Freude an diesen Kleinigkeiten haben würde. Wie ich seit langem versprochen hatte, war darunter ein Messer für ihren Gürtel, und ich vertraute darauf, dass sie es klug einsetzen würde. Ich erinnerte sie daran, dass ich nach Hause zurückkehren würde, sobald ich konnte, und dass ich hoffte, dass sie ihre Zeit gut nutzen würde, solange ich fort war. Ich befahl ihr nicht, fleißig bei ihrem neuen Hauslehrer zu lernen. In Wahrheit hoffte ich sogar, dass der Unterricht aufgrund meiner Abwesenheit und der Winterfesttage eine Weile ausgesetzt werden würde. Aber auch den Gedanken hielt ich nicht schriftlich fest. Stattdessen ließ ich meine Nachricht mit der Hoffnung enden, dass sie das Winterfest genossen habe, und fügte hinzu, dass ich sie schrecklich vermisste. Dann saß ich eine Weile da und redete mir ein, dass zumindest Rummel dafür sorgen würde, dass am Festtag irgendeine Feier stattfand. An jenem schicksalhaften Tag in Eichenbach hatte ich vorgehabt, ein paar Spielleute anzuheuern. Köchin Muskat hatte eine Speisenfolge vorgeschlagen, die Rummel noch verfeinert hatte. Sie lag irgendwo auf meinem Schreibtisch zu Hause.
Ich musste meiner Tochter besser gerecht werden. Ich musste es, und ich würde es. Aber ich konnte wenig unternehmen, bevor ich nach Hause zurückkehrte. Die Geschenke würden reichen müssen, bis ich für Biene da sein konnte.
Ich rollte meinen Brief zusammen und verschnürte ihn mit einem Stück von Chades Bindfaden. Ich fand sein Siegelwachs, schmolz ein bisschen davon auf den Knoten und drückte meinen Siegelring in den Klumpen. Nicht den angreifenden Hirschbock, der für Fitz-Chivalric Weitseher stand, sondern nur den Dachstatzenabdruck, der dem Gutsherrn Tom Dachsenbless gehörte. Ich stand auf und reckte und streckte mich. Ich würde einen Boten finden müssen.
Meine Alte Macht prickelte. Ich blähte die Nasenlöcher und versuchte, einen Geruch zu erschnuppern. Ohne mich zu rühren, ließ ich den Blick durch den Raum schweifen. Da. Hinter einem schweren Wandteppich, der Hunde bei der Hatz auf einen Hirsch zeigte und einen der geheimen Eingänge ins Zimmer verbarg, atmete jemand. Ich sammelte mich in meinem Körper. Meine eigene Atmung war lautlos. Ich griff nicht nach einer Waffe, verlagerte mein Gewicht aber auf die Füße, sodass ich binnen eines Augenblicks aufstehen, loslaufen, springen oder zu Boden hechten konnte. Ich wartete.
»Greift mich bitte nicht an, Herr.« Eine Knabenstimme. Die langgezogenen Vokale deuteten auf einen Jungen vom Lande hin.
»Komm herein.« Ich versprach ihm nichts.
Er zögerte. Dann schob er ganz allmählich den Teppich beiseite und trat ins matte Licht der Kammer. Er zeigte mir seine Hände. Die rechte war leer, die linke hielt eine Schriftrolle. »Eine Botschaft für Euch, Herr. Das ist alles.«
Ich musterte ihn gründlich und versuchte, ihn einzuschätzen. Jung, vielleicht zwölf. Sein Körper war noch nicht um die Ecke zum Mannesalter gebogen. Knochig, mit schmalen Schultern. Er würde nie ein Hüne sein. Er trug das Bocksburgblau eines Pagen. Seine Haare waren braun und kraus wie das Fell eines Wasserhundes, seine Augen ebenfalls braun. Und er war misstrauisch. Er hatte sich zwar gezeigt, das Zimmer aber nur ein kleines Stück weit betreten. Dass er die Gefahr gespürt und mir seine Anwesenheit mitgeteilt hatte, ließ ihn in meiner Achtung steigen.
»Eine Botschaft? Von wem?«, fragte ich.
Er befeuchtete sich mit der Zungenspitze die Lippen. »Von einem Mann, der sie hierher zu Euch zu senden wusste. Einem Mann, der mich den Weg hierher gelehrt hat.«
»Woher weißt du, dass ich derjenige bin, für den sie bestimmt ist?«
»Er sagte, Ihr würdet hier sein.«
»Aber hier könnte jeder sein.«
Er schüttelte den Kopf, widersprach mir aber nicht. »Vor langer Zeit gebrochene Nase. Altes Blut auf Eurem Hemd.«
»Dann bring sie mir.«
Er kam wie ein Fuchs angeschlichen, der daran denkt, ein totes Kaninchen aus einer Schlinge zu stibitzen. Er setzte die Füße sacht auf und ließ mich nicht aus den Augen. Als er die Tischkante erreichte, legte er die Schriftrolle ab und trat zurück.
»Ist das alles?«, fragte ich ihn.
Er schaute sich im Zimmer um, sah das Feuerholz und das Essen an. »Und was auch immer ich Euch sonst noch holen soll, Herr.«
»Und dein Name ist …?«
Wieder zögerte er. »Asche, Herr.« Er wartete und musterte mich.
»Ich benötige sonst nichts, Asche. Du darfst gehen.«
»Wie Ihr befehlt, Herr«, erwiderte er. Er trat zurück, drehte sich aber nicht um und wandte auch den Blick nicht von mir ab. Einen langsamen Schritt nach dem anderen zog er sich zurück, bis seine Finger den Teppich berührten. Dann verschwand er im Handumdrehen dahinter. Ich wartete, hörte aber nicht das Schlurfen seiner Schritte auf der Treppe.
Nach einem Augenblick erhob ich mich lautlos und huschte zum Teppich. Aber als ich ihn beiseiteriss, sah ich nur leere Luft vor mir. Er war verschwunden, als wäre er nie da gewesen. Ich gestattete mir ein Nicken. Im dritten Anlauf schien Chade endlich einen würdigen Lehrling gefunden zu haben. Ich fragte mich, ob er die Ausbildung selbst übernahm oder ob nicht vielmehr Hochdame Rosmarin den Jungen unterrichtete und wo sie ihn gefunden hatten … Und dann verdrängte ich das alles mit Nachdruck. Es ging mich nichts an. Wenn ich klug war, würde ich kaum Fragen stellen und mich so wenig wie möglich in den derzeitigen Stand der Morde und Intrigen in Bocksburg hineinziehen lassen. Mein Leben war ohnehin schon kompliziert genug.
Ich war hungrig, aber ich beschloss, noch ein wenig zu warten, um zu sehen, ob der Narr erwachen und mit mir essen würde. Ich kehrte an den Arbeitstisch zurück und zog Chades Schriftrolle zu mir heran. Schon bei den ersten beiden Zeilen spürte ich, wie das Netz der Ränke von Bocksburg sich um mich herum zuzog: »Da du hier bist und kaum etwas anderes zu tun hast, als darauf zu warten, dass sein Gesundheitszustand sich bessert, bist du vielleicht willens, dich nützlich zu machen? Kleidung steht zur Verfügung, und man hat bei Hofe die Erwartung auf einen Besucher geweckt, Hochherrn Feldspat von Turmeshöh, einem kleinen, aber traditionsreichen Gut im nordwestlichsten Winkel von Bock. Hochherr Feldspat ist so steinhart wie sein Name und dem Trunk ergeben, und es geht das Gerücht, dass man vor kurzem begonnen hat, in einem Kupferbergwerk auf seinem Grund und Boden Erz von vorzüglicher Güte zu fördern. Deshalb ist er nach Bocksburg gekommen, um sich an den derzeitigen Handelsabsprachen zu beteiligen.«
Da war noch mehr. Ich wurde kein einziges Mal beim Namen genannt, die Handschrift war nicht als Chades erkennbar, das Spiel hingegen sehr wohl. Ich beendete meine Lektüre der Schriftrolle und ging daran, das exotische Kostüm in Augenschein zu nehmen, das man für mich bereitgelegt hatte. Ich seufzte. Mir blieb noch etwas Zeit, bevor man von mir erwarten würde, zum Abendessen und zu den Gesprächen im Großen Saal hinzuzustoßen. Ich kannte meine Rolle: wenig reden, sehr viel lauschen und Chade alle Einzelheiten darüber berichten, wer mich aufsuchte, um mir ein Angebot zu machen – und wie hoch dieses Angebot war. Was der tiefere Sinn dahinter war, konnte ich mir nicht einmal in Ansätzen vorstellen. Ich wusste, dass Chade eine Entscheidung darüber gefällt hatte, was ich wissen musste, und mir genau das, aber nicht mehr mitgeteilt hatte. Wie eh und je webte er sein Spinnennetz.
Und dennoch spürte ich trotz meines Ärgers, wie sich ein Hauch der alten Begeisterung regte. Es war Winterfestabend. Die Burgküche würde sich selbst übertroffen haben, es würde Musik und Tanz geben, Gäste von überall aus den Sechs Provinzen würden anwesend sein. Mit meiner neuen Identität und diesem Gewand, das ebenso Aufmerksamkeit auf mich lenken wie mich als Fremden auszeichnen würde, konnte ich noch einmal für Chade spionieren, wie ich es als Jüngling getan hatte.
Ich hielt mir das Kleid an. Nein, kein Kleid, eine überladene und geckenhafte lange Jacke, die zu den unpraktischen Schuhen passte. Die Knöpfe bestanden aus gefärbtem Knochen, waren zu kleinen blauen Blumensträußchen geschnitzt und zierten nicht nur die Vorderseite, sondern auch die Manschetten. Viele Knöpfe. Knöpfe, die nicht zum Knöpfen dienten, sondern reiner Schmuck waren. Der Stoff war weich und von einer Machart, die ich noch nie zuvor gesehen hatte, und als ich das Kleidungsstück an den Schultern anhob, erwies es sich als weitaus schwerer, als ich erwartet hatte. Ich runzelte die Stirn, erkannte dann aber rasch, dass die geheimen Taschen schon für mich gefüllt worden waren.
Ich fand einen sehr schönen Satz kleiner Dietriche und ein winziges Sägeblatt mit feinen Zähnen. In einer anderen Tasche steckte eine äußerst scharfe Klinge von der Sorte, wie Beutelschneider sie bevorzugten. Ich bezweifelte, dass ich noch fingerfertig genug war, dieses Handwerk auszuüben. Die wenigen Male, die ich es für Chade getan hatte, war es nicht um die Münzen gegangen, sondern darum festzustellen, welche Liebesbriefe in Edels Geldbeutel steckten oder welcher Lakai über weit mehr Lohn zu verfügen schien, als ein ehrbarer Dienstbote je bei sich getragen hätte. Vor Jahren. Vor so vielen Jahren.
Ich hörte ein leises Stöhnen aus dem Bett des Narren, hängte mir die Jacke über den Arm und eilte an seine Seite. »Narr. Bist du wach?«
Er hatte die Stirn in Falten gelegt und die Augen geschlossen, aber als er meine Stimme hörte, verzog er den Mund zu etwas, das beinahe ein Lächeln war. »Fitz. Es ist ein Traum, nicht wahr?«
»Nein, mein Freund. Du bist hier, in Bocksburg. Und in Sicherheit.«
»Oh, Fitz. Ich bin niemals in Sicherheit.« Er hustete ein bisschen. »Ich dachte, ich wäre tot. Ich kam zu Bewusstsein, aber da war kein Schmerz, und ich fror nicht. Also dachte ich, ich wäre tot. Endlich. Dann bewegte ich mich, und all die Schmerzen erwachten.«
»Das tut mir leid, Narr.« Ich trug die Schuld an seinen neuesten Verletzungen. Ich hatte ihn nicht erkannt, als ich gesehen hatte, wie er Biene umklammerte, und so war ich hinzugeeilt, um mein Kind vor einem kranken und womöglich wahnsinnigen Bettler zu retten, nur um festzustellen, dass der Mann, auf den ich ein halbes Dutzend Mal eingestochen hatte, mein ältester Freund auf Erden war. Die rasche Gabenheilung, die ich ihm zugemutet hatte, hatte die Messerwunden geschlossen und verhindert, dass er verblutete. Aber sie hatte ihn zugleich geschwächt, und im Zuge dieser Heilung war ich mir der Vielzahl alter Verletzungen und Entzündungen bewusst geworden, die noch immer in ihm wüteten. Sie würden ihn allmählich töten, wenn ich ihm nicht helfen konnte, genug Kraft für eine gründlichere Heilung zu sammeln. »Hast du Hunger? Im Kamin steht zart gekochtes Rindfleisch. Es ist auch Rotwein da. Und Brot. Und Butter.«
Er schwieg eine Weile. Seine blinden Augen wirkten im schwachen Licht des Zimmers mattgrau. Sie bewegten sich in seinem Gesicht, als würde er trotz allem versuchen, aus ihnen zu sehen. »Wirklich?«, fragte er mit zitternder Stimme. »All das Essen ist wahrhaftig da? Oh, Fitz. Ich wage es kaum, mich zu rühren, damit ich nicht aufwache und feststelle, dass die Wärme und die Decken nur ein Traum sind.«
»Soll ich dir dein Essen dann lieber herbringen?«
»Nein, nein, tu das nicht. Ich kleckere so entsetzlich. Es liegt nicht nur daran, dass ich nichts sehen kann, sondern auch an meinen Händen. Sie zittern. Und zucken.«
Er bewegte die Finger, und mir wurde übel. An einer Hand waren alle weichen Fingerspitzen abgeschnitten worden und hatten nur dickes Narbengewebe zurückgelassen. Auf beiden Seiten wirkten die Knöchel seiner abgemagerten Finger übergroß. Einst hatte er höchst elegante Hände gehabt, mit denen er geschickt jongliert, dem Puppenspiel gefrönt oder Holz zurechtgeschnitzt hatte. Ich wandte den Blick von ihnen ab. »Dann komm. Bringen wir dich zurück auf den Stuhl am Feuer.«
»Dann lass mich vorangehen und warne mich nur, wenn ein Verhängnis droht. Ich würde den Raum gern auswendig lernen. Ich bin darin recht geschickt geworden, seit man mich geblendet hat.«
Mir fiel nichts ein, was ich dazu hätte sagen können. Er stützte sich schwer auf meinen Arm, aber ich ließ zu, dass er sich selbst den Weg ertastete. »Mehr nach links«, warnte ich ihn einmal. Er hinkte, als ob ihm jeder Schritt auf seinen geschwollenen Füßen wehtat. Ich fragte mich, wie es ihm gelungen war, allein und geblendet so weit zu kommen und Straßen zu folgen, die er nicht hatte sehen können. Später, ermahnte ich mich selbst. Für die Geschichte war später noch Zeit.
Er berührte mit der ausgestreckten Hand die Rückenlehne des Stuhls und tastete sich dann bis zur Armlehne hinab. Es dauerte eine Weile, bis es ihm gelang, sich auf den Stuhl zu manövrieren und sich darauf niederzulassen. Das Seufzen, das er ausstieß, war keines der Zufriedenheit, sondern zeugte von der Bewältigung einer schwierigen Aufgabe. Seine Finger tanzten leicht auf der Tischplatte. Dann legte er sie in den Schoß und hielt sie still. »Der Schmerz ist schlimm, aber ich denke, dass ich trotz allem die Rückreise bewältigen kann. Ich werde eine Weile hierbleiben und mich etwas erholen. Dann kehren wir zusammen zurück, um dieses Ungeziefernest auszuräuchern. Aber ich werde mein Augenlicht benötigen, Fitz. Ich muss dir eine Hilfe sein, kein Klotz am Bein, wenn wir uns zurück nach Clerres begeben. Zusammen werden wir ihnen die Gerechtigkeit widerfahren lassen, die sie verdient haben.«
Gerechtigkeit. Das Wort sickerte in mich ein. Chade hatte unsere Assassinenaufgaben immer »das stille Werk« oder »die Gerechtigkeit des Königs« genannt. Wenn ich mich auf diese Queste einließ, was würde es dann sein? Die Gerechtigkeit des Narren?
»Das Essen kommt gleich, nur einen Augenblick«, sagte ich und ging vorerst nicht auf seine Besorgnis ein.
Ich vertraute nicht darauf, dass er klug genug sein würde, Zurückhaltung zu üben und nur wenig zu sich zu nehmen. Ich tat ihm die Speisen auf, eine kleine Portion in Stücke zerteiltes Fleisch und mit Butter bestrichenes, in Streifen geschnittenes Brot. Ich goss ihm Wein ein. Ich nahm seine Hand und wollte sie zum Teller führen, aber ich hatte ihn nicht vorgewarnt, und er zuckte zurück, als hätte ich ihn mit einem heißen Schürhaken verbrannt, und warf beinahe sein Geschirr um. »Entschuldige«, riefen wir wie aus einem Munde. Ich grinste darüber, er dagegen nicht.
»Ich habe versucht, dir zu zeigen, wo dein Essen steht«, erklärte ich sanft.
Er hatte den Kopf geneigt, als würde er beschämt zu Boden sehen. »Ich weiß«, sagte er leise. Dann krochen seine verkrüppelten Hände wie verängstigte Mäuse zur Tischkante und wagten sich behutsam vor, bis er den Rand seines Tellers ertastete. Er führte die Hände sacht über den Teller, berührte, was darauf lag, hob ein Stück Fleisch hoch und schob es sich in den Mund. Ich setzte dazu an, ihm zu sagen, dass eine Gabel neben seinem Teller lag, und hielt mich dann davon ab. Er wusste es. Ich würde einen gefolterten Mann nicht verbessern, als wäre er ein vergessliches Kind. Mit beiden Händen fischte er nach der Serviette und fand sie.
Eine Weile aßen wir schweigend. Als er seinen Teller leergegessen hatte, erkundigte er sich leise, ob ich ihm noch etwas Fleisch und Brot abschneiden würde. Während ich es tat, fragte er unvermittelt: »Also … Wie war dein Leben, während ich fort war?«
Für einen Moment erstarrte ich. Dann häufte ich das geschnittene Fleisch auf seinen Teller. »Es war ein Leben«, sagte ich und staunte selbst darüber, wie fest meine Stimme klang. Ich suchte nach Worten; wie soll man vierundzwanzig Jahre zusammenfassen? Wie berichtet man von einem Werben, einer Hochzeit, einem Kind und davon, wie man Witwer geworden ist? Ich begann. »Nachdem ich mich das letzte Mal von dir getrennt hatte, habe ich mich auf der Heimreise im Gabenpfeiler verlaufen. Ein Weg, der mich bei meinen vorherigen Ausflügen nur wenige Augenblicke gekostet hatte, dauerte Monate. Als der Pfeiler mich endlich ausspuckte, war ich fast von Sinnen. Und als ich ein paar Tage später wieder zu mir kam, erfuhr ich, dass du da gewesen und schon wieder fort warst. Chade gab mir dein Geschenk, die Schnitzerei. Ich lernte Nessel endlich kennen. Das ging zunächst nicht gut. Ich, nun ja … machte Molly den Hof. Wir haben geheiratet.« Meine Worte fuhren sich fest. Selbst in solch dürren Umrissen erzählt, brach mir die Geschichte von neuem das Herz, weil ich so viel gehabt und doch wieder verloren hatte. Ich wollte sagen, dass wir glücklich gewesen waren, aber ich konnte es nicht ertragen, es in der Vergangenheitsform auszusprechen.
»Mein Beileid«, sagte er förmlich. Er meinte es ernst. Einige Augenblicke lange war ich wie vom Donner gerührt.
»Woher weißt du …?«
»Woher ich es weiß?« Er stieß einen kleinen ungläubigen Laut aus. »Oh, Fitz. Was glaubst du, warum ich gegangen bin? Um dir die Freiheit zu lassen, ein Leben zu finden, das dem so nahe wie möglich kam, das für dich, wie ich stets vorausgesehen hatte, auf meinen Tod gefolgt wäre. In so vielen Zukünften nach meinem Tod sah ich dich Molly unermüdlich umwerben, sie zurückgewinnen und endlich einen Teil des Glücks und des Friedens erlangen, die dir in meiner Nähe nie vergönnt gewesen waren. Ich sah voraus, dass sie sterben würde und dass du allein zurückbleiben würdest. Aber das macht das, was du hattest, nicht ungeschehen, und das war das Beste, was ich mir für dich wünschen konnte. Jahre mit deiner Molly. Sie hat dich sehr geliebt.«
Er aß weiter. Ich saß sehr still. Meine Kehle war so fest zugeschnürt, dass der Schmerz mich fast ersticken ließ. Es fiel mir sogar schwer, an dem Kloß im Hals vorbei zu atmen. Obgleich der Narr blind war, spürte er meine Verzweiflung wohl. Eine ganze Weile aß er sehr langsam, als wollte er sowohl das Essen als auch das Schweigen, das ich brauchte, in die Länge ziehen. Langsam tupfte er mit seinem letzten Brotstück den Rest Bratensaft von seinem Teller auf, aß es, wischte sich die Finger an der Serviette ab und ließ dann die Hand zu seinem Weinbecher hinüberwandern. Er hob ihn hoch und nippte daran. Sein Gesicht wirkte beinahe glückselig. Er stellte den Becher ab und sagte leise: »Meine Erinnerungen an gestern sind sehr verwirrend für mich.«
Ich brach mein Schweigen nicht.
»Ich war wohl einen Großteil der Vornacht hindurch gewandert. Ich erinnere mich an den Schnee und an das Wissen, dass ich nicht haltmachen durfte, bevor ich nicht irgendeinen Unterschlupf gefunden hatte. Ich hatte einen guten Stab, und der hilft ganz unbeschreiblich, wenn man keine Augen hat. Und schmerzende Füße. Es fällt mir heute schwer, ohne Stock zu gehen. Aber ich schaffte es. Ich wusste, dass ich auf der Straße nach Eichenbach war. Jetzt erinnere ich mich. Ein Karren fuhr an mir vorbei, und der Kutscher fluchte und schrie mir zu, aus dem Weg zu gehen. Also tat ich es. Aber ich fand seine Karrenspuren im Schnee und wusste, dass sie mich zu einem Zufluchtsort führen würden, wenn ich ihnen folgte. So ging ich. Meine Füße wurden taub, und das bedeutete weniger Schmerz, aber ich stürzte häufiger. Ich glaube, es war sehr spät, als ich Eichenbach erreichte. Ein Hund bellte mich an, und jemand schrie ihn an. Die Karrenspuren führten zu einem Stall. Ich konnte nicht hineingelangen, doch davor war ein Haufen aus Stroh und Dung.« Er schürzte einen Moment lang die Lippen und fügte dann trocken hinzu: »Ich habe gelernt, dass schmutziges Stroh und Mist oft warm sind.«
Ich nickte, besann mich aber dann darauf, dass er mich nicht sehen konnte. »Das sind sie«, räumte ich ein.
»Ich schlief ein wenig und erwachte, als die Stadt sich um mich herum zu regen begann. Ich hörte ein Mädchen singen und erkannte eines der alten Winterfestlieder aus der Zeit, als ich in Bocksburg gelebt hatte. Und so wusste ich, dass es wohl ein guter Tag zum Betteln sein würde. Feiertage locken bei manchen Menschen die Güte hervor. Also beschloss ich zu betteln, um zu versuchen, etwas in den Magen zu bekommen, und dann, wenn ich jemanden traf, der freundlich wirkte, darum zu bitten, dass er mich zum Weg nach Weidenhag führen möge.«
»Also warst du auf der Suche nach mir.«