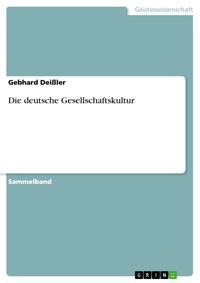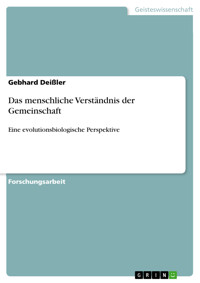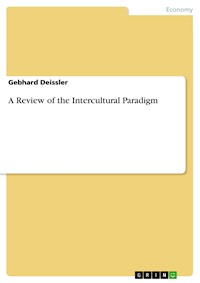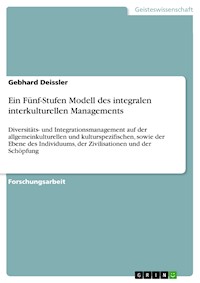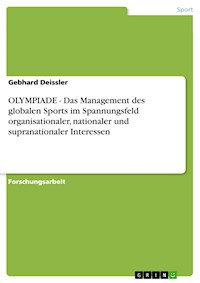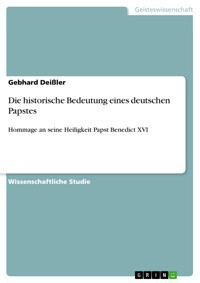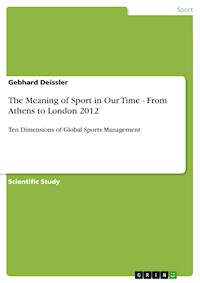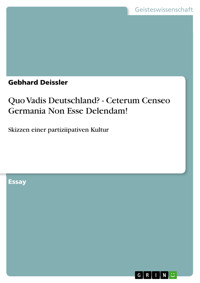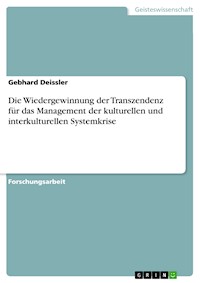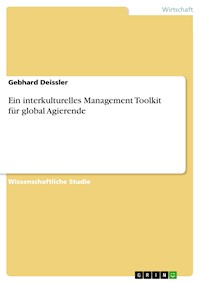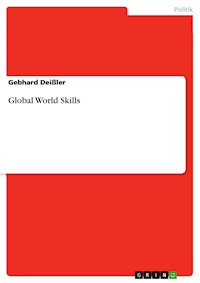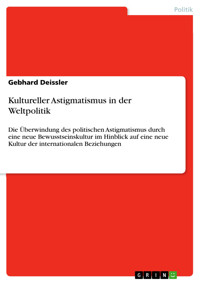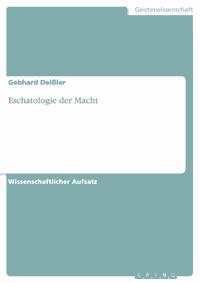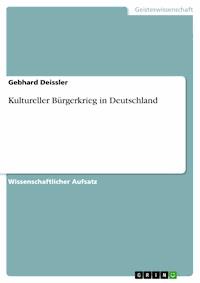39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Forschungsarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Kulturwissenschaften - Sonstiges, , Veranstaltung: interkulturelles Management, Sprache: Deutsch, Abstract: Ebenso, wie es in der Geodäsie zur Kartierung der physischen Raumes zumindest zweier Winkel für die Triangulation bedarf, bedarf es mehrerer Blickwinkel zur Erfassung des geistigen Raumes, in dem wir uns bewegen. Ebenso, wie man in der Quantenphysik ein vollständigeres Bild der Natur erhält, wenn man sie unter ihren komplementären Erscheinungsformen von Teilchen und Wellen wahrnimmt, erhält man ein umfassenderes Abbild der geistigen Natur des Menschen, wenn man komplementäre Formen der Wahrnehmung miteinbezieht, die unsere kulturell konditionierten ergänzen. Der Mensch ist also aufgefordert, so er über die eindimensionale, persönlich und kulturell bedingte Wahrnehmung hinausgehen und die Realität objektiver und umfassender erkennen möchte, seinen Horizont, seine Wahrnehmung und somit seine daraus resultierende Bewusstheit zu erweitern. Er ist aufgefordert, ein höheres Maß an persönlicher Integration in seine ganzheitliche Einheit zu realisieren, um die Realität objektiver abzubilden, da er und die Welt ein interdependentes Kontinuum darstellen. [...]
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Page 1
GebhardDeißler D.E.A./Univ. Paris I
Die transkulturelle
Befreiung vom
interkulturellen toten
Winkel
CULTURE RESEARCH
KULTUR FORSCHUNG
RECHERCHE CULTURE
BUSQUEDA CULTURAL
RICERCA CULTURALE
跨文化的智慧精髓
uтранскультурная
Page 2
Page 3
Page 4
Teil 3
Komplementäre inter- und transkulturelle Techniken für das nachhaltigere
interkulturelle Management …102
Teil 4
Transkulturell optimiertes interkulturelles Referenzwörterbuch mit
zweisprachigem Englisch-Deutschem Paralleltext …116
Literaturhinweise …261
Page 5
Teil 1
Die Entstehung des kulturellen toten
Winkels in der Wahrnehmug
Page 6
1
Die Relativität der Wahrnehmung
Ebenso, wie es in der Geodäsie zur Kartierung der physischen Raumes zumindest zweier
Winkel für die Triangulation bedarf, bedarf es mehrerer Blickwinkel zur Erfassung des
geistigen Raumes, in dem wir uns bewegen. Ebenso, wie man in der Quantenphysik ein
vollständigeres Bild der Natur erhält, wenn man sie unter ihren komplementären
Erscheinungsformen von Teilchen und Wellen wahrnimmt, erhält man ein umfassenderes
Abbild der geistigen Natur des Menschen, wenn man komplementäre Formen der
Wahrnehmung miteinbezieht, die unsere kulturell konditionierten ergänzen. Der Mensch
ist also aufgefordert, so er über die eindimensionale, persönlich und kulturell bedingte
Wahrnehmung hinausgehen und die Realität objektiver und umfassender erkennen
möchte, seinen Horizont, seine Wahrnehmung und somit seine daraus resultierende
Bewusstheit zu erweitern. Er ist aufgefordert, ein höheres Maß an persönlicher Integration
in seine ganzheitliche Einheit zu realisieren, um die Realität objektiver abzubilden, da er
und die Welt ein interdependentes Kontinuum darstellen.
Die kulturell bedingte Eindimensionalität des Wesens seiner Wahrnehmung, insbesondere
aufgrund eines parochial-ethnozentrisch befrachteten Selbstreferenzkriteriums, das einen
Schatten wirft und alles Fremdkulturelle in einen toten Winkel zu seiner Wahrnehmung
rückt, verleiht gewissermaßen nur eine relativ statische Erkenntnis seiner
Page 7
Wahrnehmungswelt und entspricht in metaphorischen quantenphysikalischen Begriffen
tendenziell dem Partikelaspekt der Natur seiner Wahrnehmung, die in der Tat
partikularistisch und relativ ist, während der komplementäre Wellenaspekt einen seine
partikularistische relative Bedingtheit transzendierenden dynamischeren Aspekt seines
Wahrnehmungswesens repräsentiert. Kulturell können wir diese beiden Aspekte als die
kulturellen und die transkulturellen Aspekte des Menschen bezeichnen. Selbst wenn man
den durch die eigenkulturelle Konditionierung geworfenen Schatten und den dadurch
bedingten toten Winkel, in den das Fremdkulturelle gerückt wird, im Wege des
interkulturellen Trainings reduziert, bleibt die Licht- und Schattendialektik des Bereiches
der interkulturellen Dualität fortbestehen. Der interkulturelle Bereich seinerseits kann
allenfalls als Zwielicht betrachtet werden. Er erzeugt naturgemäß tote Winkel der
Wahrnehmung und Erkenntnis und bildet einen toten Winkel inbezug zum
transkulturellen Bereich. Eine metaphorische quantenphysikalische Kulturerkenntnis
würde es gestatten, von einem inter-transkulturellen Dualitätsprinzip zu sprechen, das der
menschlichen kulturellen, wie auch seiner universellen Realität in vollerem Umfang gerecht
wird.
Alles Menschliche, Geist und Körper, steht von seiner Urbedingtheit an im Zeichen der
Dualität. Nur die Realisierung der Einheit des Gesamtterrains bildet die Voraussetzung für
die menschliche Integrität zur umfassenden Abbildung der Realität, kulturell und darüber
hinaus. Der Mensch muss manchmal Alienierungen dieser Integrität überwinden, um die
Voraussetzungen für die umfassendere Wahrnehmung der Integrität der Dinge zu schaffen.
Im westlichen Kulturkreis geht man von einer psychosomatischen Dualität des Menschen
aus. Doch unter Bezugnahme auf die transkulturelle und neurophysiologische Forschung
lässt sich auch hier ein komplementärer Aspekt des Menschen postulieren, der seine
Ganzheit in höherem Maße vervollständigt, sein Terrain in höherem Maße integriert und
somit eine umfassendere Wahrnehmung der Integralität der menschlichen Existenz
ermöglicht.
Page 8
Eine bewusstseinspsychologische Analogie des neurophysiologischen funktionellen
Subordinationsprinzips gestattet die Postulierung einer komplementären, der kulturell und
anderweitig bedingten Ebene übergeordneten und letztere - auf Grund des Prärogativs der
Integration durch die höhere neurophysiologische Ebene - steuernden Bewusstseinsraum.
Dieser Bereich ist nicht dualistisch und erzeugt daher keine toten Winkel, sondern erhellt
sie.
Im zweiten Teil, in dem das Management des durch unsere Bedingtheit entstehenden toten
Winkels durch unsere kulturellen Wahrnehmungsfilter thematisiert wird, wird die
komplementäre Dimension zur kulturrelativen transkulturell und transdisziplinär erforscht
und systematisiert.
Wahrnehmung ist also kulturbedingt. Das hat sich mittlerweile in der interkulturellen
Community herumgesprochen und kann experimentell nachgewiesen werden.
Kulturforscher wie Nancy Adler haben es experimentell mit einem tachistoskopischen
Verfahren nachgewiesen, das erwies, dass Kinder, die in einem kulturellen Kontext
aufwachsen, eben ihrer eigenen kulturellen Sozialisierung gemäß wahrnehmen und die
entsprechende Wahrnehmung im Falle einer experimentellen Filmprojektion selektieren.
Das Prinzip der kulturbedingten Relativität der Wahrnehmung wurde von Philosophen
und Psychologen gleichermaßen formuliert, so zum Beispiel in dem auf Heidegger et alia
zurückgehenden Diagramm (siehe Kap. 7), das dazu verwendet werden kann, das gesamte
interkulturelle Gebäude zu stützen. Es subsumiert eine Anzahl weiterer Modelle, die die
kulturelle und allgemeine Bedingtheit des Menschen veranschaulichen. Jegliches
Management des Wandels, ebenso, wie die friedliche Koexistenz diverser Menschen und
Menschengruppen wurde als durch die Bewusstheit der persönlichen und kulturellen
Relativität bedingt, als durch die Bewusstheit der Bedingtheit der Akteure, erkannt. Das
bestätigen ehemalige Präsidenten ebenso, wie der Psychoanalytiker:
Spitzenpolitiker haben es folgendermaßen formuliert. (Exzerpt aus meiner Schrift
“Intercultural Dictums, Techniques and Terminologies”, Grin Verlag:
Page 9
The Statesman’s View
“If we seek to understand a people,
we have to try to put ourselves,
as far as we can,
in that particular historical and cultural background…”
(Jawaharlal Nehru, Indian statesman, quoted form
Nancy Adler; for further references see J. F. K.
quotation further below)
…the “persistent curse, consisting in the compulsion people feel to define the meaning of
their lives in positive terms with reference to those who are like them racially, tribally,
culturally, religiously, politically, and by negative reference to those who are different.
People then feel compelled to oppress those who are different when they are small and
powerless enough not to prevent it. …the whole course of human history can be seen as a
struggle to expand the definition of who is ‘us’ and shrink the definition of who is ‘them’.”
(Former US president Bill Clinton from International Herald
Tribune, December 19th, 2002, quoted from DICM, Univ. of
Cambridge 2004)
“Let us not be blind to our differences - but let us also direct attention to our common
interests and the means by which those differences can be resolved.”
(Former US president John Fitzgerald Kennedy, Former
President of the United States, quoted from Nancy Adler,
International Dimensions of Organizational Behavior, South-
Page 10
“Nationalism Means War.”
(Former French President François Mitterrand, statement in
Moscow, not long before his demise)
Die Erkenntnis der raum-zeitlich kulturellen (individuellen und kollektiven) Bedingtheit
durch den jeweiligen Kontext reicht vom Jahrtausende alten vedischen Indien bis zur
Weisheit des amerikanischen Indianers:
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes.
(Indian proverb)
Everything has a context.
(Vedic dictum)
Und der Psychoanalytiker Ronald Laing bringt ist auf folgenden Punkt (Zitat aus derselben
Abhandlung):
“The range of what we think and do is limited by what we fail to notice, and because we fail
to notice that we fail to notice, there is little we can do to change, until we notice how failing
to notice shapes our thoughts and deeds.” (Zitat: DICM, Cambridge UK, 2004)
Die Bewusstheit um die Nichtbewusstheit würde somit die Pforten der Bewusstheit öffnen,
vergleichbar mit dem, was Papst Johannes Paul in christlicher Terminologie in
theozentrischer Form postulierte, nämlich die Türen aufzureißen, um Christus als
Verkörperung des dem Menschen natürlich entsprechenden Bewusstseins hereinzulassen,
das befreiend wirkt und obendrein proaktiv allintegrativ in jeder Hinsicht durch das
höchste Gesetz der Liebe Gottes und des Nächsten ist. Nichtchristen formulieren diese
Erkenntnis rein anthropozentrisch. Beide haben Hürden im Hinblick auf die dem Menschen
dadurch zugängliche Freiheit zu überwinden. Er kann dadurch seine Bedingtheit und seine
Freiheit kultureller und der umfassenderen menschlichen Natur gleichermaßen leben und
Page 11
realisieren. Doch in der Bewusstheit der Bedingtheit und der somit möglichen Freiheit wird
die Bedingtheit kein auswegloses Schicksal der Condition Humaine mehr darstellen. Dieser
Zustand der nichtbedingten, aller im Wege der Sozialisierung erworbenen
Konditionierungen - allen voran die persönliche und kulturelle Konditionierung - Freiheit des Bewusstseins und dadurch ungefilterten Wahrnehmung ist
der ursprüngliche und natürliche Zustand des Menschen und keine Abstraktion oder
zusätzliche Komplikation. Die transkulturelle, transdisziplinäre Systematisierung dieses
natürlich-integrativen Bewusstseins wird in Teil 2, im Hinblick auf eine strukturierte
Lösung des Problems des kulturrelativen Astigmatismus, des blinden Flecks in der
Wahrnehmung oder des toten Winkels der Wahrnehmung vorgenommen.
Und die interkulturelle Forschung hat den Sachverhalt der kulturellen Bedingtheit des
Menschen und der dadurch bedingten Ansichten, Einsichten, Werten und
Verhaltensweisen folgendermaßen verbegrifflicht und modelliert. Ich möchte dazu die
Einleitung aus meinem Buch Transcultural Management - Transkulturelles Management
verwenden, da es sich um Prinzipien handelt, die die Zeit überdauern. Nach diesen kleinen
Anzahl kurzer Kapitel, die den Sachverhalt der menschlichen Bedingtheit, insbesondere der
kulturellen, illustrieren und modellieren, dürfte ein gewisses Maß an Bewusstwerdung
hinsichtlich dieser Bedingtheit entstanden, und somit Laings Bedingung der Erkenntnis der
Bedingtheit jeglichen Wandels durch die Bewusstheit um die Nichtbewusstheit erfüllt sein.
Page 12
2
Aspekte des Interkulturellen
Die Globalisierung der Weltwirtschaft und die damit einhergehende Begegnung aller
Kulturen konfrontiert uns mit Herausforderungen, für die es bislang keine Präzedenz gibt.
Über Jahrhunderte war die systematische Begegnung mit anderen Kulturen meist mit
negativem Vorzeichen besetzt und fand in Form militärischer Auseinandersetzungen statt.
Darüber hinaus gab es seit Jahrhunderten auch Kaufleute, die lokal nicht vorhandene Güter
in fremden Breiten beschafften. Die Imperative der Globalisierung haben weltweite Präsenz
erforderlich gemacht. Wir sind weltweit präsent und die Welt ist präsent bei uns, so dass
der Grossteil des Umsatzes namhafter Konzern nicht im Inland, sondern im Ausland
erzielt wird. Umgekehrt besteht die Bevölkerung in unseren Breiten bis zu einem Viertel
und mehr aus Menschen anderer Kulturen. Die interkulturelle Erfahrung auf militärischem
und kolonialem Wege war eine ziemlich einseitige, bei der eine Partei der anderen mehr
oder weniger ihren Willen aufzuzwingen suchte. Da heute beinahe in jedem Haus, nicht
nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land, sowie an jedem Arbeitsplatz Menschen vieler
Kulturen aufeinander treffen, ist es ein Gebot der Stunde, die Frage der Interkulturalität,
der sich kaum noch jemand entziehen kann, in einer solchen Weise zu stellen, dass sie sich
zum Nutzen aller Beteiligten auswirken kann. Alles andere führt zu unüberschaubaren
Konflikten, wie es der Angriff auf das World Trade Center am 11. September 2001 in New
Page 13
York, die Londoner und Madrider Attentate, der noch schwelende Karikaturenstreit, sowie
die Krawalle in der Pariser Banlieue zeigten. Weltweit gärt es. In allen westlichen Ländern,
diesseits und jenseits des Atlantik wird die interkulturelle Debatte meist unter dem
negativen Vorzeichen des Terrorismus, meist defensiv, als Immigrations-Integrations- oder
als Wertedebatte geführt, das heisst, meist einseitig, wie es uns das kriegerisch-koloniale
Paradigma über die Jahrhunderte gelehrt hat. Seit September 2001, ja schon seit Bushs Irak- Feldzug, lebt die gesamte Weltöffentlichkeit im Bann interkultureller globaler und lokaler
Spannungen, die die gesamte Medien- und somit Öffentlichkeitsaufmerksamkeit
monopolisieren. Kriege, Terrorismus. Konfrontation am Arbeitsplatz und im privaten
Umfeld mit ethnisch-kulturellen Fragestellungen lassen keinen mehr teilnahmslos
zuschauen. Alle diese Symptome haben einen kulturellen, bzw. interkulturellen Kern als
Ursache, der natürlich durch soziale, wirtschaftliche und politische Faktoren verstärkt wird.
Das ist der soziale und politische Aspekt des Interkulturellen.
Doch genau so wichtig ist der ökonomische Aspekt des Interkulturellen, dem wir uns hier
schwerpunktmässig widmen wollen: Internationale Joint Ventures, Mergers and
Acquisitions, Post-Merger Integration etc., sowie alle Aktivitäten über kulturelle Grenzen
hinweg fordern ein hohes Mass an interkultureller Kompetenz. Die Interkulturalität und
somit nationales und internationales Diversitätsmanagement scheinen sich also zu einem
Schlüsselkonzept in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu verdichten und somit den
Harvard Professor Samuel Huntington zu bestätigen, der der Ansicht ist, dass die Kultur im
21. Jahrhundert dieselbe Rolle spielen würde, die Faschismus und Kommunismus im 20.
Jahrhundert gespielt haben: eine zentrale, determinierende geschichtliche Rolle.
Nun gibt es drei prinzipielle Antworten auf die Diversität vor unseren Augen: In den
sogenannten universalistischen Kulturen, wie den Vereinigten Staaten beispielsweise,
verbietet das Gesetz die Diskriminierung der Menschen aufgrund ihrer ethnischen,
kulturellen Zugehörigkeit. Man möchte per Gesetz die Gleichheit durchsetzen. Das heisst,
man trägt der Diversität wenig Rechnung, sei es in der Gesellschaft oder auch in den
Betrieben. Eine andere Antwort wäre partikularistischer Natur und würde heissen, dass
Page 14
man kulturelle Diversität nicht minimisiert und nicht verdrängt, sondern sie als das sieht,
was sie ist, nämlich Diversität und verschiedene Modelle der Koexistenz entwickelt, die die
Unterschiedlichkeit anerkennen und respektieren. Eine dritte Antwort besteht darin, dass
man die Diversität systematisch sucht, um sie als strategischen Erfolgsfaktor zu nutzen. Die
dritte Antwort ist die des interkulturellen Managements. In Antwort 1 sieht man von der
Diversität ab, in Antwort 2 sieht man die Diversität und respektiert sie, in Antwort 3 sieht
man sie, respektiert sie und darüber hinaus sucht man sie strategisch zu nutzen. Zwischen
Verneinung und synergistischer Nutzung der Diversität gibt es viele Nuancen und Stufen
der interkulturellen Entwicklung, die unter anderem in Milton Bennetts IDM-Modell
(Interkulturelles Entwicklungs-Modell) in sechs Entwicklungsstufen systematisch erfasst
wurden. Das Modell dieses amerikanischen Kulturforschers besteht aus drei
ethnozentrischen und drei weiterführenden ethnorelativen Entwicklungsstufen
interkultureller Sensibilisierung und Bewusstheit. Eine Standortbestimmung auf dieser
interkulturellen Entwicklungsskala zeigt uns interkulturelle Entwicklungsdefizite und
Entwicklungspotenziale auf. Diese Erörterung kann bestimmt dazu beitragen, von der
ethnozentrischen Phase der Stufen eins bis drei in die ethnorelative Phase der Stufen vier
bis sechs fortzuschreiten, ja selbst weit darüber hinaus, wenn man meinen ganzheitlichen
Ansatz miteinbezieht. Nachfolgend eine kurze Skizzierung des IDM-Modells, das Teil des
von mir entworfenen interkulturellen/transkulturellen Profilers (Kap. 8) ist:
Stufe 1 (Verneinung): Man kann überhaupt keine kulturellen Unterschiede erkennen.
Stufe 2 (Defensive Einstellung): Fremdkulturelles wird negativ bewertet.
Stufe 3 (Minimisierung): Man erkennt Unterschiede in der objektiven Kultur im Bereich
der Sitten und Gebräuche an, betrachtet aber die Grundwerte aller Menschen als
gleich.
Stufe 4 (Akzeptanz): Man erkennt und würdigt kulturelle Unterschiede.
Stufe 5 (Adaptation): Man entwickelt die Fähigkeit des kybernetischen Denkens, das
heisst, die Fähigkeit, die kulturelle Überschneidungssituation von der Warte aller
beteiligten Kulturen, bzw. deren Repräsentanten zu betrachten zu können. Man
Page 15
sollte aber nicht alle Mitglieder einer Gesellschafts- oder Nationalkultur in einen
Topf werfen. Auch wenn man Hofstedes Dimensionen und deren Indexwerte für
die Beschreibung von Kulturen und deren Vergleich verwendet, ist es ratsam,
entsprechend neuerer kultureller Forschung, diese Werte zu präzisieren, indem
man eine Aufteilung in sogenannte kulturell Normale, Marginale und
Hypernormale vornimmt, entsprechend dem Grad, in dem die kulturellen
Wertepräferenzen durch die Vertreter der Kultur zum Ausdruck kommen.
Darüber hinaus hat auch noch jeder Einzelnen sein singuläres kulturelles Profil.
Die Gaussche Normalverteilung bringt das anschaulich zum Ausdruck.
Stufe 6 (Integration): Hier wird der kulturelle Perspektivenwechsel zur zweiten Natur und
zu einem Kreativitätsfaktor durch die Nutzung der verschiedenen verfügbaren
kulturellen Alternativen und Optionen, die man in seine Sichtweise
miteinbezieht.
2001 war also ein Paukenschlag, der das 21. Jahrhundert einläutete und aller Welt deutlich
machte, dass es eine neue Ost-West Kulturfront, eine interkulturelle Verwerfung gibt und
zwar die zwischen moslemischem Fundamentalismus und dem nicht-moslemischen
Westen. Die Islamisten sprechen von einem Kreuzzug gegen den Islam, westliche
Staatsmänner sprechen von einem weltweiten Krieg gegen den Terror und Schurkenstaaten.
Beide legitimieren ihre Anschauung durch ihre kulturellen Werte, die Werte, die aus der
Religion abgeleitet werden auf der einen Seite, gegen die Werte der westlichen Demokratien
auf der anderen Seite. Der Kampf der Kulturen ist also ein Kampf der Werte. Die Wertigkeit
der Werte entzieht sich aber eines objektiven Massstabs. Sie sind kulturbedingt.
An der ökonomischen Front beobachten wir globale Unternehmenszusammenschlüsse, die
hart daran arbeiten müssen, Ihre unterschiedlichen - wenn auch westlichen -Kommunikations- und Managementkulturen auf einen Nenner zu bringen. Der Arcelor
Chef sagte kürzlich, dass der Zusammenschluss mit dem indischen Stahl-Giganten Mittal
aus kulturellen Gründen unmöglich sei.
Page 16
Politisch wie wirtschaftlich, national wie international, privat wie gesellschaftlich, ist die
Interkulturalität eine zentrale Gegebenheit und Erfolg oder Misserfolg in zentralen
Bereichen des Lebens - vielleicht sogar die Überlebenschancen der Menschheit - hängen
mehr und mehr von der Fähigkeit ab, Diversität und insbesondere interkulturelle und
internationale Diversität erfolgreich zu managen.
Erfolgreiches Kulturmanagement besteht aber nicht nur darin, dass man die mit der
Diversität verbundenen Konfliktpotentiale entschärft, sondern vielmehr, dass man lernt,
widersprüchliche Werte darüber hinaus als strategischen Erfolgsfaktor zu nutzen. Kulturell
bedingte Konflikte zu vermeiden oder interkulturelle Konfliktlösung - falls sie bereits
mangels interkultureller Kompetenz entstanden sind - und systematische Nutzung
scheinbar widersprüchlicher kultureller Bedingtheiten, kultureller Hintergründe, national
wie international, um optimalere Lösungen und Leistungen zu Wege bringen, als es in
einem monokulturellen Umfeld möglich wäre, sind Ziele der interkulturellen
Kompetenzentwicklung. Die erfolgreiche Lösung dieser Fragen ist eine Antwort auf
zentrale ethische, politische, ökonomische und individuelle Fragestellungen und Probleme,
denen sich der Mensch an der Schwelle des dritten Jahrtausends bisweilen hilflos, ja sogar
fassungslos, ausgesetzt fühlt und sieht.
Konkrete Ziele der interkulturellen Kompetenzentwicklung im transnationalen
Management sind unter anderem folgende:
1. Kulturelle Diversität erkennen, verstehen und sie in den menschlichen
Gesamtzusammenhang einordnen können.
2. Die Bedeutung einer Ethik kultureller Verantwortung verstehen.
3. Konditionierung verstehen und überwinden lernen.
4. Synergiebewusstsein und Synergietechnik erwerben.
Page 17
5. Selbstvertrauen im Umgang mit anderen Kulturen erwerben, das auf
interkultureller Kompetenz, interkultureller Ethik und interkultureller Noetik
gründet.
6. Die eigene Kultur verstehen, akzeptieren und transzendieren lernen.
7. Jedes kulturelle Interfacing (kulturübergreifende Erfahrung) nach dem neuesten
Stand der interkulturellen Forschung analysieren, verstehen und steuern können.
8. Ein neues transkulturelles Management Paradigma kennen lernen, eine Forma
Mentis, die hier als noetisches interkulturelles Management bezeichnet wird, die
das bestehende interkulturelle Expertenwissen ergänzt.
Alle dies Ziele erfordern, dass wir zunächst den Begriff „Kultur“ klären, Kriterien festlegen,
wie man denn Kultur verbindlich definieren und verschiedene Kulturen beschreiben und
vergleichen kann, also eine Sprache für die Thematisierung von Kultur entwickeln, die es
bislang, zumindest für den Grossteil der Menschheit, nicht gibt. Und da es diese nicht gibt,
muss Hand in Hand damit einhergehend die gleichermassen fehlende Sensibilisierung, die
Bewusstheit und das Wissen entwickelt werden, um Kultur erfolgreich zu managen.
Wir haben keine angemessene Sprache dafür. Das deutet daraufhin, dass unsere kulturelle
Programmierung unbewusst ist. Das ist die zentrale Herausforderung: Kultur ist
weitgehend unbewusst, und wir haben keine entwickelte Sprache, um sie zu thematisieren.
Somit ist der Intellekt nicht in der Lage, sie zu managen. Das bedeutet, dass eine
Sensibilität, eine Bewusstheit für Kultur geschaffen, eine angemessene Sprache, sowie
Kategorien entwickelt werden müssen - kulturelles Wissen und Kompetenzen - die der
Intellekt nutzen kann, um Kultur bewusst zu managen. Das nennt man kulturelle
Intelligenz oder interkulturelle Kompetenz.
Der Aufbau der folgenden Abhandlung ist wie folgt: Zunächst wird der Begriff Kultur
Page 18
definiert. Darauf wird ein systematisches Modell der bislang zentralen Erkenntnisse der
interkulturellen Forschung präsentiert. Die als Dimensionen zur Unterscheidung von
Kulturen oder Kulturdimensionen bezeichneten Kategorien werden im einzelnen
beschrieben. Die Möglichkeiten und Grenzen dieses Ansatzes werden verdeutlicht werden,
bevor der Versuch unternommen wird, das bestehende Wissen durch ein optimiertes
Modell zu erweitern.
Page 19
3
Ein Silberstreifen am Horizont
Auf der Ebene der Phänomene erscheinen die verschiedenen Wertepräferenzen, deren
Summe man als Kultur, zumindest als den impliziten Teil der Kultur bezeichnen kann,
widersprüchlich und unvereinbar. Wir beschreiben und klassifizieren die Kulturen und
stellen fest, dass sie teilweise unvereinbar bis gänzlich antagonistisch sind. Auf dieser Ebene
können wir die so genannten culture clashes (kulturbedingten Konflikte) nicht lösen,
zumindest nicht mit der aristotelischen Logik, derzufolge sich, sinngemäss,
widersprüchliche Positionen im selben Raum gegenseitig ausschliessen. So hat die westliche
Welt über Jahrtausende gedacht. Alsdann lenken wir den Blick rückwärts auf den
Beobachter der verschiedenen Kulturen und Werte und stellen fest, welche mentalen
Prämissen zu der Differenzierung der Kulturen geführt haben. Wir lernen nicht nur
Verschiedenheit systematisch zu beschreiben, sondern auch ihre Genese (Entstehung) zu
erklären und finden somit noch einige Bausteine für das Management diversitätsbedingter
Herausforderungen. Durch die Verknüpfung der kulturellen Differenzen mit der zugrunde
liegenden mentalen Systematik haben wir kausale, und nicht nur deskriptive Erkenntnis
über die Diversität, was uns befähigt, das kulturelle Interfacing (kulturübergreifende
Erfahrung) besser zu steuern, prophylaktisch, mediativ und strategisch, synergistisch. Es
bleibt aber dennoch Stückwerk, Meilensteine im Hinblick auf die Überwindung kultureller
Page 20
Konflikte. Zur Überwindung bedarf es der Herangehensweise, die ich im Kapitel über das
noetische Management-Paradigma beschreibe. Voraussetzung dafür ist, dass der Blick auf
das Bewusstsein selbst geschärft und erweitert wird. Folgende Bedingungen sollten erfüllt
werden:
Der Blick, den der Verstand bereits auf der Suche nach Erklärung auf sich selbst gelenkt hat,
muss geschärft und erweitert werden, die mentale Software in eine Gesamtperspektive des
menschlichen Geistes, des Bewusstseins an sich, gestellt werden.
Die Einstellung zur Diversität muss objektiviert werden, denn
a. Durch Äonen von Konditionierung, geschweige denn die systematische
Konditionierung für Zwecke der Machtkonsolidierung und Erweiterung wie im
Nationalismus beispielsweise, haben wir gelernt - und das ist Teil unserer universellen
mentalen Software - Unterschiede als bedrohlich wahrzunehmen. Die Erkennung dieses
Kausalzusammenhangs zwischen der Konditionierung und diesem konditionierten
Reflex kann bereits den durch das kulturelle Interfacing erzeugten Kulturschock
mildern.
b. Wenn man Diversität mit Heterogenität übersetzt, so ist zu sagen, dass diese in den
Naturwissenschaften wie Physik und Biologie antientropisch eingestuft wird, also ein
Wachstums und Lebensfaktor und kein Auflösungsfaktor ist.
c. Beim Menschen sind jedoch beide Optionen möglich. Heterogenität, bzw. Diversität
kann entweder entropische oder antientropische Züge annehmen. Der Mensch in seiner
Freiheit und Verantwortung muss hier eine Entscheidung treffen, die auf Erkenntnis um
diese Ambivalenz beruht (daher die Erfordernis der interkulturellen Intelligenz), damit
aus der Diversität kein Destruktionsfaktor wird.
Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, das heisst, wenn der Geist die der Diversität
Page 21
zugrunde liegenden Gesetzmässigkeit versteht und sie in den Gesamtzusammenhang des
menschlichen Bewusstseins stellt, während er gleichzeitig von seiner ethischen
Verantwortung im Licht der Erkenntnis der Diversität als Destruktions- und
Kreationsfaktor Gebrauch macht, muss es keinen kulturellen Konflikt geben. Es ist ein
Lernprozess, der Evolution bedeutet.
Oft wird die emotionale, die körperliche und geistige Identitätsfrage, in rechtlicher und
ethischer Terminologie diffus als Würde oder in anderer analytische Terminologie als
persönliche Unversehrtheit und Integrität bezeichnet, vernachlässigt, wo doch Gefühle,
körperliche Identität (Körperschema beispielsweise) und geistige Identität die kritischsten
Faktoren sind, weil sie uns in unserer ureigensten Natur treffen und betreffen.
Der Evolutionsprozess vom Ein-Prinzip Imperialismus über Synergie und Ethik zur Noetik
ist eine zunehmend höhere Strukturierung, die die kulturspezifischen Strukturen nicht
auslöscht, sondern ihre Konfliktpotentiale entschärft, indem sie diese in eine höhere Logik,
eine Universallogik integriert, die die kulturspezifischen, partikularistischen
Charakteristika in einen Schutzmantel hüllt, um sie zu schützen, das heisst, um ihren
antientropischen Charakter, sowie auch gegen ihre entropischen Eigenschaften zu schützen;
denn die Diversität ist Quelle der Synergie, wie auch von destruktiven Potentialen. Das
Interfacing von kulturellen Präferenzen ist Ursache von circuli vitiosi oder circuli virtuosi
(Trompenaars Terminologie), von kreativen und destruktiven Wechselwirkungen.
Page 22
4
Was ist Kultur?
Der gängige westliche Kulturbegriff bezieht sich auf die Veredelung des menschlichen
Geistes durch Kunst, Bildung und Wissenschaft. Dieser klassische Kulturbegriff wird auch
als Kultur I bezeichnet. Kultur II dagegen ist das, womit wir uns schwerpunktmässig im
Interkulturellen befassen. Ersteres bezieht sich eher auf das Individuum, letzteres auf die
Kollektivität. Während nicht jeder zwangsläufig Kultur I besitzt, da diese ja von der
individuellen Entwicklung und Verfeinerung des menschlichen Geistes abhängig ist, besitzt
jeder eine oder auch mehrere - im Fall der Bikulturalität beispielsweise - im Hinblick auf
Kultur II. In der Tat, während alle Menschen ihr jeweils individuelles Niveau im Hinblick
auf Kultur I haben, gilt im interkulturellen Bereich das Prinzip der kulturellen Relativität.
Dieses besagt, dass es keinen verbindlichen Massstab für die Qualifizierung einer Kultur in
Bezug auf eine andere als über- oder unterlegen gibt. Demzufolge, ob australischer
Aborigine oder US Yankee (Nordamerikaner), gibt es keine Höher- oder Minderwertigkeit,
ungeachtet der Tatsache, dass der erstere einer 30 000 Jahre alten Kultur, die letztere einer
vielleicht 300 Jahre alten High-tech Zivilisation angehören und dass die einen den Busch,
die anderen den Weltraum explorieren. Dieser Kulturbegriff bezeichnet demnach etwas viel
Grundsätzlicheres als die kulturellen Artefakte (alles was der Mensch geschaffen hat). Der
Begriff Kultur II bezieht sich auf unsere Wertepräferenzen, Einstellungen und
Page 23
Verhaltensweisen in Bezug auf andere Menschen, uns selbst, die Umwelt, Zeit und Raum.
Hier kann es kein über- oder unterlegen geben, weil die Lebensbedingungen ja überall
einzigartig sind. In New York City und im australischen oder afrikanischen Busch sind die
Umfeldbedingungen derart entgegengesetzt, dass jemand sehr wahrscheinlich nicht
überleben würde, wenn er versuchte, die Verhaltensmuster einer Megalopolis auf den
Busch zu übertragen, obwohl beide vielfach als Dschungel bezeichnet werden. Technisch
gesprochen haben wir es hiermit dem kultur- oder sozialanthropologischen Kulturbegriff
zu tun und dieser wird beispielsweise von einem der renommiertesten interkulturellen
Forscher und Consultants, dem Niederländer Fons Trompenaars sehr bezeichnend und im
Einklang mit dem oben beschriebenen, sinngemäss als die Reaktion auf die
Herausforderung des Menschen durch die Umwelt in sehr konkretem Bezug auf sein
Überleben und Fortbestand in der Gemeinschaft beschrieben. Im Dschungel muss man mit
einer Machete (Buschmesser) umgehen können, in einer High-tech Schmiede mit Software-
Kultur ist nicht (kein)... sondern Kultur ist...
1. neuroethologisch (angeborenes Verhalten) erlerntes Verhalten
2. individuelles Phänomen ein kollektives Phänomen
3. nicht generationsspezifisch generationsübergreifend
4. konkret, explizit symbolisch, implizit
5. universal, genetisch verankert veränderlich durch Lernen,
Erfahrung und Anpassung
6. strukturlos fraktal, selbstähnliche
Page 24
7. Selbstzweck ein bedingt bewusstes
des Sozialverhaltens
Apfelthaler (2002) hat, basierend auf Höcklin, unter anderem folgende Definitionen des
Begriffs KULTUR in englischer Sprache zusammengetragen: Nachfolgend einige
Übersetzungen ins Deutsche, beginnend mit Tyler:
1. Tyler (1871) Kultur ist jenes komplexe Ganze, das Werte, Glaubenssätze, Moral,
Gesetze, Gebräuche und alle anderen Fähigkeiten und Gewohnheiten umfasst, die
der Mensch als Mitglied der Gesellschaft erworben hat.
2. Herskovitz (1948) Kultur ist der durch den Menschen entstandene Teil seiner
Umwelt.
3. Kroeber & Kluckhohn (1952) Tradierte Verhaltensmuster und Werte, Ideen und
andere verhaltensprägende symbolische Systeme.
4. Van Maanen & Schein (1979) Die gemeinsamen Werte, Glaubenssätze und
Erwartungen einer Bezugsgruppe.
5. Louis (1983) Drei Aspekte
•Inhalte (Bedeutung und Interpretation),
•Spezifisch für eine
•Gruppe
6. Harris und Moran (1987) Eine offensichtlich menschliche Fähigkeit der Anpassung
an Bedingungen, einschliesslich der Fähigkeit, diese Fähigkeit der Beherrschung
der Umweltbedingungen und das diesbezügliche Wissen den kommenden
Generationen zu vermitteln.
Page 25
7. Hall and Hall (1987) Insbesondere ein System der Generierens, Sendens, Speicherns
und Verarbeitens von Information.
8. Jenks (1993) Kultur ist
•eine allgemein Geistesverfassung,
•der Stand der intellektuellen und moralischen Entwicklung einer
Gesellschaft,
•die Gesamtheit der Künste und intellektuellen Errungenschaften,
•die gesamte Lebensweise eines Volkes
9. Höcklin (1995) Kultur ist
•ein System gemeinschaftlicher Bedeutungen, das Menschen hilft, den
Ereignissen und Gegenständen ihres Lebens Sinn zu verleihen;
•relativ, das heisst, es gibt keine Absolute, an der eine Kultur messbar wäre.
Es gibt kein „besser oder schlechter, sondern nur ein anders“ im Kontext der
Kulturen;
•Gelernt, das heisst, nicht durch Vererbung determiniert, sondern von der
•Umgebung gelernt;
•Gruppenbezogen, also ein kollektives Phänomen