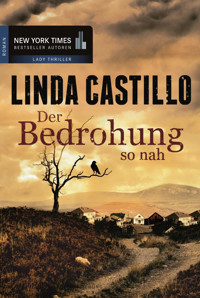Die Zahlen der Toten / Blutige Stille / Wenn die Nacht verstummt - Drei Kate-Burkholder-Krimis in einem Band E-Book
Linda Castillo
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER digiBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kate Burkholder ermittelt
- Sprache: Deutsch
Kate Burkholder, Polizeichefin von Painters Mill, ermittelt bei den Amischen. Entdecken Sie drei spannende Kriminalfälle von SPIEGEL-Bestsellerautorin Linda Castillo Die Zahlen der Toten (Kate Burkholder 1): Der erste Fall für Polizeichefin Kate Burkholder führt sie zu einer verstümmelten Frauenleiche auf einem schneebedeckten Feld. Ist der, den sie den »Schlächter« nennen, wieder zurück? Blutige Stille (Kate Burkholder 2): Sie töteten alle Mitglieder der Familie Plank. Sie waren Amische, gottesfürchtig und bescheiden. Oder enthüllt das Tagebuch der ältesten Tochter eine andere Wahrheit? Wenn die Nacht verstummt (Kate Burkholder 3): Mehrere Verbrechen gegen die amische Gemeinde wurden begangen. Dann findet man drei Leichen in der Güllegrube. Sind es Verbrechen aus Hass gegen die Glaubensgemeinde oder steckt etwas anderes dahinter?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1441
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Linda Castillo
Die Zahlen der Toten / Blutige Stille / Wenn die Nacht verstummt
Drei Kate-Burkholder-Krimis in einem Band
Über dieses Buch
Kate Burkholder, Polizeichefin von Painters Mill, ermittelt bei den Amischen. Entdecken Sie drei spannende Kriminalfälle von SPIEGEL-Bestsellerautorin Linda Castillo
Die Zahlen der Toten (Kate Burkholder 1): Der erste Fall für Polizeichefin Kate Burkholder führt sie zu einer verstümmelten Frauenleiche auf einem schneebedeckten Feld. Ist der, den sie den »Schlächter« nennen, wieder zurück?
Blutige Stille (Kate Burkholder 2): Sie töteten alle Mitglieder der Familie Plank. Sie waren Amische, gottesfürchtig und bescheiden. Oder enthüllt das Tagebuch der ältesten Tochter eine andere Wahrheit?
Wenn die Nacht verstummt (Kate Burkholder 3): Mehrere Verbrechen gegen die amische Gemeinde wurden begangen. Dann findet man drei Leichen in der Güllegrube. Sind es Verbrechen aus Hass gegen die Glaubensgemeinde oder steckt etwas anderes dahinter?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Linda Castillo wurde in Dayton/Ohio geboren und arbeitete lange Jahre als Finanzmanagerin, bevor sie mit dem Schreiben anfing. Ihre Thriller, die in einer Amisch-Gemeinde in Ohio spielen, sind internationale Bestseller, die immer auch auf der SPIEGEL-ONLINE-Bestenliste zu finden sind. Die Autorin lebt mit ihrem Mann auf einer Ranch in Texas.
Inhalt
Buch 1 - Die Zahlen der Toten
[Widmung]
[Motto]
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
Dank
Buch 2 - Blutige Stille
[Widmung]
[Motto]
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
7. KAPITEL
8. KAPITEL
9. KAPITEL
10. KAPITEL
11. KAPITEL
12. KAPITEL
13. KAPITEL
14. KAPITEL
15. KAPITEL
16. KAPITEL
17. KAPITEL
18. KAPITEL
19. KAPITEL
20. KAPITEL
21. KAPITEL
22. KAPITEL
23. KAPITEL
24. KAPITEL
25. KAPITEL
26. KAPITEL
27. KAPITEL
28. KAPITEL
29. KAPITEL
Buch 3 - Wenn die Nacht verstummt
[Widmung]
[Motto]
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Dank
Ich gehöre zu den Schriftstellerinnen, die das Glück haben, während der langen und manchmal schwierigen Monate des Schreibens von einem starken Team unterstützt zu werden. Dieses Buch ist meinem Mann Ernest gewidmet, der rein zufällig auch mein Held im wirklichen Leben ist, sowie Jack und Debbie, denen ich eine wundervolle Reise zu den Amischen zu verdanken habe.
Auf einmal war der Teufel da,
ruf nur seinen Namen, und er ist nah.
Matthew Prior, Hans Carvel
Prolog
Mit sechs hatte sie aufgehört, an Monster zu glauben, und ihre Mutter musste abends nicht mehr unterm Bett und im Schrank nachsehen. Jetzt, mit einundzwanzig, lag sie nackt, gefesselt und grausam gequält auf einem eiskalten Betonboden und wurde eines Besseren belehrt.
Um sie herum war es stockdunkel. Das Herz schlug ihr bis zum Hals, und sie zitterte am ganzen Leib. Ihre Zähne klapperten. Bei jedem auch noch so kleinen Geräusch fürchtete sie die Rückkehr des Ungeheuers.
Anfangs hatte sie noch gehofft, sie könnte fliehen oder ihren Entführer überreden, sie laufen zu lassen. Doch inzwischen hatte die Realität sie eingeholt. Sie wusste, dass das hier nicht gut enden konnte. Es würde keine Verhandlungen geben, keine Rettung durch die Polizei, keine Begnadigung in letzter Minute. Das Monster würde sie töten. Die Frage war nur noch, wann. Aber das Warten war fast so höllisch wie der Tod selbst.
Sie wusste nicht, wo sie war oder wie lange das alles schon dauerte, hatte jedes Gefühl für Zeit und Raum verloren. Allein den Gestank nach verrottetem Fleisch und das höhlenartige Echo noch des kleinsten Lautes nahm sie überdeutlich wahr.
Sie war heiser vom Schreien, erschöpft vom Kämpfen und demoralisiert von den Qualen, die er ihr zugefügt hatte. Eigentlich wollte sie einfach nur noch schnell sterben, aber lieber Gott, wie sehr sie doch am Leben hing …
»Mama«, flüsterte sie.
Über den Tod hatte sie sich nie Gedanken gemacht. Sie war voller Träume gewesen, hatte der Zukunft hoffnungsvoll entgegengesehen und fest daran geglaubt, dass es morgen noch schöner sein würde als heute. Doch jetzt lag sie in der kalten Lache ihres eigenen Urins und akzeptierte, dass es kein Morgen mehr für sie gab. Keine Hoffnung und keine Zukunft. Nur das Grauen über ihren bevorstehenden Tod und dessen Unausweichlichkeit.
Sie lag auf der Seite, die Knie bis zur Brust hochgezogen. Ihre Handgelenke waren auf dem Rücken mit Draht zusammengebunden, und anfangs war der Schmerz fast unerträglich gewesen, doch jetzt spürte sie ihn kaum mehr. Sie wollte nicht daran denken, was er ihr alles angetan hatte. Zuerst die Vergewaltigung, die ihr jedoch angesichts der späteren Ungeheuerlichkeiten, die sie noch hatte erleiden müssen, eher unbedeutend schien.
Das Knistern von Elektrizität hallte ihr noch in den Ohren. Die Erinnerung an den Stromstoß, der ihren Körper durchfahren und ihr Gehirn durchgerüttelt hatte, war noch frisch. Auch den tierischen Klang ihrer eigenen Schreie konnte sie weiterhin hören. Das Rauschen des adrenalingetriebenen Blutes in ihren Adern. Das wilde Hämmern ihres Herzens. Und dann hatte sie wieder das Messer vor Augen.
Er war mit der Konzentration eines makabren Künstlers ans Werk gegangen und ihr dabei so nahe gewesen, dass sie seinen Atem auf der Haut gespürt hatte. Wenn sie schrie, hatte er ihr einen Stromstoß verpasst, und wenn sie mit den Füßen trat, auch. Am Ende hatte sie einfach nur dagelegen und die Marter schweigend ertragen. Für ein paar Minuten waren ihre Gedanken zu dem Strand in Florida gedriftet, wo sie vor zwei Jahren mit ihren Eltern gewesen war. Weißer Sand unter ihren Füßen, eine Brise so feucht und warm, dass sie den Atem Gottes auf ihrer Seele zu spüren glaubte.
»Hilf mir, Mama …«
Stiefelschritte auf Beton rissen sie aus ihrem Tagtraum. Sie hob den Kopf und blickte wild um sich, konnte aber durch die Augenbinde nichts erkennen. Sie atmete stoßweise, wie ein wildes Tier, das man jagte, um es zu schlachten. Sie hasste ihn. Ihn und was er ihr angetan hatte. Wenn sie doch nur ihre Fesseln lösen und wegrennen könnte …
»Lass mich in Ruhe, du Scheißkerl!«, schrie sie. »Lass mich in Ruhe!«
Doch sie wusste, das würde er nicht tun.
Eine behandschuhte Hand strich über ihre Hüfte. Sie wand sich und trat mit beiden Füßen in seine Richtung. Ein flüchtiges Gefühl von Befriedigung, als ihr Peiniger aufstöhnte. Dann das Aufblitzen von Licht. Schmerz durchzuckte ihren Körper, wie nach einem Peitschenhieb. Einen Moment lang war die Welt um sie herum lautlos und grau. Vage spürte sie Hände an ihren Füßen. Hörte in der Ferne Eisen über Beton kratzen. Die Kälte, die sie jetzt durchdrang, ließ ihren ganzen Körper hemmungslos zittern.
Als ihr kurz darauf bewusst wurde, dass das Monster ihr eine Eisenkette um die Fußgelenke gewickelt hatte, erfasste sie purer Horror. Er zog die Kette fest, und die kalten Glieder gruben sich in ihre Haut. Sie versuchte zu treten, ihre Beine freizubekommen, ein letztes verzweifeltes Aufbäumen gegen den drohenden Tod.
Doch es war zu spät.
Sie schrie so lange, bis ihr die Luft ausging. Sie zappelte und wand sich, aber vergebens. Eisen scharrte über Eisen, als ihre Füße langsam von der Kette hochgehoben wurden. »Warum machen Sie das?«, schrie sie. »Warum?«
Die Kette zog knarrend ihre Füße nach oben, höher und höher, bis sie mit dem Kopf nach unten über dem Boden hing. »Hilfe! Helft mir doch! Irgendwer!«
Panik ergriff sie, als die Handschuhhand ihre Haare packte und den Kopf nach hinten zog. Ein Schrei entwich ihren Lungen. Der Schnitt des Messers, die plötzliche Hitze an ihrer Kehle. Wie aus weiter Ferne drang Wasserrauschen an ihr Ohr, als würde es von den Kacheln einer Dusche widerhallen. Sie starrte in die dunkle Augenbinde und spürte das Blut aus sich herausströmen. Das bildete sie sich bestimmt ein, so was konnte gar nicht passieren. Nicht hier. Nicht in Painters Mill.
Und dann, als hätte jemand einen Schalter umgelegt, schwanden ihr die Sinne. Ihr Gesicht wurde heiß und ihr Körper kalt. Die Panik verebbte. Der Schmerz verpuffte im Nichts. Ihre Muskeln erschlafften und ihre Glieder wurden taub.
Er tut mir also doch nicht weh, dachte sie.
Und sie entfloh zu dem weißen Sandstrand, wo schlanke Palmen sich wie graziöse Flamencotänzer im Wind wiegten. Noch nie hatte sie so blaues Wasser gesehen, so weit das Auge reichte.
1. Kapitel
Das Blaulicht auf dem Dach des Streifenwagens flackerte über die kahlen Winterbäume. Officer T. J. Banks hielt auf dem Seitenstreifen. Er schaltete den Suchscheinwerfer ein und leuchtete den Rand des Feldes ab, wo Getreidehalme in der Kälte zitterten. Etwa zwanzig Meter entfernt standen sechs Jersey-Rinder im Wassergraben und käuten in aller Ruhe wieder.
»Blöde Viecher«, murmelte er. Genau wie Hühner gehörten Rinder bestimmt mit zu den dümmsten Tieren der Welt.
Er aktivierte das Funksprechgerät. »Zentrale, siebenundvierzig hier.«
»Was gibt’s, T. J.?«, fragte Mona, die nachts in der Telefonzentrale arbeitete.
»Ich hab hier ’nen 10–54. Stutz’ verdammte Kühe sind wieder mal ausgebrochen.«
»Das ist das zweite Mal in einer Woche.«
»Und immer in meiner Schicht.«
»Was willst du machen? Er hat kein Telefon.«
Der Blick auf die Uhr im Armaturenbrett verriet ihm, dass es fast zwei war. »Also, ich bleib bestimmt nicht hier draußen in der Scheißkälte und passe auf die dämlichen Viecher auf.«
»Vielleicht solltest du sie einfach erschießen.«
»Bring mich nicht in Versuchung.« Er blickte sich um und seufzte. Um diese Uhrzeit stellten Tiere auf der Straße ein großes Unfallrisiko dar. Es brauchte nur einer zu schnell um die Kurve kommen und schon war’s passiert. Er dachte an den ganzen Papierkram, den ein Unfall nach sich zog, und schüttelte den Kopf. »Ich stell ein paar Warnleuchten auf, fahr zu Stutz und hol seinen amischen Arsch aus dem Bett.«
»Melde dich, wenn du Hilfe brauchst.« Sie kicherte.
Er zerrte den Reißverschluss seiner Jacke bis hoch zum Kinn, nahm die Taschenlampe aus der Vertiefung neben dem Sitz und verließ den Streifenwagen. Es war so kalt, dass ihm die Nasenhaare gefroren. Beim Gehen knirschten seine Stiefel im Schnee und sein Atem formte weiße Wölkchen in der Luft. Die Nachtschicht war ihm fast so verhasst wie der Winter.
Er leuchtete mit der Taschenlampe den Zaun ab und fand in zirka sechs Metern Entfernung tatsächlich eine Stelle, wo der Stacheldraht lose am knorrigen Pfahl hing. Zahlreiche Hufabdrücke belegten, dass auch die Kühe die Öffnung entdeckt hatten.
»Verdammte Mistviecher.«
T. J. ging zum Streifenwagen zurück, holte zwei Warnleuchten aus dem Kofferraum und platzierte sie auf dem Mittelstreifen, um die Autofahrer zu warnen. Gerade wollte er umkehren, da bemerkte er auf der Standspur der gegenüberliegenden Straßenseite etwas im Schnee. Neugierig ging er hin. Ein einzelner Frauenschuh, der in Anbetracht des guten Zustands und der fehlenden Schneeschicht darauf noch nicht lange dort liegen konnte. Wahrscheinlich Teenager. Der einsame Straßenabschnitt war beliebt, um ungestört Haschisch zu rauchen und Sex zu haben. Die Kids waren fast so dumm wie die Kühe.
Missbilligend runzelte er die Stirn, stieß mit dem Fuß an den Schuh. Erst da bemerkte er die Schleifspur. Anscheinend war hier etwas durch den Schnee gezogen worden. Mit dem Schein der Taschenlampe folgte er der Spur bis zum Zaun und weiter ins Feld dahinter. Plötzlich tauchte Blut im Lichtkegel auf. Viel Blut. Ihm sträubten sich die Nackenhaare.
»Was zum Teufel ist das denn?«
Er stapfte durch den Wassergraben, wo verdörrtes Gras aus der Schneeschicht ragte, und kletterte über den Zaun. Dahinter fand er noch mehr Blut, dunkel und glänzend im blütenweißen Schnee. So viel, dass einem ganz anders werden konnte.
Die Schleifspur führte ihn in die Nähe einer Gruppe kahler Milchorangenbäume am Rande eines Kornfelds. T. J. konnte seinen eigenen Atem hören, begleitet vom Wispern der abgestorbenen Getreidehalme um ihn herum. Die Hand auf dem Revolver, leuchtete er mit der Taschenlampe einen Radius von dreihundertsechzig Grad ab. Und sah wieder etwas im Schnee.
Vielleicht doch ein angefahrenes Tier, das sich bis hierhin geschleppt hatte und dann verendet war. Aber als er näher kam, blieb der Strahl seiner Taschenlampe auf etwas ganz anderem hängen – bleichem Fleisch, dunklen Haaren, einem nackten Fuß. Bei dem Anblick wurde ihm übel. »Heilige Scheiße.«
Einen Moment lang war T. J. unfähig, sich zu rühren. Wie gebannt starrte er auf die dunkle Blutlache und das bleiche Fleisch. Dann riss er sich zusammen und ging neben dem Körper in die Hocke. War es möglich, dass sie noch lebte? Er streckte die Hand aus und berührte die nackte Schulter. Ihre Haut war eiskalt. Er drehte sie trotzdem um, sah aber nur mehr Blut, fahles Fleisch und glasige Augen, die ihn anzustarren schienen.
Erschüttert wich er zurück. Seine Hand zitterte, als er nach dem Ansteckmikro am Kragen tastete. »Zentrale! Siebenundvierzig hier!«
»Was denn jetzt noch, T. J.? Hat ’ne Kuh dir Beine gemacht und dich einen Baum hochgejagt?«
»Auf Stutz’ Weide liegt ’ne Leiche.«
»Was?«
Sie benutzten in Painters Mill das Zehn-Code-System, aber die Nummer für einen Leichenfund fiel ihm beim besten Willen nicht ein. Die hatte er noch nie gebraucht. »Ich hab gesagt, hier liegt eine Leiche.«
»Das hab ich schon verstanden.« Schweigen. Anscheinend hatte es ihr die Sprache verschlagen. Dann: »Was ist dein Zwanzig?«
»Dog Leg Road, gleich südlich der überdachten Brücke.«
Erneute Pause. »Wer ist es?«
In Painters Mill kannte jeder jeden, doch diese Frau hatte er noch nie gesehen. »Ich weiß es nicht. Eine Frau. Nackt wie Gott sie schuf und toter als Elvis.«
»Ein Autounfall?«
»Das war kein Unfall.« T. J. legte die Hand auf den Griff seiner .38er und ließ den Blick zu den Schatten zwischen den Bäumen wandern. Sein Herz klopfte heftig. »Ruf lieber den Chief an, Mona. Ich glaube, sie ist ermordet worden.«
2. Kapitel
Ich träume vom Tod. Wie immer bin ich in der Küche des alten Farmhauses. Der abgewetzte Holzboden ist voller Blut, rot und grauenerregend. Der Duft von Hefebrot und frisch geschnittenem Heu mischt sich mit dem strengen Geruch meiner Panik, ein Gegensatz, den mein Verstand nicht verarbeiten kann. Durch das Fenster über der Spüle weht eine Brise herein, die Vorhänge bauschen sich. Ich sehe Blut auf dem gelben Stoff. Spritzer an der Wand. Meine Hände sind klebrig.
Ich kauere in der Ecke. Aus meinem Mund kommen fremdartige, tierische Laute, wie erstickte Schreie. Ich spüre den Tod im Raum. Um mich herum nur Dunkelheit. Auch in mir drin. Und im Alter von vierzehn Jahren lerne ich, dass es in meiner sicheren und behüteten Welt das Böse gibt.
Das Telefon reißt mich aus dem Schlaf, und der Albtraum schleicht wie ein nachtaktives Tier zurück in seine Höhle. Ich drehe mich um, taste auf dem Nachttisch nach dem Hörer und drücke ihn ans Ohr. »Yeah.« Meine Stimme krächzt.
»Hallo, Chief, hier ist Mona. Tut mir leid, dass ich Sie wecke, aber ich glaube, Sie müssen kommen.«
Mona vom Telefon-Nachtdienst neigt normalerweise nicht zur Hysterie, deshalb lässt mich die Aufregung in ihrer Stimme aufhorchen. »Was ist los?«
»T. J. ist draußen auf Stutz’ Wiese. Er wollte Kühe zurücktreiben und hat ’ne tote Frau gefunden.«
Meine Benommenheit ist schlagartig weg. Ich setze mich auf und streiche mir die Haare aus dem Gesicht. »Was?«
»Er hat eine tote Frau gefunden und klang ziemlich aufgewühlt.«
Womit T. J. nicht der Einzige ist, ihrer Stimme nach zu urteilen. Ich schwinge die Beine aus dem Bett und greife nach dem Morgenrock. Mein Blick fällt auf den Wecker: gleich zwei Uhr dreißig. »Ein Unfall?«
»Bloß die Leiche. Nackt.«
Als mir bewusst wird, dass ich meine Kleider brauche und nicht den Morgenrock, knipse ich die Lampe an. Das Licht schmerzt in meinen Augen, aber ich bin jetzt hellwach. Trotzdem habe ich Mühe, mir vorzustellen, dass einer meiner Officers eine Leiche gefunden hat. Ich frage nach dem Fundort, und sie nennt ihn mir.
»Ruf Doc Coblentz an«, sage ich. Doc Coblentz ist einer von sechs Ärzten hier in Painters Mill und der zuständige Coroner für Holmes County, Ohio.
Ich gehe zum Schrank, nehme BH, Socken und lange Unterhosen heraus. »Sag T. J., er soll nichts anfassen und auch die Leiche nicht bewegen. Ich bin in zehn Minuten da.«
Die Farm von Stutz umfasst 32 Hektar Land und grenzt an die Dog Leg Road sowie die nördliche Gabelung des Painters Creek. Der Fundort, den Mona mir genannt hat, liegt knapp tausend Meter hinter der alten überdachten Brücke an einem einsamen Straßenabschnitt, der an der County-Grenze endet.
Ich halte hinter T. J.s Streifenwagen, träume von einem Kaffee. Im Licht meiner Scheinwerfer erkenne ich seine Silhouette auf dem Fahrersitz. Er hat Warnleuchten aufgestellt und sein Blaulicht angelassen. Gut. Mit der Taschenlampe in der Hand steige ich aus dem Ford Explorer. Kälte schlägt mir entgegen, lässt mich tief in meinen Anorak kriechen und wünschen, ich hätte die Mütze nicht vergessen. Aus der Nähe betrachtet sieht T. J. ziemlich mitgenommen aus. »Was gibt’s?«
»Eine Leiche. Weiblich.« Er bemüht sich, seiner Polizistenrolle gerecht zu werden, doch als er zum Feld zeigt, zittert seine Hand. Und das liegt nicht an der Kälte. »Zehn Meter feldeinwärts, bei den Bäumen.«
»Und sie ist ganz sicher tot?«
T. J.s Adamsapfel schnellt zweimal auf und ab. »Sie ist kalt. Kein Puls. Alles ist voller Blut.«
»Dann sehen wir uns das mal an.« Wir gehen in Richtung der Bäume. »Haben Sie irgendwas angefasst? Oder verändert?«
Er senkt leicht den Kopf, was wohl Ja bedeutet. »Ich dachte, dass sie vielleicht … noch lebt, und hab sie umgedreht, nachgesehen.«
Das ist schlecht, aber ich sage nichts. T. J. Banks hat das Zeug zum guten Polizisten. Er ist gewissenhaft und nimmt seine Arbeit ernst. Aber er ist ein Neuling und noch unerfahren, arbeitet erst seit sechs Monaten für mich. Ich könnte wetten, das ist seine erste Leiche. Wir stapfen durch knöcheltiefen Schnee. Als ich die Tote sehe, packt mich das kalte Grauen. Ich wünschte, es wäre hell, doch bis Tagesanbruch dauert es noch Stunden. Die Nächte sind lang in dieser Jahreszeit. Das Opfer ist nackt. Um die zwanzig. Dunkelblondes Haar. Die Blutlache um ihren Kopf ist zirka sechzig Zentimeter groß. Sie war einmal hübsch, doch tot hat ihr Gesicht etwas Grausiges. Die Totenflecken verraten, dass sie ursprünglich auf dem Bauch gelegen hat; die eine Gesichtshälfte ist schon blaurot. Ihre Augen stehen halb offen und sind glasig. Die Zunge, auf der sich Eiskristalle gebildet haben, quillt zwischen den geschwollenen Lippen hervor.
Ich gehe neben der Toten in die Hocke. »Sieht aus, als ob sie schon ein paar Stunden hier liegen würde.«
»Frostbrand hat bereits eingesetzt«, bemerkt T. J.
Obwohl ich sechs Jahre lang Streifenpolizistin in Columbus, Ohio, und danach zwei Jahre in der Mordkommission war, ist mir das hier eine Nummer zu groß. Columbus ist zwar nicht gerade eine Mörderhochburg, hat aber wie jede Stadt ihre dunklen Seiten. Tote habe ich mehr als genug gesehen. Doch die offenkundige Brutalität dieser Tat entsetzt mich. Ich hätte gern geglaubt, dass es in einem Ort wie Painters Mill keine so grausamen Morde gibt.
Doch ich weiß es besser.
Ich ermahne mich, dass wir uns an einem Tatort befinden, also stehe ich auf und leuchte mit der Taschenlampe die Umgebung ab. Es gibt keine Spuren außer unseren eigenen. Ein ungutes Gefühl sagt mir, dass wir möglicherweise Beweismittel zertrampelt haben. »Rufen Sie Glock an, er soll herkommen.«
»Glock hat Url…«
Mein Gesichtsausdruck lässt ihn mitten im Wort verstummen.
Das Polizeirevier von Painters Mill besteht aus drei Vollzeit-Kräften, einem Hilfspolizisten, zwei Angestellten in der Telefonzentrale und mir. Rupert »Glock« Maddox, ein ehemaliger Marine, besitzt die größte Erfahrung. Den Spitznamen hat er seiner Vorliebe für die Dienstwaffe zu verdanken. Urlaub hin oder her, ich brauche ihn.
»Sagen Sie ihm, er soll Absperrband mitbringen.« Ich überlege, was wir sonst noch brauchen. »Bestellen Sie einen Krankenwagen. Geben Sie im Krankenhaus von Millersburg Bescheid, dass wir ihnen eine Tote ins Leichenschauhaus bringen. Oh, und Rupert soll Kaffee mitbringen. Viel Kaffee.« Ich blicke hinab auf die Tote.
»Wir sind sicher noch eine ganze Weile hier.«
Dr. Ludwig Coblentz ist ein rundlicher Mann mit großem Kopf, schütterem Haar und einem Bauch so ausladend wie ein VW-Käfer. Ich gehe zum Seitenstreifen, wo er gerade aus seinem Cadillac Escalade steigt. »Einer Ihrer Polizisten soll über eine Tote gestolpert sein«, sagt er wenig erfreut.
»Nicht nur tot«, erwidere ich. »Ermordet.«
Er trägt khakifarbene Hosen und eine rotkarierte Schlafanzugjacke unterm Parka. Ich sehe zu, wie er seine schwarze Tasche vom Beifahrersitz zieht, die er wie eine Brotdose hält. Sein Gesichtsausdruck verrät mir, dass er sofort anfangen will.
Er folgt mir durch den Wassergraben, und obwohl es bis zu der Toten nicht weit ist, atmet er bereits schwer, noch bevor wir über den Zaun steigen. »Wie zum Teufel kommt eine Leiche hierher?«, murmelt er.
»Jemand hat die Frau hier abgeladen, oder sie hat sich mit letzter Kraft selbst hergeschleppt.«
Er sieht mich fragend an, doch ich hülle mich in Schweigen. Ich will nicht, dass er voreingenommen an die Arbeit geht. Erste Eindrücke sind wichtig bei polizeilichen Ermittlungen.
Wir ducken uns unter dem Absperrband durch, das Glock zwischen die Bäume gespannt hat wie Toilettenpapier an Halloween. T. J. hat eine Arbeitslampe an den Ast über der Toten gehängt. Sie spendet nicht besonders viel Licht, ist aber besser als die Taschenlampen. Außerdem haben wir so die Hände frei. Ich wünschte, wir hätten einen Generator.
»Der Tatort ist gesichert«, vermeldet Glock, der mit zwei Bechern Kaffee kommt und mir einen davon hinhält. »Sie sehen aus, als könnten Sie den brauchen.«
Ich nehme den Styroporbecher, hebe den Deckel an und trinke einen Schluck. »Mein Gott, das tut gut.«
Er betrachtet die Tote. »Glauben Sie, jemand hat sie hierher gebracht?«
»Sieht so aus.«
T. J. stellt sich zu uns, wirft einen kurzen Blick auf die tote Frau. »Puh, Chief, ich finde es schlimm, wie sie so daliegt.«
Ich auch. Von hier kann ich ihre Brüste und Schamhaare sehen. Die Frau in mir krümmt sich. Aber es lässt sich nicht ändern; wir dürfen sie weder bewegen noch zudecken, bevor alles aufgenommen ist. »Kennt sie einer von euch?«, frage ich.
Beide Männer schütteln den Kopf.
Während ich an meinem Kaffee nippe, sehe ich mir den Tatort genau an und versuche mir vorzustellen, was passiert sein könnte. »Glock, haben Sie noch die alte Polaroid?«
»Im Kofferraum.«
»Machen Sie ein paar Aufnahmen von der Leiche und dem Fundort.« Dafür dass wir auf dem Schnee rumgetrampelt sind, trete ich mir im Geiste in den Hintern. Ein Sohlenprofil wäre sicher hilfreich gewesen. »Ich will auch Fotos von den Schleifspuren.« Jetzt wende ich mich an beide Männer. »Teilt den abgesperrten Bereich in Quadrate ein und sucht jedes einzelne genau ab, angefangen bei den Bäumen. Tütet alles ein, was ihr findet, auch wenn ihr es für unwichtig haltet. Und macht ein Foto, bevor ihr es anfasst. Vielleicht gibt es ja irgendwo einen Schuhabdruck. Und haltet Ausschau nach Kleidungsstücken oder einer Geldbörse.«
»Wird gemacht, Chief.« Glock und T. J. setzen sich in Bewegung.
Ich wende mich Doc Coblentz zu, der neben der Leiche steht. »Wissen Sie, wer sie ist?«, frage ich.
»Keine Ahnung.« Der Arzt zieht die Winterhandschuhe aus und schiebt die dicken Finger in Latexhandschuhe. Ächzend geht er in die Hocke.
»Können Sie schon sagen, wie lange sie tot ist?«
»Das ist schwer, wegen der Kälte.« Er hebt den Arm der Frau. Sie hat blutige Furchen an den Handgelenken. »Ihre Hände waren zusammengebunden«, sagt er.
Ich betrachte das eingeschnittene Fleisch. Sie hatte versucht, sich zu befreien. »Mit Draht?«
»Vermutlich.«
Sie hat lackierte Fingernägel und ist somit keine Amische. Mir fällt auf, dass zwei Nägel ihrer rechten Hand abgebrochen sind. Sie hatte sich gewehrt. Im Geiste notiere ich, Proben unter ihren Fingernägeln nehmen zu lassen.
»Die Leichenstarre hat schon eingesetzt«, sagt der Doc. »Sie ist mindestens acht Stunden tot. Den Eiskristallen auf der Schleimhaut nach zu urteilen, wahrscheinlich eher zehn. Sobald sie im Krankenhaus ist, messe ich die Körpertemperatur. Die fällt zwischen ein und anderthalb Grad pro Stunde. Wenn ich die weiß, kann ich den Todeszeitpunkt genauer eingrenzen.« Er lässt ihre Hand sinken.
»Hier im Gesicht sind Totenflecke«, sagt er, wobei seine Finger über dem blauroten Fleisch ihrer Wange schweben. Er blickt zu mir hoch. Seine Brille ist leicht beschlagen, und seine Augen wirken riesig hinter den dicken Gläsern. »Hat sie jemand bewegt?«, fragt er.
Ich nicke, sage aber nicht wer, frage stattdessen: »Wie steht’s mit der Todesursache?«
Er holt eine Stiftlampe aus der Jackentasche, zieht das Lid zurück und leuchtet in ihr Auge. »Keine punktförmigen Blutungen.«
»Sie wurde also nicht erdrosselt.«
»Richtig.« Vorsichtig schiebt er die Hand unter ihr Kinn und dreht ihren Kopf nach links. Ihr Mund geht auf, und ich sehe, dass zwei Vorderzähne knapp über dem Zahnfleisch abgebrochen sind. Er dreht den Kopf nach rechts, und die Wunde an ihrem Hals klafft offen wie ein blutiger Mund.
»Man hat ihr die Kehle durchschnitten«, sagt der Arzt.
»Irgendeine Vermutung, womit?«
»Etwas Scharfem, ohne Zacken. Keine augenfälligen Rissspuren. Nicht geschlitzt, sonst wäre die Wunde länger und an den Rändern flacher. Es ist schwer zu sagen bei dem Licht.« Vorsichtig rollt er die Tote auf die Seite.
Mein Blick wandert über ihren Körper. Ihre linke Schulter ist überzogen mit hellroten Schürfwunden, vielleicht auch Brandmalen. Ihre linke Pobacke ebenfalls. Beide Knie sowie die Fußrücken weisen Abschürfungen auf. Die Haut beider Knöchel ist auberginefarben. Das Fleisch selbst ist nicht verletzt, doch ihre Füße waren eindeutig zusammengebunden.
Das Herz rutscht mir in die Hose beim Anblick des Bluts auf ihrem Bauch, knapp über dem Nabel. Halb verdeckt von der dunklen Körperflüssigkeit erkenne ich etwas, das mir bekannt vorkommt. Das ich schon tausendmal in meinen Albträumen gesehen habe. »Und das da?«
»Großer Gott.« Die Stimme des Arztes zittert. »Sieht aus, als wäre etwas ins Fleisch geritzt.«
»Schwer zu erkennen, was es ist.« Doch wir wissen es beide, da bin ich mir sicher. Nur will es keiner laut aussprechen.
Der Arzt beugt sich weiter vor, ist kaum dreißig Zentimeter davon entfernt. »Sieht aus wie zwei Xe und drei l.s.«
»Oder die römische Ziffer dreiundzwanzig«, ergänze ich.
Er sieht mich an, und seine Augen drücken das gleiche Grauen, den gleichen Unglauben aus, der auch mir den Hals zuschnürt. »Vor sechzehn Jahren habe ich so etwas schon einmal gesehen«, flüstert er.
Ich starre die blutigen Einschnitte auf dem Körper der jungen Frau an und bin so fassungslos, dass ich zittere.
Kurz darauf richtet sich Doc Coblentz ein wenig auf. Kopfschüttelnd deutet er auf die Verletzungen auf ihrem Gesäß, die abgebrochenen Fingernägel und Zähne. »Jemand hat ihr fürchterlich zugesetzt.«
Wut und eine Angst, die ich nicht wahrhaben will, steigen in mir hoch. »Wurde sie sexuell missbraucht?«
Mein Herz pocht, als er mit der Stiftlampe auf ihr Schambein leuchtet. Ich sehe Blut auf der Innenseite ihrer Oberschenkel und schaudere innerlich.
»Sieht so aus.« Er schüttelt den Kopf. »Ich weiß mehr, wenn ich sie in der Leichenhalle untersucht habe. Hoffentlich hat der Scheißkerl seine DNA zurückgelassen.«
Der Knoten in meinem Bauch sagt mir, dass es so einfach nicht sein wird.
Ich blicke wieder auf die Tote und frage mich, welches Monster einer jungen Frau, die das Leben noch vor sich hatte, so etwas antun konnte. Und auch, wie viele Menschenleben durch ihren Tod zerstört werden. Mein Kaffee schmeckt jetzt bitter. Mir ist nicht mehr kalt. Ich bin zutiefst erschüttert und aufgebracht von der Brutalität dieser Tat. Schlimmer noch, ich habe Angst. »Tun Sie mir einen Gefallen und stecken ihre Hände in Tüten?«
»Kein Problem.«
»Wie schnell können Sie eine Autopsie vornehmen?«
Mit den Händen auf die Knie gestützt, erhebt sich Doc Coblentz. »Ich kann ein paar Termine verlegen und sofort anfangen.«
Inmitten von Wind und Kälte kämpfen wir vergeblich gegen die Vorstellung an, was die Frau vor ihrem Tod alles durchgemacht haben muss.
»Er hat sie irgendwo anders umgebracht.« Ich blicke auf die Schleifspuren. »Keine Anzeichen eines Kampfes. Hätte er ihr hier die Kehle durchgeschnitten, gäbe es noch mehr Blut.«
Der Doktor nickt. »Blutungen hören auf, sobald das Herz stehen bleibt. Vermutlich war sie schon tot, als sie hier abgeladen wurde. Das Blut ist aller Wahrscheinlichkeit nach nur der Rest aus der Halswunde.«
Ich denke an die Menschen, die sie geliebt haben: Eltern. Ehemann. Kinder. Es macht mich traurig. »Das war kein Verbrechen aus Leidenschaft.«
»Wer das getan hat, war nicht in Eile.« Unsere Blicke treffen sich. »Das war geplant. Gut vorbereitet.«
Ich weiß, was er denkt. Es steht in seinen Augen geschrieben. Ich weiß es, weil ich das Gleiche denke.
»Genau wie damals«, sagt er schließlich.
3. Kapitel
Schnee wirbelt im Scheinwerferlicht meines Explorers, als ich auf den langen, schmalen Feldweg zu Stutz’ Farm einbiege. T. J. sitzt schweigend neben mir. Er ist der jüngste Polizist in meinem Revier, erst vierundzwanzig – und sensibler, als er selbst je zugeben würde. Sensibilität ist bei einem Cop keine schlechte Eigenschaft, aber der Leichenfund hat ihm stark zugesetzt.
»Was für ein beschissener Start in die Woche.« Ich lächele gezwungen.
»Kann man wohl sagen.«
Ich will, dass er redet, habe aber wenig Talent in Smalltalk. »Mit Ihnen ist alles okay?«
»Mit mir? Klar, mir geht’s gut.« Meine Frage und die Bilder, die ihm bestimmt noch im Kopf rumgehen, machen ihn verlegen.
»So was zu sehen …« Ich blicke ihn in bester Cop-zu-Cop-Manier an. »Das ist hart.«
»Ich hab schon mehr Scheiße mitgekriegt«, erwidert er abwehrend. »Als Houseman frontal in das Auto der Familie aus Cincinnati gekracht ist und sie dabei alle umgebracht hat, war ich als Erster vor Ort.«
Ich warte und hoffe, dass er sich mir gegenüber öffnet.
Er sieht aus dem Fenster, fährt mit den Handflächen über die Uniformhose. Jetzt wirft er mir einen verstohlenen Blick zu. »Haben Sie schon mal so was gesehen, Chief?«
Seine Frage bezieht sich auf meine acht Jahre als Polizistin in Columbus. »So was Schlimmes noch nicht.«
»Er hat ihr die Zähne rausgebrochen. Sie vergewaltigt. Ihr die Kehle durchgeschnitten.« Er stößt Luft aus wie ein Dampfkochtopf, bei dem man das Ventil geöffnet hat. »Verdammt.«
Mit meinen dreißig Jahren bin ich zwar nicht so viel älter als T. J., doch angesichts seines jugendlichen Profils fühle ich mich steinalt. »Sie haben sich ganz gut gehalten.«
Er starrt zum Fenster hinaus, will nicht, dass ich seinen Gesichtsausdruck sehe. »Ich hab am Tatort Mist gebaut.«
»Sie konnten ja nicht wissen, dass da eine Tote liegt.«
»Schuhabdrücke wären sicher hilfreich gewesen.«
»Es ist immer noch möglich, dass wir etwas Brauchbares finden.« Eine ziemlich optimistische Annahme. »Ich bin auch auf den Schleifspuren rumgetrampelt. So was passiert.«
»Glauben Sie, Stutz weiß was über den Mord?«, fragt er.
Isaac Stutz und seine Familie gehören den Amischen an, einer Glaubensgemeinschaft, die mir sehr vertraut ist, denn ich bin vor ewigen Zeiten als Amische geboren, in just dieser Stadt.
Ich gebe mir Mühe, mein Urteilsvermögen nicht von meinen Vorurteilen und meiner Voreingenommenheit beeinträchtigen zu lassen. Doch ich kenne Isaac persönlich und halte ihn für einen anständigen, hart arbeitenden Mann. »Ich glaube nicht, dass er etwas mit dem Mord zu tun hat«, erwidere ich. »Aber vielleicht hat jemand von der Familie etwas beobachtet.«
»Wir befragen ihn also nur?«
»Ich befrage ihn nur.«
Das entlockt ihm ein Lächeln. »Richtig«, sagt er.
Der Weg biegt nach links ab und ein weißes Schindelhaus kommt ins Blickfeld. Wie die meisten Amisch-Farmen in dieser Gegend ist das Haus einfach, aber gepflegt. Ein Holzzaun mit Querlatten trennt den hinteren Garten von einem Hühnerstall mit Auslauf. Mein Blick fällt auf den schön gewachsenen Kirschbaum, der im Sommer bestimmt Früchte trägt. Jenseits davon heben sich die Silhouetten einer großen Scheune, eines Getreidesilos und einer Windmühle vom Himmel ab, wo sich die Morgendämmerung ankündigt.
Obwohl es noch nicht einmal fünf Uhr ist, werden die Fenster vom gelben Schein einer Laterne erhellt. Ich parke neben einer Kutsche, dem Amisch-Buggy, und stelle den Motor ab. Der Schnee auf dem Gehweg zur Haustür ist schon weggeschaufelt.
Noch bevor wir klopfen, geht die Tür auf. Isaac Stutz ist etwa vierzig Jahre alt. Er hat – wie alle verheirateten Amisch-Männer – einen Vollbart und trägt ein blaues Arbeitshemd, dunkle Hosen und Hosenträger. Sein Blick schnellt von mir zu T. J. und wieder zurück zu mir.
»Es tut mir leid, dass wir schon so früh stören müssen, Mr Stutz«, sage ich zur Begrüßung.
»Chief Burkholder.« Er neigt leicht den Kopf, tritt einen Schritt zurück und macht die Tür weit auf. »Kommen Sie herein.«
Ich säubere meine Schuhe auf der Fußmatte und trete ins Haus. Es duftet nach Kaffee und gebratenem Scrapple, einem traditionellen Amisch-Frühstück aus Maismehl und Schweinefleisch. Auf dem selbstgebauten Regal in der Nische im Flur stehen eine Kaminuhr und zwei Laternen. An den Holzpflöcken darunter hängen drei Strohhüte. Die Küche ist nur schwach beleuchtet, aber warm. Isaacs Frau Anna steht am gusseisernen Herd. Sie trägt die traditionelle Kappe aus Organdy und ein einfaches schwarzes Kleid. Als sie mich über die Schulter hinweg ansieht, suche ich den Blickkontakt mit ihr, doch sie wendet den Kopf gleich wieder ab. Vor zwanzig Jahren haben wir zusammen gespielt, doch heute Morgen bin ich für sie eine Fremde.
Die Amischen sind eine enge Gemeinschaft, deren Grundfeste auf dem Glauben an Gott, harter Arbeit und Familienbanden basieren. Während achtzig Prozent der amischen Kinder im Alter von achtzehn Jahren der Gemeinde Gottes beitreten, bin ich eine der wenigen, die es nicht getan haben. Infolgedessen wurde ich unter Bann gestellt, also von gewissen sozialen Kontakten mit Amischen ausgeschlossen. Doch entgegen der allgemeinen Annahme ist diese Ausgrenzung keine Form von Bestrafung. In den meisten Fällen hat sie eine läuternde Wirkung. Liebevolle Strenge, wenn man so will. Doch mich hat das nicht zurück in den Schoß der Gemeinschaft gebracht. Weil ich also abtrünnig geworden bin, wollen viele Amische nichts mehr mit mir zu tun haben. Was ich akzeptiere, denn ich verstehe ihre kulturellen Hintergründe und habe nichts gegen sie.
T. J. tritt hinter mir ins Haus. Wie immer respektvoll, nimmt er die Mütze ab.
»Möchten Sie Kaffee oder Tee?«, fragt Isaac.
Ich würde meine Waffe für einen heißen Kaffee hergeben, lehne aber ab. »Ich möchte Ihnen wegen letzter Nacht gern ein paar Fragen stellen.«
Er deutet in die Küche. »Kommen Sie, setzen Sie sich in die Nähe des Herdes.«
Auf dem Weg klacken unsere Stiefel dumpf auf dem Holzboden. Der Raum wird von einem rechteckigen Holztisch mit blau-weiß karierter Tischdecke dominiert, in dessen Mitte eine Glaslaterne steht, die unsere Gesichter in gelbes Licht taucht. Der Petroleumgeruch erinnert mich an das Zuhause meiner Kindheit, und einen Moment lang empfinde ich Wohlbehagen.
Holz kratzt auf Holz, als wir drei die Stühle unterm Tisch hervorziehen und Platz nehmen. »Wir haben letzte Nacht einen Anruf wegen Ihrer Tiere bekommen«, beginne ich.
»Ah, meine Milchkühe.« Er schüttelt selbstkritisch den Kopf, doch sein Gesichtsausdruck sagt mir, dass er weiß, ich komme nicht morgens um fünf Uhr hierher, um ihn wegen ein paar eigensinniger Kühe zurechtzuweisen. »Ich bin gerade dabei, den Zaun zu reparieren.«
»Es geht nicht um die Kühe«, sage ich.
Isaac sieht mich an und wartet.
»Wir haben letzte Nacht auf Ihrem Feld die Leiche einer jungen Frau gefunden.«
Mein Gott, höre ich Anna auf der gegenüberliegenden Seite des Raums sagen.
Ich sehe sie nicht an, sondern konzentriere mich auf Isaac. Seine Reaktion. Seine Körpersprache. Seinen Gesichtsausdruck.
»Jemand ist gestorben?« Er reißt die Augen auf. »Auf meinem Feld? Wer?«
»Wir haben sie noch nicht identifiziert.«
Ich kann sehen, wie er versucht, die Information zu verarbeiten. »Hatte sie einen Unfall? Ist sie erfroren?«
»Sie wurde ermordet.«
Wie von unsichtbarer Hand gestoßen, zuckt er auf dem Stuhl zurück. »Ach! Jammer.«
Ich sehe hinüber zu seiner Frau. Sie begegnet meinem Blick jetzt ruhig, aber mit einem ängstlichen Ausdruck im Gesicht. »Hat einer von Ihnen gestern Nacht irgendetwas Ungewöhnliches bemerkt?«, frage ich.
»Nein.« Er antwortet für sie beide.
Fast hätte ich gelächelt. Die Amischen sind eine patriarchalische Gesellschaft. Es herrscht zwar nicht zwangsläufig Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, doch ihre unterschiedlichen Rollen sind klar definiert. Normalerweise macht mir das nichts aus, doch jetzt ärgert es mich. Bei Mord ist die stillschweigende Übereinkunft der Amischen außer Kraft gesetzt, und es ist meine Aufgabe, ihnen das zu verdeutlichen. Ich sehe Anna direkt an. »Anna?«
Sie kommt näher, wischt sich die schrundigen Hände an der Schürze ab. Sie ist fast so alt wie ich und hübsch, mit großen haselnussbraunen Augen und Sommersprossen auf der Nase. Die Schlichtheit passt zu ihr.
»Ist sie eine Amisch?«, fragt Anna auf Pennsylvaniadeutsch, dem Amisch-Dialekt.
Ich kenne die Sprache, weil ich sie selbst einmal gebraucht habe, doch ich antworte auf Englisch. »Das wissen wir nicht«, antworte ich ihr. »Hast du vielleicht Fremde hier in der Gegend gesehen? Irgendwelche unbekannten Fahrzeuge oder Buggys?«
Anna schüttelt den Kopf. »Ich hab nichts gesehen. In dieser Jahreszeit wird es so früh dunkel.«
Das stimmt. Im Nordosten Ohios ist der Januar ein kalter und dunkler Monat.
»Kannst du deine Kinder fragen?«
»Natürlich.«
»Glauben Sie, einer von uns hat diese Sünde begangen?« Ein abwehrender Unterton schwingt in Isaacs Stimme mit.
Er meint damit die Amisch-Gemeinde, deren Mitglieder in der Regel Pazifisten sind. Hart arbeitend und religiös. Und familienorientiert. Doch ich weiß, dass es auch Ausnahmen von der Regel gibt. Ich selbst bin so eine.
»Ich weiß es nicht.« Ich nicke T. J. kurz zu und stehe auf. »Danke für das Gespräch. Wir finden selbst hinaus.«
Isaac folgt uns und hält die Tür auf. Als ich auf die Veranda trete, flüstert er: »Ist er zurück, Katie?«
Die Frage erschreckt mich, doch ich werde sie in den nächsten Tagen sicher noch öfter hören. Ich will nicht darüber nachdenken. Isaac erinnert sich an das, was vor sechzehn Jahren passiert ist. Damals war ich erst vierzehn Jahre alt, erinnere mich aber gut. »Ich weiß es nicht.«
Doch das ist gelogen. Ich weiß, dass der Mörder dieses Mädchens nicht derselbe Mann sein kann, der vor sechzehn Jahren vier junge Frauen vergewaltigt und ermordet hat.
Ich weiß es, weil ich ihn getötet habe.
Im Osten türmen sich purpurrote Kumuluswolken am Horizont. Ich parke den Explorer hinter T. J.s Streifenwagen. Das gelbe Absperrband an Bäumen, Zaunpfählen und Stacheldraht passt nicht in diese Landschaft. Der Krankenwagen ist weg, ebenso Doc Coblentz’ Escalade. Glock steht am Zaun und blickt auf das Feld hinaus, als berge der Schnee, der über die aufgeworfenen Erdhäufchen geblasen wird, die Antwort, die wir alle suchen.
»Gehen Sie nach Hause und schlafen Sie eine Runde«, sage ich zu T. J. Seine Schicht hatte um Mitternacht begonnen. Nach diesem Mord wird keiner von uns in nächster Zeit viel Schlaf bekommen.
Ich stelle den Motor aus. Ohne das Rauschen des Heizungsgebläses ist es plötzlich ganz still im Wagen. T. J. legt die Hand auf den Griff der Tür, öffnet sie aber nicht. »Chief?«
Ich sehe ihn an. Er schaut bekümmert drein, wie ein kleiner Bruder. »Ich will den Kerl kriegen.«
»Ich auch«, erwidere ich und stoße meine Tür auf. »Ich rufe Sie in ein paar Stunden an.«
Er nickt, und wir steigen beide aus. Ich mache mich auf zu Glock, doch in Gedanken bin ich noch bei T. J. Hoffentlich kommt er mit der Sache klar. Ich habe das schlimme Gefühl, dass die Leiche, die wir heute Morgen gefunden haben, nicht die letzte sein wird.
Hinter mir höre ich T. J. den Streifenwagen anlassen und wegfahren. Glock sieht in meine Richtung. Ihm scheint nicht einmal kalt zu sein.
»Irgendwas?«, frage ich ohne große Vorrede.
»Wenig. Ein Kaugummipapier, aber es sieht alt aus. Und ein paar lange Haare am Zaun, wahrscheinlich von ihr.«
Glock ist ungefähr so alt wie ich, hat kurzgeschorenes Haar wie beim Militär und einen Körper, der mit seinen zwei Prozent Körperfett Arnold Schwarzenegger beschämen würde. Ich habe ihn vor zwei Jahren eingestellt, wodurch er die Ehre hatte, der erste afroamerikanische Polizist in Painters Mill zu sein. Als ehemaliger Militärpolizist der Marine ist er ein Meisterschütze und Inhaber des braunen Gürtels in Karate. Er lässt sich von niemandem etwas gefallen, auch von mir nicht.
»Irgendwelche Abdrücke?«, frage ich. »Autospuren?«
Er schüttelt den Kopf. »Hier wurde ziemlich viel rumgetrampelt. Ich will versuchen, ein paar Abdrücke zu nehmen, verspreche mir aber kaum was davon.«
Schuh- oder Reifenabdrücke im Schnee zu nehmen ist kompliziert. Zuerst müssen mehrere Schichten eines Spezialwachses auf den Abdruck gespritzt werden, um ihn zu isolieren. Das soll den Verlust von Details verhindern, der sonst durch die exothermische Reaktion mit dem härtenden Abdruckmaterial eintritt.
»Wissen Sie, wie das gemacht wird?«, frage ich.
»Ich muss mir das notwendige Material aus dem Büro des Sheriffs besorgen.«
»Machen Sie das gleich. Ich bleibe solange hier, bis Skid kommt.« Chuck »Skid« Skidmore ist der dritte Officer in unserem Revier.
»Das Letzte, was ich von ihm gehört habe, war, dass er in McNarie’s Bar mit einer Blondine auf dem Pooltisch lag.« Glock lächelt. »Wahrscheinlich hat er ’nen Kater.«
»Wahrscheinlich.« Skid schätzt billige Tequilas genauso sehr wie Rupert seine Glock-Pistole. Doch der Anflug von Leichtigkeit ist schnell vorüber. »Wenn Sie die Abdrücke haben, machen Sie auch welche von allen, die hier am Tatort rumgestiefelt sind. Schicken Sie alles ans BCI-Labor. Die sollen einen Abgleich machen und herausfinden, ob es irgendwelche Besonderheiten gibt.«
BCI ist das Akronym für Bureau of Criminal Identification and Investigation in London, Ohio, einem Vorort von Columbus. Diese staatliche Behörde ist dem Büro des Generalstaatsanwalts unterstellt und hat ein hochmodernes Labor, Zugang zu Polizeidatenbanken und viele andere Ressourcen, die von örtlichen Polizeidienststellen genutzt werden können.
Glock nickt. »Sonst noch was?«
Mein Lächeln wirkt gezwungen. »Wäre es möglich, Ihren Urlaub zu verschieben?«
Auch er lächelt, doch es hat etwas Angestrengtes. Wenn jemand eine Auszeit verdient hat, dann Glock. Seit er für mich arbeitet, hat er noch keine nennenswerte Freizeit gehabt. »LaShonda und ich haben keine großen Pläne«, sagt er. LaShonda ist seine Frau. »Wir wollten nur das Kinderzimmer fertig machen. Der Arzt meint, es kann jeden Tag so weit sein.«
In einhelligem Schweigen blicken wir auf den Tatort. Obwohl ich zwei Paar Socken in meinen wasserfesten Stiefeln trage, schmerzen meine Füße vor Kälte. Ich bin müde, mutlos und erschüttert. Der Zeitdruck sitzt mir im Nacken. Jeder kompetente Polizist weiß, dass die ersten vierundzwanzig Stunden nach einem Mord entscheidend für die Aufklärung sind.
»Ich fahr dann mal los und hole die Sachen«, sagt Glock schließlich.
Ich sehe zu, wie er den Wassergraben durchquert, in seinen Streifenwagen steigt und wegfährt. Dann blicke ich wieder auf das Feld, wo der Schnee flüsternd über den gefrorenen Boden treibt. Von meinem Standort aus kann ich gerade noch die Blutlache des Opfers erkennen, leuchtend rot auf reinem Weiß. Das Absperrband flattert im frischen Nordwind, die Äste der Bäume stoßen aneinander wie klappernde Zähne.
»Wo bist du, du Scheißkerl?«, sage ich laut, doch meine Stimme klingt merkwürdig in der frühmorgendlichen Stille.
Nur das Säuseln des Windes in den Bäumen und der Widerhall meiner Stimme antworten mir.
Zwanzig Minuten später trifft Officer Skidmore am Tatort ein. Er schwingt sich aus dem Streifenwagen mit zwei Kaffeebechern in der Hand, einem »Keine Fragen bitte«-Gesichtsausdruck und einem halbgegessenen Donut in der Hand.
»Warum können sich die Leute nicht bei zwanzig Grad und Sonnenschein umbringen lassen?«, murmelt er und reicht mir den Kaffee.
»Das würde es uns viel zu leicht machen.« Ich nehme den Deckel vom Kaffee und informiere ihn kurz über den Stand der Dinge.
Als ich fertig bin, wirft er einen Blick auf den Tatort. Dann sieht er mich erwartungsvoll an, als solle ich jetzt bitte die Hände in die Luft werfen und zugeben, dass das Ganze ein schlechter Scherz ist. »Ein echter Hammer, so was mitten in der Nacht hier draußen zu finden.« Er schlürft seinen Kaffee. »Wie geht’s T. J.?«
»Ich denke, er kommt klar.«
»Der Kleine wird ziemliche Albträume kriegen.« Seine Augen sind blutunterlaufen, und mit der Kater-Prognose hatte Glock recht.
»War es spät letzte Nacht?«, frage ich.
Mit Puderzucker am Kinn, grinst er mich schief an. »Die Tequilas mögen mich leider weniger als ich sie.«
Das höre ich nicht zum ersten Mal. Skid kommt aus Ann Arbor, Michigan, wo er seinen Polizeijob wegen außerdienstlicher Trunkenheit am Steuer verlor. Jeder weiß, dass er zu viel trinkt. Aber er ist ein guter Cop. Ich hoffe, dass er sein Problem in den Griff bekommt. Alkohol hat schon das Leben vieler Menschen zerstört, ich möchte ihn ungern dazuzählen müssen. Er weiß, dass ich ihn auf der Stelle feuere, wenn er betrunken zur Arbeit kommt. Das habe ich gleich bei der Einstellung vor zwei Jahren klargestellt, und bis jetzt hat er sich daran gehalten.
»Glauben Sie, es ist derselbe Kerl wie Anfang der neunziger Jahre?«, fragt er. »Wie hat man ihn genannt? Den Schlächter? Der Fall wurde nie gelöst, stimmt’s?«
Als ich den Spitznamen laut ausgesprochen höre, kriege ich Gänsehaut auf den Armen. Damals hatten die örtliche Polizei und das FBI noch Jahre nach dem letzten Mord an dem Fall gearbeitet. Als die Spuren schließlich kalt wurden und das öffentliche Interesse schwand, ließen auch ihre Bemühungen nach. »Es ist irgendwie kaum vorstellbar«, sage ich zurückhaltend. »Eine sechzehnjährige Handlungspause lässt sich schwer erklären.«
»Es sei denn, der Kerl hat die Örtlichkeiten gewechselt.« Ich sage nichts, habe keine Lust auf Mutmaßungen. Skid fährt unbeirrt fort. »Oder er hat wegen was anderem gesessen und ist gerade wieder rausgekommen. Genau so was hab ich erlebt, als ich bei der Polizei anfing.«
Ich hasse solche Spekulationen und Fragen, weiß aber, dass ich in der nächsten Zeit noch mehr davon zu hören bekomme, und zucke mit der Schulter. »Könnte ein Nachahmungstäter sein.«
Er rümpft die laufende Nase. »Das wäre schon merkwürdig in einer kleinen Stadt wie dieser. Ich meine, Herr im Himmel, das ist doch mehr als unwahrscheinlich.«
Weil er recht hat, antworte ich nicht. Spekulieren ist gefährlich, wenn man mehr weiß, als man sollte. Ich schütte den restlichen Kaffee weg und knülle den Becher zusammen. »Sie behalten hier alles im Auge, bis Rupert zurück ist, ja?«
»Klar, mach ich.«
»Und helfen Sie ihm bei den Abdrücken. Ich fahre ins Revier.«
Auf dem Weg zum Wagen freue ich mich auf die Heizung. Mein Gesicht und meine Ohren schmerzen vor Kälte. Meine Finger sind taub. Aber beschäftigen tut mich etwas ganz anderes: Ich muss ständig an die junge Frau denken, an die unheimlichen Parallelen dieses Mordfalls zu denen vor sechzehn Jahren.
Als ich den Explorer anlasse und auf die Straße fahre, habe ich die düstere Vorahnung, dass der Mörder weitermachen wird.
Das Zentrum von Painters Mill besteht im Wesentlichen aus einer großen Hauptstraße – sinnigerweise Main Street genannt –, die von etwa einem Dutzend Geschäften gesäumt wird. Ungefähr die Hälfte davon sind Touristenläden der Amischen, in denen es von Windspielen über Vogelhäuser bis zu kunstvollen handgemachten Quilts alles zu kaufen gibt. Im Norden mündet die Straße in einen Autokreisel, im Süden endet sie an einer evangelisch-lutherischen Kirche. Östlich der Main Street befinden sich eine neue Highschool, ein zunehmend beliebtes Siedlungsgebiet namens Maple Crest und ein paar Bed-&-Breakfast-Unterkünfte. Letztere tragen dem Tourismus Rechnung, der am schnellsten wachsenden Branche der Stadt. Im Westen, kurz hinter der Bahnstrecke und der Wohnwagen-Siedlung, liegen der Schlachthof und die Abdeckerei, ein Großmarkt für Farmbedarf und ein riesiger Getreidespeicher.
Painters Mill wurde 1815 gegründet und hat konstant um die fünftausenddreihundert Einwohner, ein Drittel davon Amische. Obwohl die Amischen meistens unter sich bleiben, gehören sie doch dazu, und so ziemlich jeder weiß über jeden Bescheid. Es ist ein angenehmer Ort, in dem man gut leben und Kinder großziehen kann. Und auch, um Polizeichefin zu sein – wenn man nicht gerade einen brutalen Mord aufzuklären hat.
Das Polizeirevier liegt eingepfercht zwischen Kidwell’s Pharmacy und der Freiwilligen Feuerwehr und ist eine zugige dunkle Höhle in einem hundert Jahre alten Backsteinbau, der früher ein Tanzlokal beherbergt hatte. Ich betrete den Eingangsbereich, wo Mona Kurtz am Schreibtisch mit der Telefonanlage sitzt. Sie sieht von ihrem Computer auf, schenkt mir ein strahlendes Lächeln und winkt. »Hallo, Chief.«
Mona ist etwas über zwanzig, hat rotes, üppiges Haar und eine Energie, die jeden Duracellhasen beschämt. Sie spricht so schnell, dass ich immer nur die Hälfte verstehe, was nicht unbedingt ein Nachteil ist, weil sie meist mehr erzählt als nötig. Doch ihr gefällt der Job, und da sie unverheiratet und kinderlos ist, macht es ihr nichts aus, die Nachtschicht zu übernehmen. Zudem hat sie echtes Interesse an der Polizeiarbeit, und obwohl es von der TV-Serie CSI herrührt, war das alles Grund genug, sie letztes Jahr einzustellen. Sie hat noch keinen Tag gefehlt.
Beim Anblick der vielen rosa Telefonzettel in ihrer Hand und dem Eifer in ihren Augen wünschte ich, es wäre schon Schichtwechsel gewesen. Ich mag Mona und weiß ihren Enthusiasmus zu schätzen, aber heute Morgen fehlt mir die nötige Geduld, so dass ich sofort auf mein Büro zusteuere.
Unbeeindruckt davon kommt Mona mit ihrem Dutzend Telefonzetteln in der Hand hinter mir her. »Das Telefon klingelt ununterbrochen, Chief. Die Leute sind verunsichert wegen des Mords. Mrs Finkbine will wissen, ob es derselbe Mörder ist wie vor sechzehn Jahren.«
Ich stöhne innerlich über die Rasanz der Gerüchteküche von Painters Mill. Könnte man diese Energie zur Erzeugung von Elektrizität nutzen, würde hier keiner mehr eine Stromrechnung kriegen.
Beim Blick auf den nächsten Zettel runzelt Mona die Stirn. »Phyllis Combs vermisst ihre Katze und glaubt, derselbe Kerl ist dafür verantwortlich.« Sie sieht mich aus großen braunen Augen an. »Ricky McBride hat mir erzählt, das Opfer war … geköpft. Stimmt das?«
Ich widerstehe dem Drang, mir die brennenden Augen zu reiben. »Nein. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie alle Gerüchte sofort im Keim ersticken. Davon wird es in den nächsten Tagen nämlich noch genug geben.«
»Ganz bestimmt.«
Mit Blick auf die rosa Zettel beschließe ich, mir ihren Eifer zunutze zu machen. »Rufen Sie die Leute alle zurück. Sagen Sie ihnen, die Polizei von Painters Mill tut alles, um den Mord aufzuklären, und dass ich in der nächsten Ausgabe vom Advocate ein Statement abgeben werde.« The Advocate ist die Wochenzeitung unserer Stadt mit einer Auflage von viertausend. »Wenn Anfragen von der Presse kommen, sagen Sie, dass sie heute Nachmittag eine Pressemeldung gefaxt bekommen. Ansonsten heißt es immer ›Kein Kommentar‹, ist das klar?«
Sie hängt an meinen Lippen, wirkt dabei etwas zu aufgeregt, zu eifrig. »Hab verstanden, Chief. Kein Kommentar. Sonst noch etwas?«
»Ich könnte einen Kaffee brauchen.«
»Ist schon unterwegs.«
Ich muss an ihr Soja-Espresso-Schokolade-Gebräu denken und mich schaudert. »Einen ganz normalen Kaffee, Mona, und ein paar Aspirin, wenn wir welche hier haben.« Ich setze mich in Bewegung, um Zuflucht in meinem Büro zu suchen.
»Ja, natürlich. Milch, ohne Zucker. Ist Tylenol auch okay?«
Kurz vor meiner Bürotür fällt mir noch etwas ein und ich drehe mich um. »Hat in den letzten Tagen jemand eine junge Frau als vermisst gemeldet?«
»Nicht dass ich wüsste.«
Aber es ist immer noch früh, der Anruf kommt bestimmt, da bin ich mir sicher. »Fragen Sie bei der State Highway Patrol und beim Sheriffbüro von Holmes County nach, ja? Weiß, blaue Augen, dunkelblonde Haare. Alter zwischen fünfzehn und dreißig.«
»Wird sofort erledigt.«
Ich gehe in mein Büro, mache die Tür hinter mir zu und widerstehe der Versuchung, sie abzuschließen. Auf engem Raum stehen hier ein lädierter Metallschreibtisch, ein altmodischer, staubiger Aktenschrank und ein Computer, der Geräusche macht wie eine Kaffeemühle. Das einzige Fenster bietet einen wenig berauschenden Blick auf den Verkehr in der Main Street.
Sobald ich die Jacke ausgezogen und über den Stuhl gehängt habe, schalte ich den Computer ein und schließe den Aktenschrank auf. Während der PC hochfährt, ziehe ich die untere Schublade auf und blättere einige Akten durch. Häusliche Gewalt. Tätlichkeiten. Mutwillige Sachbeschädigung. Alles Vergehen, die in einer Stadt wie Painters Mill nicht überraschen. Doch die Akte, die ich suche, ist ganz hinten, und ich zögere einen Moment, bevor ich sie schließlich heraushole. Seit zwei Jahren bin ich hier Chief of Police, habe mich aber nicht überwinden können, mir die Akte anzusehen. Heute Morgen komme ich nicht mehr drum herum.
Es ist eine dicke Akte, braun mit verschlissenen Rändern und schwarzen, vom vielen Gebrauch zerbrochenen Metallklammern. Auf dem sich ablösenden Etikett steht: Schlächter-Morde, Holmes County, Januar 1992. Ich nehme die Akte mit zum Schreibtisch und schlage sie auf.
Mein Vorgänger, Delbert McCoy, hat alles pedantisch genau festgehalten. Auf einem getippten Polizeibericht stehen Datum, Uhrzeit und Ort. Den Namen von Zeugen folgen Kontaktinformationen und Anmerkungen über erfolgte Überprüfungen. Jeder einzelne Aspekt der Untersuchung scheint peinlich genau dokumentiert. Außer natürlich dem einen Vorfall, der nicht der Polizei gemeldet worden war …
Ich blättere die Akte durch, präge mir das Wesentliche ein. Vor sechzehn Jahren hatte in den ruhigen Straßen von Painters Mill ein Mörder auf der Lauer gelegen. Über einen Zeitraum von zwei Jahren hatte er vier Frauen auf grausamste Weise getötet.
Die Art seines Vorgehens – er hat sie wie Schlachtvieh ausbluten lassen – veranlasste einen schlagzeilengeilen Reporter, ihn als »Schlächter« zu bezeichnen, was sich dann in den Köpfen der Leute festsetzte.
Das erste Opfer, die siebzehnjährige Patty Lynn Thorpe, war vergewaltigt und misshandelt worden, ihre Kehle durchgeschnitten. Die Leiche wurde an der Shady Grove Road abgeladen – nur zwei Meilen von der Stelle entfernt, an der T. J. heute Morgen die Tote gefunden hat. Der Autopsiebericht lässt mich frösteln.
Zusammenfassung der anatomischen Befunde:
Schnittwunde am Hals: Durchtrennung der linken Halsschlagader.
Ich überfliege die Präliminarien, die Anmerkungen zur äußeren Beschau, einige weitere Details und komme zu dem, wonach ich suche.
Beschreibung der Halsschnittwunde:
Schnittwunde am Hals ist acht Zentimeter lang. Sie verläuft diagonal nach oben zum linken Ohrläppchen. Durchtrennung der linken Halsschlagader, dadurch Hämorrhagie des umgebenden Fleisches. Frische Hämorrhagie entlang gesamtem Wundrand.
Beurteilung:
Es handelt sich um eine tödliche Wunde, verursacht durch ein Messer oder einen anderen scharfen Gegenstand, wobei die linke Halsschlagader durchtrennt wurde, mit Ausblutung als Folge.
Die Ähnlichkeit mit der Wunde an der Toten, die heute Morgen gefunden wurde, ist frappierend. Ich lese weiter.
Beschreibung der sekundären Schnittwunde:
Bemerkenswert ist eine zweite Schnittwunde auf dem Unterleib über dem Nabel. Die Wunde hat eine irreguläre Form, ist insgesamt fünf Zentimeter lang und vier Zentimeter breit, mit einer Tiefe von eins Komma fünf Zentimetern. Frische Hämorrhagie entlang des gesamten Schnitts, der die Haut und die darunterliegende Fettschicht durchtrennt, aber keine Muskelfasern verletzt hat. Die Wunde wurde vor dem Tod zugefügt.
Beurteilung:
Es handelt sich um eine oberflächliche Schnittwunde, die nicht lebensbedrohlich ist.
Wieder diese verblüffende Ähnlichkeit mit der Unterleibswunde der Toten von heute Morgen.
Ich blättere im Polizeibericht und stoße auf eine handschriftliche Anmerkung von Chief McCoy.
Die Wunden auf dem Unterleib sehen aus wie ein großes V und I oder vielleicht die römische Zahl VI. Bei der Halswunde handelt es sich nicht um unkontrollierte Messerstiche eines wahnsinnigen Mörders, sondern um den gezielten Einschnitt von jemandem, der wusste, was er tat und was er damit bezwecken wollte. Der Täter hat ein Messer ohne Zähne benutzt. Die Einritzung auf dem Unterleib der Toten wurde nicht veröffentlicht.
Weiter unten steht, dass das Opfer vaginale und rektale Wunden erlitten hatte, die vom Labor untersuchten Abstriche jedoch keine fremde DNA aufwiesen.
Ein paar Seiten weiter stoße ich wieder auf eine handschriftliche Anmerkung von Chief McCoy.
Keine Fingerabdrücke. Keine DNA. Keine Zeugen. Kaum etwas Verwertbares. Wir arbeiten weiter an dem Fall und verfolgen jede Spur. Aber ich glaube, der Mord war eine Einzeltat. Ein Landstreicher, der zufällig hier durchgekommen ist.
Diese Worte sollten ihn noch lange verfolgen.
Vier Monate später fand ein Fischer am schlammigen Ufer des Painters Creek die Leiche der sechzehn Jahre alten Loretta Barnett. Sie war zu Hause überfallen und vergewaltigt worden, an einem unbekannten Ort wurde ihr dann die Kehle durchschnitten. Die Ermittlungen ergaben, dass sie von einer überdachten Brücke westlich der Stadt geworfen worden war.
An dem Punkt hatte McCoy Hilfe vom FBI angefordert. Laut Forensik hatte der Mörder seine Opfer vermutlich mit einer Elektroschockpistole unter Kontrolle gebracht. Beide Opfer wiesen Verletzungen im Genitalbereich auf, aber es konnte keine DNA sichergestellt werden, was – nach Aussage von Special Agent Frederick Milkowski – darauf hinwies, dass der Mörder entweder ein Kondom benutzt hatte oder mit einem unbekannten Objekt in sie eingedrungen war. Möglicherweise hatte der Mörder seine Körperbehaarung komplett abrasiert.
Quetschungen an den Fußgelenken der Opfer ließen darauf schließen, dass sie mit dem Kopf nach unten an einer Kette hingen, bis sie ausgeblutet waren. Beunruhigend war auch die Entdeckung der in ihren Unterleib geritzten römischen Zahl VII.
Jetzt war klar, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun hatten. Da die Opfer durch Ausbluten umgebracht worden waren, eine klassische Schlachtmethode, wandten McCoy und Milkowski sich ratsuchend an den örtlichen Schlachthof.
Ich las McCoys Gesprächsnotizen:
Bei einer informellen Befragung erklärte J. R. Purdue von Honey Cut-Enterprises, der Besitzer und Betreiber des Fleischverpackungsbetriebs: »Die Wunden entsprechen den Einschnitten, die zum Ausbluten von Tieren angebracht werden, sind aber kleiner …«
Alle, die jemals in der Honey-Cut-Fleischverpackungsfabrik gearbeitet hatten oder noch arbeiteten, wurden verhört. Ihre Fingerabdrücke wurden genommen, und männliche Angestellte wurden aufgefordert, eine DNA-Probe zu geben. Doch nichts kam dabei heraus. Und die Morde gingen weiter …
Am Ende des darauf folgenden Jahres waren vier Frauen tot. Alle starben durch Ausbluten. Alle erlitten Höllenqualen. Und allen hatte der Mörder eine fortlaufende römische Zahl auf den Unterleib geritzt, als führe er eine Art krankhafte Strichliste seiner Bluttaten.
Ich betrachte mir die Fotos vom Fundort und der Autopsie und fange an zu schwitzen. Die vielen Übereinstimmungen mit dem Mordopfer von heute Morgen sind nicht zu übersehen. Ich weiß, was die Bürger von Painters Mill denken werden: Der Schlächter ist zurückgekehrt. Nur drei Menschen auf der ganzen Welt wissen, dass das unmöglich ist, und ich bin einer von ihnen.
Als es an der Tür klopft, schrecke ich hoch. »Es ist offen.«
Mona kommt herein, stellt mir eine Tasse Kaffee und eine Großpackung Tylenol auf den Schreibtisch. Ihr Blick fällt auf die Akte. »Eine Frau von Coshocton County ist auf Leitung eins. Ihre Tochter ist gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Norm Johnston ist auf der Zwei.«
Norm Johnston ist einer von sechs Stadträten, aggressiv, egozentrisch und schwer zu ertragen. Letztes Frühjahr habe ich ihn wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet, woraufhin er seine Hoffnung, auf der politischen Leiter von Painters Mill bis ins Bürgermeisteramt hochzuklettern, ad acta legen konnte. Seitdem mag er mich nicht mehr. »Sagen Sie Norm, ich rufe ihn zurück«, erwidere ich und drücke die Eins.
»Hier ist Belinda Horner. Meine Tochter Amanda ist Samstagabend mit ihrer Freundin ausgegangen, und seither habe ich nichts mehr von ihr gehört.« Die Frau spricht zu schnell, klingt panisch und atemlos. »Ich habe geglaubt, dass sie bei Connie übernachtet, was sie manchmal tut. Aber als sie sich heute immer noch nicht gemeldet hat, hab ich angerufen und erfahren, dass sie seit Samstagnacht niemand mehr gesehen hat. Ich mache mir wirklich Sorgen.«
Heute ist Montag. Ich schließe die Augen und bete, dass die Tote in der Leichenhalle von Millersburg nicht ihre Tochter ist. Aber ich habe kein gutes Gefühl. »Ist sie schon öfter so lange weggeblieben, Ma’am? Oder ist es ungewöhnlich für sie?«
»Sie ruft immer an, wenn sie woanders übernachtet.«
»Wann hat ihre Freundin sie zuletzt gesehen?«
»Samstagabend. Connie ist manchmal furchtbar verantwortungslos.«
»Haben Sie schon bei der State Highway Patrol nachgefragt?«
»Die haben gesagt, ich soll mich ans örtliche Polizeirevier wenden. Ich habe Angst, dass sie in einen Autounfall verwickelt war. Ich rufe jetzt die Krankenhäuser an.«
Ich nehme einen Block und Kuli zur Hand. »Wie alt ist Ihre Tochter?«
»Einundzwanzig.«
»Wie sieht sie aus?«
Die Beschreibung, die sie mir gibt, passt auf die Tote. »Haben Sie ein Foto?«, frage ich.
»Natürlich.«
»Können Sie mir das neueste faxen?«
»Hm … ich hab kein Faxgerät, aber mein Nachbar hat einen Computer und Scanner.«
»Gut. Scannen Sie das Foto und schicken Sie es als E-Mail-Anhang. Geht das?«
»Ich denke schon.«
Beim Notieren ihrer Kontaktdaten fällt mein Blick aufs Telefon, wo alle vier Leitungslämpchen wild blinken. Ich ignoriere es und gebe ihr meine E-Mail-Adresse. Als ich schließlich auflege, ist mein Magen wie zusammengeschnürt, doch ich habe die Befürchtung, dass der heutige Tag für Belinda Horner noch viel schlimmer wird als für mich.