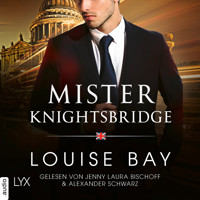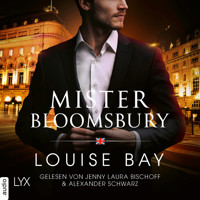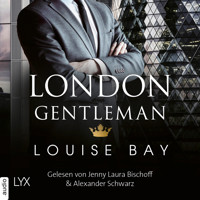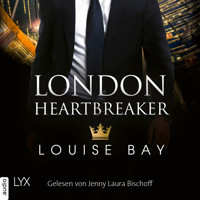11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Doctor
- Sprache: Deutsch
Er ist ihr Feind, doch sie kann ihm nicht widerstehen
Kates ruhiges Leben gerät ordentlich durcheinander, als Vincent Cove in ihrer Heimatstadt auftaucht. Der attraktive Milliardär will aus dem britischen Anwesen, in dem sie wohnt und arbeitet, ein exklusives Luxushotel machen. Mit allen möglichen Mitteln versucht Kate, die Pläne des amerikanischen CEOs zu durchkreuzen, doch dabei kann sie nicht leugnen, dass zwischen ihnen eine unerklärliche Anziehung existiert. Und sosehr sich Kate auch dagegen wehrt, droht sie schon bald Vincents unwiderstehlichem Charme zu erliegen ...
»Die Helden in dieser Reihe werden dein Herz berühren und dich an die große Liebe glauben lassen.« READ REVIEW REPEAT BLOG
Band 3 der DOCTOR-Reihe von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Louise Bay
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
Epilog
Die Autorin
Die Romane von Louise Bay bei LYX
Impressum
LOUISE BAY
Doctor and CEO
Roman
Ins Deutsche übertragen von Wanda Martin
ZU DIESEM BUCH
Kate führt ein ruhiges und zufriedenes Leben in ihrer kleinen Heimatstadt: Sie liebt ihr Zuhause im britischen Crompton-Anwesen und das gemütliche Café, in dem sie arbeitet. Allerdings gerät ihr Leben ordentlich durcheinander, als der charmante Amerikaner Vincent Cove auftaucht. Nach einem leidenschaftlichen One-Night-Stand mit dem attraktiven Milliardär ist Kate sich eigentlich sicher, ihn nie wiederzusehen – zumindest bis sie herausfindet, dass er nur in Crompton ist, um das idyllische Anwesen zu kaufen und es in ein exklusives Luxushotel zu verwandeln. Aber das kann Kate nicht zulassen, also versucht sie mit allen möglichen Mitteln, die Pläne des amerikanischen CEOs zu durchkreuzen und ihr geliebtes Zuhause zu retten. Doch dabei kann sie nicht leugnen, dass zwischen ihnen noch immer eine unerklärliche Anziehung herrscht. Ein Knistern, das sich nur sehr schwer ignorieren lässt. Und sosehr sich Kate auch dagegen wehrt, droht sie schon bald Vincents unwiderstehlichem Charme zu erliegen …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer LYX-Verlag
1. KAPITEL
KATE
Noch immer kribbelt es vor Aufregung in meinen Zehenspitzen, selbst nachdem ich die Teestube von Crompton Estate nun schon die ganzen Jahre morgens aufsperre. Ich freue mich ehrlich auf jeden neuen Tag – und wirklich mal, wie viele Leute können das von ihrer Arbeit behaupten? Ich schließe die Tür auf und drehe das Schild im Fenster auf »Geöffnet« um. Heute werden wir Hunderten lächelnden Gästen Tee, Kaffee, Kuchen und Flapjacks servieren, von Sandras Tagessuppe mal ganz abgesehen. Beschwingt von einem Rundgang durch Cromptons herrlichen Gartenpark werden die Leute auf eine kurze Pause hereinschauen, bevor sie die Besichtigung fortsetzen oder heimfahren.
Die Magnolie vor der Teestube hat gerade angefangen zu blühen, und ich weiß genau, die Leute werden beim Aufdrücken der Ladentür Bemerkungen über die kopfgroßen Blüten und den süßen Duft machen, der mir verrät, dass wir Mitte Mai haben. So ist es jedes Jahr. Das wird alle heute in besonders gute Laune versetzen. Wie könnte man auch keine gute Laune haben, wenn man Crompton besucht? Das geht gar nicht.
Die Eröffnungstakte von I Feel Pretty aus West Side Story dringen zu mir vor. Mein Lächeln wird noch breiter, und ich drehe mich zu Sandra um, die die Anlage eingeschaltet und zu singen angefangen hat. Ich stimme mit ein, während ich mich im Kreis drehend nach hinten zum Tresen bewege.
Ich habe keine supertolle Stimme – selbst wenn ich es noch so gewollt hätte, hätte ich es nie auf eine Bühne im Londoner West End geschafft –, aber ich singe gut genug für eine Cromptoner Laieninszenierung von Frozen, wie wir sie letztes Jahr aufgeführt haben. Ich war Elsa, und obwohl sie dreißig Jahre älter ist als ich, war Sandra Anna.
»Wie geht’s Granny?«, fragt Sandra. Alle nennen meine Oma »Granny«. Sie lebt und arbeitet seit dreißig Jahren hier auf dem Anwesen und gehört genauso fest dazu wie das Cottage, das sie bewohnt.
»Gut. Ihre Erkältung ist jetzt komplett auskuriert.« Ich scrolle durch die Kommentare auf der Instagram-Seite von Crompton. Ich betreue den offiziellen Account und bekomme für die zusätzliche Arbeit einen kleinen Zuschlag zu meinem Lohn als Bedienung im Café. »Gefällt dir das hier?« Ich drehe das Handy um und halte es Sandra hin, damit sie das Foto betrachten kann, das ich von der Magnolie gemacht habe, als ich herkam.
»Die sind alle schön«, sagt sie.
»Das ist das Problem. Wir sind von so viel Schönheit umgeben, dass wir ganz verwöhnt sind. Wir merken gar nicht, wie gut wir es haben.«
»Wir laufen nicht Gefahr, es zu vergessen«, erwidert Sandra. »Du erinnerst uns ja ständig daran.«
Ich lache. Ich bin hemmungslos begeistert von dem Ort, an dem wir leben und arbeiten. Nicht nur, dass ich mich gar nicht frage, ob das Gras hinter den vielen Hügeln des Anwesens grüner sein könnte – ich weiß mit Sicherheit, dass es das nicht ist.
»Ich poste es. Die anderen packe ich in unsere Storys.«
Als die Glocke über der Tür klingelt, stelle ich mich hinter den Tresen und wende mich dem ersten Kunden des heutigen Tages zu.
Womit ich rechne, ist ein Seniorenpärchen, das sich bei einer Tasse Tee aufwärmen möchte, bevor es seinen Rundgang durch den Park beginnt. Oder vielleicht eine Gruppe japanischer Touristen, die von mir den Lageplan erklärt bekommen möchten.
Der allerletzte Mensch, mit dessen Hereinkommen ich rechne, ist ein Mann, so groß, dass er sich ducken muss, damit er sich nicht am Türsturz den Kopf stößt – einer, der seine weißen Hemdsärmel hochgekrempelt hat, wodurch seine Unterarme fast schon provokativ zur Schau gestellt sind. Er bleibt direkt vor dem Tresen stehen und sieht mich an, als wäre ich ein Stück von Sandras Bakewell Tart und er würde mich gleich verschlingen.
Man kann definitiv behaupten, dass der Mann vor mir kein typischer Crompton-Gast ist.
Ich schaffe es, mein Lächeln aufrechtzuerhalten, als ich unseren neuen Kunden begrüße, obwohl ich mir fast sicher bin, dass ich allein von seinem Anblick rot werde. »Guten Morgen. Was kann ich für Sie tun?«
Ein amüsierter Ausdruck huscht über sein Gesicht. Ich möchte gar nicht wissen, was er gerade denkt. Denn daher, wie sein Mundwinkel zuckt und sich seine Augen weiten, weiß ich genau, was es auch ist, es ist etwas Unanständiges.
»Tee? Oder Kaffee?«, schlage ich leicht verunsichert vor. »Dort hinten haben wir Orangensaft.« Ich wedele in Richtung des Kühlschranks mit den Kaltgetränken.
Sandra kommt zu uns geschlurft, und aus den Augenwinkeln sehe ich, wie sie die Schokoladentorte auf den Tresen stellt. Wir werden nachher eine Wette abgeben, um welche Uhrzeit das erste Stück davon gegessen wird. Die Torte wird immer als Letztes bestellt, aber sobald das erste Stück angeschnitten ist, geht es zu wie am Black Friday – pausenlos Bestellungen, bis sie alle ist. Davor machen hausgemachte Müsliriegel und Karottenkuchen den Großteil des Vormittagsgeschäfts aus.
»Na, was sind Sie denn für ein hübscher Typ?«, sagt Sandra zu dem völlig Fremden vor mir, der mir noch nicht mal mitgeteilt hat, ob er Tee oder Kaffee möchte. Sie stützt die Hände in die Hüften und tritt zu mir – und damit auch zu dem Fremden –, als wollte sie ihn näher inspizieren, um festzustellen, ob er wirklich so gut aussieht, wie es ihr erster Eindruck war. Daran besteht kein Zweifel. Das dunkelbraune, glänzende Haar, die vollen Lippen, die Kinnpartie … sogar die sich andeutende Falte zwischen seinen Brauen verleiht seinem attraktiven Gesicht noch mehr Tiefe.
Der Mund des Kunden biegt sich zu einem Viertellächeln. »Danke.«
»Und auch noch Amerikaner!«, sagt sie auf seinen hörbaren Akzent hin, als wäre ihr gerade ein Zebra vorgestellt worden. Wir haben jeden Tag Amerikaner vor uns. Na ja, zumindest so gut wie jeden.
Sandra stupst mich an. »Er ist Amerikaner.«
Ich kann mir ein Lächeln nicht verkneifen. Sandra ist mindestens vierzig Prozent des Tages ungewollt lustig. Die übrigen sechzig verbringt sie singend, was sie zur perfekten Kollegin macht. Außerdem hat sie keinerlei Filter, kann backen und ich kenne sie seit meiner Geburt. Sandra gehört zur Familie.
»Karottenkuchen?«, schlage ich vor, indem ich Sandra zu ignorieren und meinen Job zu machen versuche – den, der meine Kindheit über mein Traumjob war und den ich mit sechzehn angefangen habe.
»Einen schwarzen Kaffee«, sagt er.
Statt dem Kunden einen Kaffee zuzubereiten, während ich das Kassieren übernehme, lehnt Sandra am Tresen. »Leben Sie in Amerika?«, fragt sie. »Machen Sie hier Urlaub?«
»Das macht ein Pfund fünfzig, und die Beantwortung von Sandras Fragenkatalog ist absolut freiwillig.«
Als er leise lacht, wird mir heiß im Schoß. Es stimmt schon, dass nicht gerade viele gut aussehende Männer auf Crompton Estate vorbeischauen. Und ich verlasse das Anwesen nicht oft, außer um kurz ins Dorf zu fahren, wenn ich zur Post muss oder in den Supermarkt. Mir laufen nicht viele gleichaltrige Männer über den Weg, die aussehen wie dieser hier vor mir, doch mein Körper reagiert derart instinktiv auf ihn, dass ich eigentlich ganz froh bin, schon länger nicht mehr weiter weg gewesen zu sein. Vielleicht hatte ich irgendeine Hormonveränderung und würde mich auf dem Boden winden, wenn ich Cambridge besuchen, um eine Straßenecke biegen und plötzlich einer ganzen Gruppe Männer gegenüberstehen würde.
Wobei selbst ein Dutzend Männer zusammen wahrscheinlich nicht mit solchem Selbstbewusstsein auftreten würden wie mein eines aktuelles Gegenüber. Es dringt ihm aus jeder Pore. Schon nach den wenigen Sekunden Interaktion kann ich sagen, dass er ein Mann ist, der weiß, was er will.
Einer, der kriegt, was er will.
»Doch kein Fragenkatalog«, widerspricht Sandra. »Ich mache nur Small Talk. Ich mag Menschen eben. Was soll ich sagen?«
»Derzeit lebe ich in den Staaten«, antwortet er.
Gerade will ich ihn fragen, ob er bar oder mit Karte bezahlen will, da hebt er zur Antwort auf meine unausgesprochene Frage sein Handy und nickt, als ich ihm das Kartenlesegerät hinhalte.
»Ich habe Familie hier. Ich treffe mich heute mit ihnen, um den Gartenpark zu besuchen.«
»Wunderbar«, erwidere ich.
»Ein Familienmensch«, sagt Sandra zustimmend. »Sind Sie verheiratet?«
Daraufhin lacht der Mann in sich hinein. Keine Ahnung, ob wegen der Fülle all der Fragen oder wegen der Privatheit dieser speziellen.
»Nein, bin ich nicht.« Sein Blick huscht zu mir und dann wieder zu Sandra.
»Wenn Sie sich setzen möchten, bringe ich Ihnen Ihren Kaffee. Sie können sich einen Tisch aussuchen.« Ich möchte mir gegen die Stirn schlagen. Natürlich kann er sich einen Tisch aussuchen. Er ist der einzige Gast. Es ist ja nicht so, als wären welche für VIPs reserviert.
»Danke«, sagt er, bevor er sich zum Gehen umdreht.
Ich beobachte, wie er sich hinsetzt, die Beine unter dem Tisch ausstreckt und sein Handy herausholt.
»Er ist umwerfend«, bemerkt Sandra, während wir ihn beide anstarren.
Abrupt schaut er hoch und erwischt uns beim Glotzen. Die Scham kriecht mir den Hals hoch, sodass ich auf die Kasse vor mir blicke, als wäre sie ein Laptop und ich mit wichtiger Arbeit beschäftigt.
Hat er Sandra gehört?
»Du brockst uns noch Trouble ein«, flüstere ich.
»Dein Leben kann ein bisschen Trouble gebrauchen. Ein bisschen Aufregung oder ein kleines Abenteuer.«
»Mir gefällt mein Leben so, wie es ist«, erwidere ich. Crompton Estate ist Abenteuer genug für mich. Ich bin glücklich hier. Darauf kommt es an.
»Vor zwanzig Jahren hätte ich mich an den Mann rangeschmissen«, sagt Sandra.
»Da warst du glücklich verheiratet«, erinnere ich sie.
Sie zuckt mit den Schultern. »Bist du aber nicht.«
»Ich bin glücklich.« Abenteuer hatte ich schon, deshalb gefällt es mir hier, im Café, wo ich Musicalhits singe und Karottenkuchen serviere.
Als der Fremde von seinem Handy aufsieht, treffen sich unsere Blicke. Er guckt nicht weg und ich auch nicht.
2. KAPITEL
VINCENT
Jacob und Sutton kommen nicht zu spät. Ich bin zu früh da. Ich wollte den Laden auf mich wirken lassen, bevor ich irgendwie abgelenkt werde – die Teestube, die rosa karierten Tischdecken, die Musicalhits, die von den beiden Frauen hinter dem Tresen geträllert werden. Ich möchte mich umsehen, einen Eindruck vom Gartenpark bekommen, davon, wie der Landsitz aussieht, wenn keine Schwärme von Touristen da sind. Ich brauche Gelegenheit herauszufinden, was mein Bauchgefühl sagt. Ich bin ein Fan von Zahlen, aber selbst wenn die gut aussehen, muss auch mein Bauch einverstanden sein, damit ich ein Investment eingehe.
Die ältere Frau hinter dem Tresen fängt an, das nächste Lied, America aus West Side Story, mitzusingen, das aus den Lautsprechern dringt. Ich lächle. Die ist ja mal fröhlich.
Das Geräusch näher kommender Schritte lässt mich aufblicken. »Ihr Kaffee«, sagt die jüngere Angestellte.
»Danke«, erwidere ich und drehe dabei die Tasse so, dass der Henkel in die entgegengesetzte Richtung zeigt.
»Ach, auch ein Linkshänder«, sagt sie strahlend. Sie trägt eine rosa gestreifte Kellnerinnenuniform mit Rüschenkragen und einer weißen Schürze. Das sollte eigentlich nicht so sexy wirken, wie es der Fall ist. Es sieht nur so verdammt unschuldig aus.
»Ihre Freundin singt wohl gern«, sage ich.
»Wir beide«, erwidert sie. »Ich könnte niemals irgendwo arbeiten, wo man nicht singen darf.« Sie sagt das ganz trocken, sodass ich mir nicht sicher bin, ob sie es ernst meint, bis sich ein breites Lächeln auf ihrem Gesicht ausbreitet.
Sie ist umwerfend.
Ihre blauen Augen funkeln beinahe, und ihr Haar ist zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, der hin und her schwingt beim Gehen … und wohl vermutlich auch bei anderen Aktivitäten.
»Darf es für Sie noch etwas sein?«
Ich verenge die Augen. »Nichts von der Karte.«
Als sie errötet, schelte ich mich innerlich dafür, dass ich mich nicht gentlemanhafter benehme. »Danke, ich bin gut versorgt.«
Die Türglocke bimmelt und Sutton kommt herein. Dahinter Parker – ich hatte gar nicht mit ihr gerechnet. Dicht gefolgt von Jacob und Tristan, Parkers Verlobtem.
Ich rücke vom Tisch weg und stehe auf.
»Wir sind zu viert hier. Ich muss meine freien Tage so nutzen, dass ich so viele Freunde wie möglich treffe«, erklärt Sutton.
»Je mehr, desto lustiger«, erwidere ich und ziehe Sutton in eine Umarmung. Je größer unsere Gruppe ist, desto mehr sieht es nach einem typischen Familienausflug aus, und genau das will ich. Meine Familie ist heute unwissentlich in mein Vorhaben eingespannt.
Während sich alle Stühle zurechtrücken und Pullis ausziehen, sehe ich hinüber zum Tresen und begegne dem Blick der jüngeren Angestellten. Ohne dass ich etwas sage, nimmt sie sich einen Block und kommt zu uns.
»Guten Morgen, alle miteinander. Willkommen in Crompton. Was kann ich Ihnen bringen?«
Ich beobachte, wie sie sorgsam alle Bestellungen notiert und dabei jeweils wiederholt, was die anderen gerade genannt haben. Zwischen jeder Bestellung geht ihr Blick zu mir, als wollte sie nachsehen, ob ich immer noch da bin.
Dann klingelt erneut die Türglocke und mein Onkel und meine Tante platzen herein.
»Mir ist saukalt, Carole. Darum trage ich zwei Pullis und den Mantel.«
Meine Tante ignoriert das Gejammer meines Onkels – sie ist daran gewöhnt – und wird in Umarmungen ihres Sohns, seiner zukünftigen Frau und ihrer Freunde gezogen.
Als ich zum Tresen schaue, ist meine Freundin erneut auf dem Weg zu uns.
»Zwei Tassen Tee und einen Karottenkuchen für John«, sage ich.
»Zwei Tassen Tee für ihn?«, fragt sie. Dann wird ihr klar, wie ich es gemeint habe, und sie schüttelt den Kopf. Sie beobachtet meinen Onkel und meine Tante, während diese sich aus ihren Kleidungsschichten schälen. Ein leises Lächeln umspielt ihre Lippen. Sie neigt ihren Stift so dezent zu Carole und John, dass niemand außer mir es bemerken würde. »Ihre Eltern?«
Ich lächle. Nicht nur die ältere Bedienung steckt voller Fragen.
Als ich ein paar Schritte zur Seite gehe, folgt sie mir.
»Wie heißen Sie?«, frage ich.
»Kate.«
Ich betrachte ihr Gesicht – die dunklen Wellen, die sich aus ihrem Pferdeschwanz lösen, die drei Sommersprossen auf ihrer linken Wange – und freue mich über die Röte, die ihr den Hals hinaufsteigt. Ich will sie nicht verlegen machen. »Die beiden sind mein Onkel und meine Tante«, erkläre ich. »Jacob ist mein Cousin – Carole und Johns Ältester. Sutton ist seine baldige Frau.«
»Zukünftige«, berichtigt sie mich.
Ich grinse und schiebe die Hände in die Hosentaschen, damit ich sonst nichts mit ihnen anstelle. »Dann noch Parker, Suttons beste Freundin, und Tristan ist wiederum ihr Zukünftiger.«
Sie nickt, als sei sie zufrieden mit meiner Auskunft. »Klingt nach einer großen Familie. Jede Menge Verlobte.«
Ich lache in mich hinein. »Keine für mich.« Ich begegne ihrem Blick. Keine Ahnung, warum ich so heftig flirte. Es ist nicht so, als wollte ich ihre Nummer haben oder sie zum Essen einladen. Doch sie hat etwas Anziehendes, das ich mir nicht recht erklären kann.
»Wir rechnen auch noch mit Nathan. Noch einem Cousin. Ich habe ganze fünf. Nathans Frau muss arbeiten, darum wird sie nicht dabei sein.«
Unter einem Seufzen dreht sie sich zu mir und legt mir eine Hand auf den Arm. Die Geste ist viel zu vertraulich, fühlt sich aber absolut richtig an. »Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag zusammen.« Sie sagt es mit einer Ernsthaftigkeit, die mich überrascht. Dann dreht sie sich um und geht zurück zum Tresen.
»Danke, Kate«, rufe ich ihr nach.
Eine bekannte Melodie setzt ein, und dann höre ich die erste Textzeile – es ist Good Morning aus Singing in the Rain.
»So was gibt’s heute nicht mehr«, bemerkt John. »Großartiges Musikstück. Nicht solcher Andrew-Lloyd-Webber-Quatsch. Singing in the Rain ist ein richtiges Musical.«
»The Dueling Cavalier«, sagt Carole.
John lacht. »Ist jetzt ein Musical.«
Daraufhin ist es Carole, die lachen muss.
Es ist schön, sie lachen zu sehen, auch wenn ich nicht verstehe, worüber.
»Alles klar bei euch?«, frage ich.
»Mit einer Tasse Tee wär’s noch besser«, antwortet John. »Müssen wir zum Bestellen an den Tresen gehen?«
»Nein«, sage ich. »Du bekommst gleich eine.«
»Du bist ein Guter, Vincent. Anders als meine Bengel.«
Ich lächle, doch das Kribbeln in meinem Nacken nimmt zu.
Kate kehrt mit einem Tablett voller Getränke zurück. »Kann ich Ihnen sonst noch etwas bringen?«, wendet sie sich an mich.
»Wenn Nathan da ist, vielleicht«, sage ich.
»Na dann, bis zu Nathans Ankunft.« Sie lächelt mich an und geht singend zurück zum Tresen.
»Britische Frauen sind spitze«, sagt Sutton.
Als ich zu ihr rübersehe, ist klar, dass sie mich dabei beobachtet hat, wie ich Kate beobachtet habe.
Ich lache leise. »Es gibt überall tolle Frauen, Sutton.«
»Warst du schon jemals verliebt?«, fragt sie.
Auf dieses Thema habe ich echt keine Lust. Ich nehme an, es ist normal, dass frisch Verliebte sich das Gleiche auch für alle anderen Menschen in ihrem Umfeld wünschen, aber dafür bin ich nicht gemacht. Ich bin ein ruheloser Mensch, nicht daran interessiert, »Die Richtige« zu finden, mit der ich den Rest meines Lebens verbringe. Ich habe kein Interesse an überhaupt irgendwas Permanentem. »Ich liebe das Leben«, erwidere ich. Zu meinem Glück geht die Cafétür auf und Nathan kommt herein, Arm in Arm mit einer Frau, die mindestens sechzig Jahre älter ist als er, was sie locker Mitte neunzig macht.
»Da sind Sie, Gladys. Ich sagte Ihnen ja, dass Sie auf mich warten. Jetzt suchen wir Ihnen mal einen Platz.« Nathan schaut hoch und nickt mir zu. »Vincent, können wir eine Tasse Tee für Gladys organisieren? Sagen wir besser zwei und noch einen Orangensaft. Ihre Tochter und Enkelin kommen gleich von der Toilette zurück.«
Ich gehe zum Tresen, um Gladys’ Bestellung aufzugeben. Kate scheint verschwunden zu sein, aber dann geht die Tür hinter dem Tresen auf, und sie kommt zurück.
Unsere Blicke treffen sich, ehe sie bemerkt, dass sie noch mehr Kunden bekommen hat.
»Gladys!«, ruft Kate aus. »Hab Sie letzte Woche gar nicht gesehen. Ist alles in Ordnung?« Sie umrundet den Tresen und nimmt es Nathan ab, Gladys zu dem Tisch direkt davor zu führen.
Gladys und sie unterhalten sich, aber worum es geht, kann ich wegen des Geräuschpegels, den unsere Gruppe beim Begrüßen von Nathan verursacht, nicht verstehen. Ich setze mich, trinke einen Schluck Kaffee und beobachte die Menschen vor mir, die gerade mindestens zwölf Unterhaltungen gleichzeitig führen.
»Sind jetzt alle da?«, fragt Carole neben mir.
Ich nicke. »Soweit ich weiß, fehlen keine Coves mehr.«
Sie tätschelt mir das Knie. »Es ist schön, dich wiederzusehen. Du warst monatelang nicht hier. Vielleicht bleibst du diesmal ein Weilchen länger.«
Das Kribbeln in meinem Nacken legt sich fast, und ich gebe ihr ein Küsschen auf die Wange. »Ich komme, sooft ich kann«, sage ich. »Aber ich muss schon sagen, dass ich es vermisse, wenn ich nicht da bin.«
»Na, und was machen wir hier?«, fragt sie. »Ich glaube dir nicht, dass du bloß einen Ausflug mit uns unternehmen willst.«
Meine Tante war eine herausragende Chirurgin. Sie ist mit Abstand das schlauste Mitglied unserer Familie. Ihr entgeht nichts.
»Niemand nimmt dir ab, dass du einen Ausflug hierher vorgeschlagen hast«, sagt John.
Ich sehe nach, ob irgendwer – genauer gesagt Kate und die ältere Cafémitarbeiterin – zuhört. »Könnt ihr euren Unglauben für die paar Stunden zurückhalten, die wir hier sind? Ich erkläre es euch zu gegebener Zeit.« Das Letzte, was ich gebrauchen kann, ist, dass Kate und die ältere Kollegin etwas aufschnappen. Sie könnten daraufhin voreilige Schlüsse ziehen.
»Natürlich. Solange es dir nur gut geht«, antwortet Carole.
Ich bekomme regelmäßig Handynachrichten oder E-Mails und Anrufe von all meinen Cousins und sogar von meinem Onkel, aber stets ist es Carole, die nachfragt, ob es mir gut geht. Sie macht das schon, seit ich klein war. Ich habe mir immer ausgemalt, ich würde nach den Sommerferien in England bei Carole und John mein Flugzeug zurück in die USA verpassen. Das ist wohl der Grund, warum ich hier auf der Uni war. Und warum ich Medizin studiert habe. Ich wollte genau wie sie sein.
Eine Familie genau wie ihre haben.
»Sehr gut sogar«, versichere ich Carole. »Du weißt doch, dass ich gern gute Investments ausfindig mache.«
Sie zieht die Augenbrauen hoch, sagt aber nichts weiter. Ich werde es ihnen später erklären. Ich werde dieses Anwesen nur kaufen, wenn der Earl die von mir gebotene Kaufsumme akzeptiert. Ich weiß allerdings nicht, wie diese Summe ausfällt, und sie festzulegen, ist das Ziel des heutigen Tages.
John hüstelt und schielt hinüber zum Tresen. »Diese Schokoladentorte sieht ganz schön gut aus, Carole –«
»Nein, John. Es ist fünf nach zehn und du hast gerade eben ein Stück Karottenkuchen gegessen.«
Grummelnd trinkt er noch einen Schluck Tee.
Ich lächle und lehne mich auf meinem Stuhl zurück.
Es ist schön, wieder da zu sein.
3. KAPITEL
VINCENT
Nachdem ich dreimal versprochen habe, dass ich nach Norfolk kommen werde, bevor ich nach New York zurückfliege, bleibe ich auf dem Parkplatz neben meinem Auto stehen, während meine Familie wegfährt.
Sie waren zur Tarnung hier, aber es war schön, sie zu sehen.
Ich schaue auf die Uhr und gehe zum Haupthaus. Zwar stehen nur die Außenanlagen Besuchern offen, aber wenn ich das ganze Anwesen kaufen will, muss ich auch das Haus sehen.
Wie angewiesen gehe ich durch ein kleines schwarzes Tor in der Mauer an der Rückseite des Grundstücks, hinter dem bereits der Makler auf mich wartet.
»Brian«, sage ich.
»Vincent. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Tut mir leid, dass ich Sie nicht durch die Gartenanlage begleiten konnte. Aber durchs Haus führen kann ich Sie auf jeden Fall.«
Er braucht nicht zu wissen, dass ich mir den Gartenpark bereits angesehen habe. Und während ich das Anwesen rund um das Haupthaus ausgekundschaftet habe, konnte ich von Weitem dessen Zustand einschätzen. Das Dach muss repariert, wenn nicht sogar neu gemacht werden. An manchen Stellen, die nicht sofort auffallen, blättert die Farbe von der Fassade. Und in den Regenrinnen wuchert Unkraut. Die Zeichen des Verfalls sind nicht augenfällig, es sei denn, man achtet darauf – und das tue ich. Nicht nur, weil ich wissen will, wie viel ich investieren muss, um die Immobilie auf Vordermann zu bringen, sondern auch, wie dringend es dem Earl mit dem Verkauf ist.
»Gehen Sie vor«, sage ich.
»Lassen Sie uns mit der Vorderseite des Hauses beginnen, so als wären Sie durch den Haupteingang hereingekommen. Dann bekommen Sie das richtige Gespür für die Pracht des Gebäudes.«
Ich folge ihm durch die rückwärtige Seite des Hauses, wobei ich die Risse in den Wänden registriere und die sich lösende Tapete in den kleinen, vollgestopften Räumen, die wir durchqueren, bis wir in der völlig anders wirkenden Eingangshalle anlangen.
»Man stelle sich vor, als Besucher herzukommen – die hohen Decken, die ausladende Treppe –, das macht gleich Eindruck, wenn man durch die Tür tritt.«
Ich schiebe die Hände in die Hosentaschen und sehe mich um. Brian hat recht, der Eingangsbereich ist ansehnlich und könnte prächtig sein. Er macht nur einen etwas mitgenommenen und lieblosen Eindruck. Der Teppichläufer auf der Treppe ist verschlissen, und alles wirkt irgendwie leer. So als würden die Möbel und die Gemälde, die die Räume füllen und die Wände zieren sollten, eher durch Abwesenheit glänzen.
»Ist der Eigentümer ausgezogen?«
»Nein, ganz und gar nicht. Aber seit seine Frau verstorben ist, ist dem Earl die Liebe zum Haus abhandengekommen.«
»Sie starb vor etwa fünf Jahren?«
Brian nickt. Er wurde vom Earl als Makler eingesetzt, nicht von mir. Offenbar brauche ich hier in Großbritannien keinen zu engagieren. Dadurch spare ich Geld, aber gleichzeitig denke ich, er würde vielleicht offener sprechen, wenn ich von jemandem vertreten würde.
»Also möchte er damit abschließen.«
»Es schmerzt ihn, aber ja, er möchte den Instandhaltungsaufwand nicht mehr auf sich nehmen.«
»Verständlich. Ein Anwesen wie dieses zu unterhalten ist teuer und zeitintensiv.«
»Lassen Sie mich Ihnen die Bibliothek zeigen«, sagt er.
Wir wenden uns nach links in den von Büchern gesäumten Raum. Zwei lederne Ohrensessel rahmen einen kleinen Tisch ein. Aber abgesehen von den Büchern wirkt die Bibliothek leer. »Hat er die Möbel abgestoßen? Und die Gemälde? Es scheint einiges zu fehlen.«
»Ich glaube, in Vorbereitung auf den Verkauf hat er etliche Möbel und Kunstwerke Familienmitgliedern gegeben.«
Ob das stimmt, weiß ich nicht recht. Vielleicht hat der Earl sie verkauft, um das Anwesen zu halten.
»Decken die Einnahmen aus den Gartenbesichtigungen die Haltungskosten des Anwesens?«, erkundige ich mich.
»Hätten Sie denn vor, die Teestube weiter zu betreiben?«, fragt er. »Und den Gartenpark für Besucher offen zu halten?«
»Das habe ich noch nicht entschieden«, erwidere ich. Er hat meine Frage nicht beantwortet, was heißt, dass die Teestube und die Gartenbesichtigungen die Haltungskosten des Anwesens nicht decken. Und er weiß das. Was bedeutet, der Earl hat es ihm gesagt, was wiederum bedeutet, den beiden ist bewusst, dass sie in einer schwachen Verhandlungsposition sind.
Natürlich werde ich den Gartenpark auf keinen Fall weiter öffentlich zugänglich halten. Wenn ich dieses verfallende alte Gebäude in ein Fünf-Sterne-Hotel umwandle, wird es exklusiv. Luxuriös. Es wird kein Gartencafé mit lauter Karottenkuchen und keine Busladungen von herumspazierenden Senioren geben.
Brian holt Luft. »Wenn Sie alles schließen, könnte das Genehmigungsverfahren wegen der wegfallenden Arbeitsplätze ein Kampf werden. Manche arbeiten schon seit Generationen hier auf dem Anwesen.«
»Es ist ein Wagnis«, räume ich ein. Selbstverständlich habe ich mich bereits über das Genehmigungsverfahren informiert. Es gibt ein Team von Leuten, das mich bei Entscheidungen berät, und auch wenn es riskant ist, ein solches Anwesen ohne Baugenehmigung zu kaufen, hatte ich schon riskantere Projekte. Den Behörden ist klar, wenn solchen großen Herrensitzen kein neues Leben eingehaucht wird, verfallen sie. Menschen werden arbeitslos und Gemeinden zerbröckeln durch das Loch im Herzen. Aber das alles braucht Brian nicht zu wissen.
»Absolut«, sagt er. »Und Sie sind heute aus London hergekommen?«, fragt er. »Oder leben Sie in den USA?« Ich weiß nicht recht, ob Brian bewusst ist, wie schlecht es ihm gelingt, nicht durchblicken zu lassen, dass der Earl die Immobilie dringend verkaufen will.
»Ich übernachte im Dorf«, sage ich. »In dem Pub am Rand des Anwesens.«
»Ah, im Golden Hare? Schönes Lokal. Hab gehört, die Zimmer sollen toll sein.«
Ich nicke. Da ich noch nicht eingecheckt habe, weiß ich nicht, wie die Zimmer sind, aber dass ich dort übernachten werde, stimmt. »Mir ist zu Ohren gekommen, dass der Earl schon seit einer ganzen Weile verkaufen will.«
Brian zieht die Stirn kraus. »Seit dem Tod der Countess gehen so einige Gerüchte um.«
Wir tänzeln beide um das eigentliche Thema herum – nämlich, ob der Earl bereit ist, mir einen attraktiven Preis zu machen.
Wenn nicht, lasse ich es, aber ich gebe zu, dass mir das Anwesen gefällt. Ich brauche eine neue Herausforderung. New York übt nicht mehr dieselbe Anziehungskraft auf mich aus wie damals, als ich hingezogen bin. Dass ich in einen anderen Stadtteil umgezogen bin, hat auch nichts an meiner Langeweile geändert. Ich brauche mehr als nur einen Tapetenwechsel, und Crompton Estate könnte dafür genau das Richtige sein.
»Kann ich mir vorstellen. Wohin geht’s als Nächstes?«
»Die Bibliothek führt in den Morgensalon.«
Dieser Raum wirkt wie aus einem Kostümfilm, an der Decke hängt ein riesiger Kronleuchter und hinter opulenten lavendelfarbenen Sofas stehen Konsolentische mit goldenen Intarsien. An allen Wänden hängen Gemälde – Porträts von gut gekleideten Männern und Frauen der Vergangenheit und Landschaftsbilder, die in Museen zu gehören scheinen. Die Teppiche sind dick, und alles wirkt gepflegt.
»Netter Raum«, bemerke ich.
»Der Earl nutzt ihn als sein Wohnzimmer. Er wird tagtäglich genutzt. Aber der formelle Empfangsraum ist ziemlich schön.«
Er führt mich wieder in die Eingangshalle und diesmal in den rückwärtigen Teil des Gebäudes.
»Das ist mein Lieblingsraum«, sagt er. »Die Galerie.«
Drei Flügeltüren gehen auf einen Garten im Innenhof hinaus und davor hängen drei Kronleuchter von der Decke. Auf beiden Seiten des Raums gibt es einen Kamin mit fein gemeißelten Verzierungen, die nach Tiermotiven aussehen, doch dafür müsste ich näher heran.
Abblätternde Farbe an den Fenstern wurde grob durch einen neuen Anstrich überdeckt, doch man hat sich nicht die Zeit genommen, die alten Schichten abzuschleifen. Oberflächliche Kosmetik – und nicht mal gut gemacht.
»Sie könnte sehr gut als Veranstaltungs- oder Speisesaal genutzt werden, wenn man hier ein Hotel eröffnen wollte«, befindet Brian in leise fragendem Ton.
Ich lächle ohne jede Absicht, darauf zu antworten. Er braucht nichts von meinen Plänen zu wissen.
»Ein schöner Raum.«
Wir gehen in einen weiteren, kleineren Wohnraum, den er als den Salon bezeichnet, und noch durch einen, den er das Esszimmer nennt, obwohl kein Tisch darin steht.
»Sollen wir dann als Nächstes ins Obergeschoss?«
Ich deute mit dem Kopf zu dem Bereich hinter dem Esszimmer. »Ich würde zuerst gern die Runde durchs Erdgeschoss beenden. Was ist mit dem Teil, durch den wir hereingekommen sind?«
Er verzieht die Lippen zu einer straffen, dünnen Linie. »Sehr gern.«
Als wir dorthin zurückkehren, wo wir anfangs durchgekommen sind, wird klar, warum er mich nicht hier haben wollte. In dem Labyrinth aus vier oder fünf Räumen, zu dem ein Billardzimmer und vielleicht noch ein weiterer Salon zu gehören scheinen, stehen die Wände praktisch kurz vor dem Einsturz. Alles wirkt verlassen.
»Hier ist natürlich einiges an Arbeit nötig«, sagt er.
»Natürlich«, entgegne ich, und er führt mich wieder zurück in die Eingangshalle. »Gab es denn großes Interesse an der Immobilie?«
Wir gehen die Treppe hoch, die sich effektvoll hinaufwindet, wie man es eben in einem herrschaftlichen Anwesen erwartet. Sie nimmt viel Platz ein, was suboptimal ist, aber dass wir die Genehmigung bekommen werden, sie zu entfernen, ist unwahrscheinlich.
»Wir bieten das Anwesen nur einem sehr begrenzten Interessentenkreis an«, sagt er.
Ich breche fast in Gelächter aus. Nicht weil er witzig ist, sondern weil er meine Frage ganz offensichtlich unbeantwortet lässt. Wäre er etwas offener, bekäme ich vielleicht das Gefühl, in keiner ganz so starken Verhandlungsposition zu sein, aber da er nicht bereit ist, überhaupt irgendetwas preiszugeben, kann ich nur das Schlimmste vermuten.
Es hat keinen Sinn, weitere Fragen zu stellen. Eine kurze Zeit lang spazieren wir von einem Raum zum nächsten und besichtigen die Schlafzimmer, die aussehen, als hätte sie seit mindestens sechzig Jahren keiner mehr modernisiert. Im zweiten Stock ist es genauso.
Das Gebäude verfällt. Der Earl will dringend verkaufen. Und ich brauche eine neue Herausforderung.
Die Sterne über Crompton Estate stehen gut.
4. KAPITEL
KATE
Ich binde mir die grüne Schürze um die Taille und stütze die Hände in die Hüften. »Fertig, ich glaube, wir können aufsperren«, rufe ich mit einem Blick über die Tische, auf denen jeweils ein kleiner Zinkeimer mit in Servietten eingerolltem Besteck und eine Gewürzmenage stehen. Obwohl sie sauber waren, habe ich alle Tische mit Desinfektionsreiniger abgewischt.
George, der Besitzer des Golden Hare, erscheint im Türrahmen. »Gut, wir sperren jetzt nämlich so oder so auf.«
Ich grinse ihn breit an, obwohl mir klar ist, dass er es nicht witzig meinte. Bloß seine Übellaunigkeit ist einfach zum Lachen. »Kümmere du dich um die Getränke, George. Ich übernehme die Speisen.«
Er grummelt vor sich hin. Ich weiß, er ist dankbar, dass ich es heute Abend hergeschafft habe. Es geht ein Virus um, und Meghan, die eigentlich für die Schicht eingeteilt war, hat sich krankgemeldet. Wir sind eine Servicekraft zu wenig, aber damit komme ich klar. Es ist Montag. Montags ist nie was los. Auch wenn heute der große, megaattraktive Amerikaner in der Teestube war. Er sah zum Anbeißen gut aus, aber der eigentliche Bringer war sein Selbstvertrauen. Er hatte einfach etwas an sich, wodurch ich am liebsten direkt meinen Schlüpfer loswerden wollte.
Ich gehe die Speisekarten neben der Kasse durch, ob auch alle mit der Vorderseite nach oben liegen, und drehe die um, die falsch herum zurückgepackt wurden. Dann nehme ich mir einen Notizblock und Stift und stecke sie in die Tasche meiner Schürze. Noch einmal sehe ich mich prüfend um, ob ich auch nichts vergessen habe, da fällt mir etwas auf dem Eichenregal auf, das etwa dreißig Zentimeter unterhalb der Decke rund um den ganzen Gastraum verläuft. Es steht voller kleiner Fotos und Krimskrams von Crompton Estate – ein Hufeisen, eine Messingschatulle, Keramikvasen mit Trockenblumen, die nur Staubfänger sind. Ab und zu, wenn nichts los ist, hole ich alles herunter und staube es ab, deshalb weiß ich ganz genau, was da oben steht. Aber nun hat sich anscheinend ein gelber Teller in das Sammelsurium geschlichen.
»George«, rufe ich. »Was hat es mit dem gelben Teller auf dem Regal auf sich?« Es ist nicht weiter wichtig und geht mich eigentlich nichts an. Nur ist in den fünf Jahren, seit ich diesen Job habe, noch nie einfach so etwas Neues da oben aufgetaucht.
Von George kommt keine Antwort, deshalb ziehe ich einen Stuhl heran und stelle ihn unter das Regal. Ich will mir das genauer ansehen.
Es sieht nach einem schlichten gelben Teller aus. Was hat der da zu suchen? Er hebt sich von den altersgrauen Gegenständen ab, die schon Ewigkeiten da stehen. Wieso sollte George den dorthin stellen? Die Balkendecke ist niedrig, und ich gelange gerade so an die Rückseite des Regals heran, wenn ich mich auf die Zehenspitzen stelle.
Ich greife nach dem Teller, und genau als ich das tue, dröhnt eine Stimme hinter mir: »Sie schon wieder.«
Meine Instinkte sind im Widerstreit. Ich will mich umdrehen, um zu sehen, wer da mit mir redet, aber gleichzeitig das Gleichgewicht halten und sichergehen, dass ich den Teller nicht fallen lasse.
Doch meine Instinkte lassen mich im Stich und mir gelingt nichts von alledem.
Mir verschwimmt die Sicht vor Augen, und ich verliere das Gleichgewicht, während genau im selben Moment meine Finger nachgeben und mir der Teller aus der Hand rutscht. Die Zeit verlangsamt sich und im Nach-hinten-Fallen versuche ich mir vorzustellen, worauf ich landen werde und ob ich am Ende für die heutige Schicht ausfalle, weil ich mit einer Kopfverletzung oder einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus muss. Ich frage mich, ob ich trotzdem meine morgige Schicht in der Teestube absolvieren kann und ob es Sandra schaffen wird, ohne mich die Stellung zu halten. Dienstags ist viel los. Da kommen immer mindestens zwei Busreisegruppen zu uns.
Stürzen ist so umständlich. Aber ich schließe die Augen und wappne mich für den Aufprall.
Anders als erwartet, lande ich nicht auf dem Boden. Es ist, als hätte jemand auf Pause gedrückt, und ich stoppe mitten in der Luft ab.
Ich brauche einen Augenblick, um zu merken, dass jemand mich aufgefangen hat.
Als ich die Augen öffne, geht mir auf, dass ich wohl in Ohnmacht gefallen sein muss und von dem gut aussehenden Amerikaner aus der Teestube träume – dem Mann, der bei mir eine spontane Höschenallergie auslöste. Ich mache die Augen wieder zu, woraufhin mir klar wird, dass ich vermutlich doch nicht bewusstlos bin, wenn ich bewusst die Augen öffnen und schließen kann.
Hitze erfasst meinen Körper, und ich schlage auf der Stelle die Augen auf.
»Sie haben mich aufgefangen«, sage ich.
»Stimmt.« Er hat eine tiefe, sonore Stimme, die ich zwischen meinen Schenkeln vibrieren spüre. »Machen Sie jetzt ein Nickerchen, oder können Sie stehen?«, fragt er.
»Ein Nickerchen würde mir gefallen«, erwidere ich, während ich hoch in seine Augen blicke. »Leider kann ich erst nach der Arbeit eins machen. Schätze also, ich sollte mich hinstellen.« Ich bin mir seiner Hände auf meinem Körper überaus bewusst – knapp vor dem Oberschenkel und auf meinem Rücken. Er ist groß, wie eine Wiege in Erwachsenengröße. Fast ist es, als sei er dafür geschaffen, mich zu fangen.
»Wir können ein paar Minuten so bleiben, wenn Sie sich gern ausruhen möchten.« Er grinst mich an.
»Oooch, danke. Vielleicht bloß so lange, bis der erste Gast reinkommt. Sie sind mega…« Ich suche nach dem richtigen Wort. Sexy? Ja, das wäre passend, ginge aber einen Tick zu weit, schließlich ist er ein Fremder und jemand, dem ich wahrscheinlich binnen der nächsten Stunde einen Burger servieren werde.
»Sie meinen, bis der zweite Gast hereinkommt«, sagt er.
»Ah, stimmt wohl, wenn Sie sich selbst mitzählen.«
»Ich will doch hoffen, hier Gast zu sein, aber ich warte damit gern noch bis nach Ihrem Nickerchen.«
Die Situation ist so schon schräg und wird nicht besser werden, bevor er mich abgesetzt hat – auch wenn ich das echte Bedürfnis habe, ein Nickerchen in seinen Armen zu machen. Oder sonst was, ehrlich gesagt.
»Tatsächlich fühle ich mich jetzt schon ausgeruhter. Vielen Dank.« Als ich zu zappeln anfange, lässt er mich herunter.
»Jederzeit.«
Ich verziehe das Gesicht. »Das sollten Sie nicht sagen, wenn Sie es nicht ernst meinen. Ich mache sehr gern ein Nickerchen – vor und nach Feierabend.«
»Oh, ich meine es ernst«, sagt er und sieht mich wie schon zuvor an, als wäre er hungrig und ich die Spezialität des Pubs. »Wenn Sie sich ausruhen möchten, lassen Sie es mich jederzeit wissen.«
Ich glaube, eventuell flirten wir. Ich habe ein dermaßen schlechtes Gespür dafür, dass es sich schwer sagen lässt. Es scheint ihn jedenfalls nicht zu stören, dass ich auf ihm gelandet bin. Keine Ahnung, ob das bedeutet, dass er flirtet oder den Kavalier gibt oder nichts von beidem. Oder beides.
»Werde ich«, gebe ich mit einem Lächeln zurück, das seines spiegelt. »Möchten Sie in der Zwischenzeit gern einen Tisch? Und werden Nathan und die anderen auch zu Ihnen stoßen?«
Diesmal lacht er aus vollem Hals. »Nein, ich bin allein. Meine Familie ist wieder zurück nach …« Er bricht ab und macht eine vage Handbewegung. »Ich übernachte hier.« Mit dem Kopf deutet er hoch zu den Zimmern, die George vermietet.
»Ah«, sage ich. »Großartig. Ein verlängerter Aufenthalt.« Es ist tatsächlich großartig. Aber auch ein bisschen seltsam. Meistens sind die Übernachtungsgäste hier Familien, die in makellos sauberen Range Rovern aus London angefahren kommen, oder Paare, die ebenfalls in blitzsauberen Range Rovern ankommen. Im Grunde genommen sind wir für eine Zielgruppe da, die sich für Landmenschen hält, aber in der Stadt lebt.
Dieser Mann hier ist ein Stadtmensch. Er gibt gar nicht vor, etwas anderes zu sein.
»Sind Sie mit einem Range Rover hier?«, frage ich, während ich ihn zu meinem Lieblingstisch führe, dem unter dem Aquarell von der Mathematikerbrücke in Cambridge.
»Nein. Ist das Bedingung?«
»Natürlich nicht«, sage ich. Nur wäre es schlüssiger. Wobei, er würde auch dann nicht ins Bild passen. Er bräuchte eine Ehefrau oder Freundin an seiner Seite. Wieso sollte er allein herkommen? »Wird noch jemand zu Ihnen stoßen?«
»Nein, es sei denn, Sie würden sich gern zu mir setzen«, antwortet er. »Sie sind ja schon den ganzen langen Tag auf den Beinen.«
Ich lege den Kopf schief, während ich versuche, mir seine Wangenknochen einzuprägen. Könnte ich das mit Contouring auch hinbekommen? Was denke ich mir bloß? Die paar Male, die ich es mit Contouring versucht habe, sah ich am Ende aus wie ein Affe von hinten. »Montage sind eigentlich die ruhigsten Tage für mich, was Gäste angeht. Ab dienstags geht es heiß her.«
Als er mir fest in die Augen schaut, ist es, als hätte er ein Feuer in mir entfacht. Man könnte Marshmallows auf mir rösten.
»Heiß her? Verraten Sie mir mehr.«
Dieser Mann bringt Trouble. Und damit will ich nichts zu schaffen haben. Nein, vergesst das. Ich will so was von damit zu schaffen haben, allerdings bin ich bei der Arbeit und muss seine Bestellung aufnehmen, bevor George rauskommt und mich anranzt. Was er so oder so tun wird, aber ich will mir lieber nichts zuschulden kommen lassen, was einen Anranzer rechtfertigt. »Na, wegen der Busreisegruppen«, verderbe ich ihm die Flirttour. »Ich kann Ihnen alles über die Spezialitäten des Hauses verraten, wenn Sie möchten?«
»Ich hatte mir zwar etwas anderes erhofft, aber das passt auch«, erwidert er.
»Der Lachs mit hausgemachter Sauce hollandaise ist fantastisch. Und natürlich ein fettreicher Fisch, der versorgt Sie also mit Omega-3-Fettsäuren. Ansonsten gibt’s einen Buttermilch-Chicken-Burger.« Ich verziehe das Gesicht. »Deutlich weniger Omega-3, aber ehrlich, der schmeckt köstlich und enthält eine ordentliche Dosis Tryptophan.«
Als er mir geradewegs in die Augen sieht, ist es, als hätte er mich in ein Brioche-Bun gesteckt und gerade eine Portion Mayonnaise draufgegeben. Ich könnte schwören, dass der Mann mich verschlingen will. Und ich weiß gar nicht mal, ob ich etwas dagegen hätte. »Ich nehme irgendwas, das lecker schmeckt.«
Mit zusammengekniffenen Augen schaue ich auf meinen Bestellblock und sage beim Schreiben gedehnt: »Einmal Buttermilch-Chicken. Darf es etwas zu trinken sein? Und Beilagen? Brokkoli, um einen leichten Herzinfarkt abzuwenden?«
Er lacht leise. »Tragen Sie die Speisekarte immer zusammen mit Ihren Ernährungsempfehlungen vor?«
»Nein, nicht immer. Aber Sie sind Amerikaner. Vielleicht wissen Sie nicht, wie es hier in Großbritannien läuft.«
»Weil Lachs in den USA keine Omega-3-Fettsäuren enthält?«
Ich zucke mit den Schultern. »Vermutlich nicht. Aber nicht dass ich’s wüsste, ich war noch nie dort.« Ich unterbreche mich, denn mein ganzer Körper erschaudert bei dem Gedanken, nach Amerika zu reisen. Oder generell ins Ausland oder … weiter weg. »Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Brokkoli?«
»Klar«, sagt er. »Ich nehme an, Tequila haben Sie keinen, oder?« Er sagt es, als wüsste er, dass es unwahrscheinlich ist.
»Ich könnte Sie knutschen.« Es rutscht mir heraus, bevor mein Hirn meinen Mund abschalten kann.
»Weil ich Tequila bestellt habe? Oder hat sich mein Getränkewunsch nur zufällig mit Ihrem plötzlichen Bedürfnis, mich zu küssen, überschnitten?«
»Beides«, sage ich, bevor ich rufe: »George! Gerade wurde ein Tequila bestellt.« Ich drehe mich wieder um zu … Nicht zu fassen, dass ich seinen Namen gar nicht kenne. »Letzten Monat habe ich ihn überredet, Tequila zu kaufen. Er meint, den wird nie jemand bestellen.«
Boah! Es wird immer noch besser mit diesem Mann. Er hat mich vor einem Besuch im Krankenhaus bewahrt, und dank ihm kann ich zu meinem knurrigen Chef sagen: »Siehst du wohl!« Dazu noch das Geflirte? Er gibt mir das Gefühl, ich wäre Adriana Lima, bloß ohne Engelsflügel. Ich sollte ihn überreden, einen Lottoschein für mich auszufüllen.
»Freut mich, dass ich behilflich sein konnte.«
»Ich bringe Ihnen ein Mineralwasser dazu«, sage ich. »Aufs Haus. Weil Sie mir das Leben gerettet, mir angeboten haben, ein Nickerchen zu machen, und auch noch dafür sorgen, dass ich George übertrumpfe.«
Die Tür geht auf, und die Radcliffes kommen einer nach dem anderen herein. Heute ist der vierzehnte Geburtstag ihrer Tochter.
Ich schaue noch einmal zu dem Amerikaner. »Ich bringe Ihnen gleich Ihre Getränke.«
Im Näherkommen winke ich Carly Radcliffe zu. »Ich habe euren Tisch für euch. Happy Birthday, Ilana!« Ilana wird vor Scham puterrot.
Ich bringe die Radcliffes zu ihrem Tisch und hole Speisekarten für sie. Die müssen sie inzwischen in- und auswendig kennen und werden ohnehin das Gleiche bestellen wie letzten Mittwoch. Wir ändern die Speisekarte nur zweimal im Jahr, vom Sommer- zum Winterangebot. Etwa alle anderthalb Jahre dann setzt George ein neues Gericht darauf und streicht ein anderes dafür, woraufhin Meghan, Peter und ich mindestens sechs Wochen lang in einer Tour herummosern, bis wir uns daran gewöhnt haben. Gerade erst ist ein gemischter Salat hinzugekommen, den nie jemand bestellt. Ich frage mich schon, warum George uns nicht erst zu Rate zieht, bevor er so was macht.
Als ich zum Amerikaner herüberschaue, spüre ich meinen Schlüpfer rutschen, als wollte er sich von allein unter meiner Schürze freimachen. Der Mann ist so was von umwerfend. Und diese Hände? Diese Schultern? Sogar seine Augenbrauen sind sexy. Geht das überhaupt? Außerdem ist er ein netter Gesprächspartner. Entspannt. Nimmt sich selbst nicht zu ernst. Hat nichts dagegen, wenn ich in seine Arme kippe und einfach ein Weilchen so verharre.