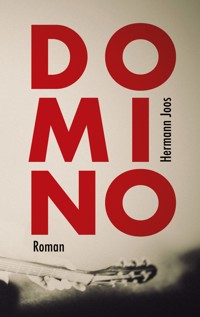
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lisa, Domino, Hannes, Bernd und Jan. In den Achtzigerjahren bildeten sie eine der erfolgreichsten Indierockformationen des Landes. Ihre Band The Dominos hatte den Durchbruch geschafft. Mit grossem Plattenvertrag, international beachteten Konzertauftritten und einer stetig wachsenden, weltweiten Fangemeinde. Ihr kometenhafter Aufstieg schien nicht mehr zu bremsen bis zu jenem Tag, als das Unglück geschah und ihre charismatische Leadsängerin Domino Winter verstarb. Zwanzig Jahre später sind die vier verbliebenen Bandmitglieder in ihren unspektakulären Alltagsleben festgefahren. Lisa entschliesst sich drei Jahre nach ihrer Scheidung sogar zu einer Carfahrt, obwohl sie sich geschworen hatte, niemals in eine Werberaupe einzusteigen. Als Hannes, der frühere Bassist der Band, seinen ehemaligen Kollegen vorschlägt, den näheren Umständen ihres Scheiterns und dem ominösen Tod ihrer Frontfrau noch einmal gemeinsam nachzugehen, löst er damit eine Kette von Ereignissen aus, die alle Beteiligten zwingt, sich mit ihrer eigenen, nicht immer lupenreinen Vergangenheit auseinanderzusetzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lektorat:
Dr. phil. Thomas Joos, Maienfeld
©
Das Copyright für den vorliegenden Text und
die Grafik liegt beim Autor und darf ohne dessen
ausdrückliche Zustimmung nicht
verwendet werden.
Basel, 2023
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
1
Die nächtlichen Lichter flossen über die Windschutzscheibe des 86er-Fords Escort wie glühende Lava. Zähflüssig, träge und monoton. Die eckige Karosserie stemmte sich entschlossen gegen den Fahrtwind und die Tunneldecke wölbte sich scheinbar unendlich über dem Wagendach.
Wenn Jan seinen Kopf einzog und seine Stirn nach vorne schob, um den tiefstehenden Dachhimmel zu verdrängen, bewegte sich das Gewölbe wie ein dahinkriechender Lindwurm – nicht schnell – nicht hektisch – eine graue Masse mit schwarzen Einschüssen, ein dreckiger Lochstreifen.
Es hatte bis vor Kurzem noch geregnet und die Rücklichter der vorausfahrenden Autos zerstäubten schwammig in der dunklen Röhre.
Bea starrte konzentriert über das Lenkrad, soweit dies bei ihrer Körpergrösse von 1,55 m überhaupt möglich war. Der Sitz war in der vordersten Position eingerastet und doch schienen die Pedale für sie unerreichbar. Irgendwie stimmte in dieser Konstellation gar nichts. Die Verhältnisse von Bein- und Armlängen zu Pedalen und Armaturen verhielten sich derart ungestalt wie ihre Augenhöhe zu den tiefliegenden Schalensitzen.
Jan musterte sie vorsichtig von der Seite und dachte, dass das auf die Dauer ja nicht bequem sein könne und wohl früher oder später zu Nackenproblemen führen werde. Mögliche Lösungsansätze schwirrten ihm durch den Kopf. Prioritär wäre der Austausch dieser sinnlosen Sportsitze durch vernünftige höhenverstellbare Standardausführungen im Komfortsegment zu behandeln, was auch optisch den Innenraum aufwerten würde. Der Produktedesigner, der für diese Ungetüme verantwortlich zeichnete, war zielgruppenspezifisch offenbar von einem grossen, sportlichen Fahrer ausgegangen, dessen oberste Priorität der Seitenhalt in temporeichen Kurven war. Die Seitenwangen der Schalen reichten Bea bis zur Mitte ihrer Oberschenkel und liessen sie darin wie in einem Nest versinken.
«Sag mal, findest du diese Autositze bequem? Ist das nicht eher was für grosse, sportliche Fahrer?»
Bea musterte ihn mit einem hastigen Seitenblick, liess ihre müden Augen kurz über den übervollen Aschenbecher unterhalb des schwach beleuchteten Autoradios wandern und konzentrierte sich wieder auf die Strasse.
Die Sicht war schlecht, der Regen hatte wieder eingesetzt und verteilte sich übermächtig auf der Frontscheibe. Quietschend kämpften die Scheibenwischer gegen die Flutwellen und hinterliessen doch bei jeder neuerlichen Anstrengung nur schleimige Schlieren.
Jan starrte noch einmal auf Beas Oberschenkel und richtete den Blick wieder nach vorne. Er hatte nicht wirklich eine Antwort erwartet und überlegte, dass 90 Prozent der Informationen, die zum Autofahren benötigt wurden, über die Augen aufgenommen werden. Das hatte er irgendwo gelesen. Zudem sei zu berücksichtigen, dass, wer nachts unterwegs sei, im Grunde gegen seine biologische Uhr fahre. Unter diesen Umständen interpretierte er Beas Schweigen als einen verantwortungsvollen Beitrag zur Verkehrssicherheit.
Ein riesiger Car, angefüllt mit Reisenden, die wie Fische aus einem Aquarium glotzen, schwebte auf der Überholspur vorbei. Der Winddruck liess den kleinen Escort zur Seite springen, Bea fuhr erschrocken zusammen und riss am Steuerrad, um den Wagen wieder in die Spur zu bringen. Eine Wasserfontäne ergoss sich über die Windschutzscheibe. Für Sekundenbruchteile glitt der Wagen im Blindflug durch die Nacht. Das Wasser in den Lachen der ausgehöhlten Fahrrinnen flutete die Radkästen und liess die Karosserie jämmerlich aufheulen.
Bea schob mit einer tastenden Bewegung ihres Zeigefingers ihr Brillengestell hoch. Die Brille sass etwas schief.
Jan dachte sich, dass Bea eigentlich ganz gut fahre. Trotz ihrer Körpergrösse, den viel zu kurzen, etwas stämmigen Beinen, der Brille und ihrer starken Kurzsichtigkeit.
Er hatte das nie so richtig verstanden mit der Kurz- und Weitsichtigkeit. Er wusste, dass Bea auf Distanz schlecht sah. War sie jetzt kurz- oder weitsichtig? Aber wen interessierte das schon. Schliesslich reichte ihre Sehleistung offenbar souverän, um eine anstrengende Nachtfahrt zu absolvieren, obwohl sie durchaus ein wenig gestresst wirkte. Aber wem würde es nicht so ergehen, wenn er Frevel trieb gegen die eigene biologische Uhr?
Er hatte sie am gleichen Abend in einer Bar getroffen und ihre Einsamkeit war mit der seinen so offensichtlich kompatibel gewesen, dass sich alles Weitere von selbst ergeben hatte.
Es war kein Gespräch, in dem geistesverwandte Seelen aufeinanderprallen wie funkenschlagende Meteoriten und sich im unbändigen Erstaunen über die bisher unentdeckten Gemeinsamkeiten zu immer lustvollerer Kongenialität erhoben. Mehr so ein Gespräch der abtastenden Suche nach einem Strohhalm, an dem sich eine leise Ahnung von Übereinstimmung emporhangeln konnte.
Und dann, nachdem sich vereinzelte gegenseitige Äusserungen aneinanderfügen liessen, waren sie auf die nächste Stufe geklettert, indem sie erste scheue Komplimente ausgetauscht hatten.
«Ich mag deine Jacke», hatte Bea festgestellt, ohne die näheren Umstände ihres Eindrucks zu spezifizieren.
Jan hatte daraufhin seine alte Lederjacke näher unter Augenschein genommen und war zu der Schlussfolgerung gelangt, dass an der Jacke wirklich etwas dran sein müsse, da auch er diese abgetragene Hülle – die er einst von seinem Vater übernommen hatte – schätzte und niemals hergegeben hätte. Er strich vorsichtig über das narbige Leder und stellte sich vor, wie sein Vater zu Studentenzeiten in diesem Kleidungsstück durch das städtische Nachtleben flaniert war, eine schöne junge Frau an seinem Arm untergehakt.
Übergangslos wechselte die Szenerie von diesem freudvollen Bild aus Vaters Jugendtagen zu der statischen Puppe, in die sich sein Vater verwandelt hatte, als Jan ihn durch das kleine verglaste Schiebefenster des Sargdeckels zum letzten Mal gesehen hatte.
Jan fühlte sich verpflichtet, auf Beas Kompliment in gleicher Weise zu reagieren, fand aber nicht die treffenden Worte, also nickte er nur und lächelte.
Er hatte einst von Tante Odilie gelernt, dass Situationen, die mit einem Lächeln geschlossen wurden, sich stets zum Guten entwickelten. Und – so Tante Odilie – er habe ein sehr einnehmendes Lächeln, dass man absolut gewinnbringend in die Waagschale werfen könne.
Also hatte Jan, im Gedenken an seine Tante, sein gewinnendes Lächeln aufgesetzt mit dem Resultat, dass Bea ihm sanft über den Unterarm streichelte, was Jan als sehr ungewohnt, aber durchaus angenehm empfand.
Daraufhin hatten sie dagesessen und die Eingangstüre beobachtet, durch die immerzu neue Gäste hereinfluteten. Sie sassen dort und blickten etwas angestrengt in die Ferne, immer auf der Suche nach einem neuen Anknüpfungspunkt, der sie rethorisch zurück ins Gespräch bringen würde.
«Ja …», räusperte sich Jan und Bea blickte zu ihm auf, als hätte er durch einen Geistesblitz ihre Konversation in neue Sphären befördert.
«Ja, die Jacke hat mal meinem Vater gehört», schloss Jan mit einem verlegenen Lächeln.
Bea nickte anerkennend und sie bestellten noch eine zweite Runde Hefeweizen in der Hoffnung, dies würde ihre Zungen lockern und ihren Mut befeuern, was nicht geschah.
2
Eigentlich hatte sich Lisa geschworen, niemals eine Carfahrt zu buchen, und jetzt sass sie doch tatsächlich, entgegen all ihrer Vorsätze, in einer Werberaupe.
Geniessen Sie einen Tag in der idyllischen Bergwelt rund um den Stausee von Emosson, entdecken Sie bei einer Rundfahrt den Lac d’Annecy oder schlendern Sie über den Markt von Luino.
Solche und ähnliche Versprechen lösten bei Lisa ein Gefühl der Erschöpfung aus. Das lange verdrängte Alter kroch bei dem Gedanken, mit fünfzig anderen Rentnern von einem vordefinierten Ereignis zum nächsten zu schaukeln, in alle Glieder und löste Taubheitsgefühle körperlicher und geistiger Natur aus. Dabei war Lisa erst fünfzig. Doch das fortgeschrittene Durchschnittsalter ihrer Reisegruppe wirkte auf sie ein wie eine ansteckende Krankheit. Lisa fühlte sich mit jedem Kilometer schwächer und älter.
Lisa hatte sich unterworfen, hatte ihren Stolz, ihre unbeugsame Individualität auf dem Scheiterhaufen der Eitelkeiten geopfert. Und wofür?
Alle düsteren Vorahnungen hatten sich nicht nur vollumfänglich bewahrheitet, nein, sie waren bei Weitem übertroffen worden. Die senilen apokalyptischen Reiter fluteten die Vorhölle in diesem vollklimatisierten Reisecar in Scharen. Seit gut einer Stunde waberte diese übergrosse Blechdose nun durch den strömenden Regen. Im Innern das nie verstummende, bohrend-fröhliche Stimmengewirr. Nie hatte sie sich einsamer gefühlt als unter all diesen Menschen, die auf kleinstem Raum zusammengepfercht durch die Nacht glitten.
Nebelfetzen stiegen theatralisch von der Strasse auf und Lichter peitschten über die riesigen Panoramascheiben. Und dann ein Tunnel. Gleich einem Vakuum wurde der Bus in die enge Röhre gesogen. Während das tonnenschwere Gefährt rücksichtslos auf der Überholspur dahinpreschte, schienen sich die Autos auf der rechten Fahrspur zu ducken und den Kopf einzuziehen. Der Car schob sich rüpelhaft durch die Menge, der Seitenwind verlachte die schwächeren Teilnehmer dieser Hatz und drückte sie in Richtung der Tunnelwand.
Lisa legte ihre Hände wie Scheuklappen an ihre Schläfen und linste nach draussen, wo ein um das andere Auto neben ihnen zurückfiel.
In ihrem Blickfeld erschien ein blaugrauer Ford Escort aus den frühen Achtzigerjahren. Es musste sich um ein 85er- oder 86er-Modell handeln. Lisa konnte sich gut an diese Modellbaureihen erinnern. Ihr Freund Max hatte in dieser Zeit auch einen Escort gefahren. Dieses eckige Gefährt hatte nichts mehr mit den eleganten, fliessenden Formen der Sechziger- und Siebzigerjahremodelle gemein. Die Karosserie schien so ungelenk, als hätte ein Schulkind erste Versuche mit Bleistift und Lineal unternommen.
Im Innern der schwach beleuchteten Fahrgastzelle erkannte Lisa eine kleine, junge Frau, die angestrengt über das Lenkrad stierte, den Blick auf das Lichtspektakel der perlenden Farben im wasserdurchfluteten Tunnel gerichtet.
Als der Car den kleinen Mittelklassewagen passierte, geriet dieser ins Wanken und die junge Frau riss erschrocken am Lenkrad, um das Gefährt wieder unter Kontrolle zu bringen.
Lisa war immer gerne Auto gefahren. Am liebsten lange Strecken, in der Nacht und ganz alleine. Angst hatte sie nie gehabt. Am Steuer fühlte sie sich stets frei und ungebunden. Eine faszinierende Welt wartete da draussen und es galt, diese zu erfahren.
Im Gegenteil zu anderen Frauen in ihrem früheren Freundeskreis hatte sie sich stets für Autos begeistert und sie überlegte, ob sie sich wieder einmal eine dieser Automobilzeitschriften kaufen sollte. Nur um wieder über aktuelle Modelle, Trends und Marken auf dem Laufenden zu sein.
Endlich schob sich der Reisecar wieder ins Freie. Die fünfzig Passagiere wurden in eine pechschwarze Nacht hinauskatapultiert. Die weiten Felder der Vorstädte konnte man ausserhalb der wenigen Lichtpunkte auf der Autobahn nur erahnen. Der Regen hatte plötzlich aufgehört.
Da sich Lisa den vordersten Platz gleich beim Eingang reserviert hatte, konnte sie ihren Blick gleichermassen durch das Seitenfenster wie auch durch die Frontscheibe ins konturenlose Dunkel schweifen lassen.
Der hell erleuchtete Mittelstreifen verschwand gleichmässig pendelnd unter dem Bus. Träge, eintönig – ein langsam dahintickendes Metronom.
Und dann fiel der Scheinwerferkegel auf die Fussgängerüberführung. Ein schmales Betonband, das in der nächtlichen Szenerie kurz aufflackerte. In weitem Bogen über den schnell dahinfliessenden, nächtlichen Verkehrsstrom gespannt. Und im Bruchteil von Sekunden nahm Lisa den Mann wahr, der vor dem Geländer stand, die Arme unnatürlich nach hinten gekrallt wie einen Rettungsanker. Die Augen weit aufgerissen widerspiegelten die tausend Scheinwerfer, die unbeteiligt unter ihm hindurchschossen.
Lisa riess den Blick herum, um zu sehen, ob der Mann den Sprung ins gleissende Licht gewagt hatte, ob sich die nachfolgenden Autos wie ein Akkordeon zusammenschieben würden, nachdem der erste Wagen in der rasenden Kolonne die Vollbremsung eingeleitet hatte. Doch der Blick nach hinten war durch schwatzende, lachende Mäuler versperrt. Keiner im Innern des Reisecars hatte etwas von der Szenerie mitbekommen, und als Lisa sich abmühte, ihren erstarrten Körper wiederzubeleben und ihren schnellen Atem unter Kontrolle zu bringen, war sie sich nicht mehr sicher, ob sie sich alles nur eingebildet hatte. Oder war sie gar für einige Sekunden eingenickt? Die Wärme im Bus, das gleichmässige Motorengeräusch, der Stimmenmoloch. Alles hatte dazu beigetragen, dass Realität und Traum zu einem flirrenden Raum jenseits der Zeit mutiert waren. Und dann war da dieses Gesicht auf der Brücke erschienen, ein Gesicht aus der Vergangenheit, ein Gesicht, das einst vertraut gewesen war. Ein Gesicht, das sie geliebt hatte. Hannes’ Gesicht. Aber das konnte doch nicht sein.
Lisa versuchte ihre Ohren zu spitzen, um Aussengeräusche wahrzunehmen, etwa quietschende Bremsen oder das hässliche Knarzen, wenn Blech auf Blech traf. Vielleicht einen Aufschrei aus der hintersten Reihe des Busses. Sie erwartete, dass sich das heillose Entsetzen wie eine Schallwelle vom Heck des Cars nach vorne Bahn brechen würde. Aber die Zeit floss weiter im gleichmässigen Rythmus des Motorengeräusches und des leisen Summens der Klimaanlage.
Der Reisecar bahnte sich seinen Weg durch die Nacht und Lisa war ein Bestandteil dieser Fuhr. Obwohl sie sich eher wie ein Virus im System fühlte, ein Fremdkörper, ein Wesen, das mehr wahrnahm als sein Umfeld.
Der gefederte Sessel wirkte auf sie wie Treibsand, schien sie festzuhalten, ihren Körper aufzusaugen. Ihr Herz schlug immer noch bis zum Hals und sie wollte diesen Sog so gerne überwinden und aufspringen, um in den Hohlkörper dieser Blechraupe zu schreien.
Doch das Vakuum war stärker als Lisa und so klammerte sie sich mit weissen Knöcheln an den gummierten Haltegriff. Und obwohl der Reisecar mittlerweile längst mehrere Kilometer zurückgelegt hatte, horchte Lisa doch weiter in die Dunkelheit, versuchte die Stimmen auszublenden und sich auf das Wesentliche zu fokussieren, doch die Reise nahm ihren unvermeidlichen Verlauf.
3.
Hannes starrte in den Lichterschein, der wie ein Fluss unter ihm dahinrauschte. Ein riesiger Farbtrichter, der einen unheimlich starken Sog ausübte. In verschiedenen Klanghöhen schossen die Blechkörper dahin. Der Wind war stark auf der Brücke, er durchdrang die Kleidung – eisig und stechend. Gischt spritzte auf, als ob das Brückengeländer sich gleich einem Wellenbrecher gegen die Übermacht des Ozeans stemmte.
Hannes’ Hände krallten sich in die rauhen Betonsäulen, die sich mit Wasser vollgesogen hatten. Er fragte sich, was er hier oben verloren hatte. Was hatte es für einen Sinn, sich an diese Reling zu klammern, wenn er es doch nicht wagen würde loszulassen.
Schon so oft hatte er hier gestanden und in diese Spirale gestarrt, nur um festzustellen, dass es noch nicht an der Zeit war, sich fallen zu lassen. Er hatte sich selbst einen Feigling, einen Versager gescholten und er fühlte sich allein.
Hannes wünschte sich, dass auch nur eine Person in diesen vielen dahinschiessenden Projektilen auf ihn aufmerksam würde, ihn sähe, seine Not verstände, ihm in irgendeiner Form Trost spendete. Für einen kurzen Moment wärmte ihn dieser Gedanke – eine kleine, blaue Flamme in der Dunkelheit.
Die Gummisohle einer seiner Vintageturnschuhe rutschte über die nasse Kante und Hannes klammerte sich mit den Händen noch stärker an die Brüstung. Es schmerzte, die scharfe Kante der Betonbalustrade schnitt sich unaufhörlich in die Armbeuge.
«Was habe ich hier oben nur verloren? Was tue ich hier eigentlich?»
Fragen kreisten rhythmisch in seinem Kopf.
Dann näherte sich ein grosser Reisecar, hell erleuchtet, das Dach mit quadratischen Aufbauten versehen, die – so vermutete Hannes – irgendwie mit der Klimaanlage in Zusammenhang standen.
Er überlegte, dass, wenn er jetzt springen würde, er auf dem Dach des grossen Gefährts zum Stehen käme wie auf einem Helikopterlandeplatz. Er würde sich an den Aufbauten festklammern und mitgezogen werden durch die nasse, kalte Nacht. Erbarmungslos und ohne Aussicht auf Rettung.
Doch der Buschauffeur hätte sicher den Aufprall gehört, also würde er vorsichtig das Tempo drosseln – langsam, gleichmässig mit einem schreckerfülltem Blick, der immer wieder zur Dachverkleidung hochschweifte. Und so käme das Abenteuer doch noch zu einem guten Ende.
Jetzt war es soweit. Der Reisecar passierte die Brücke und der Luftdruck hätte Hannes beinahe vom Brückengeländer gefegt. Er zitterte, weinte und schrie in die Nacht. Nur der Regen antwortete. Prasselnd trommelte das Unwetter sein Lied auf die Eisenbetonkonstruktion der Bogenbrücke.
Und dann war da plötzlich noch eine andere Stimme, ruhig und sanft.
«Was machen Sie denn da?»
Die Umrisse eines alten Mannes schälten sich aus dem aufsteigenden Nebel.
«Ich hoffe doch, es ist nicht das, wonach es aussieht?»
Hannes drehte sich um die eigene Achse und umklammerte nun die Brüstung wie einen schweren Mehlsack.
Er starrte in die faltigen Augen, die tief unter einem dunkelgrünen Südwester hervorleuchteten.
Der Mann stand da in seiner Regenmontur wie der Kapitän auf der Brücke eines Dreimasters. Er stand da, musterte Hannes, schwieg und wartete.
Hannes überlegte, ob dies ein Zeichen des Himmels war. Er hatte jetzt Publikum erhalten. War dies sein Einsatz? Ein Sprung rückwärts ins Ungewisse unter dem wachsamen Blick dieses Zuschauers. Waren diese alten Augen wirklich das Letzte, was er sehen wollte, bevor sich alle offenen Fragen von selbst klärten, alle Schmerzen verschwanden, alle Sorgen in der Gischt zerstoben? Oder würde es wieder ablaufen wie immer? Er würde über die Brüstung zurückklettern, sein ganzer Körper würde schmerzen wie nach einer starken körperlichen Anstrengung. Seine Lunge würde brennen und seine Hände bluten. Und dann umgäbe ihn wieder die abgestandene Leere seiner Zweizimmerwohnung, wo ihn die Dunkelheit und die Stille umarmte wie ein dröges Gespenst.
Der Alte reckte eine Hand nach vorn, den Zeigefinger ausgestreckt wie in Michelangelos Deckenfresco Die Erschaffung Adams.
Hannes starrte auf die ausgestreckte Hand, dann in die Augen, die von einem Faltenkranz umrankt waren wie ein blühender Rosengarten. Schliesslich kletterte er über das Brückengeländer, zurück auf das sichere Deck. Er begab sich in die Obhut des Kapitäns und harrte der weiteren Folgen.
«Ich will jetzt nicht in meine Wohnung», flüsterte Hannes und der Alte nickte verständisvoll. Vorsichtig legte er seine behandschuhte Hand auf Hannes’ Schulter und sie setzten sich mit langsamen Schritten in Bewegung. Hannes kam es vor, als habe er seit Jahren keinen Fuss mehr vor den anderen gesetzt. Und obwohl er nicht wusste, wohin ihn sein Gegenüber führte, tat es ihm wohl, ein Ziel vor Augen zu haben, auch wenn dieses im Dunkel lag.
Der eisige Nordwind zerrte an ihren Kleidern, als ob er Hannes wieder zurück aufs Vorderdeck schleifen wollte, aber der Alte hielt ihn sicher auf Kurs.
Der Weg führte zwischen schwarzen Rapsfeldern in die Leere der ländlichen Vorstadtlandschaft. Hier gab es keinen Baum, keine Mauer, kein Gebäude, das sie vor den heranstürmenden Regenschauern schützen konnte. Hannes schloss die Augen, um diese unheimliche, erschreckend kraftvolle Endwelt auszusperren, und vertraute auf die führende Hand an seiner Schulter, die mit sanftem Druck eine wärmende Stelle direkt unter seinem linken Schulterblatt erzeugte.
Hannes hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Stunden verdampften zu Sekunden, er konzentrierte sich auf die Schritte – immer ein Fuss vor den anderen.
Als er die Augen wieder aufschlug, waren sie in einem recht anschaulichen Dorfkern angelangt und steuerten ein kleines gelbes Haus an, das von einem Rosengarten umgeben war. Hannes hatte nichts anderes erwartet. Die Augen des Alten hatten das Bild des blühenden Rosengarten vorweggenommen, es in sich getragen, es verwahrt wie in einem Tagebuch.
Das Dorfzentrum war menschenleer. Gedämpftes Licht hinter zugezogenen Tagesvorhängen. Die Regenmassen tanzten mit den Nebelfetzen um einen runden Marktbrunnen. Über ihre Köpfe donnerte ein landendes Flugzeug, in der Ferne erklang eine Polizeisirene.
Fünf steinerne Stufen führten zur hölzernen Eingangstüre hinauf, die von einem gläsernen Vordach mit Jugendstilkonsolen beschirmt wurde. Mit weissen Blütendolden kletterte eine Hortensie an einem Rankgitter empor.
Lautlos schwang die Eingangstüre auf. Der Alte betätigte den Lichtschalter und ein gemütlicher, hell gestalteter Garderobenflur empfing den erschöpften Hannes. Er hatte eine dunkle, miefige, abgestandene Wohngrotte erwartet, vielleicht etwas verstaubt und vollgestellt mit Dingen, deren Sinn und Zweck irgendwann in grauer Vorzeit im Dunkel entschwunden war. Den süsslichen Duft nach Mottenkugeln oder die schwere Note lange ungenutzter Stoffe.
Diese Vorahnung hatte sich nicht bewahrheitet. Hannes liess seinen Blick über den hell geschliffenen Fischgratparkett, die weiss strahlenden Wände und die ausgesucht schönen Nippesfiguren wandern. Er atmete tief ein und eine Leichtigkeit durchflutete seine Lungen, wie er sie schon lange nicht mehr erfahren hatte. Viele gerahmte Fotografien zierten diesen Eingangsbereich, doch ihre Anordnung fügte sich leicht und luftig in das Gesamtbild. Innen- und Aussenwelt schienen in dieser lichten Welt auf natürliche Weise miteinander zu verschmelzen, und wenn Hannes all das, was er sah auf einen Begriff hätte reduzieren müssen, wäre es Liebe gewesen.
4.
Sandra wurde von der Flugbegleiterin bereits zum dritten Mal darauf hingewiesen, dass sie während des anstehenden Landemanövers das Mobiltelefon abzustellen habe.
Genervt versprach sie der Dame im blauen Kostüm, das Handy gleich in der Handtasche zu verstauen. Sie wollte nur noch diese letzte Textnachricht an Joe zu Ende bringen, betreffend der erfolgreich absolvierten Präsentation. Vielleicht ein letztes Emoji – Daumen hoch und Smiley mit Siegerpokal, vielleicht noch schnell die beiden gekreuzten Champagnergläser. Aber die Flugbegleiterin liess nicht locker und blieb mit verschränkten Armen und schmalen Lippen neben Sandra im Mittelgang stehen, bis sie das Gerät nachweislich in den Tiefen ihrer Louis Vuitton-Tasche hatte verschwinden lassen.
Verdriesslich spähte Sandra durch das Flugzeugfenster nach draussen. Regen, Nacht, Kälte, graue endlose Felder. Die Autobahn – ein dahinfliessendes Leuchtband, das die Landschaft zerteilte. Am Horizont die Lichter der Stadt und die parallelperspektivisch verlaufenden Leuchtdioden der Landebahn. Mustergültig wie im Zeichenkurs.
Kurz darauf dröhnten die Räder des Airbus A 220 über die Landebahn 14/32, von wo der grosse Vogel das Dock E ansteuerte. Die Turbinen verstummten, die Gangway wurde angedockt. Sandra stöckelte auf ihren Highheels über das Linoleum zur Gepäckausgabe.
Endlich fand sie wieder Zeit, ihre flinken Finger über die Tastatur ihres Smartphones zur wirbeln. Doch just in dem Moment, als Sandra wieder das Emojimenu aufrufen wollte, schrillte das iPhone – Klingelton Marimba. Es war Joe.
«Hallo? Wie geht es meiner Stardesignerin? Wie lief der Pitch? Ich hab gehört, du hast sie alle mit deinen Ideen vom Hocker gehauen?»
Sandra verzog keine Miene.
«Das war kaum anders zu erwarten. Dass ich wegen dieses Humbugs nach London fliegen musste, war echt überflüssig. Das hätte auch Eleonore oder Conny machen können. Ich bin zu teuer für solche Standards. Das weisst du, Joe.»
«Natürlich weiss ich das, meine Liebe, aber du bist nun einmal die Beste. Und wenn es um einen Millionendeal geht, will ich eben nur die Beste an der Front haben. Da kann ich beruhigt schlafen.»
«Du wirst hoffentlich auch weiterhin gut schlafen können, wenn du meine Provisionsrechnung in die Wege geleitet hast. Du weisst, ich bin nicht Mutter Teresa. Ich will meine Boni.»
«Klar, Sandy, und die wirst du bekommen. Ein Mann, ein Wort. Die ganze Agentur steht hinter dir. Wir sind alle deine Fans.»
«Gut. Und nenn mich nie wieder Sandy.»
Sandra legte ohne ein Abschiedswort auf.
Das grossspurige und selbstherrliche Geklotze Joes stiess Sandra schon länger sauer auf.
Sie schaute auf die Uhr. 23.00 h. Jetzt war es etwas zu spät, um noch ihren Vater in der Vorstadt zu besuchen. Sie würde direkt in ihre Stadtwohnung fahren. Ihr Wagen stand im Airportparking.
Die Koffer drehten immer noch ihre Runden auf der Gepäckförderanlage. Sandra schnappte sich ihre Tasche mit dem ausklappbaren Griff und klackerte weiter zur Tiefgarage. Ihre Füsse schmerzten in den Jimmi Choo’s. Love hiess das Modell. Ihre Zehen empfanden keinerlei Liebe. 700 Franken für 100 mm Stilettos und schmerzende Füsse, aber umwerfend schön waren sie. Und die Kombination mit dem neuen Prada-Dreiteiler war berauschend. Im Vorbeischweben musterte Sandra ihre Silhouette mit einem zufriedenen Lächeln in den Spiegelungen der Schaufenster. Genauso musste das aussehen, dachte sie. Sexy und doch dezent.
Sie hatte die alten Spanner des Londoner Fernsehsenders bei der Präsentation um den Finger gewickelt. Sie hatte alles eingesetzt, ihre ganze Swissness, ihre jahrelange Kompetenz an der Werbefront, ihre unendlich langen Beine. Und am Ende hörte sie den Satz, den sie immer hörte, wenn sie ihre Hausaufgaben gemacht hatte: «Wo sollen wir unterschreiben?» Genau so musste das sein.
Endlich, der Wagen war erreicht. Porsche 911 Carrera S Cabriolet. Bevor sie einstieg, fuhr Sandra sanft über den metallischen Lack des Kotflügels.
Und jetzt nichts wie raus aus diesen Schuhen. Sie schleuderte Tasche und Highheels auf die Rückbank und schnappte sich ihre Nikes. Ein wohliger Schauer breitete sich von den Füssen bis zu ihren Haarspitzen aus. Als sie den Motor startete, knurrten die 450 PS unter der Haube wie ein erwachender Drache. Ja, dachte Sandra, genauso musste sich das anhören.
Als sich Sandra in den Grosstadtverkehr einreihte, zuckten Blitze über den nachtschwarzen Himmel, Donner grollte. Das Handy klingelte, sie schaute auf das Display, Joe, der konnte ihr jetzt gestohlen bleiben. Sie hatte einen anstrengenden Tag hinter sich, hatte der Agentur einen Millionendeal verschafft und jetzt wollte sie einfach in Ruhe gelassen werden. Trotzdem nahm sie nach dem fünften Klingeln den Anruf entgegen.
«Weisst du eigentlich, wie spät es ist, Joe?»
«Ich weiss, Schätzchen, aber mir ist grad noch was eingefallen. Morgen kommt diese unangenehme Tante von der Modefirma wegen der Logoredesigns vorbei.»
«Du meinst Frau Lardier?», knurrte Sandra genervt.
«Genau, genau die. Und die hasst mich irgendwie. Keine Ahnung wieso, sie hasst mich einfach. Ich meine, könntest du vielleicht an die Präsentation … ich meine.»
«Wann?»
«Um 09.00.»
«Ich werde da sein. Und Joe?»
«Ja?»
«Nenn mich nie wieder Schätzchen.»
Sandra hängte auf.
Die schmale Quartierstrasse stieg steil an. Im reichen Vorstadtquartier schälten sich die Villen aus dem Bodennebel. Sie erhoben sich abweisend und kühl über das Lichtermeer der Stadt, thronten wie alte Fürsten an den Hügeln der Goldküste. Langsam rollte Sandra auf ihr Haus zu, betätigte die Fernbedienung zur Tiefgarage und stellte ihren Wagen auf das Parkfeld. Mit einem ploppenden Geräusch schloss das Garagentor. Neonlichter sprangen an.
Mit dem Lift fuhr sie hoch ins Penthouse. Die LED-Spots im Gang und über der Bar flammten automatisch auf, als sie die Eingangstüre durchschritt. Sandra seufzte wohlig, als sie ihre Wohnung betrat. Marmor, Leder, Seide und Single-Malt-Whisky – genauso gehörte sich das.
5.
Bernd sass allein im Atelier und stierte betrübt auf die Leinwand. Ein grosses Format. 2,5 Meter auf 1,95 Meter. Eine chinesisch anmutende Landschaft, pixelartig zerstückelt, von der rechten Seite flossen Blubberblasen ins Bild, ähnlich denen einer Lavalampe. Sie schienen sich virusartig dem malerischen Grundmotiv zu bemächtigen, es zu erdrücken und zu ersticken.
Und genauso fühlte sich Bernd. Seit dem Streit mit Jan hatte er nichts mehr von ihm gehört. Und nun sass er da mit diesem Ungetüm von einem Bild und wusste nicht, ob es was taugte oder ob er damit den Kamin befeuern sollte. Die hohen Räume des alten Fabrikgebäudes waren schwierig zu beheizen. Die ganze Wärme verpuffte in den oberen zwei Metern der Industriehalle. In Bodennähe, wo Bernd kauerte, blieb es kalt. Zumal der Gussbetonboden die Kälte speicherte wie eine Kaltkompresse.
Es war eine Auftragsarbeit, obwohl der Auslieferungstermin nicht klar definiert worden war. Irgend so ein reicher Werber hatte Bernds Bilder in der Galerie gesehen und wollte jetzt eines für seine Stadtvilla. Etwas Grosses, Farbiges, Psychedelisches, wie er sich ausdrückte.
Bernd schüttelte den Kopf.
«Etwas Grosses, Psychedelisches! So eine Scheisse aber auch», schimpfte Bernd ins Leere. Immer diese Kunstbanausen, diese Besserwisser. Die Kunst ging diesen Kapitalzombies doch am Arsch vorbei und doch benötigte Bernd das Geld.
Und jetzt sass er vor diesem Ungetüm und wusste nicht, ob das jetzt das Endresultat war oder nur die Grundierung. Irgendwie schien etwas zu fehlen. Aber was? Jan hätte gewusst, wo die Schwachstelle lag. Jan war Grafiker, kein Künstler. Aber er war näher dran an der Realität, am Markt. Er hätte gewusst, ob diese Allegorie des Schreckens einem versnobten, hochnäsigen, steinreichen Werber zusagen würde oder nicht. Aber nach dem Streit wollte Bernd nicht gleich wieder die Waffen strecken und Jan anrufen.
Worum war es da überhaupt gegangen? Bernd konnte sich nicht entsinnen. Irgendeine alltägliche Banalität, die sich hochgeschaukelt und dann in einem waschechten Disput geendet hatte. Jan hatte die eiserne Ateliertür hinter sich zugeschlagen, dass die Schettdachverglasung nur so gescheppert und Bernd unwillkürlich den Kopf eingezogen hatte.
Und jetzt tropfte der Regen durch eines der Oblichter und Bernd hatte einen Eimer untergestellt.
Das gleichmässige Aufschlagen der Wassertropfen beutelte Bernds Gehirn. Mit jedem Platsch wurde es schlimmer. Als ob die Tropfen Stück für Stück seine Hirnrinde durchdrangen. In Bernds Schläfen hallte jeder Spritzer wie ein Pistolenschuss, es war nicht zum Aushalten.
Bernd fixierte erneut die Leinwand. Die Blubberblasen schienen sich langsam über das Bild zu bewegen und bei jedem Wassertropfen hüpften sie ein klein wenig und bildeten winzige konzentrische Kreise.
«Jetzt reicht es», schimpfte Bernd und beschloss, die Situation mit dem Genuss einer Zigarette zu entschärfen. Er stellte sich unter das Vordach und beobachtete den Regen, der immer grössere Pfützen im Hinterhof des Fabrikareals bildete. Aus der Dachrinne rauschte das Wasser in ein überfliessendes, rostiges Fass.
Plötzlich stand Klaus neben ihm, in der Hand eine Packung Marlboro Gold und ein ziseliertes, silbernes Zippofeuerzeug. Klaus war Bildhauer und ebenfalls Mitglied der Künstlergemeinschaft Engler, die nach der Nähmaschinenfabrikationsfirma benannt war, die einst in den Industriehallen der jetzigen Ateliergemeinschaft untergebracht war. Klaus begrüsste Bernd mit einem Kopfnicken, während er die Zigarette zwischen die Lippen schob und gleichzeitig mit schützender, vorgehaltener Hand über das Reibrad des Feuerzeugs strich. Für Sekundenbruchteile flackerte sein Gesicht im trübem Licht auf, die Augen zu Schlitzen verengt. Dann liess er die Hand sinken und schob das Feuerzeug mit einer ungelenken Bewegung in die Pattentasche seines abgetragenen Sakkos.
«Scheisswetter», meinte Klaus. Bernd nickte.
«Alles ok?», erkundigte sich der Bildhauer und fixierte Bernd mit erhobener Augenbraue.
«Ja, hab mich mit Jan verkracht. Dann ist er abgehauen und war ziemlich sauer.»
Klaus nahm einen langen Zug seiner Marlboro und liess seinen Blick hinaus in den dunklen Hof wandern. Dahinter auf der nassen Fahrbahn der Transitstrasse glitt ein Sportwagen vorüber. Er krallte sich an den teerigen Strassenbelag wie ein geduckter Schatten.
«Ja, Jan kann manchmal schon ein bisschen schwierig sein. Da muss man aufpassen.»
Bernd musterte Klaus erstaunt: «Wieso das denn? Ich mein, kennst du Jan überhaupt? Ich meine nicht nur vom Atelier, sondern so richtig? Ich kenne Jan schon seit dem Kindergarten und als schwierig würde ich ihn nicht bezeichnen.»
Klaus schnippte unbeteiligt seine Kippe ins dunkle Nass und drehte sich auf dem Absatz: «Na, wenn du meinst, dann ist ja alles im Lot.»
Bernd brauste auf: «Nein, gar nichts ist im Lot. Wenn sich alte Freunde streiten ist das echt zum Kotzen. Und das Verrückteste daran ist, ich hab keine Ahnung mehr, worum es da ging, dabei war ich nicht mal betrunken.»
Klaus verzog seinen Mund zu einer nachdenklichen Schnute: «Hast du ihn zu deinem Monsterbild befragt?» Bernd versuchte sich zu erinnern, aber irgendwie wollte sich keine klare Erinnerung einstellen, jeder Gedanke versank im Unscharfen.
«Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Sag mal, Klaus, was hältst eigentlich du von meinem Bild?»
Klaus lehnte sich an das gusseiserne Geländer und strich mit dem Mittelfinger darüber, als ob er einen Kaugummi abkratzen wolle, dann fuhr er sich durch den wirren Haarschopf.
«Phuu, da fragst du den Falschen. Ich bin Bildhauer, Mann, kein Kunstmaler.»
«Das ist mir egal. Du wirst doch eine Meinung dazu haben.»
«Okaay», Klaus zog das Wort in die Länge, als ob es aus unzählig vielen Vokalen bestehen würde: «Ich glaube, es ist überinszeniert.»
Bernd horchte verärgert auf: «Wie jetzt, überinszeniert? Was zur Hölle willst du damit sagen?»
«Na überinszeniert, artifiziell, too much. Das Teil ist überfüllt, da passiert so viel auf dem Bild, dass es vom Wesentlichen ablenkt.» Bernds Interesse war geweckt: «Und was ist das Wesentliche?»
Klaus schnippte mit den Fingern, als ob er eine Falle zuschnappen lassen wollte: «Siehst du, das ist genau das, was ich meine. Du hast das riesige Ungetüm gemalt und hast keine Ahnung, was du damit sagen willst. Da malst du irgend so eine chinesische Landschaft, weil dir normale Landschaftsbilder zu bieder sind. Und dann denkst du: Ok, dann nehm ich eben so eine asiatische Landschaft statt der Lüneburger Heide. Und dann merkst du, dass das dann nach Touristenkunst aussieht, also verpixelst du das Ganze, das wirkt dann aber immer noch irgendwie so inhaltslos, leer und öde. Aber dein Auftraggeber wollte ja was Psychedelisches, Farbiges, Modernes. Also spachtelst du diese Lavalampenblubberblasen drüber, und weil eine Blubberblase allein noch keinen Frühling macht, kleckerst du eine zweite dazu und eine dritte und irgendwann ist es dann eben zu viel. Eben überinszeniert.»
Bernd war sprachlos. Noch nie hatte er Klaus mehr als vier Wörter aneinanderreihen gehört, und jetzt das.
Er warf einen Blick durch das Fenster in sein Atelier, auf die riesige Leinwand, die plötzlich abgestanden und matt wirkte, sein Blick schweifte weiter zum Blecheimer, wo das Wasser überlief und sich auf den Boden ergoss.
«Weisst du was, Klaus? Ich glaube, das hat Jan auch gesagt. Und dann hab ich ihn rausgeworfen.»
6.
Als der alte Escort auf den Parkplatz einbog, überlegte sich Jan, wie er mit den bevorstehenden Ereignissen verfahren sollte. Welche Erwartungen trug Bea in sich? Sie hatte Jan angeboten, ihn nach der erfolgreich absolvierten Kennenlernrunde in der Bar nach Hause zu fahren – obgleich Jan ziemlich weit draussen wohnte. Bea hatte sich durch die Fluten des Sturms über die Autobahn gekämpft, mit sichtlicher Anstrengung, nur um ihn, Jan, bis zu seiner Wohnung im seelenlosen Vorort zu chauffieren. Daraus resultierte wahrscheinlich eine gewisse Erwartungshaltung. Doch wie diese im Detail auszusehen hatte und ob sie überhaupt existierte, darauf wusste Jan keine Antwort. Wäre eine Einladung zu einem Getränk in den eigenen vier Wänden angemessen? Das Angebot, die anstrengende Rückfahrt zu umgehen durch eine zwanglose Übernachtung im Gästezimmer? Oder war unter den gegebenen Umständen gar Sex angemessen? Mit anschliessendem Frühstück – 5-Minuten-Eier und Croissants?
Er versuchte, die verschiedenen Lösungsszenarien gegeneinander abzuwägen, doch angesichts der Zeitnot war eine saubere Planung kaum möglich. Jan starrte erneut auf Beas stämmige Oberschenkel und versuchte, sie sich nackt vorzustellen. Eigentlich hatte er keine Lust, mit Bea zu schlafen. Diese Tatsache stand jedoch in keiner Weise in Zusammenhang mit ihrer Figur. Es fehlte das gewisse Etwas, ein Beben tief in der Magengrube, ein Kribbeln, das sich von den Zehen langsam über den gesamten Körper ausbreitete. Jan horchte noch einmal in sich hinein, aber er nahm nicht die geringste Erschütterung wahr. Sein Körper war im Standbymodus eingeschlafen – ein kleines rotes Licht im Dunkeln – nicht gewillt, aufzuwachen und aktiv zu werden.
Jan überlegte, ob es verwerflich wäre, mit Bea zu schlafen, nur um ihre Erwartungen zu erfüllen, beschloss aber, in dieser Sache eine klare Linie zu fahren. Wenn keine offensichtliche Lust für Beischlaf bestand, dann wäre es sicher besser, es bleiben zu lassen, denn aus einem aufgesetzten Liebesversprechen erwuchsen meist langwierige Komplikationen mit ermüdenden Ausreden und einem Rattenschwanz von Lügen. Eine solche Lawine wollte Jan nicht lostreten und beschloss, Bea reinen Wein einzuschenken.
Bea parkte den Wagen rückwärts ein. Das klappte nicht beim ersten Versuch. Sie rangierte drei Mal vor- und zurück. Jan fragte sich, ob dies beabsichtigt war, da sich Bea möglicherweise mit den gleichen Gedanken wie er trug und Zeit gewinnen wollte, um sich darüber klar zu werden, was sie selbst wollte und ob sich diese Vorstellungen eventuell mit denen von Jan deckten.
Schliesslich stand der Escort halbwegs parallel zu den weissen Parkstreifen. Bea stellte den Motor ab, liess aber den Schlüssel stecken. Dann legte sie die Hände auf ihre Oberschenkel und starrte durch die Windschutzscheibe, auf welcher der Regen in langen Rinnsalen Streifen zog. Der warme Motor knackte unter der Haube. Bea räusperte sich. Jan rückte ein Stück zurück in seinem Schalensitz, was ein knarzendes Geräusch erzeugte.
Bea drehte unsicher den Kopf und musterte Jan: «So, da wären wir.»
Jan nickte, presste die Lippen zusammen und wischte mit den Händen über seine Hose, als ob er Ölflecken entfernen wollte: «Ja, da sind wir. Vielen Dank.»
«Klar doch», Bea lächelte und fing an mit dem Schlüsselanhänger zu spielen, der vom Zündschloss baumelte.
Der Regen trommelte gleichmässig aufs Wagendach.
Jan beschloss, etwas Nettes, aber Abschliessendes zu sagen. Seine Worte hallten viel zu laut im blechernen Raum: «Das war schön, vielleicht gehen wir wieder mal was zusammen trinken?»
Bea nickte. Jan versuchte, aus ihrem Gesichtsausdruck Hinweise auf ihren Gemütszustand und die damit verbundenen Erwartungen abzuleiten. War da Enttäuschung, Zweifel oder Erleichterung zu lesen? Ihre Blicke trafen sich, aber Jan konnte keine hilfreiche Mimik in Beas Gesicht erkennen. Keinen Hinweis darauf, wie die Konversation ohne Kollateralschaden weiterzuführen wäre.
Er dachte an Bernd und überlegte, wieso dieser so wütend geworden war, als er einige Kritikpunkte zu seinem raumfüllenden Gemälde geäussert hatte.
Wahrscheinlich war Bernd in einer schwierigen Neuorientierungsphase. Er hatte das schon öfter bei ihm erlebt. Immer wenn sich wieder ein neuer, gestalterischer Weg am Horizont abzeichnete, dieser aber noch schwammig war, blieb Bernd im Treibsand stecken. Er strampelte und ruderte, schwitzte und kämpfte, bis sich der neue Schaffenszyklus zu erkennen gab und Konturen bekam. Aber diese Übergangsphase war für seinen Freund wie ein Drogenentzug, verbunden mit aufwühlenden Innensichten und zerstörerischen Entscheidungen. Wenn dann





























