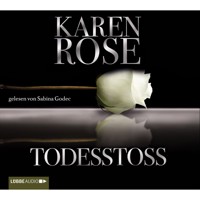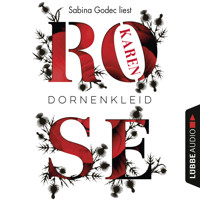Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dornen-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der vierte Band der Dornen-Reihe von Karen Rose! Nach dem Spiegel-Bestseller "Dornenspiel" widmet sich die US-amerikanische Autorin im Thriller "Dornenherz" erneut finstersten seelischen Abgründen und Obsessionen. Meredith Fallon betreut Opfer von sexuellem Missbrauch und hilft ihnen, wieder einen Platz in der Welt zu finden. Als ein Mord-Anschlag auf sie verübt wird, dem sie nur knapp entkommt, scheinen die Zusammenhänge klar: Bei ihrer Arbeit muss sie sich jemandes abgrundtiefen Hass zugezogen haben. Detective Adam Kimble vom Cincinnati Police Department, der ein Auge auf Meredith geworfen hat, unternimmt alles, um sie zu schützen. Doch Meredith ist nicht die Einzige, die der Killer im Visier hat ... Die explosive Thriller-Reihe (mit Schauplatz Cincinnati, Ohio) von Karen Rose im Überblick: Band 1: "Dornenmädchen" (im Mittelpunkt: FBI-Agent Deacon Novak und Faith Corcoran) Band 2: "Dornenkleid" (im Mittelpunkt: Marcus O'Bannion und Detective Scarlett Bishop) Band 3: "Dornenspiel" (im Mittelpunkt: Agents Griffin "Decker" Davenport und Kate Coppola) Band 4: "Dornenherz" (im Mittelpunkt: Detective Adam Kimble und Meredith Fallon)
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:7 Std. 24 min
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Karen Rose
Dornenherz
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die Psychologin Meredith Fallon betreut Opfer von sexuellem Missbrauch und hilft ihnen, wieder einen Platz in der Welt zu finden. Als ein Mordanschlag auf sie verübt wird, dem sie nur knapp entkommt, scheinen die Zusammenhänge klar: Bei ihrer Arbeit muss sie sich jemandes abgrundtiefen Hass zugezogen haben. Detective Adam Kimble vom Cincinnati Police Department, der ein Auge auf Meredith geworfen hat, unternimmt alles, um sie zu schützen. Doch Meredith ist nicht die Einzige, die der Killer im Visier hat …
Inhaltsübersicht
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
Epilog
Dank
Karen Rose bei Knaur
Eine Liste aller Karen-Rose-Romane in chronologischer Reihenfolge:
Verzeichnis der auftretenden Figuren in den Romanen von Karen Rose
Für meine Leser.
Ich danke euch dafür, dass ich durch euch in meinem Traumjob arbeiten darf und ihr meine Figuren so sehr liebt wie ich.
Und wie immer – für Martin.
Prolog
Cincinnati, Ohio
Freitag, 18. Dezember, 23.15 Uhr
Andy schreckte aus dem Schlaf hoch und riss die Augen auf. Sein eigenes Zittern hatte ihn geweckt. Kalt. Es war so verdammt kalt. Dann beweg dich, verdammt. Los, bring deinen Kreislauf …
Dann kam die Erinnerung – und mit ihr lähmende Panik.
Er konnte sich nicht bewegen. Jemand hatte ihn gefesselt und einfach hier liegen gelassen. Wo auch immer dieses hier sein mochte.
Schrei, verdammt! Ruf um Hilfe! Er holte tief Luft. Seine Lunge brannte wie Feuer, und er wurde von einem heiseren Husten geschüttelt.
Es fiel ihm wieder ein. Nein. Nicht schreien. Sein Kopf schmerzte noch vom letzten Versuch. Er war schon einmal zu sich gekommen und hatte es probiert. Wie lange war das her? Es war dunkel gewesen. So wie jetzt.
Der Mann, ganz in Schwarz gekleidet, war aufgetaucht. Natürlich. Die Bösen trugen doch immer Schwarz, richtig?
Und der Mann gehörte zu den Bösen. Andy hatte um Hilfe gerufen, nach irgendjemandem. Aber der Mann in Schwarz hatte ihm einen so brutalen Tritt gegen den Kopf verpasst, dass er Sterne gesehen hatte. Danach hatte er lieber den Mund gehalten.
Doch nicht der Schlag hatte ihn das Bewusstsein verlieren lassen. Nein. Er schluckte mühsam. Seine Angst war so übermächtig, dass er fast keine Luft mehr bekam. Seine Brust fühlte sich an, als wäre sie mit Eis gefüllt. Der Kerl hatte ihm einen stinkenden Lappen aufs Gesicht gelegt. Andy hatte versucht, nicht zu atmen, doch dann hatte der Kerl zu einem weiteren Schlag ausgeholt, diesmal in den Magen, und Andy hatte nach Luft geschnappt und damit unwillkürlich eingeatmet, womit der Lappen getränkt war.
So war es auch am Hinterausgang der Imbissstube geschehen.
Ja, genau! Jetzt erinnerte er sich wieder. Hinter dem Pies & Fries. Er hatte gerade Rauchpause gemacht. Jemand hatte ihm aufgelauert. Es war schon dunkel gewesen, deshalb hatte Andy ihn erst gesehen, als er seine Zigarette anzündete, weder ein Gesicht noch eine Gestalt, sondern bloß einen Schatten am Rand seines Gesichtsfelds.
Wer sind die? Was wollen die von mir? Und wieso? Er hatte keine Feinde. Nicht mehr. Und nicht hier.
Er hatte doch noch mal ganz von vorn angefangen.
Und jetzt würde er hier verrecken. Wo auch immer das »hier« sein mag, dachte er bitter.
Ich verpasse meine Abschlussprüfungen, und dabei hatte ich lauter Einsen. Sogar in englischer Literatur. Dafür hatte er sich so ins Zeug gelegt.
Aber das spielte jetzt keine Rolle mehr. Nichts von alldem.
Ich muss hier raus. Bevor der Typ zurückkommt. Wer auch immer er sein mag.
Ich muss hier raus. Linnie finden. Ich hab ihr nie gesagt, dass ich sie liebe. Aber ich muss es unbedingt tun. Und dass ich es nicht so gemeint habe. Nichts davon. Sie hatten sich gestritten, und er hatte ihr schreckliche Dinge an den Kopf geworfen. Und jetzt glaubte sie, dass das alles ernst gemeint war. Sie glaubte, er würde abhauen, sie hängen lassen, so wie alle anderen Menschen in ihrem Leben. Wie all die anderen Menschen in seinem Leben.
Ich habe einen Fehler gemacht. Es konnte nicht sie gewesen sein, die er an jenem Tag gesehen hatte. Mit einem anderen Mann. Sie hatte es so vehement abgestritten, als er ihr seine Vorwürfe entgegengeschleudert hatte. Seine Wut. Seine Kränkung. Sie war in Tränen ausgebrochen, hatte es immer noch abgestritten. Dann war sie weggelaufen. Und er hatte es zugelassen.
Aber dann, nachdem er sich ein wenig beruhigt hatte, war ihm klar geworden, dass er ihr glaubte. Ich glaube dir. Aber auch das hatte er ihr nicht gesagt. Noch nicht. Und wenn ich nicht bald hier rauskomme, werde ich es ihr überhaupt nicht mehr sagen können.
Er zerrte an seinen Fesseln, erreichte jedoch nur, dass sich die Seile noch tiefer in seine Haut gruben. Er sank auf den kalten Beton und hatte Mühe, den Schluchzer zu unterdrücken, der ihn von innen heraus zu zerreißen drohte und schließlich als klägliches Wimmern über seine Lippen drang.
Sei ein Mann, verdammt noch mal! Tu was. Sieh zu, dass du hier rauskommst!
Aber es war sinnlos. Ich werde hier drinnen sterben.
Auf keinen Fall. Dafür hast du schon viel zu viel geschafft, zu erbittert gekämpft.
Völlig umsonst. Ich werde hier drinnen sterben.
Er fror so entsetzlich, spürte den eiskalten Beton durch seinen dünnen Pulli und die Socken. Seinen Parka und die Schuhe hatten sie ihm weggenommen. Beide waren nagelneu gewesen. Na ja, er hatte sie letzte Woche erst im Secondhand-Laden gekauft; nachdem er die Semestergebühren bezahlt hatte, war gerade noch genug für ein paar Winterklamotten übrig gewesen. Von den Sachen des letzten Jahres passte ihm nichts mehr.
Weil ich endlich gewachsen bin. Jahrelang hatte er darauf gewartet, groß genug zu sein, um sich wehren zu können. Und jetzt drückt mir so ein Arschloch einen Lappen ins Gesicht, und ich bin erst mal völlig k. o.
Aber wer? Wer würde so was tun? Wer, verdammt noch mal? Ein Raubüberfall war es jedenfalls nicht. Er hatte gerade mal zwanzig Mäuse in der Tasche gehabt – sein Trinkgeld vom Abendgeschäft, und sein gesamtes restliches Geld, hundertzweiundvierzig Dollar und sechs Cents, lag sicher auf seinem Konto.
Niemand, der auch nur halbwegs klar im Kopf war, würde ihn ausrauben, und die einzige Person, die ihn hasste wie die Pest, saß im Knast.
Dieses kranke Miststück saß doch noch ein, oder? Neuerliche Panik wallte in ihm auf. Der Richter hatte sie zu fünfzehn Jahren verknackt, von denen gerade einmal drei vorbei waren.
O Gott. Wenn sie rauskommt, bin ich tot. Andy begann zu hyperventilieren. Aber die Cops hätten ihn doch gewarnt, oder?
Nein, du Genie, weil sie keine Ahnung haben, wo du steckst. Du bist abgehauen, schon vergessen? Hast deinen Namen geändert. Und keine Nachsendeadresse hinterlassen.
Shane und Linnie waren die Einzigen, die wussten, wo er sich aufhielt. Linnie … bestimmt wollte sie ihn nie wiedersehen. Er schloss die Augen. Was ich gesagt habe … tut mir so leid.
Natürlich würde Shane zu Hilfe eilen, wenn Andy sich bei ihm meldete, aber Andy hatte ihn nie zurückgerufen, nachdem sich ihre Wege getrennt hatten. Weil ich ganz von vorn anfangen wollte.
Genauso wie Shane. Shane hatte nie Schiss vor etwas.
Eine Träne löste sich aus Andys Augenwinkel und lief ihm übers Gesicht. Ich werde den morgigen Tag nicht erleben.
Zumindest nicht, wenn sie ihn weiter hier hocken ließen. Er würde erfrieren.
Tu etwas. Sei ein Mann, verdammt noch mal! Lass dir etwas einfallen, wie du diese Seile durchschneiden kannst, bevor der Typ zurückkommt und dir den Lappen noch mal aufs Gesicht drückt.
Sieh zu, dass du freikommst, damit du Linnie suchen und es ihr sagen kannst.
Auf dem Boden lag nichts Brauchbares herum, nichts Metallisches mit einer scharfen Kante. Auch nichts aus Plastik, noch nicht einmal ein Stein oder so etwas. Rein gar nichts.
Bloß Betonboden und Wände aus grob gezimmertem Holz. Jemand hatte aus Planken eine Hütte zusammengebaut; es gab weder Mörtel noch Glasfasern noch sonst etwas in den Ritzen, das die Kälte abgehalten hätte. Damit stand fest, dass es nur noch schlimmer werden konnte.
Das Knacken eines Zweigs ließ ihn erstarren. Jemand kam.
Hilfe, vielleicht? Vielleicht ist jemand hier, der mich nach Hause bringen kann.
Doch dann ging die Tür auf, und der Mut verließ ihn. Es war wieder der schwarz gekleidete Mann. Wortlos zog er ihn hoch und schwang ihn sich im Gamstragegriff über die Schulter.
Ein stechender Schmerz fuhr ihm durch den Schädel, und sein restlicher Körper war schon ganz taub vor Kälte. Er sah die von dünnem, zwei Tage altem Schnee bedeckte Rasenfläche, als der Mann ihn durch einen Garten trug und schließlich eine Tür öffnete.
O mein Gott. Warm. So warm. Seine Füße begannen heftig zu prickeln, als sein Blut wieder zu zirkulieren begann. Wieder drang ein Wimmern aus seinem Mund.
»Leg ihn da rüber«, befahl eine leise Stimme. Ein Mann. Älter. Und so drohend, dass Andy erschauderte.
Erneut durchzuckte ihn der Schmerz, als der schwarz gekleidete Typ ihn mit dem Gesicht voran auf ein Sofa fallen ließ. Es war alt. Staubig.
In diesem Moment ertönte eine weitere Stimme. Sie gehörte einer jungen Frau und kam ihm bekannt vor. O Gott. Er kannte sie. »Warum?«, fragte sie, und er hörte den körperlichen Schmerz in den beiden Silben. »Warum er? Er hatte doch gar nichts damit zu tun.«
»Weil ich ihn brauche«, antwortete der Mann. »Setz ihn aufrecht hin.«
Der Mann in Schwarz zerrte Andy am Kragen seines dünnen Pullis hoch. Andy sah sich um. Er befand sich in einem mit altem schäbigem Mobiliar ausgestatteten Büro. Eine Werkstatt? Es roch nach Öl.
Andy starrte den Kerl in Schwarz im trüben Schein einer einzelnen Lampe an.
Er war … keine Ahnung. Andy hatte ihn noch nie gesehen. Er war nicht alt, aber auch nicht jung. Vierzig? Oder fünfzig? Schwer zu sagen bei diesem Licht. Er schien sehr groß und kräftig zu sein; der gestärkte weiße Stoff seines Hemds spannte sich um seinen Bizeps.
Andy kannte den Typ nicht, und er war auch niemand, dem er über den Weg laufen wollte.
Die Frau dagegen … O Gott, Linnie. Sie hingegen wusste genau, wer er war. Das verriet ihr bleiches, beängstigend schmales Gesicht klar und deutlich. Ihr verschwollenes, von Hämatomen übersätes Gesicht.
»Linnie?«, krächzte Andy. Dieser Mann war gefährlich. Und er hatte sie beide in seiner Gewalt.
Vielleicht ist das alles ein Missverständnis. Ein schreckliches Missverständnis. Vielleicht hatte er es ja auf jemand ganz anderen abgesehen.
Aber dann schüttelte Linnie den Kopf, wollte ihm nicht in die Augen sehen. »Es tut mir leid«, flüsterte sie. »Es tut mir so leid, Andy.«
Also war es doch kein Missverständnis. Der Mann hatte niemand anderen in seine Gewalt bringen wollen, sondern es zumindest auf Linnie abgesehen.
Das muss er sein. Andy hatte sie gemeinsam ein Motelzimmer betreten sehen. Sie beide … zusammen. »Wer sind Sie?« Seine Stimme klang brüchig, kläglich. »Was wollen Sie?«
»Sie, Mr Gold. Genauer gesagt, Ihre Dienste«, sagte der Mann.
»Meine Dienste?«, wiederholte Andy verständnislos. »Was für Dienste? Du lieber Gott, ich bin Kellner! Und ich studiere englische Literatur im Hauptfach. Sie müssen mich mit jemandem verwechseln.«
Der Mann wandte sich Linnie zu. »Er weiß es nicht, stimmt’s, Linnea?« Andy spürte, wie sich ihm vor Angst der Magen umdrehte. Linnie wusste also, weshalb man ihn geschnappt und entführt hatte.
Linnie schloss die Augen. »Nein«, flüsterte sie. »Er glaubt, wir wären ein Paar.«
Der Mann stieß ein schnaubendes Lachen aus. »Ein Paar? Dass ich nicht lache. Los, sag ihm die Wahrheit.«
Linnie schüttelte den Kopf. Sie sank auf ihrem Stuhl zusammen und wandte ihr geschundenes Gesicht ab.
Andy packte die kalte Wut. »Sie haben sie geschlagen? Sie?«
»Ich habe ihr die Seele aus dem Leib geprügelt«, erwiderte der Mann mit einem grausamen Lächeln, holte aus und verpasste ihr mit dem Handrücken einen weiteren Schlag, der sie vor Schmerz aufheulen ließ. Es klang wie das Jaulen eines Hundes. »Los, sag es ihm, Linnie«, befahl er höhnisch.
»Linnie?«, krächzte Andy, während er seinen Herzschlag in den Ohren rauschen hörte. »Mir was sagen? Wer ist der Typ?«
»Sag es ihm«, befahl der Mann noch einmal. »Er soll wissen, wieso er hier ist. Das hat er verdient.«
Andy spürte bittere Galle in seiner Kehle aufsteigen. Die Angst fühlte sich wie ein Klumpen ranzigen Fetts in seinem Magen an. »Bitte, Linnie?«
»Er ist mein … Zuhälter.« Sie spie das Wort förmlich aus.
Andy blieb der Mund offen stehen, doch kein Wort drang über seine Lippen. Ihr Zuhälter? Linnie war eine Prostituierte? Das konnte unmöglich sein. Hätte sie Geld gebraucht, wäre sie doch zu mir gekommen, hätte es mir gesagt. Oder etwa nicht?
Er liebte sie. Seit Jahren. Eines Tages würden sie heiraten. Weil er irgendwann den Mut aufbringen würde, ihr seine Gefühle zu gestehen. Irgendwann. Er hätte es getan.
Ich hätte ihr sagen müssen, dass ich sie liebe. Seine Augen brannten. Denn es war auch jetzt noch die Wahrheit.
Unverbrämte Bosheit lag in dem Lächeln des Mannes. »Und?«, höhnte er. »Wem gehörst du nun, Linnea?«
Ein Schluchzen stieg in ihrer Kehle auf. »Dir.«
»Genau. Du gehörst mir.« Der Mann stieß sie weg, als wäre sie Abfall. »Du gehörst mir. Und vergiss das gefälligst nicht, Miststück. Niemals«, knurrte er. »Machen Sie den Mund zu, Mr Gold. Das sieht höchst unattraktiv aus.«
Unattraktiv. Das Wort hing in der Luft, zwischen ihnen. Vibrierte wie eine Gitarrensaite. Unattraktiv? Andy schluckte hörbar. »Ich mache da nicht mit«, stieß er verzweifelt hervor. »Ich werde nichts tun, um attraktiv zu sein. Ich werde mich nicht verkaufen.«
Der Mann musterte ihn einen Moment lang, dann warf er den Kopf in den Nacken und lachte. »Du glaubst, ich will dich verkaufen? Das ist echt gut, Junge. Nein, du wirst nicht anschaffen, sondern du wirst töten.«
Entsetzt wich Andy zurück. »Nein. Das mache ich nicht.«
»Oh, doch, das wirst du.« Der Mann strich Linnie eine Haarsträhne aus dem Gesicht – eine fast zärtliche Geste, stünde ihm die Verachtung nicht ins Gesicht geschrieben. »Denn wenn du es nicht tust, jage ich ihr eine Kugel in den Kopf.« Er tippte ihr gegen die Stirn. »Und zwar genau hier.«
Nein. Nein … Nein. Andy stockte der Atem, als Linnie einen kläglichen Schrei ausstieß. »Nein«, stöhnte sie. »Bitte. Ich tue es. Lass es mich an seiner Stelle tun.«
Wieder schlug der Mann ihr ins Gesicht. »Halt’s Maul!«, schnauzte er sie an. »Er wird es tun!«
Andys Lunge schien sich aus ihrer Erstarrung zu lösen, und er schnappte nach Luft, zu schnell, zu scharf. »Das können Sie nicht machen. Sie können sie nicht töten. Das … Das können Sie nicht!«
Der Mund des Mannes verzog sich zu einem Lächeln, bei dessen Anblick Andy neuerlich eiskalt wurde. »Los, nimm sie«, befahl er dem Kerl in Schwarz. »Zeig ihm, wozu wir fähig sind.«
»Nein«, stöhnte Linnie. »Bitte, nicht.«
Der Schwarzgekleidete warf sich Linnie über die Schulter, so wie er es zuvor mit Andy getan hatte, und trug sie hinaus. Augenblicke später drangen Linnies Schreie herein – entsetzliche Schreie. Er tat ihr weh. Der Schwarzgekleidete tat ihr weh.
Und Andy konnte ihn nicht daran hindern.
Er schloss die Augen, um das Grinsen des Kerls vor ihm nicht länger sehen zu müssen. Ihr Zuhälter. Der Typ war ihr Zuhälter. Sie hatte versprochen, es nicht zu tun. Sie hatte es versprochen. Damals, in der Pflegefamilie, hatten sie einen Pakt geschlossen – er, Linnie und Shane. Sie hatten sich gegenseitig das Versprechen gegeben, niemals ihren Körper zu verkaufen, selbst wenn es noch so schwierig werden würde. Sie hatte es versprochen.
Aber es war eine Lüge gewesen. Andy konnte nicht sagen, was ihn mehr schmerzte – die Tatsache, dass sie ihren Schwur gebrochen hatte, oder dass sie verzweifelt genug gewesen sein musste, sich nicht daran zu halten. Oder dass sie sich mir nicht anvertraut hat.
Der Mann zündete sich eine Zigarette an und nahm einen tiefen Zug, ehe er den Rauch ausstieß, der in einer dünnen Säule aufstieg. »Also, Andy, nein, Mr Gold – wie hätten Sie’s denn gern? Wollen Sie noch mehr? Mein Partner kann dafür sorgen, dass sie noch eine halbe Ewigkeit weiterschreit. Oder kann ich darauf zählen, dass Sie Ihrer kleinen Freundin das Leben retten?«
Andy schlug die Augen auf und zwang sich, den Mann anzusehen, der ihrer beider Leben mit dieser beiläufigen Gleichgültigkeit in seiner Hand hielt. Der Kerl lauschte mit schief gelegtem Kopf Linnies Schreien.
»Also, Mr Gold? Raus mit der Sprache. Meine Geduld lässt allmählich nach.«
Andy biss die Zähne aufeinander. »Was soll ich tun?«, stieß er hervor.
1. Kapitel
Cincinnati, Ohio
Samstag, 19. Dezember, 15.30 Uhr
»Bist du sicher, dass das Kleid einigermaßen gut aussieht, Mer?«
Mit einem gutmütigen Seufzer wandte sich Dr. Meredith Fallon der jungen Frau zu. »Es sieht fantastisch aus, Mallory. Du siehst fantastisch aus. Sehr schick. Keiner wird dich für etwas anderes halten als für eine Achtzehnjährige, die sich soeben für ihre Kurse eingeschrieben hat.«
Aber das war nicht das einzig Bemerkenswerte an Mallory Martin, die heute zum ersten Mal die Zufluchtsstätte für Gewaltopfer verlassen hatte, wo sie während der letzten vier Monate versucht hatte, das Erlebte zu verarbeiten und ihre Wunden zu heilen – was an sich schon eine enorme Leistung war. Dabei hatte der Heilungsprozess erst begonnen. In den zehn Jahren ihrer Arbeit als Kinder- und Jugendpsychologin war Meredith kaum ein Opfer begegnet, das mehr durchgemacht hatte als Mallory – und kaum eines, das so mutig war wie sie.
»Das stimmt, aber sie gehen aufs College, ich dagegen nur …« Mallory wandte den Kopf ab. »Verdammt.«
»Du nimmst dein Leben in die Hand. Habe ich dir eigentlich schon gesagt, wie verdammt tapfer du bist?«
»Zweimal. Und zwar allein heute.« Sie lächelte flüchtig, ehe sie verlegen das Gesicht verzog. »Ich weiß, es ist blöd von mir … zu versuchen, dir ein Lob abzuluchsen, meine ich. Entschuldige.«
Diesmal war Merediths Seufzer nicht mehr ganz so geduldig. »Was haben wir über dieses Wort gesagt?«
»›Blöd‹?«
»Ja, das auch. Aber eigentlich geht es mir um das ›Entschuldigung‹. Streich sie sofort aus deinem Vokabular, alle beide.«
Mallory holte Luft und nickte knapp, aber entschlossen. »Eliminiert.«
»Gut. Los, legen wir einen Zahn zu. Es ist nicht mehr weit bis zum Café, und mir frieren bald die Zehen ab.«
Sie würden ein bisschen feiern. Mallory hatte sich für mehrere Volkshochschulkurse eingetragen – ein erster Schritt in Richtung Highschool-Abschluss, den ihr das Monster verwehrt hatte, das sie sechs lange Jahre gefangen gehalten hatte.
»Vielleicht hättest du gefütterte Stiefel anziehen sollen«, zog Mallory sie auf. »Und welche ohne diese Wahnsinnsabsätze.«
Meredith betrachtete ihre nagelneuen kniehohen Wildlederstiefel und musste lächeln – Mallory belehrte sie. Eigentlich eine Kleinigkeit, aber so herrlich normal. Das Mädchen hatte sich zu einer ihrer erklärten Lieblingspatientinnen entwickelt. »Aber die sind eben schöner. Außerdem waren sie heruntergesetzt.«
Mit liebevoller Nachsicht schüttelte Mallory den Kopf. »Und natürlich musstest du sie haben. Damit sich die vielen anderen Stiletto-Wildlederstiefel in deinem Schuhschrank nicht gar so einsam fühlen.«
Merediths Lächeln verblasste. Nicht etwa wegen der Kritik, denn a) lag auf der Hand, dass Mallory sie nur necken wollte, und b) zogen ihre Freundinnen sie ohnehin ständig wegen ihres überquellenden Schuhschranks auf.
Nein. Sondern weil Meredith sie tatsächlich hatte kaufen müssen. Nicht zwingend diese Stiefel, aber sie hatte das dringende Bedürfnis gehabt, sich irgendetwas zu gönnen. Sie hatte sich damit ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk gemacht, weil nichts darauf hindeutete, dass sie das Geschenk bekommen würde, nach dem sie sich in Wahrheit sehnte. Im Sommer hatte es den Anschein gehabt, als würde es vielleicht klappen – dass sie außer ihrer Familie das erste Mal jemanden an ihrer Seite hätte, an den sie sich über die Feiertage kuscheln könnte.
Wie albern von ihr, sich solche Hoffnungen zu machen. Ihre gemeinsame Zeit mit Adam Kimble war kostbar und knapp gewesen – und ihm hatte sie ganz offensichtlich nicht genauso viel bedeutet wie er ihr. Der Fall, der sie zusammengeführt hatte, war mittlerweile gelöst und Adam von der Bildfläche verschwunden. Wieder einmal.
Was angesichts ihres gemeinsamen Freundeskreises einiges an Talent und Planung erforderte. In den letzten vier Monaten hatte es mehr als genug Gelegenheiten gegeben, sich rein zufällig über den Weg zu laufen. Aber da es nie dazu gekommen war, musste sie davon ausgehen, dass er ihr bewusst aus dem Weg ging. Das tat weh. Sehr.
Allerdings hatte er sie nicht konsequent gemieden. Sie dachte an die Umschläge, die sie alle paar Wochen in ihrem Briefkasten gefunden hatte. Ohne Absender.
Aber von wem die aus Malbüchern herausgerissenen, mit Buntstiften oder farbigen Kugelschreibern ausgemalten Seiten stammten, lag auf der Hand. Sie waren alle mit größter Sorgfalt angefertigt worden, ohne auch nur einen Strich über die Linien hinaus. Detective Adam Kimble schien stets darauf bedacht zu sein, innerhalb der vorgezeichneten Grenzen zu bleiben.
Die ersten Bilder waren noch in allen möglichen Rotschattierungen gewesen, im Lauf der Wochen waren jedoch weitere Farben hinzugekommen. Eines der Bilder war sogar mit Wasserfarben ausgemalt; sage und schreibe fünfzehn verschiedene Farben hatte sie gezählt, eigentlich war es gar nicht so übel gewesen. Die Botschaft dahinter war eindeutig: Ich arbeite dran. Und es geht mir allmählich besser. Gib mich nicht auf.
Aber vielleicht war das auch reines Wunschdenken ihrerseits.
»Meredith?«, fragte Mallory kleinlaut. »Es tut mir leid. Ich wollte dich doch bloß aufziehen.«
Meredith blieb abrupt stehen, als sie merkte, dass Mallory direkt vor dem Café stand und sie mit ernster Miene ansah. Sie waren einen ganzen Häuserblock weit gelaufen, ohne ein Wort zu wechseln. Scham ergriff Besitz von ihr, hinterließ einen bitteren Geschmack auf ihrer Zunge. Eigentlich ist heute Mallorys großer Tag, und ich habe es geschafft, dass es wieder mal nur um mich geht.
Sie rang sich ein Lächeln ab. »Weiß ich doch, Süße. Es lag nicht an dir oder daran, was du gesagt hast. Manchmal bin ich einfach mit den Gedanken woanders.«
»Es beruhigt mich, dass es sogar dir so geht. Da fühle ich mich gleich viel besser.«
Meredith lächelte. »Wie schön, dass ich selbst dann noch helfen kann, wenn ich Mist baue.« Sie deutete auf das Schild über dem Café. »Gehen wir rein. Ich hoffe, es gefällt dir. Hier gibt’s die beste Pasta der ganzen Stadt.«
»Trifft sich gut, ich habe nämlich Bärenhunger. Eine Frage habe ich allerdings«, sagte Mallory ernst.
»Nur eine?« Meredith lachte, als Mallory die Augen verdrehte. Wieder eine so herrlich normale Reaktion. Sei dankbar, statt dem nachzutrauern, was du nicht haben kannst. Sie konnte Adam nicht zwingen, mit ihr zusammen sein zu wollen, und es wurde allmählich Zeit, seinetwegen nicht länger den Mond anzuheulen. »Raus damit. Was gibt’s?«
»Was passiert eigentlich, wenn ich den Führerschein mache und wieder Auto fahre?«
Die Hand auf der Türklinke, hielt Meredith inne. »Was meinst du?«
Mallorys Gesicht verzog sich zu einem verschmitzten Grinsen. »Na ja, wie soll ich Auto fahren, wenn ich das Wort ›blöd‹ nicht in den Mund nehmen darf? Ich meine, vorhin, beim Parkplatzsuchen, hast du es mindestens dreimal benutzt. Also, wie soll ich fahren, ohne dieses Wort sagen zu dürfen? Oder ›Schwachkopf‹? Oder ›Sch…‹?« Sie zog den Laut in die Länge. »Sch-öne Bescherung.«
Meredith lachte. »Du kleines Ekelpaket.«
Mallory grinste, sichtlich zufrieden mit sich. »Kann sein, aber immerhin habe ich dich zum Lachen gebracht. Und zwar richtig.«
Meredith schluckte. »Rein jetzt, bevor ich zum Eiszapfen werde.« Sie hielt Mallory die Tür auf. Ihre Kehle fühlte sich eng an, wenngleich aus einem anderen Grund als zuvor. Mallory hatte einen Witz gerissen. Um mich aufzumuntern. Dass sich die junge Frau, die so grausam missbraucht worden war, die Fähigkeit bewahrt hatte, Mitgefühl für andere zu empfinden … Meredith war zutiefst gerührt. Sie räusperte sich.
»Es müsste ein Tisch auf den Namen ›Fallon‹ reserviert sein«, sagte sie mit immer noch leicht belegter Stimme.
»Ja, bitte hier entlang.« Die Kellnerin, eine junge Frau in Mallorys Alter, führte sie zu einem Fenstertisch. »Das ist der beste Platz, um Leute zu beobachten«, sagte sie mit einem Lächeln.
»Und um auf das Feuerwerk zu warten, während es schön warm und gemütlich ist«, fügte Meredith hinzu.
Mallorys Augen begannen zu leuchten, doch sie wartete, bis die Kellnerin verschwunden war, ehe sie sich vorbeugte. »Feuerwerk? Wo denn?«
»Auf dem Fountain Square«, antwortete Meredith. »Wir essen erst mal was, trinken in aller Ruhe Kaffee, und dann gehen wir raus auf die Straße.«
»Hast du das Café deshalb ausgesucht?«
»Nein, nein.« Meredith ließ den Blick wohlwollend umherschweifen. »Ich war jedes Jahr mit meiner Großmutter hier, nachdem wir uns den Nussknacker angesehen haben. Nur wir beide. Damals fanden die Aufführungen noch in der Music Hall statt und waren sehr festlich.« Nach einer langen Renovierungsphase hatte die Music Hall dieses Jahr den Betrieb wieder aufgenommen. Eigentlich hatte Meredith vorgehabt, die Mädchen, die im Mariposa House Zuflucht gefunden hatten, dorthin mitzunehmen, die Idee jedoch wieder verworfen. Die meisten Mädchen hätten angesichts der Menschenmassen Panik bekommen. Vielleicht klappte es ja nächstes Jahr.
»Wie festlich?«, wollte Mallory wissen. »Mit langen Kleidern und Handschuhen und so?«
»Na ja, nicht ganz so schick«, wiegelte Meredith lächelnd ab. »Aber ich durfte mein schönstes Weihnachtskleid tragen und bekam eine große Schleife ins Haar, und meine Oma trug ihr Festtagskostüm und ihre Perlenkette dazu. Granny trug immer Perlen.«
»So wie du«, meinte Mallory. »Zumindest als Ohrringe. Ich habe dich noch nie ohne gesehen. Und ohne deine Armreifen«, fügte sie mit einem Blick auf Merediths Handgelenke hinzu.
Meredith strich liebevoll über einen der Ohrringe. »Die habe ich von ihr geerbt. Du hättest meine Großmutter bestimmt gemocht. Sie war eine echte Granate.«
Mallory lächelte belustigt. »Eine Granate mit Perlenkette.«
»Das kannst du laut sagen. Und das ist noch nicht alles. Gran war nicht nur eine Lady mit Perlenkette, sondern eine ausgebuffte Falschspielerin, die fluchen konnte wie ein Kutscher, eine Pistole in ihrer riesigen Handtasche hatte und dabei alle glauben machte, sie sei eine harmlose Omi, die gern Socken strickt.«
Mallory blickte mit hochgezogenen Brauen von der Speisekarte auf. »Sag nichts gegen Stricklieseln. Inzwischen kenne ich mehrere von denen, die auch bis an die Zähne bewaffnet sind.«
Meredith prustete los. Kate, ihre jüngste Freundin, war FBI-Agentin, Scharfschützin und strickte wie eine Verrückte. Und sie brachte immer mehr von Merediths Freundinnen dazu, sich ihr anzuschließen. Inzwischen gehörte zu ihrem allmonatlichen Mädelsabend neben Wein und Schokolade auch Strickwolle.
Meredith selbst hatte sich noch nicht vom Strickfieber anstecken lassen, dafür trug sie bereits seit Jahren heimlich eine Waffe, entweder in der Tasche ihres Blazers oder in einem BH-Holster. Als Kinder- und Jugendtherapeutin war sie immer wieder mit gewalttätigen Familienmitgliedern konfrontiert, die ihr drohten. Sie trainierte regelmäßig auf dem Schießstand, hatte ihre Waffe aber zum Glück bisher nie benutzen müssen.
»Meine Großmutter fehlt mir sehr«, sagte sie wehmütig. »Nach dem Tod meiner Eltern war sie mein Fels in der Brandung.«
Mallory legte den Kopf schief. »Und wann ist sie gestorben?«
»Vor drei Jahren«, antwortete Meredith, wohl wissend, dass sie Mallory bisher nie etwas über sich erzählt hatte. Ich muss sie an einen anderen Therapeuten überweisen, und zwar bald. Die Vorstellung tat weh. Aber eigentlich war dieser Schritt längst überfällig. In den letzten Monaten war ihre Bindung viel zu eng geworden. »An einem Herzinfarkt. Aber wenigstens ging es ganz schnell, und sie musste nicht leiden. Obwohl sie schon über achtzig war, hatte ich nicht damit gerechnet. Es war ein Schock. Ich war einfach noch nicht bereit, sie gehen zu lassen.«
Mallorys Gesicht wurde traurig. »Das kann ich verstehen. Und was ist mit deinen Eltern passiert?«
Meredith holte tief Luft. Ihr Tod war weder schnell noch ohne Schmerzen vonstattengegangen, darüber hinaus jährte sich bald ihr Todestag. Noch ein weiterer Grund für ihren Frustkauf. »Ein Flugzeugabsturz«, sagte sie leise. »Vor sieben Jahren.«
»Oh«, sagte Mallory betroffen. »Und was ist mit deinem Großvater?«
Beim Gedanken an ihn hob sich Merediths Stimmung augenblicklich. Sie sah Mallory die Erleichterung an. »Er lebt noch und ist ein ziemlich wilder Typ. Er lebt in Florida, in einem Haus am Strand, und geht jeden Tag angeln. Er behauptet, er würde auch jeden Tag einen Fisch fangen, aber das ist bestimmt eine Lüge. Vielleicht lernst du ihn sogar kennen. Er kommt über die Feiertage her.« Er ließ sie Weihnachten niemals allein verbringen. »So, aber jetzt schauen wir endlich, was es zu essen gibt. Heute lasse ich es mal so richtig krachen.« Sie ging direkt zu den Desserts über. »Sonst ist meine morgendliche Lauferei ja völlig sinnlos.«
Meredith überlegte gerade, für welches Schokoladendessert sie sich entscheiden sollte, als sie Mallory scharf den Atem einsaugen hörte. Sie sah auf, und auch ihr stockte der Atem.
Ein junger Mann stand direkt zwischen ihrem Tisch und dem Fenster. Er war kreidebleich und zitterte am ganzen Leib. Lauf, war ihr erster Gedanke, und mit den Jahren hatte sie gelernt, im Zweifelsfall ihren Instinkten zu folgen. Doch stattdessen ließ sie die Speisekarte sinken und zwang sich zu einem Lächeln, während sie sich erhob. Mit einer beiläufigen Geste schob sie die Hände in ihre Blazertasche und löste den Verschluss ihres Holsters. »Kann ich Ihnen helfen?«
Der junge Mann schluckte. »Es tut mir so leid«, sagte er und zog eine Waffe aus der Tasche. »Es tut mir leid«, flüsterte er. »So leid.«
Und dann zielte er auf sie.
Meredith holte Luft und ignorierte die erschrockenen Aufschreie der anderen Gäste. Sie musste ihn von seinem Vorhaben abbringen. Es war ihr schon früher mit Schießwütigen gelungen, warum also nicht auch jetzt? »Reden wir darüber«, sagte sie.
Er schüttelte den Kopf. Die Verzweiflung stand ihm ins Gesicht geschrieben. »Dafür ist es zu spät. Ich muss es tun.«
Meredith riskierte einen Blick auf Mallory. Das Mädchen starrte wie gebannt auf den Pistolenlauf. Ihre Augen waren weit aufgerissen und glasig. Sie stand eindeutig unter Schock.
»Sie müssen das nicht tun«, sagte Meredith ruhig. »Wir kriegen das wieder hin. Was auch immer los ist, wir finden eine Lösung.«
Der junge Mann schüttelte den Kopf. »Seien … Sie einfach still. Bitte.« Die Waffe in seiner Hand wackelte gefährlich, als er noch stärker zu zittern begann.
Er will das nicht tun. Er will eigentlich gar nicht hier sein. Jemand hatte ihn gezwungen.
Beschwichtigend streckte Meredith eine Hand nach ihm aus, während ihre andere zu ihrem Holster glitt, ohne die Waffe herauszuziehen. »Tun Sie’s nicht. Ich kann Ihnen helfen. Wie heißen Sie, mein Lieber?«
Wieder schüttelte der Junge verzweifelt den Kopf. »Still jetzt! Ich muss nachdenken!« Er zuckte zusammen, riss die freie Hand hoch und schlug sich aufs Ohr. »Hören Sie auf, mich anzuschreien! So kann ich nicht denken!«
Aber niemand schrie ihn an. Im Gegenteil. Im Restaurant herrschte Totenstille.
Er stieß sich den Finger ins Ohr. »Ich hab doch gesagt, ich tu’s!«, schrie er.
Schizophrenie? Er war genau in dem Alter, in dem die Krankheit häufig ausbrach, aber normalerweise zeigten die Patienten keine Gewaltbereitschaft gegen andere. Es sei denn, die Stimmen in seinem Kopf befahlen ihm, zu schießen. Außerdem war es nach wie vor möglich, dass ihn jemand dazu zwang. Sie musste herausfinden, womit sie es hier zu tun hatten, und sich dann für die beste Taktik entscheiden.
Sie traute sich nicht, den Blick von ihm zu lösen. »Runter, Mallory«, befahl sie ganz leise.
»Nein!«, rief der Junge, während sein Blick zu der kreidebleichen Mallory schweifte. »Keiner rührt sich!« Er richtete die Waffe zuerst auf Mallory, dann wieder auf Meredith. »Keine Bewegung.«
Meredith hatte den kurzen Moment genutzt, um ihre eigene Waffe zu ziehen. Ihre Hand war ganz ruhig, als sie sie auf den Jungen richtete, dessen Augen sich weiteten.
Im Restaurant war es immer noch totenstill, lediglich vereinzelte erstickte Angstlaute und schweres Atmen der Gäste war zu hören.
»Nimm die Waffe weg, Junge«, sagte Meredith sanft. »Ich will dir nicht wehtun, und ich weiß, dass du mir auch nicht wehtun willst.«
Der junge Mann wimmerte. Er konnte kaum älter als Mallory sein. Er ist bloß ein Junge. Ein völlig verängstigter Junge. »Ich kann das nicht«, flüsterte er.
»Ich weiß«, sagte Meredith besänftigend. »Ich weiß, dass du es nicht kannst. Und das ist in Ordnung. Lass die Waffe fallen, bitte. Ich helfe dir. Ich will dir helfen.«
»Er wird sie umbringen«, flüsterte der Junge heiser.
Wer? Die Frage lag ihr auf der Zunge, doch sie verkniff sie sich. Viel wichtiger war jetzt, ihn zum Aufgeben zu bewegen. »Wir können dir helfen. Das weiß ich. Bitte … bitte, nimm einfach die Waffe runter.«
Cincinnati, Ohio
Samstag, 19. Dezember, 15.55 Uhr
»Verdammt«, stieß er hervor, während er Andy mit dem Fernglas vom Fahrersitz seines vor dem kleinen Café geparkten SUV aus beobachtete. Fallon trug eine Waffe.
Die ruhige Stimme der Psychologin drang aus dem Transmitter in Andys Tasche. Sie versuchte, ihn zu beruhigen, es ihm auszureden. Und allem Anschein nach gelang es ihr, denn bislang hatte er nicht geschossen. Aber eigentlich spielte es keine Rolle. Die Waffe war lediglich die einfachste Methode, damit Andy möglichst nahe an ihren Tisch herankam.
Über das Mikro in Andys Ohr hatte er ihm befohlen, an den Tisch zu treten, an dem Fallon mit ihrem Schützling saß. Er hatte ihn angewiesen abzudrücken und ihn noch einmal daran erinnert, dass Linnea sterben würde, falls er es nicht täte. Aber in Wahrheit würde er sie ohnehin töten. Das Mädchen hatte sein Gesicht gesehen.
Genau wie Andy. Auch er würde nicht mit dem Leben davonkommen.
Er schob den Automatikhebel nach vorn, ließ den Fuß jedoch auf der Bremse, während er die Anruftaste auf seinem Handy drückte. Dann nahm er den Fuß von der Bremse und erstarrte.
Nichts war passiert.
Dabei hätte in diesem Moment alles losbrechen müssen, aber da war nichts – keine Explosion, kein berstendes Glas, kein umherfliegender Schutt. Nichts.
Er rammte den Hebel wieder in die Parkposition, schnappte das Fernglas und nahm Andy ins Visier. Der Junge zielte immer noch auf Meredith, die inzwischen ihre eigene Waffe auf ihn gerichtet hielt. Er lebte also immer noch. Verdammte Scheiße! Er überprüfte die Nummer. Sie stimmte. Er wählte sie ein zweites Mal. Wieder nichts.
»Verdammt!«, stieß er hervor. Er konnte die Stimme des Jungen über das Mikro kaum hören. Er wird sie umbringen. Andy war drauf und dran, Meredith Fallon alles zu erzählen. Dieser beschissene kleine Dreckskerl.
»Niemals!« Dazu würde es nicht kommen. Er zog das Gewehr unter dem Sitz hervor, ohne Linnea auf dem Rücksitz zu beachten, die entsetzt nach Luft schnappte.
»Nein!«, schrie sie. »Das kannst du nicht machen!«
Doch er konnte. Und er würde. Keine losen Enden.
2. Kapitel
Mount Carmel, Ohio
Samstag, 19. Dezember, 15.55 Uhr
»Eine Idee weiter nach links. So ist es zu weit rechts.«
Adam Kimble stand auf der obersten Leitersprosse und beäugte den Stern aus Alufolie, dann warf er Wendi Cullen einen finsteren Blick zu. Die zierliche Leiterin des Mariposa House, wo Opfer von sexueller Gewalt und Menschenhandel Zuflucht fanden, mochte wie Tinker Bell aussehen, doch Adam wusste nur zu genau, dass sich hinter der elfenhaften Fassade ein stählernes Rückgrat und ein eiserner Wille verbargen.
Für den Bruchteil einer Sekunde flackerte Angst in ihm auf, weil er wusste, dass hinter ihrem munteren Lächeln heiße Wut lauerte. Als Detective des Morddezernats der Polizei von Cincinnati mit dreizehn Jahren Berufserfahrung sollte er sich von Tinker Bell eigentlich nicht den Schneid abkaufen lassen, dachte er verdrossen, und trotzdem war es so.
Er hatte sie nicht gefragt, weshalb sie so sauer auf ihn war, weil er den Grund dafür sehr wohl kannte, das Gespräch jedoch unbedingt vermeiden wollte. Weil Wendi völlig recht hatte.
Ich bin ein egoistischer Dreckskerl, dachte er resigniert. Und das nicht zum ersten Mal, weder heute noch in der vergangenen Stunde. Nein, der Gedanke kam ihm, wann immer er einen Fuß in dieses Haus setzte, wo er sie an jeder Ecke sehen konnte, obwohl sie heute gar nicht hier war.
Was wiederum der Grund war, weshalb er hergekommen war: Er achtete darauf, sich seine Freiwilligendienste im Mariposa House so einzuteilen, dass er Meredith Fallon nicht in die Arme laufen konnte.
Es schmerzte ihn, ihre Stimme nicht hören, ihr Gesicht nicht sehen zu können, doch den Ausdruck in ihren grünen Augen ertragen zu müssen, war noch viel schlimmer – Enttäuschung. Reue. Und Scham. Vor allem der Anblick von Letzterem bohrte sich wie ein Dolch in sein Herz. Sie hatte keinerlei Grund, sich zu schämen. Sie hatte nichts falsch gemacht.
Sondern ich. Es ist alles meine Schuld. Jedes Versagen, jede Schwäche, jeder Moment der Reue. Und es gab so viele davon. Aber er hatte sich fest vorgenommen, all das zu ändern und zu jenem Mann zu werden, den sie verdiente.
Allerdings hatte er nicht die Absicht, ihre überaus respekteinflößende Freundin in seine Pläne einzuweihen, solange er auf einer fünf Meter hohen Leiter stand und versuchte, die Christbaumspitze möglichst gerade auf den Baum zu platzieren, während ihm das Glitzerzeug schon an den Händen klebte.
Die Mädchen, die den Stern gebastelt hatten, waren ziemlich großzügig mit dem Kram gewesen. Er wischte sich die Hand an seiner Jeans ab und wünschte, sie hätten dafür mit dem Klebstoff ein bisschen weniger gegeizt.
»Gerade sollte ich ihn doch noch eine Idee nach rechts rücken«, maulte er.
»Das liegt daran, dass er gerade noch zu weit links war«, erwiderte Wendi scharf. Adam fragte sich, ob sie ihn einfach nur schikanieren wollte.
Die beiden Männer, die mit ihm zum Schmücken abkommandiert worden waren, stießen wie auf Kommando ein belustigtes Schnauben aus, was seinen Verdacht bestätigte. Der fast fünf Meter hohe Baum stand mitten im Wohnzimmer des alten Hauses, das inzwischen zwanzig jungen Frauen in unterschiedlichen Stadien der Genesung dazu diente, wieder auf die Beine zu kommen. Stone O’Bannion fädelte Popcorn auf eine Schnur, während Diesel Kennedy in Kartons mit altmodischem Christbaumschmuck wühlte, die man auf dem Dachboden des alten Hauses entdeckt hatte.
Beide Männer arbeiteten eigentlich für den Ledger, ein Regionalblatt. Vor einem Jahr noch hätte Adam nicht im Traum daran gedacht, sich im selben Raum mit Reportern aufzuhalten – es sei denn, um sie zu verhaften –, doch hinter ihnen allen lag ein reichlich verrücktes Jahr, und inzwischen zählten die beiden zu seinen engsten Freunden. In den letzten Monaten hatten sie gemeinsam hier gesägt und gezimmert, abgeschliffen, gestrichen und poliert, bis jede Erinnerung an die einstigen Gewaltopfer in den alten, gruseligen Mauern verbannt und der heimeligen Behaglichkeit eines neuen, sicheren Zuhauses gewichen war.
Adam hatte sich kopfüber in die Arbeit gestürzt; zum einen, weil sie wichtig war und erledigt werden musste, zum anderen, weil die körperlichen Strapazen eine willkommene Abwechslung darstellten. Aber in allererster Linie hatte er es für Meredith getan. Weil Mariposa House zu Wendis und Merediths Lebensaufgabe geworden war – die Idee, all jenen Mädchen und jungen Frauen zur Seite zu stehen, die noch nicht für eine Pflegefamilie oder ein eigenständiges Leben bereit waren. Hier fanden Opfer von brutaler sexueller Gewalt oder skrupellosen Sexhändlern Zuflucht. Die Mädchen waren zwischen neun und achtzehn Jahre alt, die Mehrzahl jedoch im Teenageralter. Ziel war es, sie bis zu dem Punkt zu begleiten, an dem sie in die Gesellschaft zurückkehren konnten.
An jeder Ecke war Merediths Einfluss zu spüren, Mariposa House war so behaglich wie ihr eigenes Zuhause. Und Adam wollte Meredith helfen, ihren Traum zu verwirklichen, auch wenn es das Einzige war, was er ihr schenken konnte. Zumindest im Augenblick.
Stones Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. »Der Stern an sich ist ja okay, Kimble«, sagte er belustigt. »Das Problem ist der Baum. Am Fenster würde er viel besser aussehen. Was denkst du, Wendi? Sollte er ihn nicht lieber rüberwuchten?«
»Nein«, erwiderte Adam schnell, bevor die Idee in Wendis Kopf überhaupt erst Gestalt annehmen konnte.
»Nein«, erwiderte Wendi in derselben Sekunde todernst.
Stone lachte. »Kommt schon. Das würde super aussehen. Überlegt nur, wie sich das Licht darin fangen würde.«
»Halt den Mund, O’Bannion«, unterbrach Adam, wenn auch nur zum Schein. Stone lachte, und es stand ihm ausgesprochen gut. Im Sommer hätte ihn um ein Haar eine Kugel getötet, und er war noch nicht wieder vollständig auf dem Posten. Manchmal hatte er Mühe, das Gleichgewicht zu halten, was einer der Gründe war, weshalb Adam sich bereit erklärt hatte, auf die Leiter zu steigen.
Diesel sah zu Adam hoch. »Vielleicht hättest du lieber auf mich hören sollen, bevor du da hochkletterst und an etwas herumzirkelst, was doch völlig in Ordnung ist«, meinte er und zog die dunklen Brauen hoch. Eigentlich wäre er derjenige gewesen, der sich um die Christbaumspitze kümmern sollte.
»Aber das Ding war schief«, beharrte Adam.
»Klar war es schief«, gab Diesel zurück. »Weil die Mädchen den Stern selbst gebastelt haben. Und das ist doch völlig okay. Nicht alles muss immer perfekt sein.« Er warf Wendi einen vorsichtigen Blick zu. »Wenn du einen perfekten Stern willst, dann kauf einen.«
Mit seinen auffälligen Tattoos, dem kahlen Schädel, dem Ohrring und seiner beeindruckenden Größe von über einem Meter neunzig sah Diesel Kennedy wie ein übellauniger Meister Proper aus. Aber sobald er lächelte, stürzten sich die Kids, denen er Fußballspielen beibrachte, auf ihn und wollten ihn gar nicht mehr loslassen. Hinter seiner Gangsterfassade verbarg sich ein hochanständiger Bursche.
Wendi seufzte. »Wenn wir die Spitze nicht draufsetzen, verletzen wir die Gefühle der kleineren Mädchen. Deshalb …«
»Ist schon in Ordnung, Wen. Lass gut sein.«
Ein verdrossenes Grunzen ertönte aus der Wohnzimmerecke, wo FBI Special Agent Parrish Colby im Schneidersitz mit einer langen Lichterkette kämpfte. Wie es aussah, würde die Lichterkette eindeutig gewinnen. Auf den ersten Blick schien der bullige Agent alles andere als die perfekte Wahl für die puppenhafte Wendi zu sein, doch seit dem Sommer waren die beiden offiziell ein Paar.
»Du hast dir den Stern ja noch gar nicht angesehen«, tadelte Wendi.
Mit seiner roten Weihnachtsmütze auf dem Kopf und der hoffnungslos um seinen Hals verhedderten Lichterkette sah Colby wie ein kampflustiger Elf aus, der einmal zu häufig mit seinen Kumpanen aneinandergeraten war. Er verdrehte genervt die Augen. »Er ist prima«, sagte er. »Der Scheißstern sieht ganz toll aus.«
»Parrish! Wie redest du denn?« Wendi warf ihm einen tadelnden Blick zu.
»Ist doch keiner da«, meinte Colby.
Das stimmte. Dank einer planerischen Meisterleistung waren alle Bewohnerinnen von Mariposa House anderweitig beschäftigt, sodass Wendi in Ruhe schmücken und die Geschenke einpacken konnte. Und für alles hatte sie Helfer engagiert – Begleitschutz für die Mädchen und Dekorationshilfen für sich selbst.
Adams Cousin Deacon war gemeinsam mit seiner Verlobten Faith abkommandiert worden, auf die Mädchen aufzupassen. Gut so, dachte er. Das gab ihm Gelegenheit, seine Hilfe anzubieten, ohne dabei Meredith über den Weg laufen zu müssen.
Die restlichen Mitarbeiter und weitere Freiwillige waren mit einigen der Mädchen Geschenke kaufen gegangen, während andere, die sich noch nicht zutrauten, unter Fremden zu sein, einen Bastelkurs besuchten und dort Geschenke anfertigten.
Mallory Martin, die Älteste in Mariposa House, war zur Volkshochschule gefahren, um sich dort für ihre Kurse einzuschreiben. Und Meredith begleitete sie, wie ihm sein Partner bei der MCES, der Spezialeinheit für Gewaltverbrechen, Special Agent Deacon Novak, verraten hatte – allerdings nicht in offizieller Funktion, sondern weil er Adams Cousin und ältester Freund war und die Information von seiner Verlobten bekommen hatte. Deacon war mit Dr. Faith Corcoran verlobt, die wiederum eine enge Freundin von Meredith war und in deren Kinder- und Jugendpsychologiepraxis arbeitete.
Sie waren alle eng miteinander verbandelt, seine ganze Familie und seine Freunde. Das machte es manchmal schwierig, weil jeder von jedem alles wusste.
Na ja, nicht alles. Es gab trotz allem Dinge, die Adam Deacon vorenthielt, weil … ich will nicht, dass er es weiß. Weil ich mich schäme.
Doch jenseits aller Geheimnisse gab es eine Sache, die sie alle verband: der Wunsch, den Mädchen in Mariposa House eine sichere Zufluchtsstätte zu bieten. Erklärtes Ziel war es, die Mädchen auf ein eigenständiges Leben vorzubereiten, und der Einstufungstest an der Volkshochschule war ein bedeutender Einschnitt und großer Erfolg für Mallory.
Genauso wie für mich. Denn ihm, Deacon und dem restlichen MCES-Team war es gelungen, diesem elenden Dreckskerl, der Mallory und viele andere aufs Übelste gequält hatte, das Handwerk zu legen. Zudem war es ein seltener Sieg, den er umso mehr in vollen Zügen genoss.
Ausnahmsweise war Adam nicht zu spät gekommen. Er hatte nicht versagt. Und die Kids waren noch am Leben gewesen. Seit Monaten war dies der Gedanke, der ihn bei der Stange hielt. Er klammerte sich daran, manchmal weniger, manchmal mehr, beispielsweise um drei Uhr morgens, wenn ihn all jene, die er nicht zu retten vermocht hatte, in seinen Träumen heimsuchten und er schweißgebadet aus dem Schlaf schreckte, mit hämmerndem Herzen und von seinen verzweifelten Schreien schmerzender Kehle.
Und dem so übermächtigen Drang nach einem beschissenen Drink, dass er glaubte, sterben zu müssen, wenn er ihn nicht bekam.
Die Erinnerung an das Bedürfnis kam unerwartet und so heftig, dass ihm einen Moment lang schwindlig wurde und er am ganzen Leib zu zittern begann. Er hielt sich an der obersten Sprosse fest, spürte, wie sich das Metall in seine Handfläche grub und einen Schmerz verursachte, der das Verlangen verjagte, dessentwegen er um ein Haar sein ganzes Leben zerstört hätte.
Er schloss die Augen und zwang sich, nicht länger an die Gesichter all jener zu denken, die er nicht hatte retten können, sondern sich stattdessen die Opfer vorzustellen, zu deren Rettung er rechtzeitig herbeigeeilt war. Es mochten zwar nicht ganz so viele sein, doch es gab sie. Und sie waren am Leben.
Daher, nein – du brauchst keinen Drink. Du willst höchstens einen. Aber brauchen tust du ihn nicht.
Er holte Luft und sog tief den Harzduft des Baums ein.
Dann atmete er noch einmal ein, spürte, wie er seinen Körper und seinen Geist gleichermaßen wieder unter Kontrolle bekam, um erleichtert festzustellen, dass das Ganze nur ein paar Sekunden gedauert hatte, weil Wendi immer noch mit Colby schimpfte.
»Es ist egal, ob die Mädchen hier sind oder nicht«, sagte sie. »Deine Kraftausdrücke und deine schlechten Manieren haben hier nichts zu suchen, das weißt du ganz genau.«
»Tut mir leid«, brummte Colby.
Kurz herrschte Stille, dann ertönte Wendis leises Lachen. »Nein, tut es nicht.«
Colbys Lachen hörte sich an, als versuche jemand, ein rostiges Sägeblatt durch einen Holzbalken zu treiben. »Vielleicht ein kleines bisschen.«
Adam blickte über die Schulter und sah, wie Wendi Colby einen raschen Kuss auf den Mund drückte. »Du erdrosselst dich noch«, sagte sie liebevoll und zog an den Kabeln, die er um seine Arme, Beine und sogar seinen Hals geschlungen hatte. Das Lächeln, das auf Colbys Züge trat, war von verblüffender Süße. Er schien förmlich dahinzuschmelzen.
Adam wandte sich abrupt ab, schluckte den Kloß in seiner Kehle hinunter und tat so, als würde er das plötzliche Brennen in seinen Augen nicht bemerken. Genau das will ich auch, dachte er. Diesen Moment der Zärtlichkeit, den er gerade miterleben durfte. Aber er wollte nicht nur einen einzigen Moment, sondern eine unendliche Aneinanderreihung davon, ein ganzes Leben lang. Einen Kuss und ein Lächeln von jenem Menschen, für den er der Richtige war. Selbst wenn er so etwas eigentlich gar nicht verdiente.
Und das tat er tatsächlich nicht. Er verdiente sie nicht. Noch nicht.
Aber irgendwann wird es so weit sein. Ich brauche nur noch eine Weile, das ist alles.
Adams Blick schweifte durch den Raum und blieb an Diesel hängen, der ebenfalls Zeuge der Zärtlichkeit zwischen Wendi und Colby geworden war. Seine Miene war wie versteinert. Er richtete sich auf, murmelte, er hätte etwas in seinem Truck vergessen, und war verschwunden, noch bevor jemand etwas sagen konnte.
Verdammt. Jeder in ihrem Freundeskreis wusste, dass Diesel etwas für Adams Cousine Dani empfand, es bislang aber noch nicht geschafft hatte, ihr irgendwie näherzukommen. Seufzend stieg Adam von der Leiter, wobei er Stones besorgte Miene bemerkte.
»Alles klar?«, fragte Stone. »Es hat ausgesehen, als wäre dir schwindlig geworden.«
Schwindlig. Genau. Es war die perfekte Ausrede. »Ich glaube, ich sollte mal etwas essen. Ich hatte seit dem Frühstück nichts mehr«, meinte er achselzuckend. »Mein Blutzuckerspiegel ist wohl in den Keller gerasselt.«
»Dann iss etwas, Dummkopf«, gab Stone kopfschüttelnd zurück. »Ich habe eine halbe Lkw-Ladung voll Essen mitgebracht.« Er beugte sich verschwörerisch vor. »Und in Diesels Truck ist auch Bier, aber sieh zu, dass die Gefängnisdirektorin es nicht mitbekommt.«
Adam zuckte unwillkürlich zusammen und verdrängte die Stimme aus seinem Kopf. Ist doch bloß Bier. Eines wird schon nicht schaden. Aber aus einem würden zwei werden, dann ein ganzes Sixpack, und am Ende würde er mit einem Riesenkater und einem Filmriss wieder zu sich kommen.
Adam wollte gerade seine Standardantwort geben – Geht nicht, ich habe Bereitschaft. Wenn irgendwo eine Leiche auftaucht, muss ich los –, doch Wendi war schneller.
»Das habe ich gehört«, rief sie barsch, ohne von Colbys Schoß aufzustehen. »Herrgott noch mal, Stone, du kannst hier drin keinen Alkohol trinken.«
»Tue ich doch gar nicht«, gab er zurück. »Es ist im Truck. Also draußen.«
»Das spielt aber keine Rolle.« Sie sprang auf und stemmte die Hände in die Hüften. »Und sieh mich nicht so an. Du kennst die Regeln. Du benimmst dich bloß wieder mal wie ein blöder Arsch.«
»Tut mir leid, du hast ja recht.« Ganze zwei Sekunden gelang es Stone, zerknirscht zu wirken, ehe ein Grinsen auf seinem Gesicht erschien. »Aber du hast geflucht«, sagte er und hob zwei Finger. »Sogar zwei Mal.«
»Schhhh…« Wendi verkniff sich ein weiteres Schimpfwort und verpasste Colby einen Klaps auf den Arm, als der zu prusten begann. »Und du bist still. Also gut. Dann macht eine Pause, aber das Bier könnt ihr vergessen. Und trödelt nicht so lange herum. Es ist schon fast vier, und wir haben mit der Außenbeleuchtung noch nicht mal angefangen. Ich will, dass sie hängt, wenn es dunkel wird und die Mädchen nach Hause kommen.«
Adam blinzelte. Er hatte gar nicht mitbekommen, dass es schon so spät war. Auch heute hatte er sich seine Arbeit im Mariposa House so eingeteilt, dass er rechtzeitig verschwunden war, bevor Meredith mit Mallory zurückkam. Panik stieg in ihm auf. »Ich … ich kann nicht mehr lange bleiben. Aber ich komme gern später noch mal vorbei.«
Wendi runzelte die Stirn und hob warnend das Kinn. »Wir sind aber noch nicht fertig.«
»Ich habe dir doch gesagt, dass ich um drei gehen muss«, sagte Adam.
Sie warf ihm einen finsteren Blick zu. »Das stimmt. Weil du ein Feigling bist.«
Adam biss die Zähne zusammen, wohl wissend, dass er diesem Vorwurf nichts entgegenzusetzen hatte. »Mag sein, aber das geht dich nichts an.«
Aus dem Augenwinkel bemerkte er, dass Stone sich mit der Schüssel Popcorn auf einen Stuhl fallen ließ und den Dialog mit unverhohlener Faszination verfolgte. Dreckskerl.
Wendi trat vor ihn, so dicht, dass ihre Schuhe die seinen beinahe berührten. »Es geht mich tatsächlich nichts an, nur leider betrifft es in diesem Fall eine enge Freundin von mir.«
Ihre Freundin Meredith, die er wollte, seit er sie zum ersten Mal gesehen hatte. Ihr Gesicht war es, das er sich vorstellte, wenn das Verlangen so stark wurde, dass es ihm die Luft abschnürte.
Colby seufzte. »Wendi, Schatz, du hast ihr versprochen, dass du es nicht tun würdest. Und mir auch.«
Wut flackerte in Wendis Augen auf. »Ich weiß«, sagte sie, ohne den Blick von Adam zu lösen. »Aber ich kann ihm wenigstens sagen, dass Meredith die nächsten zwei Stunden nicht zurückkommt, weil sie Mallory zum Essen eingeladen hat und sie sich danach das Feuerwerk ansehen.«
Adams Panik ließ nach, und er holte Luft. Von dem Abendessen hatte er gewusst. Wendi hatte es vor ein paar Tagen erwähnt. Daher hatte er auch gewusst, dass sie nicht so schnell zurückkommen würde. Er hatte lediglich einen Zeitpuffer schaffen wollen, doch es sah so aus, als würde dieser nicht so groß werden wie erhofft.
»Gut, dann kümmere ich mich um die Außenbeleuchtung«, sagte er und wich einen Schritt zurück, doch Wendi trat gleichzeitig einen Schritt nach vorn. Er sah, wie ihr Tränen in die Augen schossen.
»Sie ist so traurig, Adam«, flüsterte sie. »Traurig und einsam, weil sie immer noch auf dich wartet. Wenn du sie nicht willst, dann lass sie gehen, damit sie mit jemand anderem glücklich werden kann.«
Mit einem Mal fühlte sich seine Brust an, als hätte jemand Beton hineingegossen – hart, schwer und unbeweglich. Nein. Er wollte das Wort aussprechen, doch sein Mund verweigerte seinen Dienst. Nein. Er konnte sie nicht gehen lassen. Sie durfte nicht mit einem anderen glücklich werden. Sie gehört mir, verdammt noch mal, mir ganz allein.
Luft. Er brauchte Luft. Er stieß den Atem aus, sog ihn wieder ein. Es fühlte sich an, als hätte er Scherben eingeatmet. Er wirbelte herum und ging mit zitternden Knien zur Tür, so wie Diesel wenige Minuten zuvor. O Gott, sind wir etwa dieselben Loser?
Eisige Luft schlug ihm entgegen, kalt und trocken. Er sog ein weiteres Mal den Atem ein, beugte sich vor und versuchte, die Hände auf die Knie abgestützt, gegen den Brechreiz anzukämpfen.
Sie gehört mir, mir, mir. Das stete Mantra in seinem Kopf half ihm, seine Atmung wieder unter Kontrolle zu bekommen. Eine Panikattacke. Jetzt, da sie vorüber war, erkannte er die Symptome. Seit Monaten hatte ihn keine mehr heimgesucht.
Seit er das letzte Mal Meredith Fallons Haus hatte verlassen müssen.
Sie ist traurig und einsam.
Aber ich bin noch nicht bereit. Noch nicht gut genug für sie. Noch nicht.
Cincinnati, Ohio
Samstag, 19. Dezember, 16.00 Uhr
»Ich helfe dir«, sagte Meredith noch einmal. Sie spürte, wie der Junge zauderte, wartete mit angehaltenem Atem, bis sich seine um die Waffe gekrallten Finger lösten und sie polternd zu Boden fiel. Seine Schultern sackten herab, und ein Schluchzer drang aus seiner Kehle. Tränen liefen ihm übers Gesicht.
»Es tut mir leid, Lin.« Er fummelte am Reißverschluss seiner Jacke herum. »Er wird sie umbringen. Er wird sie umbringen.« Er sah auf, blickte Meredith wie ein gehetztes Tier an. »Weg hier. Laufen Sie, um Himmels willen, laufen Sie!«
In diesem Moment zerbarst die Glasscheibe. Und der Kopf des Jungen … explodierte.
Wie erstarrt stand Meredith da, während die Gäste ringsum schrien. Tische wurden umgestoßen. Mallory, die sich bereits auf den Boden geworfen hatte, zerrte Meredith zu sich nach unten.
Ein weiterer Schuss ertönte, gefolgt von einem schrillen Schrei, während Meredith wie betäubt auf die Waffe in ihrer Hand starrte. Sie hatte nicht abgedrückt. Was war hier gerade passiert, zum Teufel?
Vor dem Café ertönte das Dröhnen eines Motors, gefolgt von quietschenden Reifen.
Ringsum herrschte Stimmengewirr. Einige Gäste wählten den Notruf. Am ganzen Leib zitternd, hielt sie die Waffe in der einen Hand und kramte mit der anderen in ihrer Handtasche, bis sie ihr Handy gefunden hatte. Sie wählte die Nummer, ohne sich zu fragen, weshalb es ausgerechnet diese war.
Mount Carmel, Ohio
Samstag, 19. Dezember, 16.03 Uhr
Noch immer vornübergebeugt, starrte Adam auf die Schneedecke im Vorgarten des Hauses, während er um Atem rang. Diese elenden Panikattacken! Er fragte sich, ob er seinen Sponsor bei den Anonymen Alkoholikern anrufen sollte, als sich ein riesiges, in Stahlkappenstiefeln steckendes Paar Füße in seinem Sichtfeld materialisierte. Er setzte eine neutrale Miene auf, hob den Kopf und blickte Diesel ins Gesicht.
Auch Diesel hatte seine Miene vollständig unter Kontrolle, was nicht weiter überraschend war. In der Hand hielt er eine Schachtel Kopierpapier, die aussah, als wäre sie mindestens zwanzig Jahre alt. »Alles klar?«, fragte er.
Adam nickte. »Was ist in dem Karton?«
»Da ist eine Menora drin.«
Adam rang sich ein Lächeln ab. »Daran habe ich gar nicht gedacht. Gibt es auch Jüdinnen unter den Mädchen?«
»Keine Ahnung. Aber wenn wir einen Baum haben, sollten wir auch eine Menora aufstellen. Diese hat meiner Mutter gehört. Ich wollte sie auf den Kaminsims stellen.«
Adams gezwungenes Lächeln schlug in ein aufrichtiges um. »Das ist echt nett von dir, Diesel. Ich bin …« Er deutete auf die Kartons mit den Lichterketten, die bereits unter einer der großen Eichen standen. »Ich soll hier draußen die Lichter aufhängen und könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen.«
Diesel wirkte erleichtert. »Ich bringe nur kurz die Menora hinein und bin gleich wieder da.«
»Danke.« Er trat einen Schritt zur Seite, um Diesel durchzulassen, als Cyndi Laupers »True Colors« auf seinem Handy ertönte. Adam erstarrte.
Diesen Klingelton hatte er seit dem Tag, als er ihn installierte, nicht mehr gehört.
Er gehörte zu Meredith. Das Herz schlug ihm bis zum Hals, als er sein Telefon aus der Tasche zerrte. »Hallo?«, fragte er vorsichtig – Meredith würde ihn nur anrufen, wenn etwas sehr Schlimmes passiert war.
Und genau das schien der Fall zu sein. Er hörte Schreie im Hintergrund, laute Stimmen und Schluchzen. »Meredith?«, sagte er scharf, während seine Fantasie augenblicklich die schlimmsten Bilder heraufbeschwor. »Bist du das?«
Diesel starrte Adam an, ohne ein Wort zu sagen. Er wartete.
»Meredith?«, sagte Adam, während ihn neuerlich Panik erfasste. »Sag mir, dass du das bist.«
»Ja.« Ihre Stimme war dünn, spröde. »Ich … Kannst du bitte herkommen? Ich brauche dich.«
»Ja. Ja, natürlich.« Er versuchte, ganz ruhig zu bleiben, gegen die Angst anzukämpfen, die ihm die Luft abzuschnüren drohte. Eine Hand legte sich um seinen Oberarm, drückte so fest zu, dass es wehtat … und holte ihn ins Hier und Jetzt zurück. Dankbar sah er auf, direkt in Diesels Gesicht, und deutete in Richtung Haus. »Hol bitte Colby«, sagte er. Diesel rannte sofort los. »Ich bin hier«, sagte er in den Hörer. »Sag mir, wo du bist, Süße.«
Ein halb unterdrückter Schluchzer drang durch die Leitung. »Im Buon Cibo.«
Stimmt ja, dachte er. Wendi hatte es vor ein paar Tagen erwähnt, als er das undichte Rohr in der Küche repariert hatte. Er kramte die Schlüssel aus der Tasche. In dem Moment kamen Colby, Wendi und Diesel aus dem Haus gelaufen, gefolgt von Stone, der nicht ganz mithalten konnte.
»Ich weiß, wo du bist.« Adam schob das schmiedeeiserne Tor auf und trat zu seinem Jeep. Die anderen folgten ihm. »Ich steige schon in den Wagen. Sag mir, dass es dir gut geht.«
Wendi war kreidebleich geworden und schlug sich die Hand auf den Mund. Colby legte ihr beschützend den Arm um die Schultern.
»Ich bin …« Merediths Stimme war kaum hörbar. »Es geht mir gut. Mallory auch. Es gab eine Schießerei. Ein Mann ist tot. Aber ich habe nicht geschossen, ich schwöre, ich war’s nicht.« Ihre Stimme brach.
Adam kniff die Augen zusammen und zwang sich zu atmen. »Es geht ihr gut«, sagte er zu den anderen und stieg in seinen Jeep. »Mallory auch, aber offenbar gab es in dem Café, wo sie essen waren, eine Schießerei. Im Buon Cibo.«
»Wir fahren dir hinterher«, sagte Colby, packte Wendi, die bereits zu seinem Wagen laufen wollte, und schob sie in Richtung Haus. »Ohne Jacke kannst du nicht mitkommen, Wendi. Wir beeilen uns, versprochen.«
Colbys Stimme schien sie zu beruhigen. Sie ließ sich gegen seine Brust sinken und nickte schwach.
»Ruf an, wenn du uns brauchst!«, rief Diesel, als Adam mit heulendem Motor und quietschenden Reifen davonschoss.
Adam hob kurz die Hand, dann wandte er seine Aufmerksamkeit wieder Meredith zu. »Hast du die Polizei gerufen?«
»Alle haben es getan«, stieß sie atemlos hervor. »Die anderen Gäste.«
»Sehr gut«, sagte er beschwichtigend. »Wo genau bist du gerade, Schatz?«
»Im Café. Unter dem Tisch.« Ihr Atem ging schnell und flach. »Ich hatte meine Waffe gezogen, Adam. Aber ich habe ihn nicht erschossen.«
Adam runzelte die Stirn. Was sie sagte, war ziemlich verwirrend. Aber … Moment mal! Meredith trug eine Waffe bei sich? Er hatte nicht mal gewusst, dass sie überhaupt eine besaß. »Natürlich nicht. Aber wer hat ihn dann erschossen?«
»Das weiß ich nicht.« Wieder drang ein Schluchzer durch die Leitung. »Er hat auf mich gezielt, aber ich habe es ihm ausgeredet. Er hat sie runtergenommen. Und dann …« Sie brach in Tränen aus. Frustriert krallte Adam die Hände ums Steuer.
Ich hätte bei ihr sein sollen. Zum x-ten Mal verfluchte er sich für seine Schwäche. Wäre ich nicht so kaputt, wäre ich an ihrer Seite gewesen … wo ich hingehöre. Ich wäre da gewesen, und es würde ihr gut gehen. »Und dann?«, fragte er sanft.
»Sein Kopf … er ist einfach explodiert.« Sie würgte ein wenig, dann holte sie tief Luft. »Ich bin … o Gott. Ich bin voller … Gott, Adam!«
»Verstehe«, sagte er. Die Hirnmasse eines toten Mannes klebte überall an ihr. Er preschte die gewundene Straße so schnell entlang, wie er nur konnte, und trat kräftig aufs Gas, sowie er den Highway erreichte. »Ich bin schon unterwegs, Meredith. Leg die Waffe einfach auf den Boden. Die Polizei kann später feststellen, dass du keinen Schuss abgegeben hast, aber es ist besser, wenn sie dir die Waffe nicht erst abnehmen müssen. Hast du sie hingelegt?«