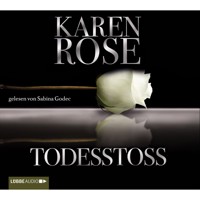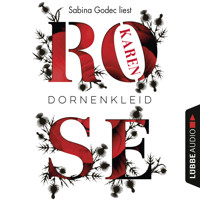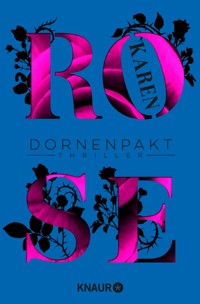
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dornen-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein atemloser Thriller um zwei Brüder auf der Flucht vor einem gnadenlosen Killer »Dornenpakt« ist der 5. Thriller aus der Dornen-Reihe in Cincinnati, Ohio, von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Karen Rose: Dr. Dani Novak und Diesel Kennedy müssen zwei Brüder vor einem Killer beschützen. Michael hat sich schon immer um seinen kleinen Bruder Joshua gekümmert. Ihre Mutter ist drogenabhängig, der Stiefvater gewalttätig. Eines Tages wird der 14-Jährige Zeuge, wie sein Stiefvater von einem Fremden brutal ermordet wird. Michael flieht mit Joshua, doch er weiß nicht, wem er sich anvertrauen kann. Er ist gehörlos und außer sich vor Sorge. Fußballtrainer Diesel Kennedy ahnt, dass etwas nicht stimmt. Gemeinsam mit der Ärztin Dani Novak, für die er mehr als nur Freundschaft empfindet, gewinnt er langsam das Vertrauen von Michael. Doch inzwischen weiß der Killer, dass es einen Zeugen gibt – und eröffnet eine tödliche Jagd ... Wie schon in ihren bisherigen Thrillern nimmt sich die internationale Bestseller-Autorin Karen Rose auch im 5. Teil ihrer Dornen-Reihe finsterste menschliche Abgründe vor. In einem sehr persönlichen Nachwort beleuchtet sie eindrucksvoll, warum das Thema Gehörlosigkeit in diesem Thriller eine zentrale Rolle spielt. Die SPIEGEL-Bestsellerautorin Karen Rose verbindet gekonnt nervenaufreibende Spannung mit einer fesselnden Liebesgeschichte. Explosive Pageturner, die alle Fans von Romantic Suspense und Psychothrillern von der ersten bis zur letzten Seite in Atem halten. Die Dornen-Thriller-Serie, die in Cincinnati, Ohio, spielt, ist in folgender Reihenfolge erschienen: - Dornenmädchen (FBI-Agent Deacon Novak und Faith Corcoran) - Dornenkleid (Marcus O'Bannion und Detective Scarlett Bishop) - Dornenspiel (FBI-Agent Griffin »Decker« Davenport und FBI-Agentin Kate Coppola) - Dornenherz (Detective Adam Kimble und Meredith Fallon) - Dornenpakt (Dr. Dani Novak und Diesel Kennedy
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 942
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Karen Rose
Dornenpakt
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Andrea Brandl
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Michael hat sich schon immer um seinen kleinen Bruder Joshua gekümmert. Ihre Mutter ist drogenabhängig, der Stiefvater gewalttätig. Eines Tages wird der 14-Jährige Zeuge, wie sein Stiefvater von einem Fremden brutal ermordet wird. Michael flieht mit Joshua, doch weiß nicht, wem er sich anvertrauen kann. Er ist gehörlos und außer sich vor Sorge.
Fußballtrainer Diesel Kennedy ahnt, dass etwas nicht stimmt. Gemeinsam mit der Ärztin Dani Novak, für die er mehr als nur Freundschaft empfindet, gewinnt er langsam das Vertrauen von Michael. Doch es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Der Killer weiß inzwischen, dass es einen Zeugen gibt ...
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
Epilog
Nachwort
Dank
Karen Rose bei Knaur
Eine Liste aller Karen-Rose-Romane in chronologischer Reihenfolge:
Verzeichnis der auftretenden Figuren in den Romanen von Karen Rose
Für Christine. Ich bin so froh, dass du Teil meines Lebens bist.
Und wie immer für Martin. Ich liebe dich.
Prolog
Cincinnati, Ohio
Samstag, 9. März, 01.30 Uhr
Lauf. Sieh dich nicht um. Lauf einfach.
Michael Rowland biss die Zähne zusammen, als sich die scharfkantigen Steine und Äste schmerzhaft in seine Fußsohlen bohrten, während er Joshua fester an sich drückte und so schnell rannte, wie er nur konnte.
Er blinzelte gegen die Tränen an und konzentrierte sich einzig auf das Ende der Einfahrt am Fuß des steilen Hügels.
Zur Straße.
Und dann? Er hatte keine Ahnung. Das würde er sich überlegen, wenn er dort war.
Genau wie alles andere.
Aber wo ist »dort« überhaupt?
Still jetzt. Weiterlaufen.
Er widerstand dem Drang, sich umzudrehen, weil er nicht ganz sicher war, ob er Brewer tatsächlich bewusstlos geschlagen hatte oder nicht. Aber selbst wenn, würde Brewer wieder zu sich kommen und ihnen folgen. Sich umzudrehen und nachzusehen, brachte ihn nicht weiter, sondern kostete bloß wertvolle Zeit und machte es Brewer dadurch leichter, sie einzuholen.
Er wird mich umbringen, dachte Michael. Daran bestand kein Zweifel. Aber Joshua würde er noch viel Schlimmeres antun. Und Joshua war erst fünf. Deshalb rannte Michael weiter.
Er näherte sich der Ansammlung von Bäumen, die Joshua immer den »Wald« nannte. Einst ein Obstgarten, war er mittlerweile hoffnungslos verwildert, nichts als ein Gewirr aus Ästen und Zweigen und Brombeergestrüpp, das nahezu alles überwucherte.
Diese blöden Brombeersträucher. Inzwischen blutete er an beiden Füßen. Egal. Die Erleichterung über den Schutz der Bäume ließ ihn den Schmerz kurz vergessen. Los, weiter.Lauf weiter.
Er zog das Tempo an, tauchte behände unter den tief hängenden Ästen durch, heilfroh, dass sein Fußballtrainer der Mannschaft regelmäßig Beweglichkeitsübungen aufs Auge gedrückt hatte. Michael war schnell – der Schnellste im Team, obwohl er der Jüngste war. Trotzdem musste er jetzt noch einen Zahn zulegen. Bitte, mach, dass ich schneller bin.
Das Flackern der Lampe am Ende der Einfahrt schien etwas näher gekommen zu sein, auch wenn es im Dickicht kaum zu sehen war. Die Hälfte des Wegs hatte er hinter sich. Noch eine Viertelmeile.
Er spürte den Zug an seinem Fuß den Bruchteil einer Sekunde, bevor er ausgehebelt wurde und in hohem Bogen nach vorn fiel.
Joshua.
Im letzten Moment drehte er sich zur Seite, schlug hart mit der Schulter auf dem Boden auf. Er unterdrückte ein Stöhnen, als der Schmerz durch seine Schulter schoss und ihn der Schwung des Falls auf den Rücken warf und weiter auf die andere Seite rollen ließ, wo er, die Arme immer noch fest um Joshua geschlungen, mühsam auf die Ellbogen kam.
Blinzelnd holte er Luft, sammelte sich und beugte sich schützend über Joshua, für den Fall, dass Brewer ihnen bereits auf den Fersen war. Doch es kam nichts, keine Schläge, keine Tritte.
Nichts.
Michael hob den Kopf und sah sich um. Niemand war hinter ihm. Vielleicht war es ja gar nicht Brewer gewesen, der ihn gepackt hatte. Vielleicht bin ich bloß über eine Wurzel gestolpert.
Also hatte er Brewer ja vielleicht doch ausgeknockt. Der Gedanke erfüllte ihn mit grimmiger Befriedigung.
Er sah auf Joshua hinab. Der Kleine war immer noch bewusstlos … nicht tot, aber er stand unter Drogen. Was mochte in der Spritze gewesen sein, die der elende Dreckskerl seinem kleinen Bruder gegeben hatte? Michael schickte ein kurzes Dankesgebet gen Himmel, weil er vor dem Zubettgehen noch eine Limo getrunken hatte. Hätte er nicht zur Toilette gemusst, wäre er nicht wach gewesen und hätte nicht gesehen, wie Brewer Joshua die Nadel in die Haut drückte.
Mit gerunzelter Stirn blickte er auf Joshuas friedliches Gesicht. Sollte ich ihn lieber ins Krankenhaus bringen? Aber er wusste nicht so genau, wie er das anstellen sollte. Auch das würde er erst herausfinden müssen – sobald sie weit genug von Brewers Haus weg waren.
Er blickte noch einmal auf Joshuas Brust, die sich hob und senkte. Wenigstens ist er nicht tot.
Michael war zuvor mit verschwommenem Blick die Treppe hinuntergetaumelt – Brewer hatte ihm einen heftigen Schlag gegen die Schläfe verpasst, als er versucht hatte, die Spritze zu fassen zu bekommen – und hatte Brewer mit Joshua auf dem Arm zur Haustür stürmen sehen. Einen grauenvollen Moment lang hatte er gedacht, Joshua sei tot. Weil er sich nicht bewegt hatte.
Michael hatte keine Zeit mit dem Versuch verloren, es herauszufinden – was auch immer Brewer im Schilde führen mochte, es konnte nichts Gutes sein –, sondern war ihm von der dritten Stufe in den Rücken gesprungen und hatte ihn von den Füßen gerissen.
Brewer hatte gerade lange genug von Joshua abgelassen, um Michael einen weiteren Hieb zu verpassen, diesmal in die Magengrube, der Michael hatte rückwärtstaumeln lassen. Dabei hatte er die Kaminschaufel zu fassen bekommen und sie mit voller Wucht auf Brewers Hinterkopf sausen lassen, als dieser sich hinuntergebeugt hatte, um Joshua vom Boden aufzuheben. Brewers Knie hatten nachgegeben, und Michael hatte ihn zur Seite gestoßen, um seinen kleinen Bruder zu schnappen.
Der geatmet hatte. Gott sei Dank.
Also war er losgerannt, mit Joshua in den Armen.
Mit schmerzverzerrtem Gesicht kam Michael auf die Knie und legte Joshua vorsichtig auf dem Boden ab, ehe er sich umsah.
Schon immer hatte er sich gewünscht, hören zu können, doch nie so sehr wie in diesem Moment. Denn falls Brewer ihnen gefolgt war, könnte er Geräusche wie einen knackenden Zweig oder schwere Atemzüge nicht hören.
Brewer könnte sich überall verstecken. Michael traute dem elenden Mistkerl nicht über den Weg, keinen Meter weit.
Keine Zeit verplempern. Du musst zur Straße.
Mit einem tiefen Atemzug hob er Joshua auf und drückte ihn an seine unversehrte Schulter, dann machte er einen Schritt nach vorn. Ein Schrei stieg in seiner Kehle auf.
Tut das weh. O Gott, es tut so weh. Der Schmerz schoss von seiner Schulter nach oben, durch seinen Nacken bis zum Hinterkopf. Er konnte nur hoffen, dass er nicht versehentlich ein Wimmern ausgestoßen hatte.
Er sah sich noch einmal um und ging weiter, diesmal allerdings langsam. Ja, es tat weh, aber er würde es schaffen. Er hatte schon Schlimmeres erlebt. Viele Male. Und Brewer war schuld daran.
Einen Moment lang wünschte er, der Mann wäre tot, doch dann schüttelte er den Kopf. Nein. Nicht tot. Bloß im Gefängnis. Wo ihm andere schlimme Typen – größere, fiesere – jeden Tag wehtun, Jahr für Jahr, den ganzen Rest seines erbärmlichen Lebens.
Das wäre … wie hatte sein Lehrer es genannt? Ja, genau! Ausgleichende Gerechtigkeit.
Er erreichte den Rand des alten Obstgartens und spähte ins Dunkel. Wieder sah er die flackernde Beleuchtung am Ende der Einfahrt. Nur gut, dass er von dem Flackern gewusst hatte, sonst hätte er noch geglaubt, er habe eine Gehirnerschütterung.
Er trat einen Schritt vor und erstarrte. Scheiße. O Scheiße.
Eilig wich er zurück und ging in Deckung, wobei ihm vor Schmerz Tränen in die Augen schossen. Er blinzelte dagegen an und blickte auf den Wagen, der langsam die Einfahrt in Richtung Straße hinabrollte. Es war zu dunkel, um die Marke, das Modell oder auch nur die Farbe auszumachen, aber eigentlich spielte es auch keine Rolle, denn er wusste auch so, dass es sich um einen BMW530i handelte, Baujahr 2018, alpinweiß mit hellbrauner Lederausstattung. Brewer war sehr stolz auf sein Auto.
Im Schneckentempo kroch der Wagen dahin, mit höchstens fünf Meilen pro Stunde, blieb stehen, rollte weiter.
Er sucht nach uns. O Gott. Was soll ich jetzt machen? Michael verstärkte den Griff um seinen Bruder. Er bringt mich um. Und dann schnappt er sich Joshua und schafft ihn weg. Aber wohin? Er hatte keine Ahnung, wusste nur, dass ihn dort Schlimmes erwarten würde.
Und dann … ein weiteres Scheinwerferpaar erhellte die Dunkelheit, als ein Wagen von der Straße einbog, allerdings war er im trüben Schein der Lampe kaum auszumachen. Michael sah bloß, dass es sich um einen SUV handelte, vermutlich schwarz.
Der SUV kam zum Stehen, und ein Mann stieg aus. Er war groß. Und hatte eine Glatze. Das flackernde Licht spiegelte sich auf seinem kahlen Schädel, als er zu Brewers BMW trat, der inzwischen ebenfalls zum Stehen gekommen war.
Weil der SUV ihm den Weg versperrte.
Der Mann riss die Fahrertür auf. Eine Sekunde später hatte er Brewer am Kragen herausgezogen und zerrte ihn zu seinem SUV. Als sie dort waren, fiel Michael auf, dass Brewer seltsam schlaff wirkte.
Wäre er nicht vor Angst halb wahnsinnig, hätte er gejubelt. Endlich war jemand da, der stärker als Brewer war und ihm einen Löffel seiner eigenen Medizin verabreichte.
Michael runzelte die Stirn, als er sah, wie Brewer sich zu wehren begann. Seine Bewegungen waren langsam, fast wie in Zeitlupe. Brewers Hand verschwand in seiner Tasche, doch der Mann schleuderte ihn zu Boden und nahm etwas an sich.
O Gott. Eine Waffe. Brewer hatte eine seiner Waffen dabei. Er hätte mich umgebracht.
Doch jetzt befand sich Brewers Waffe in der Hand des großen Mannes. Mit angehaltenem Atem verfolgte Michael das Geschehen, wartete nur darauf, dass der Mann dieses Monster tötete, das ihnen seit fast fünf Jahren tagtäglich das Leben zur Hölle machte – seit er ihre Mutter Stella geheiratet hatte.
Die völlig nutzlos war.
Doch der Mann erschoss Brewer nicht, sondern steckte die Waffe ein, riss Brewer hoch und drückte ihn gegen seinen Wagen. Dann legte er ihm seine Pranken um den Hals.
Brewer wehrte sich. Anfangs.
Und dann nicht mehr.
Mit offenem Mund sah Michael zu, wie Brewer ein weiteres Mal erschlaffte und zusammensackte. Der Glatzkopf trat einen Schritt zurück und blickte kopfschüttelnd mit in die Hüften gestemmten Händen auf die reglos daliegende Gestalt.
O Gott. Er hat ihn umgebracht. Der glatzköpfige Riese hat ihn getötet.
Erst jetzt wurde Michael bewusst, dass er laut atmete. Eilig biss er die Zähne zusammen, damit der Mann ihn nicht hören konnte.
Zum Glück war der Kerl immer noch mit Brewer beschäftigt. Er öffnete den Kofferraum des SUV und schwang Brewers Leiche hinein, als wiege sie gerade mal so viel wie eine von Joshuas Actionfiguren.
Dann schlug er den Kofferraum zu, trat zu Brewers BMW und beugte sich über den Fahrersitz. Als er sich wieder aufrichtete, warf er etwas in die Luft und fing es mit einer Hand wieder auf.
Der Schlüssel. Er hatte den Wagenschlüssel abgezogen.
Der Glatzköpfige riss alle vier Türen und den Kofferraum des BMW auf und suchte den Wagen ab, schien aber nicht fündig zu werden. Nach einer Weile schloss er Türen und Kofferraumklappe wieder, steckte Brewers Schlüssel ein, stieg in seinen SUV, setzte ihn rückwärts aus der Einfahrt und fuhr davon.
Michael stieß den Atem aus. Kein Schlüssel. Zwar konnte er nicht fahren, hätte es aber bestimmt irgendwie hingekriegt. Nun stand der Wagen nicht länger als Fluchtmöglichkeit zur Verfügung.
Aber das ist auch nicht nötig. Weil Brewer weg ist.
Und Michael war unendlich müde. Seine Mutter war mit ihren Freundinnen feiern gegangen, dröhnte sich wieder einmal zu. Vermutlich war Brewer deshalb so dreist gewesen, da sich seine Übergriffe sonst eher im Verborgenen abspielten.
Aber jetzt war niemand mehr da, der sie quälen und ihnen wehtun konnte.
Außerdem wusste Michael, wo Brewer seine Waffen aufbewahrte und wie er sie benutzen musste, um seinen kleinen Bruder zu beschützen. Ich bringe Joshua jetzt ins Haus zurück. Und schlafe erst mal. Morgen früh überlege ich mir, was ich tun soll.
Gerade als er den Obstgarten durchquert hatte, regte Joshua sich. Er schlug die Augen auf und lächelte, als er Michaels Gesicht sah.
»Hi«, sagte Joshua.
Zumindest sah es so aus, und Michael konnte ziemlich gut von den Lippen lesen. Vor allem von Joshuas. Michael hatte seinen Bruder beim Sprechen beobachtet, seit er seine ersten Worte gebrabbelt hatte.
Trotz des Schmerzes in seiner Schulter lächelte Michael ihn an. »Alles klar?«, fragte er, da er nicht gebärden konnte, solange er Joshua auf dem Arm hatte.
Joshua nickte schlaftrunken und schloss die Augen wieder.
Ein erleichterter Schauder überlief Michael. Sie waren gerade noch mal davongekommen, und Joshua ahnte von alldem nichts.
Und Brewer? Ich bin froh, dass er tot ist. Um ihn ist es nicht schade.
Cincinnati, Ohio
Samstag, 9. März, 02.15 Uhr
Heute Abend führte der Fluss eine Menge Wasser, bemerkte Cade, als er von seinem Beobachtungspunkt aus die Fluten unter sich vorbeirauschen sah. Zwar drohte noch keine Gefahr, dass das Wasser über die Ufer treten würde, trotzdem war die Strömung schnell. Tödlich. Perfekt für seine Zwecke.
Er wandte sich ab und blickte zu der Leiche im Kofferraum seines SUV. Gut, dass dieses elende Schwein endlich tot ist. Auf Nimmerwiedersehen.
Heute Abend war es knapp gewesen. Zu knapp. Er hatte gedacht, der Elektroschocker, den er ihm an den Hals gehalten hatte, hätte ihn ausgeschaltet, doch dann hatte es John Brewer doch irgendwie geschafft, seine Waffe zu ziehen.
Das war ihm in den vier Jahren seiner »Dienste« an der Gemeinschaft noch nie passiert.
Er zog den Elektroschocker aus der Jackentasche und hielt ihn prüfend in das trübe Licht der Kofferraumbeleuchtung. Er sah ganz normal aus. Vielleicht war er ja nicht voll aufgeladen gewesen. Oder kaputt. So was kam vor. Mehr als einmal hatte er in den Nachrichten von Polizisten gehört, die einen Verdächtigen erschießen mussten, weil der Taser nicht funktioniert hatte, es aber immer für eine faule Ausrede der Bullen gehalten.
Er drückte das Teil auf Brewers Brust und betätigte den Auslöser, woraufhin die Leiche zuckend hochschnellte.
»Whoa! Heilige Scheiße!« Der Elektroschocker funktionierte einwandfrei. Zumindest meistens. Vielleicht hatte Brewer irgendwas eingeworfen, das könnte der Grund sein. Jedenfalls hatte ihn der Widerstand des Mistkerls kurz aus dem Konzept gebracht.
Ihn in seiner eigenen Einfahrt kaltzumachen, war nicht der Plan gewesen. Stattdessen hatte er warten wollen, bis er hier war, am Flussufer, weit weg vom nächsten Nachbarn, wo niemand Brewers Schreie hören konnte.
Stirnrunzelnd blickte er in John Brewers gut geschnittenes Gesicht. Der Scheißkerl ist viel zu oft ungeschoren davongekommen. Er hatte viel zu viele Leute mit seinem aufgesetzten Charme um den Finger gewickelt.
Darunter auch meinen Boss. Normalerweise ließ Richard sich nicht so schnell hinters Licht führen. Außer von mir, natürlich. Cade war sich ziemlich sicher, dass Richard seine außerplanmäßigen »Dienste« an der Gemeinschaft nicht gutheißen würde, sollte er jemals davon erfahren. Andererseits hatte man schon Pferde vor Apotheken kotzen gesehen.
Er hätte nie im Leben gedacht, dass Richard sich auf Menschenhandel einlassen würde, aber genau das hatte er an diesem Abend getan. Brewer hatte versucht, Haus und Grundstück zurückzugewinnen, die er zuvor verzockt hatte, und Richard hatte dem schmierigen Mistkerl erlaubt, seinen fünfjährigen Stiefsohn als zusätzlichen Einsatz draufzulegen, als die kleine Menge Heroin den Mindestanforderungen am Pokertisch nicht genügt hatte.
Bargeld war bei dem Spiel, zu dem Richard unter dem Siegel der Verschwiegenheit einlud, nicht zugelassen, stattdessen wechselten Woche für Woche wertvolle Unikate den Besitzer, einige davon legal, in der Hauptsache aber Schwarzmarktware. Schon häufig hatte Cade sich gefragt, was die Männer mit ihren Gewinnen – Grundstücke, Luxuskarossen, gestohlene Meisterwerke und exotische Tiere, teils lebendig, teils ausgestopft – wohl so anfingen.
Er ging davon aus, dass die Teilnehmer dieser Pokerrunden etwas ganz Bestimmtes im Auge hatten und alles andere vermutlich so schnell wie möglich wieder loswurden. Üblicherweise über Richards weitreichende Kanäle.
Abgesehen von seinem erfolgreichen Casinoboot auf dem Ohio River betätigte sich sein Chef auch als »Vermittler« für die Reichen im Mittleren Westen und Umgebung. Richard wusste, was manche brauchten und andere hatten, brachte die interessierten Parteien zusammen und schuf so die perfekte Voraussetzung für zivilisierte Geschäfte.
Menschen hatten allerdings bis heute Nacht niemals auf der Liste der Gewinne gestanden; das eine oder andere Angebot für menschliche Transplantate durchaus, was an sich schon ein Schock für Cade gewesen war. Aber niemals Menschen. Zumindest nicht, soweit ich weiß.
Die Vorstellung war besorgniserregend. Unwillkürlich fragte Cade sich, wie oft wohl derartige Ware unter der Hand den Besitzer gewechselt haben mochte, während er draußen Wache gestanden hatte, und ob Richard John Brewer an den Tisch gelassen hatte, weil er genau gewusst hatte, dass einer der anderen Spieler Interesse an dem Jungen haben würde.
Er fragte sich, ob er auch Richard würde töten müssen.
Brewer hatte sein Haus so unbedingt zurückgewinnen wollen, dass er dafür sogar seinen eigenen Stiefsohn geopfert hatte, dachte Cade angewidert. Dabei gehörte das Haus Brewer nicht einmal, sondern seiner Frau, zumindest bis eine Woche vor dem Spiel. Eigentlich hatte Richard es als Einsatz gar nicht zugelassen, dann hatte allerdings Brewer mit etwas anderem gelockt, das ebenfalls seiner Frau gehörte – mit ihrem kleinen Sohn.
Verzweifelte Männer seien lausige Pokerspieler, sagte Richard immer, und Brewer war der lebende Beweis für diese Theorie. Er hatte haushoch verloren und war zitternd und kreidebleich vom Tisch aufgestanden.
Hocherfreut hatte der Gewinner des heutigen Spiels Brewer Ort und Zeitpunkt eines Treffens für die Übergabe genannt, allerdings würde es nicht dazu kommen, da der gute Mann zwischenzeitlich … indisponiert war.
Cade riss die Decke von der Gestalt, die im Kofferraum seines Wagens lag, und blickte in die entsetzten, weit aufgerissenen Augen. In denen vielleicht ein Anflug von Trotz lag? Falls ja, werde ich ihn dir mit dem ersten Schnitt heraussäbeln.
Die Welt von einem Pädo-Schwein zu befreien, war etwas, das er an sich schon genoss. Doch die blanke Angst in den Augen dieser Tiere zu sehen, ihre Schreie zu hören, verlieh seinem selbst gewählten Kreuzzug erst die richtige Würze.
Er lächelte Blake Emerson an, den Pädophilen, der sich erdreistet hatte, im Zuge eines Pokerspiels einen kleinen Jungen zu kaufen. »Hi«, sagte er zu dem angemessen verängstigten Mann und deutete auf Brewers Leiche, die direkt neben ihm lag. »Ihr beide kennt euch ja schon, deshalb kann ich darauf verzichten, euch einander vorzustellen. Außerdem ist er ohnehin schweigsam … weil er tot ist. Brewers Tod war weniger qualvoll, als deiner es gleich sein wird, aber dafür kann ich nichts.« Er zuckte die Achseln. »So ist es eben manchmal. Aber wäre er noch am Leben, hätte er dieselben Höllenqualen leiden müssen, auch wenn es letzten Endes keine Rolle spielt, weil keiner von euch davonkommt.«
Und Brewers fünfjähriger Stiefsohn wäre ab sofort in Sicherheit, ebenso wie alle künftigen Opfer dieses elenden Schweins.
Andererseits hatte der Junge nicht in Brewers Wagen gesessen, daher hatte das Arschloch vielleicht gar nicht vorgehabt, ihn Emerson zu übergeben, sondern bloß abhauen wollen. Aber auch das spielte keine Rolle, da er allein für das Angebot den Tod verdient hatte.
Cade runzelte die Stirn. Vielleicht hatte Brewer den Kleinen auch längst in seine Gewalt gebracht und irgendwo versteckt und war gerade unterwegs dorthin gewesen, um ihn zu holen und seinem neuen »Besitzer« zu übergeben.
Bittere Galle stieg in Cades Kehle auf, füllte seine Mundhöhle.
»Verdammt!« Er musste sich vergewissern, dass es dem Kleinen gut ging, andererseits konnte er schlecht mit einer Leiche und einem Gefangenen im Wagen zu Brewers Haus zurückfahren. Viel zu riskant. Er nahm die Elektrosäge aus der Kiste im Kofferraum und wedelte damit vor der Nase des Pädophilen herum.
»Soll ich dir zuerst mal was abschneiden? Nein?«, antwortete er für den Mann, der wegen des Knebels nicht sprechen konnte. »Gute Entscheidung. So kannst du genau sehen, was mit dir passiert, und bist am Leben, damit du jeden Schnitt spüren kannst.«
Er zerrte Brewers Leiche aus dem Wagen und ließ sie auf den Boden plumpsen, ehe er die Elektrosäge einschaltete, wobei er darauf achtete, dass sein gefesselter Gefangener alles gut im Blick hatte.
»Als Erstes die Finger«, erklärte er seinem entsetzten Zuschauer. »Und dann seinen Schwanz. Dafür, dass er dir seinen Jungen verkaufen wollte. Aber ich werde mit deinem Schwanz anfangen. Weil du den kleinen Jungen in deine Gewalt gebracht und sein Leben zerstört hättest. Danach gehe ich standardmäßig vor. Arme und Beine, dann sein Kopf. An der Stelle wird es dann ein bisschen fies, vor allem, wenn man noch lebt, was bei dir der Fall sein wird. Eine Schande, dass Brewer tot ist. Es hätte mir gut gefallen, wenn er hätte zusehen können, wie du dich windest und zappelst. Aber das wirst du an seiner Stelle erleben.«
Und wenn sie hier fertig waren, würde Cade nach dem Jungen sehen. Sich vergewissern, dass es ihm gut ging.
Cincinnati, Ohio
Samstag, 9. März, 05.40 Uhr
Michael rutschte auf dem Sessel in der Ecke von Joshuas Zimmer nach hinten und versuchte, es sich irgendwie bequem zu machen, während er über seinen kleinen Bruder wachte, der friedlich in seinem Bett schlief, ohne zu ahnen, was sich heute Nacht abgespielt hatte. Immerhin. Wenn Joshua aufwachte, würde er nicht mehr wissen, dass ihr Stiefvater ihn unter Drogen gesetzt hatte, ebenso wenig würde er sich an ihre Flucht durch den alten Obstgarten erinnern.
Anfangs hatte Michael sich in sein eigenes Bett gelegt, um zu schlafen. Er hatte es versucht. Wirklich. Erschöpft genug war er. Doch sobald ihm die Augen zugefallen waren, hatte er Brewer gesehen, wie er Joshua die Spritze in den Arm rammte und ihn wegtrug. Er hatte sich gezwungen, das Bild zu verdrängen und daran zu denken, wie Brewers Körper unter den Pranken des riesigen Glatzkopfs schlaff wurde, doch sein Verstand hatte sich geweigert und stattdessen immer wieder einen Brewer heraufbeschworen, der aufstand und entkam. Dabei war es nicht so gewesen, doch solange Michael nicht sicher sein konnte, dass Brewer tot war, saß er wie auf glühenden Kohlen und wartete nur darauf, dass der Mann seiner Mutter wieder nach Hause kam.
Deshalb war er aufgestanden und in Joshuas Zimmer gegangen, um über ihn zu wachen. Schließlich gab es sonst niemanden, der das tun würde. Ihre Mutter hatte sich ohnehin nie sonderlich um ihn und Joshua gekümmert, doch seit Brewer bei ihnen lebte, war alles noch viel schlimmer geworden.
Wieder rutschte er auf dem Sessel herum und erstarrte, als ihm ein vertrautes Rumpeln unter seinen Füßen einen Schauder durch den ganzen Körper jagte.
Das Garagentor. Jemand hatte es aufgeschoben.
Jemand ist hier.
Michael sprang auf, tastete nach der Waffe, die er aus Brewers Safe genommen hatte, steckte sie in den Bund seiner Jeans und sah sich hektisch um. Sein erster Impuls war, Joshua aus dem Bett zu reißen.
Doch er erstarrte neuerlich. Es war zu spät. Jemand kam.
Jemand ist hier.
Brewer? Oder … Der Glatzkopf, der Brewers Schlüssel in die Luft geworfen und wieder aufgefangen hatte. War er zurückgekommen? Hatte er zuerst Brewer getötet und jetzt … sind wir dran?
O Gott. Er hat mich gesehen und weiß, dass ich beobachtet habe, wie er Brewer getötet hat. Er denkt, ich verrate ihn. Und deswegen bringt er auch mich um.
Lauf, sagte ihm sein Instinkt. Bis sein Blick auf seinen kleinen Bruder fiel, der immer noch schlafend im Bett lag. Ich passe auf dich auf. Ich lasse nicht zu, dass er dich anfasst. Das verspreche ich.
Er verkroch sich hinter dem Sessel und zog die Waffe. Er würde jeden töten, der durch diese Tür trat. Bis auf ihre Mutter. Sie würde er am Leben lassen. Obwohl sie es nicht verdiente.
Er war zu ihr gegangen, völlig verstört, verängstigt, blutend, hatte ihr erzählt, was Brewer getan hatte. Das erste Mal war es vor gut zwei Jahren passiert, dann ein zweites und ein drittes Mal. Sie hatte ihm nicht geglaubt. Oder hatte es zumindest behauptet.
Du lügst doch, hatte sie gesagt. Michael spürte noch das Brennen ihrer Ohrfeige auf seiner Wange. Es grenzte an ein Wunder, dass sie ihm keinen Zahn ausgeschlagen hatte. Aber er hatte nicht gelogen. Die Dinge, die ihr Ehemann ihm angetan hatte, stimmten.
Er hatte gedroht, zur Polizei zu gehen, in der Hoffnung, dass man ihm dort Glauben schenken würde, doch seine Mutter hatte nur gemeint, dass die ihn mitnehmen würden – und sie vielleicht auch. Er und Joshua kämen ins Heim, aber nicht zusammen. Man würde sie auseinanderreißen, und jeder wüsste, was mit Kindern in den Heimen passierte. Die würden Joshua wehtun, und Michael wäre schuld. Es sei denn, er hielte den Mund. Also hatte er genau das getan. Hatte die nächtlichen »Besuche« seines Stiefvaters über sich ergehen lassen, während er darauf gehofft hatte, eines Tages würde es enden und Brewer verschwinden.
Und genauso war es gekommen. Weil er tot ist.
Erschaudernd verdrängte er den Gedanken. Nicht jetzt. Er durfte die Nerven nicht verlieren, musste sich zusammenreißen. Später, wenn Joshua in Sicherheit war, konnte er loslassen, sich seinem Schmerz hingeben.
Joshua war der einzige Grund, weshalb er hiergeblieben war, in dieser Hölle.
Mit beiden Händen umklammerte er die Pistole, damit sie nicht zitterten, zwang sich, die Augen offen zu lassen, obwohl er sie am liebsten ganz fest zusammengekniffen und so getan hätte, als würde all das nicht gerade passieren. Denn die Tür ging auf. Ganz langsam.
Er hielt den Atem an, sein Herz hämmerte wie verrückt. Nein, nein, nein. Es durfte nicht Brewer sein. Brewer war tot. Bitte mach, dass er tot ist. Mach, dass es Mom ist. Bitte.
Ein Schatten erschien im Türrahmen. Groß. Riesig.
Es war der Mann. Der Glatzköpfige. Der Brewer mit bloßen Händen getötet hatte. Er war hier, durchquerte das Zimmer. Das Mondlicht spiegelte sich auf seinem kahlen Schädel wider, als er am Fußende von Joshuas Bett stehen blieb.
Michael konnte sein Gesicht klar und deutlich erkennen, speicherte alle Details in seinem Gedächtnis ab, damit er sie später der Polizei beschreiben konnte.
Nein, nein, das geht nicht. Du kannst der Polizei gar nichts sagen. Weil sie ihm nicht glauben würden. Seine Mutter würde erzählen, er sei ein Lügner. So wie damals, als er ihr offenbart hatte, dass ihr frisch angetrauter Ehemann nachts zu ihm ins Bett kam.
Sie wird einen Weg finden, mir die Schuld zu geben. Wie immer.
Sein Blick fiel auf die Waffe zwischen seinen zitternden Fingern. Ich muss der Polizei gar nichts erzählen. Weil ich ihn töten werde.
Aber der Mann rührte Joshua nicht an. Sondern stand einfach da, den Blick auf seinen kleinen Bruder geheftet. Nicht einmal ein Anflug von Wut zeichnete sich auf seinem Gesicht ab, und auch nicht diese schmierige Anzüglichkeit, die Michael so oft bei Brewer gesehen hatte. Stattdessen wirkte der Mann beinahe … erleichtert. Was völlig unlogisch war.
Abrupt hob der Riese den Blick. Erschrocken fragte Michael sich, ob er ein Geräusch verursacht hatte, doch der Mann machte auf dem Absatz kehrt und verließ das Zimmer.
Erleichtert ließ Michael sich gegen die Wand sinken und stieß den Atem aus, den er unwillkürlich angehalten hatte. Minuten später spürte er, wie das Garagentor geschlossen wurde.
Er schlich ans Fenster und spähte in die nächtliche Dunkelheit hinaus. Und holte tief Luft, als er den Glatzkopf mit einem Koffer in der Hand die Einfahrt hinunterlaufen sah, in Richtung des flackernden Lichts.
Er war weg.
Michael und Joshua waren wieder allein.
Er begann am ganzen Leib zu zittern und schaffte es gerade noch zum Sessel, ehe seine Beine nachgaben. Die Frage, was der Kerl getan hätte, wenn er ihn entdeckt hätte, erübrigte sich – er hätte Michael gepackt und ihn gewürgt, bis er erschlafft wäre, so wie er es mit Brewer getan hatte.
O Gott. O Gott. Ich wäre tot. Und Joshua wäre ganz allein, ohne jeden Schutz. Er blickte auf die Waffe in seiner Hand. Er war wie erstarrt gewesen. Eigentlich hätte er den Mann erschießen sollen, doch er hatte es nicht gekonnt.
Nächstes Mal wird es nicht so sein. Sollte er zurückkommen, werde ich bereit sein.
1. Kapitel
Cincinnati, Ohio
Samstag, 16. März, 11.30 Uhr
Diesel Kennedy pfiff ab und bedeutete den Knirpsen, sich zu ihm an den Spielfeldrand zu begeben. »Das reicht für heute, Jungs. Kommt rüber.«
Lächelnd sah er zu, wie die zehn Jungen, allesamt im Kindergartenalter, das Spielfeld verließen. Sie sahen so niedlich aus in ihren Stollenschuhen und den Schienbeinschützern. Nur zwei von ihnen hatten echtes Talent, die anderen trafen den Ball nicht, fielen um oder purzelten übereinander wie bei einer Slapsticknummer. Gleichzeitig strengten sie sich wirklich an und schienen großen Spaß zu haben, was für Diesel im Vordergrund bei seinem Trainingsprogramm stand.
Mittlerweile engagierte er sich seit fünf Jahren für die Kinder und war fest entschlossen, dass keines von ihnen dieselben Erfahrungen machen musste wie er in diesem Alter. In seinem Leben hatte es keine männlichen Vorbilder gegeben, stattdessen hatte ihm derjenige, der ihn hätte beschützen sollen, Verletzungen zugefügt, unter denen er bis zum heutigen Tage litt. Daher war es ihm ein Herzensanliegen, jedem einzelnen Kind in seiner Obhut die richtigen Werte zu vermitteln, ihm beizubringen, wie man gewann oder auch mal verlor, wie man sich in die Mannschaft integrierte und ein Team bildete. Und auch, den Mund aufzumachen, sich durchzusetzen oder um Hilfe zu bitten.
Er kannte sämtliche Anzeichen von Missbrauch und schaltete in seiner Funktion als staatlich anerkannter Betreuer das Jugendamt ein, wann immer er den Verdacht hatte, dass ein Kind misshandelt wurde. Vier Minderjährige hatte er dadurch in den letzten fünf Jahren aus ihrer Zwangslage befreien können.
Mit seinem Engagement mochte er vielleicht nicht die ganze Welt retten, aber immerhin konnte er sich mit der Gewissheit trösten, dass vier der kleinen Jungen heute in Sicherheit waren. Ein Kind nach dem anderen zu retten, solange es nur irgendwie ging, das war seine Devise. Und im Zuge dessen brachte er ihnen weiterhin Sportsgeist und Kameradschaftlichkeit bei, etwas, wovon jedes Kind nur profitieren konnte.
Er hob die Hand, um mit den Kleinen abzuklatschen, die sich um ihn geschart hatten und hochspringen mussten, um seine Hand zu berühren. Mit seinen knapp zwei Metern ragte er wie ein Leuchtturm über die Fünfjährigen, die die Köpfe weit in den Nacken legen mussten, wenn sie ihm ins Gesicht blicken wollten.
»Ihr wart echt gut heute. Ich bin sehr stolz auf euch.« Zehn kleine Gesichter strahlten. »Also, zu nächster Woche. Da findet euer erstes Spiel statt! Und freuen wir uns darüber?«
»Jaaaa, Coach Diesel!«, riefen sie.
»Und was passiert, wenn wir gewinnen?«
»Dann gibt’s Eiscreme!«
»Ganz genau.« Er hob die Brauen. »Und wenn wir verlieren?«
Die Knirpse sahen einander an, dann runzelte einer von ihnen die Stirn, als er fieberhaft sein Gedächtnis zu durchforsten schien, denn Diesel hatte nach jedem Training in den letzten zwei Wochen dasselbe gefragt. »Auch Eiscreme?«, fragte er schüchtern.
Grinsend streckte Diesel ihm die Faust zum Check hin, während er sein eigenes Gedächtnis nach dem Namen des Jungen mit dem dunklen Haar, den dunklen Augen und dem kleinen Grübchen am Kinn durchsuchte … Richtig. Joshua Rowland. »Ganz genau, Joshua! Es gibt Eiscreme, ganz egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Gewinnen ist super, aber nicht das Wichtigste. Denn was sind die drei wichtigsten Dinge beim Fußball?« Er hob drei Finger und ließ erwartungsvoll den Blick in die Runde schweifen.
»Es soll Spaß machen!«, riefen alle.
Er nickte. »Das ist die Nummer eins. Was ist Nummer zwei?«
»Wir sollen unser Bestes geben!«
»Sehr gut. Und das Dritte?«
Wieder ratlose Gesichter. Fragend sahen die Jungs zu Diesel hoch.
Joshua meldete sich ein weiteres Mal. »Nett sein?«
Sichtlich verlegen, weil es ihnen entfallen war, nickten die anderen eifrig und wiederholten die Antwort.
Diesel musste ein Lächeln unterdrücken. Die winzigen Burschen waren so was von süß. »Ganz genau. Man soll immer ein guter Sportsmann sein, das heißt, wir sind nett zueinander. Wenn wir verlieren, lächeln wir und gratulieren den Siegern. Und dann gehen wir Eis essen. Und wenn wir gewinnen, nehmen wir die Glückwünsche des Gegners entgegen und gehen Eis essen. Egal, wie das Spiel ausgeht, es gibt Eiscreme. Es gibt nur einen Grund, weshalb keiner ein Eis kriegt, und zwar …?«
»Wenn wir schlechte Sportsmänner sind.«
»Ganz genau.« Er blickte über die Schulter zu den Eltern, die sich bereits eingefunden hatten, um ihre Sprösslinge abzuholen. »Eure Moms und Dads sind hier. Also, stellt euch in einer Reihe auf und wartet, bis ich euch aufrufe. Vorher bekommt ihr noch euren Snack von Mrs Moody. Und was sagt ihr zu ihr?«
»Danke, Mrs Moody!«, riefen sie im Chor, während seine Assistentin sie in einer Reihe aufstellte und Snacks und Getränke verteilte. Shauna Moody war eine reizende, mütterliche Frau, deren Sohn während seiner Schulzeit in der Fußballmannschaft gespielt hatte. Mittlerweile ging er aufs College, und da sie die Ansicht vertrat, dass er dank des Fußballs beschäftigt gewesen und nicht auf die schiefe Bahn geraten war, wollte sie sich revanchieren und war jede Woche mit Kinderpflastern und etwas Süßem zur Stelle.
Diesel wandte sich mit dem Klemmbrett in der Hand den wartenden Eltern zu. Im Lauf der Jahre hatte er auch Kids betreut, deren Eltern in einen erbitterten Sorgerechtsstreit verstrickt waren, daher vergewisserte er sich stets, dass jeder seiner Schützlinge in die Obhut des Elternteils entlassen wurde, der es offiziell abholen durfte. Es konnten die schlimmsten Dinge passieren, wenn ein Kind in die Hände der falschen Person geriet.
Das wusste er aus eigener schmerzhafter Erfahrung.
Eine Mutter – ihr Junge wurde als Neunter aufgerufen – zögerte kurz, ehe sie vorsichtig lächelte. »Sie machen das wirklich toll«, sagte sie, wobei ein Anflug von Erstaunen in ihrer Stimme mitschwang.
Diesel wappnete sich innerlich für das, was als Nächstes kommen könnte. Bereits beim ersten Training waren ihm ihr Misstrauen und Argwohn aufgefallen. »Ich bemühe mich nach Kräften.«
Und das tat er auch. Denn keiner hatte sich um ihn gekümmert, als er fünf Jahre alt gewesen war. Deshalb war ihm wichtig, dass diese Jungs ein besseres Vorbild bekamen, als er es gehabt hatte. Was, offen gestanden, nicht allzu schwierig war, denn er hatte in seiner Kindheit nur wenig Zuspruch oder sonst etwas Positives durch Erwachsene erfahren.
Sollte diese Mutter ihren Jungen aus dem Team nehmen wollen, würde er höflich bleiben, ihrem Wunsch nachkommen und direkt danach das erste Kind von der Warteliste drannehmen, die mittlerweile rund zwei Dutzend Namen umfasste.
Die Mutter, Mrs Jacobsen, musterte ihn eingehend. »Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, Mr Kennedy. Als wir das erste Mal mit Liam hier waren, habe ich Ihre Tattoos gesehen und … na ja, ich dachte, Sie seien …«
Diesels Mundwinkel hoben sich. Das Gespräch schien sich doch in eine andere Richtung zu bewegen, als er befürchtet hatte. »Ein Fiesling? Ein wilder Schlägertyp?«
Sie lachte nervös. »Ja, so etwas in der Art. Wir versuchen, unserem Sohn beizubringen, andere Menschen nicht nach dem Äußeren zu beurteilen, aber genau das habe ich wohl bei Ihnen getan. Gleichzeitig haben meine Freunde in den höchsten Tönen von Ihnen geschwärmt, deshalb habe ich Liam erlaubt, dem Verein beizutreten. Worüber ich jetzt sehr froh bin. Ich habe mich geirrt, und es tut mir leid.«
»Danke«, erwiderte er freundlich. »Ich hoffe, Liam gefällt es bei uns.« Er zwinkerte dem Knirps zu. »Er ist ein toller Junge.«
Liam strahlte. »Tschüss, Coach Diesel.«
Diesel winkte ihnen hinterher, ehe er sich mit einem lautlosen Seufzer wieder seiner Liste zuwandte. Ein Name blieb übrig. Ein Junge, den niemand abholen gekommen war. Er drehte sich um und sah Joshua Rowland neben Mrs Moody auf einem der Klappstühle sitzen. Mit verkniffener Miene suchte der Kleine den Parkplatz nach dem Wagen seiner Mutter ab.
Bislang war Mrs Brewer zu jedem Training zu spät gekommen. Diesel hatte sie sogar auf dem Handy anrufen und daran erinnern müssen, dass ihr Sohn auf sie wartete. Sie hätte so viel um die Ohren, und es tue ihr schrecklich leid, hatte sie jedes Mal gesäuselt, doch Diesel beschlich allmählich der Verdacht, dass sie es eher darauf anlegte, selbst Aufmerksamkeit zu bekommen, als dass sie sich um Joshuas Wohlergehen sorgte.
Er wählte ihre Handynummer, doch es sprang bloß die Voicemail an, wo er eine höfliche Nachricht hinterließ, ehe er Joshua anlächelte. »Deine Mom verspätet sich ein bisschen. Aber du könntest mir ja helfen, die Fußbälle einzusammeln, bis sie kommt.«
Sofort sprang Joshua auf. Er wollte unbedingt helfen, es jedem recht machen.
Diesel blutete das Herz. Der Junge erinnerte ihn schmerzlich an sich selbst. Kinder, die so darauf bedacht waren, jedem zu gefallen, waren leichte Beute für üble Kerle.
Sie verstauten das Equipment auf der Ladefläche von Diesels Pick-up; wieder musste Diesel ein Lächeln unterdrücken, als er zusah, wie Joshua die Heckklappe schloss und sich mit einem hochzufriedenen Lächeln den Staub von den Händen wischte.
Gleichzeitig entging ihm nicht, dass der Kleine die ganze Zeit den Parkplatz im Auge behielt und sich seine Miene erneut verdüsterte, als auch jetzt weit und breit nichts von seiner Mutter zu sehen war.
Joshuas Augen füllten sich mit Tränen. »Was soll ich jetzt machen? Ich kenne den Heimweg nicht.«
Mrs Moody, die sie vom Spielfeldrand aus beobachtet hatte, trat zu ihnen und nahm den Jungen in die Arme. »Du musst nicht ganz alleine nach Hause gehen, Schatz«, sagte sie. »Natürlich bringen wir dich.«
Joshua blickte zuerst sie, dann Diesel an. »Na gut. Tut mir leid.«
Diesel ging vor ihm in die Hocke und sah ihm in die Augen. »Es gibt nichts, wofür du dich entschuldigen müsstest, Kumpel. So was kommt nun mal vor.«
Joshua schluckte. »In letzter Zeit ist sie immer so traurig. Und …« Er biss sich auf die Lippe. »Und sie schläft ganz viel.«
Diesel biss die Zähne aufeinander. Jetzt wurde es heikel. Ein Elternteil, das unter Depressionen litt, war nicht zwingend unfähig, für sein Kind zu sorgen. Hier galt es, mit größter Vorsicht vorzugehen. Joshuas Mutter hatte ganz normal gewirkt, als sie ihn abgeliefert hatte, und Joshua selbst wies keine Anzeichen von Vernachlässigung auf. Seine Kleider waren sauber – zumindest vor dem Training –, außerdem wirkte er gut genährt, und Diesel waren auch keine Blutergüsse oder sonstigen verdächtigen Verletzungen an ihm aufgefallen.
»Und wer passt auf dich auf, wenn sie schläft, Joshua?«, fragte er.
Joshuas Züge erhellten sich. »Michael. Er kümmert sich um mich.«
Obwohl sämtliche Alarmglocken in ihm schrillten, lächelte Diesel. Michael war Joshuas großer Bruder, aber gerade einmal vierzehn. Im Zuge seiner Recherchen für den Ledger, für den er seit etlichen Jahren arbeitete, waren ihm Konstellationen wie diese häufiger untergekommen. Viel zu oft mussten sich die Älteren um ihre kleinen Geschwister kümmern; manchmal, weil die Eltern alleinerziehend waren und mehrere Jobs auf einmal stemmen mussten, um ihre Familie zu ernähren, doch das traf auf Joshua Rowlands Mutter nicht zu. Sie war mit einem gewissen John Brewer verheiratet, den Diesel allerdings bisher nie zu Gesicht bekommen hatte. Dass die Jungs einen anderen Nachnamen hatten, ließ darauf schließen, dass Brewer sie nicht adoptiert hatte, was jedoch an und für sich nichts Schlimmes bedeuten musste.
Brewer schien jedenfalls nicht am Hungertuch zu nagen. Die Familie lebte in einem noblen Viertel mit feudalen Häusern und Grundstücken so groß, dass sie als »Anwesen« bezeichnet wurden. Mrs Brewer trug Designerklamotten, fuhr einen teuren Wagen und ging laut Anmeldeformular keiner Tätigkeit nach … und schon gar nicht zwei oder mehreren Jobs.
Eigentlich müsste sie Zeit haben, sich um ihre Kinder zu kümmern, oder zumindest genug Geld, um eine Nanny zu engagieren. Wenn sie also ihren älteren Sohn einspannte, damit er sich um Joshua kümmerte, stimmte hier etwas anderes nicht.
Er bemühte sich um einen sanftmütigen Tonfall, was bei seinem rauen, kernigen Bass nicht ganz einfach war, deshalb lächelte er freundlich. »Und was tut Michael so für dich?«
»Er wäscht meine Sachen. Spielt mit mir. Liest mir abends was vor und macht mir morgens Frühstück. Eier und Speck«, fügte Joshua sichtlich stolz hinzu. »Weil ich groß und stark werden muss und Haferflocken nicht reichen, sagt er.«
»Da hat er ganz recht«, bestätigte Diesel. »Ich sehe schon, wie du gerade immer größer wirst.«
Wie beabsichtigt, kicherte Joshua belustigt. »Nein, das kann gar nicht sein.«
Diesels Lippen zuckten. »Na ja, vielleicht nicht in dieser Sekunde, aber es ist mir aufgefallen. Und wer holt dich aus der Vorschule ab?«
»Michael. Er bringt mich nach Hause.« Joshuas Lächeln verblasste, und er biss sich neuerlich auf die Lippe. »Aber Michael ist auch immer traurig, und ich schaffe es nicht, dass er wieder lacht.«
Diesel blickte in Mrs Moodys mitfühlende Augen, ehe er sich wieder dem kleinen verlorenen Jungen zuwandte. »Und warum ist Michael immer traurig?«
Joshua zuckte die Achseln und blickte auf seine Füße. »Mama schreit ihn ganz oft an. Vor allem, seit Onkel John weg ist.«
Du lieber Gott. Wieder schlugen Diesels sämtliche Alarmglocken an. »Onkel John?«
»Er ist ihr Mann.« Joshua runzelte die Stirn. »Aber nicht mein Daddy. Der ist nicht mehr da. Sondern im Himmel.«
»Ah.« Für sich genommen, war es kein Problem, wenn ein Junge seinen Stiefvater »Onkel« nannte, aber in der Summe … »Und wieso ist Onkel John nicht mehr da?«
Wieder Achselzucken. »Mom sagt, es sei alles Michaels Schuld. Aber Michael ist nett.«
»Ganz bestimmt, mein Kleiner«, murmelte Diesel. »Und …« Er hielt inne und holte Luft. »Schlägt deine Mom deinen Bruder auch manchmal? Oder dich?«
Joshuas bekümmerte Miene sprach Bände.
Verdammt. Diesel lauschte bedrückt, während seine Entschlossenheit wuchs. Niemand würde diesem Jungen wehtun. Für ihn selbst mochte damals niemand da gewesen sein, aber er würde dafür sorgen, dass kein Kind in seinem Umfeld erdulden musste, was ihm widerfahren war, bei Gott.
Sein Herz schlug für diese Kids, für all jene, die Opfer von Vernachlässigung und Missbrauch wurden. Erst als er ein heftiges Druckgefühl in der Brust verspürte, wurde ihm bewusst, dass er sich den Handballen fest auf die Herzgegend gepresst hatte – eine Erinnerung daran, dass seine Tage auf Erden gezählt waren. Manchmal vergaß er schlicht, dass noch immer eine Kugel dort steckte – abgefeuert von einem Rebellen der al-Qaida und zu dicht am Herzen, um sie operativ zu entfernen. Eines Tages würde sie verrutschen und damit seinem Leben ein Ende machen.
Inzwischen hatte er sich daran gewöhnt und war fest entschlossen, das Maximum aus seinen Leben herauszuholen, ganz egal, wie viele Jahre – oder gar Tage – es am Ende sein mochten. Sich anderer Leute Kinder anzunehmen, war seine Lebensaufgabe.
Und Joshua Rowland war soeben ganz nach oben auf seiner Prioritätenliste geklettert.
Cincinnati, Ohio
Samstag, 16. März, 11.30 Uhr
»Mom!« Michael blickte auf die Wanduhr und rüttelte seine Mutter an der Schulter. Seine Stimme klang rau, als er ihren Namen hervorstieß, und er wusste, dass sie es nicht leiden konnte, wenn er den Mund aufmachte.
Dabei war es nicht immer so gewesen. Zwar hatte sie ihn nie sonderlich unterstützt, aber gehasst hatte sie ihn auch nicht. Bis Brewer in ihr Leben getreten war. Davor mochte vielleicht nicht alles perfekt gewesen sein, aber seit dieser elende Mistkerl hier wohnte, war sein Leben die reinste Hölle.
Vor Brewer war es zwar schwierig mit ihr gewesen, sie hatte jedoch keine Drogen genommen. All das hatte sich verändert. Und im letzten Jahr war es noch viel, viel schlimmer geworden. Früher hatte sie ihn nie geschlagen. Aber jetzt …
Manchmal ging sie mit Fäusten auf ihn los, meist aber beschränkte sie sich darauf, ihm nachzuwerfen, was sich gerade in Reichweite befand. Heute Morgen war es eine Müslischüssel gewesen. Er war so damit beschäftigt gewesen, Joshua das Frühstück zu machen, dass er zunächst nichts bemerkt hatte.
Vorsichtig berührte er seine Schläfe und zuckte zusammen, als er das Blut an seiner Fingerspitze sah. Er hatte die Wunde notdürftig gereinigt, und irgendwann würde sie schon aufhören zu bluten, der hämmernde Schmerz nachlassen. Irgendwann …
Jetzt war erst einmal Joshua wichtig.
»Mom.« Sie hätte längst losfahren sollen, um ihn vom Fußballtraining abzuholen, hätte dabeibleiben und auf ihn warten sollen, hatte es aber nicht getan. Stattdessen hatte sie beim Nachhausekommen wieder mal diese glasigen Augen gehabt – immer ein schlechtes Zeichen.
Sie war high gewesen, hatte wahrscheinlich schon während der Fahrt ein paar Pillen eingeworfen. Und jetzt lag sie, eine gebrauchte Spritze auf dem Beistelltisch neben sich, auf dem Sofa. Immerhin atmete sie noch, sprich, sie war nicht tot. Kurz überlegte er, die Polizei zu rufen und dafür zu sorgen, dass die ihren jämmerlichen Arsch wegen Heroinbesitzes und Verwahrlosung geradewegs in den Knast verfrachteten, aber zuerst musste er sich um Joshua kümmern.
Eigentlich sollte er genau jetzt abgeholt werden. Was, wenn der Coach ihn einfach dort gelassen hatte und Joshua versuchte, ganz alleine heimzulaufen? Der Trainingsplatz war sechs Meilen entfernt. Was, wenn irgendein perverses Schwein ihn sich schnappte? Wenn der Glatzkopf ihn abpasste?
O Gott, o Gott, o Gott.
Michael schnappte sich sein Handy und die Hausschlüssel, warf einen Blick auf die Wagenschlüssel seiner Mutter, ehe er den Kopf schüttelte. Allein die Idee war völlig verrückt. Sein Kopf tat weh, und ihm war schwindlig. Er hätte nie im Leben einen Wagen fahren können, selbst wenn er gewusst hätte, wie es ging. Auch mit dem Fahrrad wäre es riskant gewesen, aber das hatte sich ohnehin erledigt.
John hatte sein Rad vor Monaten verkauft – er brauche ein bisschen Bares, hatte er gemeint. Was an sich schon schlimm war, dabei hatte John das Fahrrad noch nicht einmal bezahlt, sondern Michael hatte es von dem Geld gekauft, das er mit Rasenmähen bei den Nachbarn verdient hatte.
Aber das war jetzt nicht mehr wichtig. Er musste Joshua abholen. Und zwar schleunigst.
Nur gut, dass er ein erstklassiger Läufer war.
Cincinnati, Ohio
Samstag, 16. März, 12.05 Uhr
Verdammt. Diesel kämpfte gegen seine Wut an. »Schlägt deine Mutter euch beide?«, fragte er weiter, um einen ruhigen Tonfall bemüht. Erleichterung durchströmte ihn, als Joshua den Kopf schüttelte.
»Nein, nur Michael«, flüsterte der Kleine und blinzelte, woraufhin ihm die Tränen über das Gesicht liefen. »Sie wirft auch Sachen nach ihm. Und sagt, er hätte ihr Leben zerstört. Wieso ist sie so gemein zu ihm?«
Diesel holte neuerlich tief Luft. »Ich weiß es nicht«, antwortete er und drehte sich um, als sich Joshuas Züge unvermittelt erhellten.
»Da ist er. Michael ist da!« Er sprang auf und stürmte seinem Bruder entgegen, der über den Parkplatz gesprintet kam. Als er Joshua sah, ging er auf die Knie und breitete schwer atmend die Arme aus.
Bis Diesel aufstand und sich umdrehte. Sämtliche Farbe wich aus Michael Rowlands Gesicht. Er verlor das Gleichgewicht und kippte nach hinten weg, wobei er Joshua so fest an sich drückte, dass dieser in seinen Armen zappelte. Michael starrte Diesel an, als hätte er ein Gespenst vor sich. Seine Atemzüge waren langsamer geworden, so langsam, dass Diesel noch nicht einmal sicher war, ob der Junge überhaupt noch atmete.
»Lass los, Michael.« Joshua drückte Michael von sich und versuchte, sich zu befreien. »Meine Hände!«
Doch der Junge machte keine Anstalten, seinen kleinen Bruder loszulassen, sondern starrte Diesel weiter an. Diesel kannte diesen Ausdruck nur zu gut. Grauenvolle Angst.
Aber warum? Soweit er wusste, hatte er Michael Rowland noch nie gesehen. Er warf Mrs Moody einen kurzen Blick zu. Auch sie schien von Michaels Reaktion verwirrt zu sein.
Diesel hob beide Hände und trat vorsichtig auf die beiden Brüder zu. »Michael?«
»Er kann Sie nicht hören!«, ächzte Joshua, während er sich noch immer aus dem schraubstockartigen Griff zu befreien versuchte. »Er spricht mit den Händen.«
Oh. Alles klar. Diesel kannte ein paar Gesten. Na ja, eigentlich nicht bloß ein paar. Vielmehr lernte er Gebärdensprache, nachdem er Dr. Danika Novak, deren Bruder Greg gehörlos war, das erste Mal gesehen hatte.
Greg hatte sich vor einiger Zeit an ihn gewandt und um Unterstützung bei einer »Computerrecherche« gebeten, wie Diesel es bezeichnete, weil »Hacking« so derb klang, so ohne jede Finesse, dabei hatte er es zur Kunstform erhoben, die er mit großem Stolz betrieb. Diesel hatte gehofft, dass Greg zu unterstützen auch bedeutete, mehr Zeit mit Gregs Schwester verbringen zu können, was aber nicht der Fall war. Noch nicht.
Diesel hatte die Hoffnung nicht aufgegeben. Noch nicht.
Er wünschte, Dani wäre jetzt hier. Sie würde die richtigen Worte finden, um diesen verängstigten Jungen zu beruhigen. Aber ich bin nun mal auf mich gestellt.
Langsam ließ er sich auf die Knie sinken, um nicht mehr so groß und weniger bedrohlich zu wirken, und hob zögernd die Hände.
»Hab keine Angst. Ich tue dir nichts. Versprochen«, gebärdete er.
Michael blinzelte und blickte auf Diesels Hände, daher wiederholte Diesel die Zeichen. »Ich bin Coach Diesel«, fügte er hinzu, wobei er das Wort Coach buchstabieren musste, weil er die Zeichen dafür nicht kannte. »Freut mich, dich kennenzulernen, Michael.«
Michael starrte ihn immer noch an, dann blickte er ihm forschend ins Gesicht. Mittlerweile schien er seinen Schock überwunden und sich gefangen zu haben.
»Geht es dir gut?«, gebärdete Diesel.
Michael nickte langsam, während die Spannung aus seinen Schultern wich. Er löste den Griff um Joshua, der sich daraufhin vollends aus seiner Umklammerung befreite und mit ausholenden Gesten auf ihn einredete.
Blinzelnd richtete Michael seine Aufmerksamkeit wieder auf Joshua und antwortete ihm.
Diesel schnappte genügend Zeichen auf, um zu verstehen, dass Joshua Michael gefragt hatte, was los sei – und wo ihre Mutter sei. Michaels Antwort war nicht ganz so hektisch: Er bedeutete Joshua, es tue ihm leid. Und er hätte gedacht …
Diesel runzelte die Stirn. Den Rest verstand er nicht. Nur, dass Michael Joshua erklärte, ihre Mutter schlafe gerade.
Das kurze Zögern vor dem schläft verriet Diesel, dass die Frau entweder stoned oder betrunken war, allerdings war es ihm ein Rätsel, wie sie das so schnell hinbekommen haben sollte. Schließlich hatte sie ihren Jüngsten vor nicht einmal zwei Stunden hier abgeliefert. Dabei hatte sie keineswegs breit gewirkt, andererseits kannte er genug dieser sogenannten funktionierenden Alkoholiker, um zu wissen, dass diese Leute es hervorragend beherrschten, ihre Sucht vor anderen zu verbergen.
»Er sagt, es tut ihm leid, er hat Sie mit jemandem verwechselt«, erklärte Joshua. »Sie sehen jemandem ähnlich.«
Und offenbar hatte dieser Jemand die Macht, diesen Jungen in Angst und Schrecken zu versetzen. Vielleicht ein weiterer Onkel? Keine Ahnung. Diesel wusste nur eins: dass er diese beiden Jungen nicht nach Hause schicken wollte. Erst wenn er sicher sein konnte, dass ihnen dort nichts passierte.
»Er sagt, meine Mom schläft«, fuhr Joshua fort. »Er wollte sie wecken, damit sie mich holen kommt, aber es ging nicht, deshalb ist er gekommen.«
»Verstehe«, sagte Diesel laut, ehe er gebärdete: »Braucht deine Mutter einen Arzt?«
Joshua riss die Augen auf. »Sie können Gebärdensprache?«, fragte er, da er Diesel zuvor den Rücken zugedreht hatte.
»Ein bisschen«, antwortete Diesel in einem Mix aus beidem, ohne den Blick von Michael zu lösen. »Wie bist du hergekommen?«
Der Junge zuckte die Achseln, wobei er vor Schmerz zusammenfuhr. »Gelaufen.«
Diesel starrte ihn fassungslos an. Vom Anmeldeformular wusste er, wo die Familie wohnte. »Aber das sind …« Er hob die Hand, versuchte, sich das Zeichen in Erinnerung zu rufen, ehe er buchstabierte. »Fünf Meilen.«
»Ein klein bisschen mehr als fünf.« Diesmal hob Michael nur eine Schulter. »Ich bin schnell.«
»Er ist ein echter Fußballstar«, warf Joshua stolz ein.
Michael verdrehte die Augen und schüttelte den Kopf.
Diesel war immer noch völlig von den Socken. »Und wie lange hast du gebraucht?«
»Eine gute halbe Stunde.«
Was bedeutete, dass er losgelaufen war, als seine Mutter eigentlich hätte bereits unterwegs sein müssen. Damit war dieser Junge nicht nur schnell, sondern geradezu rekordverdächtig.
Aber das war jetzt nicht wichtig. »Braucht deine Mutter einen Arzt?«, fragte er ein zweites Mal.
Wieder erstarrte Michael. »Nein.« Er unterstrich seine Geste mit steifer Endgültigkeit. »Sie schläft.« Er legte besondere Betonung auf das Wort, um Diesel zu zeigen, dass er die wahre Bedeutung der Frage sehr wohl verstand.
Diesel rieb sich den Schädel, spürte die winzigen Stoppeln an seiner Handfläche. Er musste sich demnächst rasieren. »Okay, Joshua, für das, was ich als Nächstes sagen will, reichen meine Kenntnisse nicht, deshalb musst du für mich übersetzen, okay?«
Mit finsterer Miene stieß Michael Joshua an und fragte, was Diesel gesagt hatte. Joshua übersetzte, und beide Brüder nickten.
»Ich darf dich nicht mit Michael gehen lassen, weil er nicht auf meiner Liste der erlaubten Personen steht.« Michael wollte protestieren, aber Diesel hob die Hand. »Allerdings kann ich euch beide nach Hause fahren. Mrs Moody wird uns begleiten.«
Er hielt inne. »Aber bevor wir losfahren, will ich noch etwas wissen. Deine Schulter scheint wehzutun. Ist alles in Ordnung mit dir?« Hier stimmte etwas nicht, und er würde herausfinden, was es war.
Michael nickte und kniff die Augen zusammen. »Ja«, gebärdete er, ebenso knapp wie sein »Nein« zuvor.
»Nein, es geht ihm überhaupt nicht gut«, warf Joshua ein, woraufhin Michael ihn böse ansah. »Es geht dir nicht gut«, gebärdete er so knapp wie Michael zuvor. »Seine Schulter tut weh. Und sein Kopf auch. Heute Morgen hat er sogar geblutet.«
»Mir geht’s gut«, signalisierte Michael beharrlich.
Wieder hob Diesel beide Hände. »Wenn du blutest, sollte Mrs Moody sich das mal ansehen. Sie war früher Krankenschwester.«
»Und sie ist nett«, fügte Joshua hinzu, nachdem er Diesels Ansage übersetzt hatte.
Mrs Moody näherte sich so vorsichtig, als hätte sie ein verwundetes Tier vor sich, mit diesem mütterlichen Lächeln, das Diesel auf Anhieb so gemocht hatte. »Wie gebärde ich das Wort ›Bitte‹, Joshua?«
Er zeigte es ihr, woraufhin sie die Geste imitierte.
Trotzig wich Michael einen Schritt nach hinten und verschränkte die Arme.
Diesel seufzte. »Wenn sich die Wunde infiziert« – auch hier musste er buchstabieren –, »wirst du krank, und wer kümmert sich dann um Joshua?«
Michael wandte sich ihm zu und musterte ihn. Nach einer gefühlten Ewigkeit nickte er und senkte den Kopf, damit Mrs Moody einen Blick auf die Verletzung werfen konnte.
Sie ging sanft, aber effizient vor, und ihre Miene verriet Diesel, dass ihr nicht gefiel, was sie sah. »Das ist ein tiefer Schnitt«, murmelte sie. »Die Wunde muss gesäubert und genäht werden. Mindestens zwei Stiche, wenn nicht sogar drei. Sie blutet immer noch.« Sie trat einen Schritt zurück. »Könntest du ihn fragen, wann das passiert ist, Joshua?«
»Beim Frühstück«, antwortete Joshua wie aus der Pistole geschossen und machte die entsprechenden Gebärden dazu. »Mama hat ihn mit einer Schüssel verletzt.« Er schilderte seinem Bruder, was Mrs Moody gesagt hatte.
»Nein.« Michael stieß das Wort hervor, unnachgiebig und mit tonloser Stimme.
»Aber es blutet immer noch, deshalb könntest du sehr krank werden«, sagte Mrs Moody sanft.
Angst flackerte in Michaels Blick auf, als er Joshuas Übersetzung verstand. »Kein Arzt«, gebärdete Michael. »Mom … sie wird sehr wütend und nicht bezahlen.«
Wieder musste Diesel seinen Zorn hinunterschlucken. »Was, wenn ich dich zu einer Ärztin bringe, die dich kostenlos versorgt?«, gebärdete er. »Sie kann auch Gebärdensprache. Sie heißt Dr. Novak und ist sehr nett.« Und war immer in seinen Gedanken. Allein bei der Vorstellung, sie wiederzusehen, beschleunigte sich sein Puls.
Sie hatte unmissverständlich klargemacht, dass ihre Zurückweisung auf seine unbeholfenen Annäherungsversuche »nichts mit ihm zu tun« hätten, was er ihr natürlich nicht abgekauft hatte, trotzdem hegte er nach wie vor die Hoffnung, dass sie es sich anders überlegen könnte. Er wäre schon glücklich, wenn er sie bloß sehen könnte.
Ihre Gegenwart beruhigte ihn, wie niemand sonst es konnte. Er hatte sogar seine lächerliche Phobie gegen weiße Kittel überwunden, nur um in ihrer Nähe sein zu können, ohne dass ihn die blanke Panik heimsuchte. Letztlich hoffte er darauf, dass sich seine Geduld und Beharrlichkeit irgendwann auszahlten.
Hoffte, mit ihr zusammen sein zu können, wenn auch nur ein Weilchen.
Es war erbärmlich. Das war ihm durchaus klar. Aber damit hatte er sich abgefunden.
Michael musterte ihn eindringlich. »Sie ist Gregs Schwester?«
Diesel sah ihn erstaunt an. »Du kennst Greg Novak?«
Michael nickte. »Ja. Er geht auf meine Schule. Ein paar Klassen über mir.«
Stimmt. Greg lebte bei seinem älteren Bruder Deacon, ganz in der Nähe von Joshua und Michael. »Ja. Dr. Novak ist Gregs Schwester. Also, darf ich dich zu ihr bringen?«
Mit angehaltenem Atem wartete er, bis Michael widerstrebend nickte.
Erleichtert lächelte Diesel. »Gut. Würden Sie schon mal in meinen Pick-up steigen, Mrs Moody?«
Sie lachte leise. »Ich fürchte, da werde ich wohl einen Kran brauchen.« Sie streckte die Hand aus. »Hilfst du mir, Joshua?«
Vertrauensvoll legte Joshua seine Hand in die ihre und begleitete Mrs Moody zu dem Truck, während Diesel sich wieder Michael zuwandte. »Bereit?«, gebärdete er.
Michael nickte mürrisch, was Diesel allerdings nicht weiter kümmerte. Der Junge musste ärztlich versorgt werden, und dann würde er Dani bitten, aus Michael herauszukitzeln, was ihn so in Angst und Schrecken versetzt hatte.
Diese Art von Grauen sah er nicht zum ersten Mal, daher wusste er, dass es nicht von einer Bagatelle heraufbeschworen wurde. Nein, ein Mann, der genauso aussah wie er selbst, hatte diesem Jungen wehgetan. Oder er hatte ihm zumindest damit gedroht.
Er würde in Erfahrung bringen, wer dieser Mann war. Und dafür sorgen, dass Michael und Joshua nichts mehr passieren konnte.
Indian Hill, Ohio
Samstag, 16. März, 12.25 Uhr
Endlich, Herrgott noch mal! Cade verdrehte die Augen. Hätte er nicht so einen fürchterlichen Krampf im Bein, würde er seinen Boss tatsächlich für dessen Stehvermögen bewundern. Aber die Muskeln in seinem Schenkel waren betonhart, außerdem drohte seine Blase zu platzen, weil er seit beschissenen vier Stunden in diesem verdammten Kleiderschrank hockte und sich das Gestöhne und Geächze anhören durfte, mit dem sein Chef die Schlampe vögelte, die er am Abend vorher aus dem Casino abgeschleppt hatte. Wann immer er dachte, sie seien endlich fertig – oder vor Erschöpfung ohnmächtig geworden –, ging es ein weiteres Mal zur Sache.
Cade wusste nicht, wie die Frau hieß, und es war ihm auch egal. Sie sollte bloß endlich abhauen. Zum Glück war Richard kein Kuschelbär, sondern versuchte das Weibsbild bereits loszuwerden.
»Aber ich dachte, wir könnten zusammen Mittag essen«, jammerte sie.
»Nö«, antwortete Richard knapp und versetzte ihr einen Klaps auf den Hintern.
»Au!«, schrie die Frau auf. »Das hat wehgetan.«
»Du stehst doch auf so was«, erwiderte Richard mit einem anzüglichen Lachen.
»Aber noch mehr würde ich drauf stehen, wenn ich ein Mittagessen bekäme«, maulte die Frau, ehe sie die Taktik änderte. »Komm schon, Süßer. Wir könnten doch irgendwo etwas essen, zurückkommen und noch ein bisschen weitervögeln.«
»Ich habe Nein gesagt.« Schlagartig war Richards Tonfall kalt geworden. »Meine Gäste bleiben grundsätzlich nie über Nacht. Du kannst froh sein, dass ich dich nicht gleich nach der ersten Runde rausgeschmissen habe.«
Cade hörte ein Rascheln. Offenbar sammelte sie ihre Sachen ein, die sie glücklicherweise auf dem Fußboden liegen gelassen hatte, weshalb er gewarnt gewesen war, dass sich seine Gespielin noch im Haus aufhielt, als er sich vor vier verdammten Stunden hereingeschlichen hatte, in der Annahme, Richard liege alleine im Bett.
Cade hatte die Toilettenspülung gehört und war in den Kleiderschrank geschlüpft … Sekunden, bevor eine splitternackte Frau aus dem angrenzenden Badezimmer hereingekommen war und Richard »für die zweite Runde« geweckt hatte. Cade hatte sich gerade noch rechtzeitig verstecken können. Zum Glück, denn er wollte nicht gezwungen sein, auch noch die Frau zu töten. Natürlich hätte er es getan, aber dann hätte er ihre Leiche zusätzlich am Hals gehabt, außerdem wusste er nicht, ob und wer im Zweifelsfall nach ihr suchen würde.
Davon abgesehen hörte es sich an, als sei der Sex mit Richard schon Strafe genug für sie.
Die Frau schnaubte verdrossen. »Als hättest du mich rauswerfen können. Immerhin musste ich dich von mir runterrollen, weil du sofort eingepennt bist, nachdem du gekommen warst. Im Gegensatz zu mir«, fügte sie hämisch hinzu. »Ich bin kein einziges Mal gekommen, sondern hab’s bloß gespielt. Und zwar jedes einzelne Mal.«
Die Schranktür wackelte plötzlich, als Richard die Frau dagegendrückte. Cade zog seine Sig. Sollte Richard jetzt die Tür aufreißen, würde er sie beide abknallen müssen. Das war nicht der Plan gewesen. Richard sollte allein sein, sein Tod wie ein Unfall aussehen.
Mit angehaltenem Atem starrte er auf die Schranktür, die bebte, jedoch nicht aufging.
»Du bist eine beschissene Lügnerin«, grollte Richard. Die Frau schrie auf.
»Du tust mir weh. Nimm deine Pfoten weg. Ich werde jedem erzählen, was für ein Loser du bist. Dass du bloß noch mit Viagra einen hochkriegst.«
Klingt einleuchtend, dachte Cade. Richard war Diabetiker und spritzte Insulin. Trotzdem.