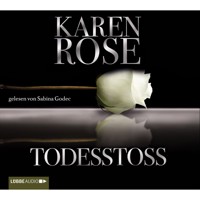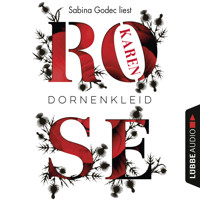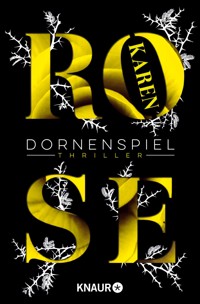
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dornen-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel zwischen FBI-Agenten und einem skrupellosen Verbrecher, der vor nichts zurückschreckt ... Nach den Spiegel-Bestsellern "Dornenmädchen" und "Dornenkleid" folgt mit "Dornenspiel" der dritte Teil der Dornen-Thriller-Reihe von der amerikanischen Bestseller-Autorin Karen Rose. In "Dornenspiel" bekommen es die FBI-Agenten Griffin "Decker" Davenport und Kate Coppola mit einem unaussprechlichen Verbrechen zu tun … Cincinnati, Ohio: Als Griffin "Decker" Davenport nach mehreren Tagen aus dem Koma erwacht, wandern seine Gedanken sofort zu seinem letzten Fall. Er hat drei Jahre damit zugebracht, als FBI-Undercover-Agent einen Menschenhändler-Ring auszuheben. Doch er weiß auch, dass ihm das nur teilweise gelungen ist – und dass Kinder in Gefahr sind. FBI Special Agent Kate Coppola ist entsetzt, als sie von Decker erfahren muss, dass ein Partner des Rings Jugendliche für seinen Online-Sexhandel benutzt. Sie und Decker eröffnen die Jagd auf ihn und werden gleichzeitig zu Gejagten. Denn ihr Gegner beseitigt alle, die ihm in die Quere kommen … Die SPIEGEL-Bestsellerautorin Karen Rose verbindet gekonnt nervenaufreibende Spannung mit einer fesselnden Liebesgeschichte. Ein Pageturner, der alle Fans von Romantic Suspense und Psychothrillern von der ersten bis zur letzten Seite in Atem hält. Die Dornen-Thriller-Serie, die in Cincinnati, Ohio, spielt, ist in folgender Reihenfolge erschienen: - Dornenmädchen (FBI-Agent Deacon Novak und Faith Corcoran) - Dornenkleid (Marcus O'Bannion und Detective Scarlett Bishop) - Dornenspiel (FBI-Agent Griffin »Decker« Davenport und FBI-Agentin Kate Coppola) - Dornenherz (Detective Adam Kimble und Meredith Fallon) - Dornenpakt (Dr. Dani Novak und Diesel Kennedy)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1092
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Karen Rose
Dornenspiel
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Als Griffin »Decker« Davenport nach mehreren Tagen aus dem Koma erwacht, wandern seine Gedanken sofort zu seinem letzten Fall. Er hat drei Jahre damit zugebracht, als Undercover-Agent einen Menschenhändlerring auszuheben. Doch er weiß auch, dass ihm das nur teilweise gelungen ist – und dass Kinder in Gefahr sind …
FBI Special Agent Kate Coppola ist entsetzt, als sie von Decker erfahren muss, dass ein Partner des Rings Jugendliche für seinen Online-Sexhandel benutzt. Sie und Decker eröffnen die Jagd auf ihn und werden gleichzeitig zu Gejagten. Denn ihr Gegner räumt alle aus dem Weg, die ihm in die Quere kommen …
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
Dank …
Karen Rose bei Knaur
Eine Liste aller Karen-Rose-Romane in chronologischer Reihenfolge:
Verzeichnis der auftretenden Figuren in den Romanen von Karen Rose
Meiner Freundin Amy Lane – für deine Geschichten, die mich beruhigt haben, als ich voller Angst und Trauer war, und dafür, dass ich mich durch deine Figuren ein weiteres Mal in meine eigenen verlieben konnte.
PS: Danke fürs Stricken :-]
Meiner Tante Maurita – inmitten des schlimmsten Leids hast du wahre Stärke und Haltung bewiesen. Danke, dass ich dein Ersatzkind in Ehren sein darf.
In Erinnerung an Reverend Richard Wertz alias Onkel Dick. Du hast unsere Ehe geschlossen, hast mit uns gelebt und gelacht, und als sich deine Zeit auf Erden dem Ende neigte, hast du dem Tod mit großer Würde und tiefem Glauben entgegengeblickt. Wir wünschten, du wärst immer noch bei uns.
Und wie immer für Martin, für unsere (bisher) fünfunddreißig wunderbaren gemeinsamen Jahre. Ich liebe dich.
Prolog
Cincinnati, OhioSamstag, 8. August, 12.45 Uhr
Kekse. Chips. Fruchtgummis. Mit jedem Artikel, der in ihrem Einkaufswagen landete, biss Mallory Martin die Zähne fester zusammen. Sie strich die Fruchtgummis von ihrem Einkaufszettel und ging weiter in die Tiefkühlabteilung. Pizza. Eiscreme. Dann weiter zu den Backwaren am Ende des Gangs, wo sie von jeder Sorte Kuchengarnitur eine aussuchte: Schokoladensirup, kandierte Walnüsse, Erdnuss und Karamell. Aber keine Eigenmarken, hatte er ihr eingeschärft. Die aufsteigende Galle brannte in ihrer Kehle. Nur das Beste vom Besten, Mallory, Schatz. Nur das Beste.
Sie blickte wieder auf ihren Zettel, ob sie auch alles hatte. Vergiss bloß nichts, Schatz, hatte er mit einem verkniffenen Lächeln gesagt und ihr mit dem Finger über die Wange gestrichen. Du weißt doch, wie ungern ich dich bestrafe.
»Na, da feiert wohl jemand eine Party, was?«, ertönte eine tiefe Männerstimme hinter ihr.
Mallory zuckte zusammen und umklammerte das Glas mit den eingemachten Kirschen ein wenig fester, das sie gerade aus einem der Regale genommen hatte. Kirschen brauchen wir unbedingt. Seine dahingeträllerten Worte hallten in ihrem Kopf wider, als wollten sie sie verhöhnen.
Sie hörte seine Stimme ununterbrochen, immer, ganz egal wann und wo. Sie hasste sie. Sie hasste ihn. Ihr Blick fiel auf das Glas in ihrer Hand. Sie hasste sich selbst.
»Alles klar, Miss?« Vor ihr stand ein Mann und musterte sie besorgt.
Mallory verdrängte die Stimme aus ihren Gedanken und sah den Fremden an. Er war um die dreißig Jahre, hatte breite Schultern und einen kleinen Bauchansatz, Typ ehemaliger Footballspieler. Sie kannte die Sorte Mann. Kannte sie alle. Er musterte sie argwöhnisch, als wäre sie eine Irre, die bloß auf eine Gelegenheit wartete, etwas komplett Schwachsinniges zu tun.
Was ja auch stimmt, dachte sie.
»Entschuldigung, ich wollte Sie nicht erschrecken«, sagte er.
»Kein Problem«, sagte sie leise. »Aber danke.« Sie wollte ihren Einkaufswagen an ihm vorbeischieben, doch er vertrat ihr den Weg.
»Ich kenne Sie doch.« Er musterte sie mit zusammengezogenen Brauen.
Ein Schauder lief ihr über den Rücken. Angst. Ekel. Verzweiflung. »Das glaube ich nicht. Ich bin ganz neu in der Stadt«, erwiderte sie mit einem gezwungenen Lächeln. Natürlich war das eine glatte Lüge, aber was machte eine mehr oder weniger schon aus?
Er musterte sie eingehender. Mallory wollte zurückweichen, als sich seine Wurstfinger um das Metallgitter des Wagens schlossen und sie gezwungen war, stehen zu bleiben.
Sie konnte genau sehen, wann der Groschen fiel – seine Lippen verzogen sich zu einem anzüglichen Lächeln. Sie kannte diesen Mann nicht, seine Art zu lächeln dagegen sehr wohl. Wieder kam ihr die Galle hoch, doch diesmal mischte sich die blanke Angst unter ihren Abscheu.
»Lassen Sie mich vorbei.« Sie hörte die Panik in ihrer Stimme. »Ich muss sofort hier raus.« Kurz überlegte sie, den Einkaufswagen einfach stehenzulassen und die Beine in die Hand zu nehmen, aber dann entriss sie ihn seinem Griff und schob ihn an ihm vorbei.
Der Impuls, wegzulaufen, war fast übermächtig. Sie wollte laufen. Laufen, so schnell sie nur konnte.
Bis sie an einen Ort gelangte, wo sie nie wieder einem Mann begegnen müsste, der sie auf diese Weise anlächelte.
Aber diesen Ort gab es nicht.
Denn das Internet war überall. Und damit war auch Mallory überall, auch wenn sie sich am liebsten in Luft auflösen würde. Was natürlich ebenfalls nicht ging. Sie schob den Wagen zu den Milchprodukten, öffnete eines der Kühlregale und genoss für einen Moment die angenehme Kälte auf ihren erhitzten Wangen.
Das Herz schlug ihr bis zum Hals, und sie hörte das Rauschen ihres Bluts in den Ohren, das alle anderen Geräusche übertönte. Die Hand noch immer um die Tür des Kühlregals gelegt, spähte sie über die Schulter.
Der Typ stand am Ende des Gangs und tippte etwas in sein Handy, das in seinen Pranken winzig aussah. Er sah auf, verzog das Gesicht erneut zu einem fiesen Grinsen und winkte ihr zu.
Und dann schoss er ein Foto von ihr.
Nein. Nein. Nein. Nicht schon wieder, hätte sie am liebsten geschrien. Nicht schon wieder. Ich will das nicht.
Aber sie tat es nicht. Sie weinte nicht, lief auch nicht weg. Stattdessen nahm sie so würdevoll, wie sie nur konnte, eine Milchflasche heraus, stellte sie in den Wagen und blickte wieder auf ihren Zettel.
Schlagsahne. Das war der letzte Artikel. Mit zitternden Fingern nahm sie die rote Sprühflasche aus dem Regal. Eigentlich sollte nichts weiter dabei sein, Schlagsahne zu kaufen, aber sie wusste ganz genau, wieso er sie haben wollte, wusste, dass er sie für ganz andere Dinge verwenden würde, als einen Eisbecher damit zu verzieren.
Sag es jemandem. Lieber Gott, Mallory, du musst mit jemandem reden.
Halt den Mund, befahl sie sich stumm. Wie oft hatte sie bereits mit diesem Gedanken gespielt? Aber so einfach war das nun mal nicht. Nichts war einfach, gar nichts. Sonst hätte ich es ja längst getan, dachte sie resigniert. Die rote Sprühflasche wanderte in den Wagen, und Mallory machte sich auf den Weg zur Kasse.
Der Ex-Footballtyp hatte sich in der Schlange links von ihr angestellt und zwinkerte ihr ununterbrochen zu, doch Mallory beachtete ihn nicht, sondern hielt den Kopf gesenkt. Wie üblich bezahlte sie bar.
Wir dürfen doch keine Spuren hinterlassen, stimmt’s, Schatz?
Nein, dachte sie niedergeschlagen, das dürfen wir nicht. Aber ich habe genau das getan. Und zwar eine Spur, die sogar aus dem beschissenen All zu sehen war. Dabei war es nicht ihre Absicht gewesen. Es war nicht meine Schuld.
Das stimmte, aber wen kümmerte das schon?
Die Kassiererin wollte wissen, ob ein Angestellter Mallory die Tüten nach draußen tragen sollte, doch das Mädchen schüttelte den Kopf. Sie war schließlich achtzehn Jahre alt und konnte ihre Einkäufe selbst zu ihrem verdammten Auto bringen.
Na ja, streng genommen war es nicht ihr Auto, sondern seines. Wie alles andere auch.
Sogar Mallory gehörte ihm. Und er sorgte dafür, dass sie es keine Sekunde lang vergaß.
Die brütende Augusthitze schlug ihr entgegen, als sie den Einkaufswagen aus dem Laden schob. Ehe sie die Straße überquerte, sah sie sich noch einmal um, aber der Footballtyp war weg. »Gott sei Dank!«, sagte sie leise.
Eilig lud sie die Einkäufe in den Kofferraum, sorgsam darauf bedacht, die Eiscreme in eine Gefriertüte zu geben, damit sie auf dem Heimweg nicht schmolz. Sonst würde er stocksauer werden. Und das war nicht gut. Ihre Narben bewiesen es ganz deutlich. Aber dass er ihr das angetan hatte, würde ihr sowieso keiner glauben.
Dafür hat er gesorgt, dachte sie bitter und schlug mit beiden Händen den Kofferraumdeckel zu, dann stand sie einen Moment lang da, die Hände flach auf dem brüllend heißen Blech, und kämpfte gegen das heftige Zittern in ihren Beinen an. Niemand wird mir je wieder glauben.
In dem Moment registrierte sie einen dunklen Schatten hinter sich. »Na, wenn das nicht Sunshine Suzie ist!«, ertönte die tiefe, gedehnte Männerstimme.
Mallory erstarrte.
Der Ex-Footballspieler. Er stand direkt hinter ihr. Seine breitschultrige Gestalt spiegelte sich in der Heckscheibe des Autos. Er hatte schon wieder sein Handy gezückt. »Ich hab dir doch gleich gesagt, dass sie es ist«, verkündete er feixend, ehe er das Handy so hindrehte, dass sich in der Fensterscheibe das verzerrte Gesicht eines anderen Mannes spiegelte. Ein Videoanruf. Scheiße. »Los, dreh dich mal um, Suzie, und sag hallo zu meinem Freund. Er ist auch ein Riesenfan von dir.«
Mallory schob die Hand in ihre Jeanstasche und schloss die Finger um die Autoschlüssel. Nur ein paar Meter. Steig einfach ein, dann kann dir nichts mehr passieren. Sie wollte davonstürzen, doch die Wurstfinger des Typen legten sich wie ein Schraubstock um ihren Oberarm, so fest, dass es bestimmt blaue Flecke geben würde.
»Loslassen!«, schrie sie. »Bitte, lassen Sie mich los!«
»Vergiss es.« Sein grausames Lachen hallte in ihren Ohren wider. »Jahrelang warst du von der Bildfläche verschwunden, Süße. Aber jetzt bist du wieder da, und da will ich doch eine kleine Zugabe sehen. Was meinst du, Justin? Findest du nicht auch, dass Sunshine Suzie uns eine kleine Extra-Show schuldig ist?«
»Aber hallo!«, johlte der Typ am anderen Ende der Leitung. »Und halt gefälligst dein Scheißhandy drauf!«
»Worauf du dich so was von verlassen kannst!«
»Nein!«, schrie Mallory, wirbelte herum und riss den Autoschlüssel abrupt hoch, wobei das scharfkantige Metall über die Wange des Footballspielers schrappte. Vor Schreck ließ er sein Handy fallen, dessen Display in tausend Scherben zerbarst – und mit ihm das Gesicht seines Kumpels am anderen Ende der Leitung.
Wieder versuchte Mallory zu fliehen, doch Mr. Football bekam sie erneut zu fassen. »Das Teil war nagelneu, du beschissene Schlampe«, stieß er hervor. »Dafür wirst du bezahlen. Auf die eine oder andere Art.«
»Entschuldigen Sie.« Eine ruhige Frauenstimme drang an Mallorys Ohren. »Gibt es hier ein Problem?«
Eine Polizistin. In Uniform. JA!, hätte Mallory am liebsten geschrien, doch stattdessen hörte sie sich sagen: »Nein, Ma’am.«
Mr. Football ließ von ihr ab. »Überhaupt nicht, Officer«, sagte er mit einem lässigen Grinsen. »Nur ein kleines Missverständnis, aber es ist nichts passiert.«
»Gar nichts«, bekräftigte Mallory, nickte der Polizistin flüchtig zu, ehe sie zur Autotür lief und das Schloss per Knopfdruck aufspringen ließ.
»Einen Moment!«, befahl die Polizistin.
Eine Hand um die geöffnete Tür gelegt, hielt Mallory inne. »Ich muss los«, erklärte sie, wohl wissend, dass die Panik in ihrer Stimme unüberhörbar war. »Sonst schmilzt mein Eis.«
»Was geht hier vor?«, wollte die Polizistin wissen.
Sag es ihr. Los, sag es ihr einfach. Alles. Für den Bruchteil einer Sekunde war sie drauf und dran, doch dann fiel ihr wieder ein, was beim letzten Mal passiert war. Und das Mal davor. Keiner hatte ihr zugehört. Keiner hatte ihr geglaubt. Und die Strafe war zu brutal gewesen, um es auf einen weiteren Versuch ankommen zu lassen.
»Gar nichts«, wiegelte sie ab, »nur eine Verwechslung, das ist alles.« Sie stieg ein und ließ den Motor an, heilfroh, dass kein Wagen vor ihr parkte, da die Polizistin und der Footballtyp immer noch hinter ihr standen. Auf dem Weg zur Ausfahrt sah sie in den Rückspiegel und stellte erleichtert fest, dass ihr die Polizistin nicht gefolgt war.
Die Hände fest um das Lenkrad gekrallt, machte sie sich auf den Weg … nach Hause. Allein beim Gedanken daran wurde ihr elend, aber es nützte nichts. Dort lebte sie, auch wenn es noch so grauenvoll sein mochte. Als sie in die Einfahrt bog, schmerzten ihre Finger von der Anstrengung.
Du hättest einfach weiterfahren sollen, sagte sie sich. Der Tank war voll genug, um bis nach Columbus oder gar Toledo zu kommen. Und dann? Das ist doch Schwachsinn, Mallory. Du bist zurückgekommen, weil du es musstest. Sie konnte nirgendwo anders hin. Nirgendwo.
Und selbst wenn sie es gekonnt hätte, war es ausgeschlossen. Wegen Macy. Macy, die wegläuft, wenn sie mich bloß sieht. Als wäre ich ein Monster. Macy wusste nicht, wer das Monster in Wirklichkeit war, und sie würde es auch nie erfahren, solange Mallory spurte. Also würde Mallory genau das tun.
Sie saß im Auto und blickte auf das hübsche weiße Farmhaus, ihr Gefängnis; das Haus, das zu ihrer Falle geworden war. Und wenn sie noch länger hier herumhockte, würde sie die Peitsche zu spüren kriegen. Beim letzten Mal hatte es zwei Wochen gedauert, bis die Striemen verheilt waren, so wütend hatte sie ihn gemacht.
Aber sie war immer noch völlig durcheinander von dem Vorfall auf dem Parkplatz. Sunshine Suzie. Mallory hasste Sunshine Suzie.
Sie schloss die Augen und kämpfte ihre aufsteigende Übelkeit nieder. Es war nicht das erste Mal, dass man sie erkannt hatte, und auch um eine »kleine Extra-Show« war sie schon mehr als einmal angebettelt worden, aber dass sich die Polizei einmischte, hatte es bisher noch nie gegeben.
Soll ich ihm von der Polizistin erzählen?, überlegte sie. Die Antwort kam blitzschnell. Nein. Auf keinen Fall. Selbst wenn die Beamtin das Kennzeichen notiert hätte, würde die Spur nicht hierherführen. Zu ihm. Ihn konnte keiner aufspüren. Er war unsichtbar.
Er war Satan. Und ich werde seiner Hölle niemals entkommen.
Niedergeschlagen stieg sie aus und holte die Tüten aus dem Kofferraum, während ihr das Wort »Extra-Show« immer noch im Kopf herumging. Der Geruch nach gegrillten Burgern schlug ihr entgegen, als sie ums Haus herumkam und die Hintertreppe zur Küche hinaufstieg.
Hamburger, Hotdogs, Eiscreme. Was könnte sich ein Kind sonst noch wünschen?
Freiheit.
Mallory blickte durchs Fenster, ehe sie den Türknauf umfasste. Beim Anblick des Küchentischs drehte sich ihr der Magen neuerlich um.
O Gott. Diesmal waren es vier, die am Tisch saßen. Normalerweise war es bloß einer oder auch mal zwei. Aber heute …
Vier. Zwei Jungs und zwei Mädchen. Alle noch jung, dreizehn Jahre vielleicht. Und alle völlig aus dem Häuschen über ihr vermeintliches Glück. Hamburger, Hotdogs und Eiscreme.
So hübsch. Alle vier. Mit großen, unschuldigen Augen.
Aber nicht mehr lange. Er würde sie benutzen, bis sie zerstört waren. Bis sie so sind wie ich. Und dann werden die Leute im Supermarkt auch sie wiedererkennen.
Nein. Etwas in ihrem Innern zerbrach. Das war’s. Sie spürte es. Plötzlich konnte sie die Übelkeit nicht länger unterdrücken. Ihre Knie gaben nach. Sie sackte gegen das Treppengeländer, beugte sich darüber und gab das wenige, was sie heute gegessen hatte, in einem Schwall von sich.
Sie sank zu Boden, kauerte zitternd neben der Schwelle. Heute gab es Eisbecher. Nächste Woche Pizza, alles gratis, aber dann … Mallory wischte sich mit dem Ärmel den Mund ab.
Dann kam die Bezahlung. Irgendwann kam immer der Moment, wenn es an die Bezahlung ging.
Sie hob den Kopf. Aber diesmal nicht. Keine Sunshine Suzies mehr. Keine Extra-Shows. Schluss. Aus.
Aber was ist mit Macy? Ihre Entschlossenheit geriet ins Wanken. In diesem Moment drang Gelächter aus der Küche. Vier Kinder, die sich prächtig über einen Scherz amüsierten. Mallory konnte sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal gelacht hatte. Falls überhaupt jemals. Aber Macy lachte gern, und Mallory musste dafür sorgen, dass es so blieb.
Extra-Show. Sie schloss die Augen. Es musste einen Weg geben. Ihm Einhalt zu gebieten. Diesem Alptraum ein für alle Mal ein Ende zu machen, ohne Macy zu opfern.
Die Küchentür öffnete sich fast geräuschlos. Sein Schatten fiel über sie, als er heraustrat. »Mallory, Schatz«, sagte er mit seidiger Stimme. »Komm doch rein. Die Eiscreme schmilzt ja.«
Mallory zwang sich aufzustehen und presste die Knie gegeneinander, damit ihre Beine nicht unter ihr nachgaben. Nickte, ohne ihm in die Augen zu sehen. Das tat sie niemals. Weil unerträglich war, was sie darin sah. Die Macht. Die Überheblichkeit, weil er genau wusste, dass er die Fäden in der Hand hielt.
»Ich möchte dich gern unseren Gästen vorstellen«, sagte er. Mallory zwang sich, den Kindern in die Augen zu blicken. »Das ist meine Tochter.«
Es muss aufhören. Mallory musste dafür sorgen. Und das würde sie auch.
Selbst wenn ich ihn töten muss.
Selbst wenn ich dabei getötet werde.
1. Kapitel
Cincinnati, OhioMittwoch, 12. August, 17.30 Uhr
Lauf. Los. Schneller. Du musst ihn aufhalten. Bitte, lieber Gott, mach, dass ich es diesmal schaffe.
Immer zwei Stufen auf einmal nehmend, stürzte Kate die Treppe hinauf. Ihr Herz hämmerte, aber nicht vom Laufen, sondern vor Angst – so übermächtig, dass sie sie förmlich riechen, auf der Zunge schmecken und spüren konnte, wie sie sich wie ein Film über ihre Haut legte, als sie die nicht enden wollenden Stufen hinaufhetzte.
Weil sie wusste, dass sie ihn nicht aufhalten konnte. Niemals. Sie kam zu spät, jedes Mal.
Jedes Mal wieder blieb sie vor der Tür stehen. Ich kann es nicht. Nicht noch einmal. Bitte, zwing mich nicht, es noch einmal zu tun. Doch ihre Hand bewegte sich wie von allein, schloss sich um den Türknauf. Langsam schwang die Tür auf.
Dahinter sah sie ihn in ihrem Sessel sitzen. Sein Kopf ruhte auf der Decke, die ihre Großmutter ihr gehäkelt hatte, als sie sechs Jahre alt gewesen war. Auf seinem Gesicht lag ein höhnisches Lächeln.
Und in seinem Mund steckte der Lauf einer Waffe. Ihrer Waffe.
Sie zuckte zusammen und schloss die Augen, nur eine Sekunde, bevor der Schuss losging. Weil sie genau wusste, was passieren würde. Sie wusste, wie grauenvoll es –
»Kate!« Die gedämpfte, aber beharrliche Stimme drang durch den Nebel ihres Bewusstseins, dann wurde sie auf einmal laut und klar, und im nächsten Moment spürte Kate einen vorsichtigen Klaps gegen ihre Wange. »Kate? Aufwachen, Special Agent Coppola.«
Kate schreckte hoch und registrierte, dass ihr Herz noch schneller schlug als in ihrem Traum. Schon wieder war sie zu spät gekommen. Aber das würde sie immer tun. Weil er es so gewollt hatte.
Er hatte gewollt, dass sie es mit ansah.
Blinzelnd setzte sie sich in ihrem Stuhl auf – was für ein unbequemes Ding! – und sah zu dem schlafenden Mann im Bett hinüber: Special Agent Griffin Davenport, dessen rhythmische Atemzüge das einzige Geräusch in dem ansonsten stillen Krankenzimmer waren.
Dann blickte sie in ein ungewöhnliches Augenpaar – das eine Auge blau, das andere braun –, das auf sie gerichtet war, betrachtete die breiten schlohweißen Strähnen, die in scharfem Kontrast zu dem tiefschwarzen Haar der Frau vor ihr standen. Vorsichtig streckte sie die Hand aus und berührte Danis Schulter, um sich zu vergewissern, dass sie nicht träumte. Sie fühlte sich fest und real unter ihren Fingern an.
»Dani«, sagte sie, nur um ihre eigene Stimme zu hören. Sie klang rauh, wie Schmirgelpapier. Als hätte sie sich die Seele aus dem Leib geschrien. O Gott, bitte mach, dass ich nicht geschrien habe.
Dr. Dani Novak sprach ganz leise und ruhig, als hätte sie ein wildes Tier vor sich. Oder eine Frau, die gerade aus einem Alptraum gerissen worden war. »Ja. Ich bin echt. Und, ja, Sie sind tatsächlich wach.«
Sie kniete vor dem Sessel, Kates Ohrstöpsel in der einen, den Laptop in der anderen Hand, während Kate sich die Decke, an der sie gestrickt hatte, wie ein Schutzschild gegen die Brust presste.
»Ihr Laptop wäre beinahe heruntergefallen«, erklärte Dani im selben beruhigenden Tonfall. »Ich habe ihn in letzter Sekunde aufgefangen. Sie haben geträumt.«
Kate ließ ihr Strickzeug sinken und presste sich die Fingerspitzen gegen die Schläfen. »Stimmt«, murmelte sie nur. Aus diesem Traum aufzuwachen, war jedes Mal fürchterlich. Sie hasste die Benommenheit, die Orientierungslosigkeit, hasste das Hämmern ihres Herzens, das letzte Bild des Traums – der zerberstende Kopf des Mannes, als er abdrückte. »Ich wünschte, Sie wären ein paar Sekunden früher reingekommen«, murmelte sie.
»Ich auch«, sagte Dani mitfühlend. »Sie haben im Schlaf gesprochen.«
Kates Augen weiteten sich, als eine ganz andere Angst Besitz von ihr ergriff. »Was habe ich gesagt?« Bitte nicht zu viel.
»Nur ›Es tut mir leid, Jack. So leid.‹«, antwortete Dani leise.
»Das war alles?«
Zu Kates Erleichterung nickte Dani, und obwohl sie die Ärztin nicht besonders gut kannte, wusste sie, dass sie kein Mensch war, der log. Schließlich war sie die Schwester ihres engen Freundes und früheren FBI-Kollegen Deacon, einem der aufrichtigsten Menschen, den Kate kannte.
Was sie mit Deacon Novak verband, hatte echten Seltenheitswert: Er war Kollege und guter Freund zugleich. Mehr nicht. Ohne jedes erotische Knistern oder sonst etwas, wofür Kate mehr als dankbar war. Als sie sich begegneten, hatte sie alles gebraucht, aber keinen Mann an ihrer Seite. Und vielleicht würde es auch für alle Zeiten so bleiben. Aber einen Freund, den hatte sie damals dringend gebraucht, und einen besseren als Deacon hatte sie kaum finden können.
Nach seiner Versetzung von Baltimore nach Cincinnati hatte Kate ihn schmerzlich vermisst, sowohl seine Fähigkeiten als Polizist als auch seinen Sarkasmus, gepaart mit seiner unverblümten Geradlinigkeit. Dann hatte sich eine freie Stelle in Cincinnati aufgetan, und Kate hatte sofort zugegriffen. Sie hätte es auch getan, wenn es eine Degradierung für sie bedeutet hätte, doch zum Glück war genau das Gegenteil der Fall. Sie hatte allen erzählt, sie hätte die Stelle angenommen, weil eine Beförderung damit verbunden war, doch der wahre Grund für den Wechsel war Deacon Novak.
Zwar arbeiteten sie nicht länger Seite an Seite – Deacon gehörte einer Einheit an, die eng mit dem CPD, dem Cincinnati Police Department, zusammenarbeitete, während Kate dem FBI-Büro zugeteilt war, doch allein die Gewissheit, dass er in der Nähe war und sie im Auge behielt, genügte ihr schon.
Dass Deacon kurze Zeit nach seinem Umzug auch noch die Liebe seines Lebens kennengelernt hatte, freute Kate umso mehr. Sie selbst hatte ihren eigenen Seelenverwandten schon vor langer Zeit gefunden, lange bevor sie Deacon Novak begegnet war. Deacon hatte sein Glück mehr als verdient, und Kate wünschte ihm und seiner Verlobten Faith das Glück, das sie einst hatte erleben dürfen.
Allerdings hoffte sie, dass die beiden es länger genießen durften, als es ihr vergönnt gewesen war. Schließlich waren ein paar Jahre der unbeschwerten Freude nicht allzu viel, wenn man bedachte, dass jener Mann die Liebe ihres Lebens gewesen war. Mit gebrochenem Herzen und am Boden zerstört war sie drei Jahre zuvor nach Baltimore gekommen, und erst Deacons Auftauchen hatte ihr vor Augen geführt, wie allein sie gewesen war. Und jetzt …
Das höhnische Lächeln, der Pistolenlauf in seinem Mund, der Schuss …
Hör auf! Entschlossen verdrängte sie das Bild aus ihren Gedanken, doch ihr war bewusst, dass es auf kurz oder lang zurückkehren würde. Sie wusste, dass es immer da war, stets am Rand ihres Bewusstseins, als wollte es sie verspotten, doch gleichzeitig erinnerte es sie auch daran, wie sehr sie Freunde brauchte. Und vielleicht könnte sie irgendwann auch Deacons Schwester dazuzählen.
»Ich glaube nicht, dass jemand Sie gehört hat. Eigentlich war es nur ganz leise, ein Murmeln. Geht es Ihnen gut?«, fragte Dani sachte.
Kate nickte, obwohl sie immer noch ziemlich erschüttert war. Von dem Traum, aber auch von dem Wissen, wie hilflos sie im Schlaf war. Wenn sie schlief, konnte sie nicht kontrollieren, was sie sagte. Andererseits hätte es schlimmer kommen können. Immerhin habe ich nicht geschrien.
Aber ging es ihr gut? Nein, verdammt, es ging ihr überhaupt nicht gut. Und vielleicht würde es ihr auch nie wieder gutgehen.
»Das wird schon«, log sie mit einem gezwungenen Lächeln und nahm Dani den Laptop und die Ohrstöpsel ab, sorgsam darauf bedacht, dass ihre Hände nicht zitterten. »Danke, dass Sie das blöde Ding aufgefangen haben.« Sie schob ihn unter ihren Stuhl. »Sosehr ich mir ja einen neuen wünsche, brauche ich das Teil hier wenigstens noch, bis ich meine Notizen zu den Audiodateien speichern konnte, die ich den ganzen Nachmittag lang transkribiert habe.«
Dani zuckte mit den Schultern. »Entweder war die Datei zu Ende, oder es war sowieso nichts drin.«
Kate sah sie durchdringend an. »Sie haben gelauscht? Aber sie waren nicht für fremde Ohren bestimmt.«
»Es war keine Absicht.« Gelassen griff Dani nach den Ohrstöpseln und ließ das Ende mit dem Stecker vor Kates Nase baumeln. »Der hier ist beim Hochheben herausgefallen.«
»Entschuldigung«, sagte Kate zerknirscht. »Noch mal danke. Das war nicht nett von mir, aber ich bin immer mies drauf, wenn ich so aus dem Schlaf gerissen werde.«
Dani winkte ab. »Geht mir genauso. Jedenfalls habe ich nur Rauschen gehört.«
»Weil die Lautsprecher genauso lausig sind«, brummte Kate. Sie konnte froh sein, dass sie die jüngsten Erkenntnisse in einer laufenden Ermittlung nicht versehentlich auch noch sämtlichen Schwestern, Patienten und deren Angehörigen auf der Intensivstation preisgegeben hatte.
»Was haben Sie sich denn da angehört?«, fragte Dani neugierig.
»Aufzeichnungen aus seiner Arbeit als verdeckter Ermittler«, antwortete Kate mit einem Nicken in Davenports Richtung.
Special Agent Griffin Davenport war vor einer Woche ins künstliche Koma versetzt worden, um seinen Genesungsprozess zu beschleunigen, nachdem eine Kugel eine Rippe durchschlagen hatte und in seine Lunge eingedrungen war, was zu einer massiven Blutung im Brustkasten geführt hatte. Er war an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen, die allem Anschein nach ihre Aufgabe hervorragend erledigte, wie seine sich stetig hebende und senkende Brust bewies.
Dani von Davenports Aufzeichnungen zu erzählen, stellte kein Problem dar. Seine Tarnung war beim Versuch, einen Menschenhändlerring zu entlarven, aufgeflogen, wofür ihm die Verbrecher im Gegenzug eine Kugel verpasst hatten. Eine Schwester in der Notaufnahme hatte den in seinem Hosenbein eingenähten Umschlag mit mehreren CDs zufällig entdeckt und der Polizei übergeben.
Leider hatten sie bislang nichts allzu Belastendes ans Licht gebracht, obwohl Kate seit Tagen darüber saß.
Sind es wirklich erst ein paar Tage? Eigentlich fühlt es sich eher wie Wochen an. Auf den CDs waren eine Menge Unterhaltungen zwischen den Mitgliedern der Gruppe abgespeichert, die allerdings keine bahnbrechend neuen Erkenntnisse lieferten, zumindest nichts, was rechtfertigen würde, Davenport deswegen über den Haufen zu schießen.
»Wieso ausgerechnet Sie?«, fragte Dani.
Kate zwang sich, ihren Blick wieder auf Dani zu richten, die sie argwöhnisch musterte. »Was meinen Sie damit?«
»Wieso hören Sie sich die Aufzeichnungen an?«
»Weil auf diesen Dingern irgendetwas ein muss.« Kate ging jede Wette ein, dass sie irgendwann fündig werden würde. »Sie bei sich am Körper zu tragen, war ein enormes Risiko.«
Der Umschlag mit den CDs war an Davenports Kontaktmann adressiert, für den Fall, dass er ihn nicht persönlich abgeben konnte, was am Ende auch der Fall gewesen war. Allerdings hätte der Umschlag ihn sowieso nie erreicht, da die Menschenhändler Davenports Kontaktmann getötet hatten, und aus diesem Grund war Kate die Aufgabe zugefallen, sich Davenports Aufzeichnungen anzunehmen.
»Nein, ich meine, warum ausgerechnet Sie sich die Aufnahmen anhören. Es gibt doch massenhaft Leute im Dezernat, und Deacon meinte, Sie stünden in der Hierarchie ziemlich weit oben, deshalb frage ich mich, wieso es nicht jemand von den niederen Rängen übernommen hat.«
Kate zuckte unbehaglich mit den Schultern. »Ich bin die Neue und habe nach einer Woche logischerweise noch nicht massenhaft Fälle auf dem Schreibtisch. Außerdem unterstützen mich ein paar Kollegen.«
Nachdenklich legte Dani den Kopf schief – eine Geste, die Kate bei ihrem Bruder schon Tausende Male beobachtet hatte. »Und wieso besuchen Sie ihn jeden Tag?«, fragte sie und lachte, als sie Kates konsternierte Miene sah. »Dachten Sie, den Schwestern fällt das nicht auf? Die haben mich ausgequetscht, sobald ich zur Tür reingekommen bin, das kann ich Ihnen versichern.«
Dass die Schwestern Dani mit Fragen bestürmten, war nicht weiter verwunderlich, schließlich arbeitete sie als Ärztin in der Notaufnahme, allerdings war sie vorübergehend beurlaubt. Kate konnte sich jedoch nicht vorstellen, weshalb ausgerechnet sie so interessant für die Schwestern sein sollte. »Und weswegen?«, fragte sie.
Dani verdrehte die Augen. »Sie dachten, Sie beide wären ein Liebespaar, das auf tragische Weise getrennt wurde und nun wieder zueinanderfindet, da er angeschossen wurde und Sie an seine Seite geeilt sind.«
Kate riss die Augen auf. »Sie machen Witze, oder? Davenport und ich?«
»Na ja, aber Sie sind doch jeden Tag hier, oder?«
Das stimmte. Manchmal hatte sie sich die Aufzeichnungen im Büro der FBI-Außenstelle angehört, aber es trotzdem nie versäumt, zumindest einmal am Tag im Krankenhaus vorbeizusehen. Soweit sie wusste, tat das außer ihr keiner, was ihr ziemlich an die Nieren ging. Die Vorstellung, dass er jetzt, nach seinem endlos langen Undercover-Einsatz, mutterseelenallein hier lag, war schrecklich – doch für einen verdeckten FBI-Ermittler war Einsamkeit meist kein Fremdwort.
Manchmal redete sie über ganz banale Dinge mit ihm, erzählte von der erbarmungslos schwülen Hitze, von ihrer Suche nach einem passenden Apartment. Ab und zu machte sie auch ihrem Frust Luft, weil sich auf den verdammten CDs nichts Brauchbares fand, dann wieder spielte sie ihm Songs von ihrem iPod vor oder las ihm aus dem Buch vor, das sie bei ihrer Abreise aus Baltimore spontan eingepackt hatte. Aber meistens saß sie einfach da und strickte, während sie den Aufzeichnungen lauschte, für die er sein Leben aufs Spiel gesetzt hatte.
»Ob Sie’s glauben oder nicht, aber ich habe ihn nicht mal eine Stunde vor der Schießerei kennengelernt«, sagte sie mit einem Seufzer, als Dani sie weiter wortlos musterte. »Deacon wollte mit seinem Team das Versteck der Menschenhändler ausheben und mich als Scharfschützin dabeihaben.« Sie war gerade mal zwei Tage in der Stadt gewesen, hatte die Gelegenheit jedoch sofort beim Schopf gepackt, schließlich konnte sie ihre Fähigkeiten mit der Waffe nicht allzu häufig unter Beweis stellen. Deshalb war ihr der Einsatz gerade recht gekommen. »Ich habe das Gelände ausgekundschaftet und mitbekommen, dass Davenport sich davonmachen wollte. Er wollte die CDs in Sicherheit bringen, was ich aber logischerweise nicht wissen konnte. Deshalb habe ich mich von einem Baum fallen lassen und ihn gestellt.«
Dani erhob sich und setzte sich mit einem begeisterten Grinsen auf den Stuhl neben Kate. »Sie haben sich fallen lassen und ihn niedergestreckt? Heilige Scheiße, Sie sind ja unglaublich! Und ich dachte, Deacon übertreibt bloß.«
Kates Wangen glühten. »Na ja, ganz so war es nicht. Ich glaube nicht, dass ich ihn einfach so hätte niederstrecken können, auch nicht von einem Baum.« Schließlich war Griffin Davenport ein Bulle von einem Kerl.
»Das glaube ich gerne, wenn ich ihn mir so ansehe«, murmelte Dani. »Was haben Sie mit ihm angestellt?«
»Ich bin hinter ihm runtergesprungen und habe ihm meine Waffe ins Kreuz gedrückt. Damit hatte er nicht gerechnet. Aber natürlich wollte er festgenommen werden und hat sofort kooperiert. Ich hätte nur sehr ungern auf ihn geschossen. Leider hatten die Menschenhändler weniger Skrupel.«
Dani nickte. »Ich hatte noch gar keine Gelegenheit, mich bei Ihnen zu bedanken.«
Kate runzelte die Stirn. »Wofür denn?«
»Dafür, dass Sie Deacon das Leben gerettet haben. Er stand direkt neben Davenport, als die Schießerei losging. Hätten Sie den Schützen nicht kaltgemacht, würden jetzt noch viel mehr Patienten hier liegen. Oder ihre Leichen in der Pathologie. Deshalb – danke.«
Kate rutschte auf ihrem Stuhl herum. »Ach, das hätte jeder andere auch hingekriegt.«
Dani zog eine Braue hoch. »Soweit ich weiß, ist keiner der anderen Agents versiert genug mit der Waffe, um aus einer halben Meile Entfernung die Reifen eines Wagens zu treffen.«
»Deacon übertreibt mal wieder«, murmelte Kate, obwohl sie wusste, dass Dani recht hatte. Aber sich mit ihren Fähigkeiten zu brüsten, lag ihr nun mal nicht. »Außerdem haben sie versucht, vom Tatort zu flüchten. Eigentlich wollte ich sie nicht töten. Es wäre mir lieber gewesen, sie hätten alle überlebt, damit wir sie verhören können.« Sie hatte die drei Flüchtenden gestoppt, doch der Schütze war durch den Aufprall gegen einen Baum ums Leben gekommen, während die beiden anderen das Bewusstsein verloren hatten. Einer war kurz darauf gestorben, und der Dritte hatte zwar überlebt, aber zu wenig über den Menschenhändlerring gewusst, um wesentlich zur Aufklärung des Falls beitragen zu können.
Dani schüttelte den Kopf. »Das mag ja sein, trotzdem bin ich froh, dass meinem Bruder nichts passiert ist. Ich bin Ihnen etwas schuldig, Kate, ganz im Ernst.«
Kate wollte mit einem Lachen abwiegeln, als ihr aufging, dass Dani Novaks Dankbarkeit aufrichtig war. »Er ist mein Freund«, sagte sie nur. »Das hätte ich für jeden anderen Kollegen auch getan, aber so konnte ich in dieser Nacht definitiv ruhig schlafen.«
Was nicht stimmte, denn auch in dieser Nacht war sie aus ihrem Alptraum hochgeschreckt. Im letzten Monat vor ihrem Umzug nach Cincinnati hatte sie ihn überhaupt nicht mehr gehabt, nun jedoch suchte er sie praktisch jede Nacht heim. Vielleicht war er durch den Schusswechsel mit den Übeltätern heraufbeschworen worden … oder durch den Umstand, dass sie in einem fremden Hotelbett schlief. Oder die pure Erschöpfung, weil sie nachts so gut wie keine Ruhe mehr fand. Oder es lag an dem unbequemen Stuhl hier.
Kates Nacken gab ein lautes Knacken von sich, als sie den Kopf hin und her drehte. »Ich hasse es, wenn ich im Sitzen einschlafe.«
»Dann sollten Sie vielleicht nach Hause gehen«, schlug Dani sanft vor.
»Ich hätte nicht gedacht, Sie hier zu sehen«, wechselte Kate abrupt das Thema. »Sind Sie wieder im Dienst?«
Danis Beurlaubung lag mehrere Monate zurück. Kate kannte nur ein paar einzelne Fakten, teils aus Telefonaten und Mails während der letzten neun Monate mit Deacon, teils aus den Nachrichten im Internet. Dani war HIV-positiv, doch das war einzig und allein ihre Angelegenheit. Mehr gab es dazu nicht zu sagen.
Aber offensichtlich war jemand anderer Meinung gewesen und hatte sich mit der Nachricht an die Medien gewandt, die sie aufgegriffen und damit Danis Beurlaubung ausgelöst hatten. Kate wusste nichts Genaues, kannte die Novaks jedoch gut genug, um sicher zu sein, dass Dani bei der Arbeit stets alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen hatte. Dass sie jetzt hier war, bedeutete hoffentlich, dass sich der Wirbel gelegt hatte und sie ihre Arbeit wiederaufnehmen durfte, für die sie so lange studiert hatte.
Ein Schatten huschte über Danis Gesicht. »Nein. Ich habe gekündigt.«
Kate blieb der Mund offen stehen. »Was? Aber warum? Und wann? Gerade eben?«
Dani holte tief Luft und ließ sie langsam wieder entweichen. »Eigentlich bin ich auch nicht wegen Agent Davenport hier, sondern wegen Ihnen. Deacon meinte, es könnte zu viel für Sie sein, rund um die Uhr an seinem Bett zu wachen.«
Kate hätte sie gern noch gefragt, wieso sie das Krankenhaus nicht wegen Diskriminierung verklagte. Sie konnte nur hoffen, dass Dani bereits eine andere Stelle gefunden hatte. Aber es lag auf der Hand, dass sie nicht darüber reden wollte, deshalb stieß Kate einen leisen Seufzer aus und zwang sich zu einem Lächeln. »Sie können Deacon sagen, dass es mir gutgeht.«
»Ich werde ihm sagen, dass Sie im Stuhl eingeschlafen sind und wahrscheinlich seit einer Ewigkeit nichts mehr gegessen haben. Aber er kommt sowieso bald vorbei, dann kann er Ihnen ja selbst die Meinung geigen«, erklärte sie knapp, obwohl sie insgeheim erleichtert war.
Kate schnitt eine Grimasse. »Eigentlich sollten Sie doch nett zu mir sein, Novak.«
Dani grinste. »Überraschung! Aber da Ihnen ja offensichtlich nichts fehlt, kann ich wieder gehen.« Sie stand auf, doch Kate hielt sie zurück.
»Nein, warten Sie.« Sie wollte nicht allein mit ihren unerfreulichen Gedanken sein, wollte nicht wieder einschlafen und sich ein weiteres Mal in den Fängen des schrecklichen Traums verstricken. »Könnten Sie nicht eine Weile mit mir reden, damit ich wach bleibe?« Sie bemühte sich um ein tapferes Lächeln.
Dani musterte sie stirnrunzelnd. »Wenn Sie so müde sind, sollten Sie vielleicht tatsächlich nach Hause gehen«, sagte sie noch einmal.
»Ich habe kein Zuhause, sondern wohne im Hotel, bis meine Sachen geliefert werden«, gab sie zurück. Und ins Hotel wollte sie auf keinen Fall. Weil sonst nur der Traum zurückkommt, und ich … Ein Schauder überlief sie, und dass sie noch nicht einmal den Versuch unternahm, ihn zu unterdrücken, sprach Bände – entweder war sie viel zu erledigt dafür, oder aber sie fühlte sich so wohl in Danis Gegenwart, dass es ihr nichts ausmachte, Schwäche zu zeigen … vielleicht war es auch eine Mischung aus beidem. »Außerdem muss ich bei Agent Davenport bleiben, falls er aufwacht. Mein Gesicht war eines der letzten, das er gesehen hat, bevor er das Bewusstsein verlor, deshalb hoffe ich, dass ich ihn beruhigen kann, falls er desorientiert ist, wenn die Ärzte noch einmal versuchen, ihn aus dem Koma zu holen.«
»Noch einmal? Das heißt, es gab schon einen Versuch?«
»Ja, aber es lief nicht besonders gut.« Kate stand auf, um sich zu strecken und einen Blick auf Davenports halb von einer Sauerstoffmaske verdecktes Gesicht zu werfen. Sanft strich sie eine blonde Locke zurück, die ihm in die Stirn gefallen war. »Heute Morgen, bevor ich hergekommen bin, aber offenbar war er völlig außer sich, hat wild um sich geschlagen und versucht, sich den Beatmungsschlauch herauszureißen, deshalb haben sie ihn sofort wieder sediert.«
»Das ist bei einem Mann von seiner Größe ziemlich gefährlich«, bemerkte Dani leise. »Er könnte jemanden verletzen.«
Allerdings. Davenport war bestimmt einen Meter neunzig groß, so dass seine riesigen Füße fast über die Bettkante hingen, und wog schätzungsweise fast hundert Kilo, allerdings ohne auch nur ein Gramm Fett, soweit Kate es beurteilen konnte.
Und dass sie ihn genauer unter die Lupe genommen hatte, war ein Geheimnis, das diese vier Wände niemals verlassen würde. Sie mochte nicht auf der Suche nach dem Mann fürs Leben sein, aber das bedeutete noch lange nicht, dass sie blind für maskuline Reize war. Und Griffin Davenport war selbst im Koma eine echte Augenweide – abgesehen von seiner muskelbepackten Brust, war er ein sehr gutaussehender Mann mit dichtem blondem Haar und einem markanten Kiefer, auch wenn im Moment wegen der Maske nicht allzu viel davon zu erkennen war.
Wie sämtliche Avengers in Personalunion, plus eine Prise von Thor und Captain America, ihren Lieblingshelden. Über kurz oder lang würde er wieder zu sich kommen, dessen war sie sich ganz sicher, und auch die Ärzte hatten eine rasche Genesung prognostiziert. Würde sein Leben am seidenen Faden hängen, hätte sie es nie gewagt, ihn so ungeniert anzustarren.
»Die Schwester hat gesagt, drei Pfleger hätten ihn festhalten müssen, damit der Arzt ihm die Spritze geben konnte.«
»Es ist nicht ungewöhnlich, dass Patienten beim Aufwachen aus dem Koma so aufgebracht sind«, meinte Dani. »Es kann ziemlich traumatisch sein, so als würde man aus einem besonders lebhaften Alptraum aufwachen.«
Ein leicht ironischer Unterton hatte sich in Danis Stimme geschlichen. Kate sah auf und bemerkte, dass Dani nicht länger den Patienten betrachtete, sondern sie … und ertappte sich dabei, dass sie die ganze Zeit sanft, fast zärtlich Davenports Stirn gestreichelt hatte.
Und das war nicht das erste Mal. Allerdings hatte sie es nur getan, weil man davon ausging, dass Koma-Patienten spürten, wenn jemand bei ihnen war. Weil sie nicht wollte, dass er sich einsam fühlte oder Angst hatte. Bloß eine mitfühlende, menschliche Geste, sagte sie sich, doch wenn sie ganz ehrlich war, hatte es immer noch etwas zutiefst Beunruhigendes, die Haut eines fremden Mannes unter ihren Fingern zu spüren, auch wenn sie nicht genau erklären konnte, warum.
Vielleicht weil die Zärtlichkeit, die sich ungewohnt anfühlen sollte, bei ihm so … natürlich war. Oder weil sie nicht angewidert zurückgewichen war.
»Der Arzt sagt, sie hätten das Paralytikum abgesetzt, das ihn stillhalten sollte, und allmählich auch das Narkotikum, so dass er jederzeit aufwachen könnte.«
»Bestimmt freut er sich, wenn er als Erstes ein freundliches Gesicht sieht«, bemerkte Dani.
»Das dachte ich auch. Bei mir wäre es jedenfalls so, wenn ich an seiner Stelle hier liegen würde.« Sie strich ihm ein letztes Mal über die Stirn, dann setzte sie sich wieder und verzog das Gesicht, als ihr Magen laut knurrte. »Ich brauche etwas zu essen, sonst fährt meine Laune in den Keller. Noch mehr als sonst«, fügte sie hinzu und sah, dass Dani grinste. »Meine Proteinriegel habe ich schon verputzt, und das Essen in der Cafeteria ist fürchterlich. Haben Sie das mitgekriegt, Davenport?« Sie wandte sich dem bewusstlosen Mann im Bett zu. »Nächstes Mal müssen Sie wirklich aufwachen, damit ich aus dem Krankenhaus rauskomme und etwas Anständiges essen kann.«
»Hat er eigentlich Familie? Jemanden, den Sie für ihn anrufen könnten?«
»Bisher habe ich niemanden gefunden. Er hat mehrere Jahre verdeckt gearbeitet. Normalerweise nehmen Burschen wie er solche Jobs an, eben weil sie keine Familie haben. Er hat seinen Verbindungsmann als Notfallkontakt angegeben, aber der wurde letzte Woche von einem der Anführer getötet. Ansonsten stand niemand im Formular.«
»Schlimm, so einsam zu sein«, meinte Dani.
Genau das hatte Kate auch gedacht. Auch in ihrem Leben gab es niemanden mehr, der im Notfall benachrichtigt werden sollte – eine Tatsache, die ein seltsames Gefühl der Verbundenheit mit Davenport heraufbeschworen hatte. Aber zumindest hatte sie eine Handvoll Leute um sich herum, die sie fragen könnte. Was sie schleunigst tun sollte, da ihr die Personalabteilung seit dem Wechsel nach Cincinnati deswegen bereits im Genick saß.
»Sie sagten doch vorhin, dass Sie mir einen Gefallen schuldig wären, Dani. Tja, ehrlich gesagt, würde ich ihn sogar gleich einfordern. Natürlich können Sie auch nein sagen, ich würde das vollkommen verstehen …«
»Fragen Sie einfach.«
»Ich musste alle möglichen Formulare für die Personalabteilung ausfüllen. Dabei fiel mir auf, dass mein Notfallkontakt nicht … nicht mehr zur Verfügung steht.« Nicht an den Traum denken. Nicht … »Ich würde ja Deacon fragen, aber …« Sie zuckte die Achseln.
Dani legte den Kopf schief. »Aber?«
Kate seufzte. »Vermutlich würde er fragen, wieso ich plötzlich jemand anderen brauche, und ich will ihn nicht mit diesem Thema belasten.« Weder jetzt noch sonst jemals.
»Früher war es Jack?«
In ihrer Frage schwang so viel Freundlichkeit und Mitgefühl mit, dass Kate unwillkürlich nickte. Ihr war bewusst, dass ihre Stimme versagen würde, deshalb beließ sie es dabei.
Jack Morrow war tatsächlich ihre Notfallkontaktperson gewesen. Bis er sich in ihrem Wohnzimmersessel das Hirn aus dem Schädel geschossen hatte. Über die gesamte Wand, den Teppich, die Deckenlampe. Und die Häkeldecke ihrer Großmutter.
»Mein herzliches Beileid«, sagte Dani sanft.
»Danke«, presste Kate mühsam hervor. Eigentlich sollte sie ein schlechtes Gewissen haben, weil sie Dani in dem Glauben ließ, Jack hätte ihr etwas bedeutet, doch nicht einmal dazu konnte sie sich durchringen. Und eigentlich war es ja nicht gänzlich unwahr. Jack war tatsächlich ein sehr guter Freund gewesen, aber dann hatte sich alles verändert.
Jack hatte sich verändert. Genauso wie Kate. In vielerlei Hinsicht nicht zum Besseren. Was wäre, wenn Johnnie dich jetzt so sehen könnte? Was würde er von der Frau denken, zu der du geworden bist?
Wenn Johnnie mich jetzt sehen könnte, wäre er hier, und damit wäre auch Jack hier, und ich würde kein schwachsinniges Selbstgespräch führen.
Ein scharfer Schmerz schoss ihr durch den Nacken. Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass sie die Zähne fest aufeinandergebissen hatte. Und auch Dani war das natürlich nicht entgangen. »Alles in Ordnung?«, fragte sie nüchtern.
»Klar. Alles super.«
»Rufen Sie mich einfach an, wenn Sie was brauchen«, sagte Dani.
»Sie mich auch.« Dani stand bereits an der Tür, als Kate aus ihren Gedanken schreckte. »Moment, warten Sie. Haben Sie eigentlich schon einen neuen Job? Natürlich würde Deacon Sie nicht verhungern lassen, aber …« Beschämenderweise brach ihre Stimme. Trotzig reckte sie das Kinn. »Ich muss sicher sein, dass es Ihnen gutgeht.«
Das Lächeln, das sich auf Danis Gesicht ausbreitete, reichte bis zu ihren bemerkenswerten Augen. »Ja, ja, ich schaffe das schon. Danke. Ich habe zuletzt stundenweise in der Lorelle E. Meadows Klinik gearbeitet, die zur städtischen Notunterkunft gehört. Dort können sich Obdachlose gratis behandeln lassen. Der Vorstand hat gerade beschlossen, eine Vollzeitstelle zu schaffen, die man mir angeboten hat. Offen gestanden, ärgert es mich maßlos, dass ich nicht länger in der Notfallmedizin arbeiten kann, nur weil die Zeitungen Schwachsinn verzapfen und die Leute dermaßen engstirnig sind, noch dazu, wo ich die Vorschriften der Ärztekammer genauestens befolgt habe. Aber in der Klinik kann ich immerhin etwas bewirken, und das ist gut. Am Montag ist mein erster Tag. Wenn Sie sich ein bisschen eingelebt haben, können Sie gern vorbeikommen, dann zeige ich Ihnen alles.«
»Mache ich.« Als Dani gegangen war, richtete Kate ihre Aufmerksamkeit wieder auf Griffin Davenport, dessen Brust sich rhythmisch hob und senkte. »Ich will ja nicht meckern, Griff, aber es wäre echt nett, wenn Sie sich ein bisschen beeilen und bald aufwachen würden. Ich brauche dringend Schlaf, aber nicht hier. Nicht noch einmal.«
Sie fuhr hoch, als sie glaubte, einen Finger auf dem weißen Laken zucken gesehen zu haben; sie rief sogar die Schwester, die jedoch keinerlei Anzeichen des Erwachens feststellen konnte. Sie tätschelte Kates Hand und riet ihr, nach Hause zu fahren und sich eine Mütze voll Schlaf zu gönnen, offensichtlich sehe sie schon Gespenster.
Kate verkniff sich einen bissigen Kommentar, setzte sich wieder hin, nahm ihr Strickzeug zur Hand und griff nach den Ohrstöpseln, um sich Davenports nächste Aufzeichnung anzuhören.
Doch dann hielt sie inne. »Ihnen ist schon klar, dass Sie mir dann auch verraten könnten, wonach ich suche, oder? Also los, Davenport.« Sie musterte ihn aufmerksam, doch er schien sich nicht zu regen, also steckte sie die Ohrstöpsel in die Ohren und machte sich an die Arbeit.
Cincinnati, OhioMittwoch, 12. August, 22.30 Uhr
Will man etwas verstecken, plaziert man es am besten dort, wo es jeder sehen kann – diese Erkenntnis hatte er bereits vor vielen Jahren gemacht. Genau aus diesem Grund war er mit dem Wagen durch das kaputte Tor auf der Rückseite des King’s College gefahren und wartete nun auf seine Informantin. Niemand würde Verdacht schöpfen, wenn er ihn hier stehen sah … Lovers’ Lane, die Stelle war so etwas wie der Geheimtreffpunkt für Verliebte.
Na ja, eher eine Mischung aus Geheimtreffpunkt für Verliebte und Drogenumschlagplatz.
Kameras gab es keine, zumindest keine funktionierenden, dafür hatten die Studenten gesorgt. Wer behauptete, die Jugend von heute würde immer dümmer, hatte offensichtlich noch nie die Kids gesehen, die ums Verrecken high oder flachgelegt werden wollten. Oder beides.
Im Semester zuvor waren zwei junge Frauen entführt worden, was für einigen Wirbel gesorgt hatte. Die Collegeverwaltung hatte sich zutiefst schockiert und entsetzt über die mutwillige Zerstörung der Überwachungskameras gezeigt und das gesamte Equipment bis hin zur letzten Glühbirne auf dem Campus ersetzt, nur um sich danach selbst zu der erfolgreichen Maßnahme zu beglückwünschen und sich fortan nicht weiter darum zu scheren. Die Kamera am hinteren Tor war gleich als Erstes abmontiert worden. Sie hatte nicht mal eine Woche dort gehangen.
All das wusste er von seinem Kundenstamm – Collegekids gerieten schnell in Plauderlaune, wenn sie high waren, und sein Stoff zählte zum Besten, was man kriegen konnte. Was ein offenes Geheimnis war.
Sollte die Kamera wider Erwarten doch funktionieren, wäre es auch kein Problem, weil nur genau das zu sehen wäre, womit er sie gefüttert hatte. Trotzdem war er nicht allzu scharf darauf, hier herumzusitzen und zu riskieren, beobachtet zu werden, denn über kurz oder lang würde jemand vorbeikommen, schließlich trafen sich hier die Verliebten zum Knutschen.
Er sah auf seine Armbanduhr – ja, er trug tatsächlich eine Uhr, auch wenn so etwas nur alte Männer taten – und runzelte die Stirn. Sie kam zu spät. Das ging ihm ganz gewaltig gegen den Strich, weil es einen grundsätzlichen Mangel an Respekt darstellte, der nicht toleriert werden durfte. Andererseits spielte es keine Rolle. Sie würde die nächste Verabredung sowieso nicht mehr erleben, insofern war es die ganze Aufregung nicht wert.
Er hörte sie, noch bevor er sie sah. Sidney Siler fuhr einen Motorroller, dessen Auspuff dringend repariert werden musste. Kies spritzte hoch, als sie auf den Hof fuhr. Er verdrehte die Augen. Indem er sie tötete, würde er der Menschheit sogar einen Gefallen tun. Dieses Mädchen war eine Gefahr im Straßenverkehr, wie sie im Buche stand.
Sie öffnete die Beifahrertür und stieg ein. »Bitte entschuldigen Sie die Verspätung. Ich weiß ja, dass Sie Zuspätkommen nicht leiden können.«
Es gefiel ihm, dass sie gar nicht erst mit faulen Ausreden ankam, zwar nicht so sehr, als dass er sie deswegen am Leben gelassen hätte, aber trotzdem. »Und? Hast du sie gesehen?«
»Ja, und sie hat mir sofort abgekauft, dass ich die Assistentin ihres Anwalts bin. Ich hab mein schwarzes Kostüm angezogen – das eine, das ich immer zu Beerdigungen trage. Das und die Bestätigung auf dem Briefpapier ihres Anwalts haben gereicht, um ohne Probleme an der Gefängnispforte vorbeizukommen. Ich bin Ihnen echt was schuldig.«
Natürlich hatte das Bestätigungsschreiben funktioniert, schließlich hatte er es eigenhändig gefälscht. Dass sie ihr Beerdigungskostüm angezogen hatte, verlieh dem Ganzen eine köstlich ironische Note. »Und? Wie ist es gelaufen?«
Sidney zog eine Grimasse. »Von jetzt an werde ich höllisch aufpassen, von wem ich meine Drogen kaufe. So ein Gefängnis ist der reinste Saustall. Ich will jedenfalls nicht auf der anderen Seite der Glasscheibe enden.«
»Ich hoffe doch, die Hygienezustände sind nicht das einzige Abschreckungsmittel«, bemerkte er trocken. »Wie war Alice drauf?«
»Cool.« Ein Schauder überlief sie. »Die Frau ist ja der reinste Eisklotz. Ich kann froh sein, dass sie mir abgekauft hat, dass ich auf ihrer Seite bin. Die will ich definitiv nicht gegen mich haben.«
Das war so ziemlich das Intelligenteste, was Sidney je von sich gegeben hatte. »Und?«
»Sie war ein bisschen überrascht. Eigentlich hatte sie ihren Anwalt doch gefeuert, weil er so ein Schlappschwanz ist. Ihre Worte, nicht meine. Ich hatte das Gefühl, sie ist nicht so recht überzeugt davon, dass er es schafft, sie da rauszuholen. Eine wie sie braucht keinen Schlaffi, sondern eine knallharte Nummer. Im juristischen Sinne, meine ich.«
Seine Mundwinkel zuckten amüsiert. Er mochte Sidney. »Stimmt. Und mit knallharten Nummern kennt sie sich aus. Zumindest in diesem Sinne.« Alice war ein eiskaltes Luder. Heilige Scheiße, die Frau hatte mit einem Scharfschützengewehr von einem Dach auf eine Horde Agents geschossen, die einen Kronzeugen begleitet hatten. Davon abgesehen, war sie im Bett eine echte Granate gewesen. Mit ihr zu vögeln hatte beinahe Spaß gemacht, allerdings war sie viel zu alt für seinen Geschmack. Er unterdrückte einen Schauder. Sex mit Alice gehörte einfach dazu: Wollte man ihre Ware, musste man sie vögeln. Und eine Zeitlang hatte er die Ware gewollt und es deshalb notgedrungen in Kauf genommen.
Sidney grinste verschlagen, wobei sich ihre weißen Zähne von ihrer dunklen Haut abhoben. »Ich kann mir das echt nicht vorstellen. Sie beide, Sie wissen schon … zusammen. Ich meine, sie ist so alt wie ich. Und Sie … nicht.«
Er warf ihr einen finsteren Blick zu. Das kam dabei heraus, wenn man sich mit Kunden einließ, die noch grün hinter den Ohren waren. Im Handumdrehen vergaßen sie, wo ihre Grenzen waren. »Das ist lange her. Ich meinte damit, dass Alice eine lange und harte Zeit vor sich hat.«
Sidney prustete vor Lachen. »Lang und hart … Entschuldigung. Entschuldigung.« Sie zwang sich, ein ernstes Gesicht zu machen. »Sie meint, jemand hätte sie verpfiffen.«
»Logisch. Das sagen alle. Hat sie mich erwähnt? Du weißt schon … schöne Grüße an den Ex-Freund oder etwas in der Art?«
»Nein. Ich habe aber auch nichts von Ihnen erzählt.« Sie runzelte die Stirn. »Ich bin ja nicht blöd, Professor.«
Erleichterung durchströmte ihn. Das war die einzige Schwachstelle in seinem Plan gewesen, aber er hatte unbedingt jemanden ins Gefängnis einschleusen müssen, der mit Alice redete. Jemanden, dem keine Verbindung zu ihm nachgewiesen werden konnte.
»Gut.« Er lächelte. »Wie du gerade gesagt hast … gegen mich will ich sie definitiv nicht haben. Und wenn sie erfährt, dass ich dich dort eingeschleust habe, damit du deinen Artikel schreiben kannst …«
»Wird sie nicht. Keiner wird je davon erfahren. Ich habe es ja noch nicht mal meiner Studienberaterin erzählt. Ich war nicht sicher, ob es klappt, und wollte nicht, dass sie enttäuscht ist. Aber sie wird ausflippen, wenn ich es ihr sage. Das wird der perfekte Aufhänger für unsere Soziopathen-Story. Ich habe alle Zeit der Welt, und das Semester hat noch nicht mal angefangen.«
»Hast du Alice gebeten, dir die Unterlagen zu geben, damit du einen Deal aushandeln kannst?«
»Ja, ich habe ihr gesagt, mein Boss würde glauben, er könnte die Todesstrafe vom Tisch bekommen, wenn sie etwas liefert, woraus hervorgeht, wer ihre Kunden und Lieferanten sind, so wie Sie es wollten. Aber sie ist komplett ausgeflippt. Sie meinte, nur Vollidioten, Schwachköpfe und debile alte Säcke würden etwas schriftlich festhalten. Das sei doch viel zu riskant. Sie meinte, sie würde auspacken, und zwar komplett, sobald man ihr Straffreiheit gewährt. Deshalb sollte ich den Schwachsinnsvorschlag meines Chefs nehmen und ihn ihm in den Arsch stecken. Es war wirklich unglaublich … so als würde ich sie wirklich … sehen. Als könnte ich hinter ihre Fassade blicken und erkennen, was für ein Mensch sich dahinter versteckt. Eine Soziopathin, die alle Masken fallen lässt.«
Eine weitere Woge der Erleichterung durchströmte ihn. Alice hatte also keinerlei schriftliche Unterlagen irgendwo deponiert, das erleichterte die Dinge ungemein. Er hatte ausschließlich mit Alice kommuniziert, wenn er Ware von ihr gekauft hatte, deshalb brauchte er auch keine Angst zu haben, jemand könnte seinen Namen oder sonst etwas über ihn wissen. Das bedeutete, er konnte sie problemlos beseitigen.
Damit blieb nur noch ein Unsicherheitsfaktor: ein ehemaliger Undercover-FBI-Typ, der im Koma lag. Aber er hatte bereits alle notwendigen Schritte eingeleitet, um auch dieses Problem so schnell wie möglich zu lösen.
»Tja, Alice ist nun mal eine Soziopathin«, sagte er und lächelte Sidney zu. »Ich habe dir eine versprochen, und du hast sie bekommen.«
»Aber hallo. Ich kann es kaum erwarten, an den Schreibtisch zu kommen. Es war der totale Oberhammer.«
Er zog die Brauen hoch. Sie fühlten sich schwerer an als sonst – die Augusthitze ließ die Gesichtsprothese, die er bei seinen Trips zum Collegecampus trug, klebrig werden. Die Idee dazu war ihm vor vielen Jahren gekommen, als er selbst noch Student gewesen war und Koks an seine Freunde vertickt hatte. Keine großen Mengen, sondern nur für den Hausgebrauch, gerade genug, um seine Fachbücher und den Sprit für seinen Wagen bezahlen zu können. Aber das Geschäft hatte sich rasch entwickelt und er sich einen Ruf erarbeitet, »Spitzenstoff« zu verkaufen.
Er hatte das Zeug selbst hergestellt, im Keller, quasi der echte Walter White, zehn Jahre bevor den Drehbuchschreibern in Hollywood die Idee zu Breaking Bad gekommen war. Auch heute noch verkaufte er an Einzelpersonen wie Sidney, aber eigentlich eher, um weiterhin bei den Kids das Ohr am Gleis zu haben, und weniger wegen des Geldes. Die großen Summen kamen durch den Verkauf an echte, weitverzweigte Drogenringe wie der herein, den Alice für ihren Vater betrieben hatte. Aber jetzt, wo Alice dem FBI ins Netz gegangen war, musste er sich andere Partner suchen, schließlich hatte auch er Ausgaben.
Alice hatte nicht gewusst, dass er sowohl Kunde als auch Lieferant war. Als Professor hatte er ihr seinen erstklassigen Stoff verkauft und unter seinem richtigen Namen Ware abgekauft. Zum Glück hatte er bereits andere Quellen für seine Käufe aufgetan, viel preiswertere als Alice’, und obendrein blieb es ihm auch erspart, mit ihr in die Kiste steigen zu müssen.
Jedenfalls war er heilfroh, dass Sidney seinen Namen nicht erwähnt hatte.
»Willst du dir mal so richtig das Hirn rausblasen?«
Sidneys dunkle Augen leuchteten. »Ich dachte schon, Sie fragen überhaupt nicht mehr.«
Er reichte ihr ein Tütchen mit weißem Pulver. »Meine Spezialmischung.«
Sie beäugte die Ware argwöhnisch. »Und wie viel kostet die?«
»Dasselbe wie sonst auch. Ich dachte, du willst vielleicht ein bisschen feiern.«
Sie strahlte. »Absolut.« Sie zog ihr Besteck aus dem Rucksack und legte alles auf die Mittelkonsole: Spiegel, Strohhälmchen, Rasierklinge. Mit routinierten Bewegungen zog sie drei säuberliche Lines auf dem Spiegel, beugte sich vor und wollte die erste hochziehen, als er ihre Schulter berührte.
»Heute gibt’s einen Bonus. Etwas Neues, mit dem ich gerade ein bisschen experimentiere. Willst du’s mal probieren?«
Sie musterte ihn. »Ist das Zeug auch ungefährlich?«
Das Mädchen schniefte Koks. Er unterdrückte den Impuls, die Augen zu verdrehen. »Absolut. Ich habe es selbst schon genommen und an einige meiner besten Kunden verteilt. Du wirst begeistert sein, versprochen.«
Sie strahlte vor Freude, zu seinen besten Kunden gezählt zu werden. »Und was muss ich dafür tun?«
Er hielt ein Glasröhrchen mit einer einzelnen Kapsel hoch. »Zuerst sniefst du eine Line, dann steckst du dir das in den Mund und zerkaust es. Es ist der totale Hammer, geradezu orgasmisch.«
Sie kicherte. »Ich glaube nicht, dass es das Wort wirklich gibt, Professor.« Sie beugte sich vor, zog sich das Pulver in die Nase und lehnte sich zurück, während das Koks in ihrem Gehirn ankam. »Puh, wow. Allein das schon … Wahnsinn.«
Behutsam ergriff er ihr Kinn, drückte ihren Mund auf und ließ die Kapsel aus dem Röhrchen auf ihre Zunge gleiten. Keine Berührung. Keine Fingerabdrücke. »Und jetzt beiß zu. Fest. Und schnell schlucken.«
Sie gehorchte. Eine Minute lang passierte gar nichts. Sie runzelte die Stirn. »Ich spüre nichts.«
»Das kommt schon, keine Angst.« Er zog ein Paar Latexhandschuhe aus der Tasche und streifte sie über, dann gab er das restliche Kokain in das Tütchen, verschloss es und steckte es ein, ehe er ihr Besteck einsammelte und in ihren Rucksack fallen ließ und ihr Handy herauszog.
»Was machen …« Sie verzog das Gesicht. »Mir geht’s irgendwie nicht gut … o Gott, was war in der Kapsel?«
»Zyanid.«
»Wa–?« Hilflose Panik flackerte in ihren Augen auf, während sie vergeblich versuchte, das Wort über die Lippen zu bringen.
»Und in dem Koks war Ketamin. Das ist meine Spezialmischung. Gleich kannst du dich nicht mehr bewegen, also versuch’s gar nicht erst. Du wirst dir wünschen, du wärst tot. Und gleich bist du es auch.«
Er packte ihre Hand und drückte ihren rechten Zeigefinger auf die Taste ihres Smartphones, um die Sicherung zu lösen. Presto. Dann scrollte er durch die Fotos, um sicherzugehen, dass sie keines von Alice gemacht hatte. Es durfte keinerlei Verbindung geben.
Hervorragend. Keine Fotos. Er würde das Smartphone in den nächsten Mülleimer werfen.
Sidney hatte sich nach vorn gebeugt und die Arme um den Oberkörper geschlungen. Krämpfe. Jetzt würde es nicht mehr lange dauern. Er beugte sich über sie, öffnete die Tür und schob sie vom Sitz, dann warf er ihren Rucksack hinterher. »Tut mir leid«, sagte er. Und er meinte es auch so.
Er schloss die Tür und fuhr durch das kaputte Tor. Nach ein paar Metern nahm er die SIM-Karte aus dem Smartphone und warf das Gerät in den ersten Mülleimer, den er sah. Ein paar Blocks später hielt er ein weiteres Mal an und ließ die Karte in den Rinnstein fallen. Nächster Halt, Ohio River.
Wie praktisch. Und sollte die Karte wider Erwarten doch irgendwo angespült werden, wären die Daten längst zerstört. Er verzog das Gesicht. Und die Leute essen immer noch Fisch aus dieser Brühe. O Gott.
Apropos … er hatte noch nicht zu Abend gegessen. Er fragte sich, was Mallory wohl gekocht haben mochte. Wehe, es gab Fisch.
2. Kapitel
Cincinnati, OhioMittwoch, 12. August, 23.30 Uhr
Sie klackerte wieder. Und summte. Und zwar fürchterlich falsch. Aber das machte Decker nichts aus. Wenigstens waren die Laute real. Das war das Allerwichtigste. Er klammerte sich mit aller Macht an das Reale, doch die Finsternis wollte ihn immer wieder aufs Neue verschlingen, und er war zu erschöpft, um weiterzukämpfen.
Doch jetzt hörte er dieses Klappern und das Summen, an dem er sich festhalten konnte. Was war das für ein Song? Er wusste genau, dass er ihn kannte, auch wenn die Töne noch so schief waren. Der Name schwebte direkt vor seinem geistigen Auge, und doch war er zu weit entfernt. Dann kamen die Worte. Sie sang.
»Wish you were here …«
Ah. Pink Floyd. Himmelschreiend falsch gesungen. Und so unendlich traurig. Warum ist sie so traurig? Er musste es wissen, konnte aber … er konnte sie nicht fragen. Weil er sich nicht bewegen konnte. Wut loderte in ihm auf, verrauchte aber sofort wieder. Nicht einmal dafür reichte seine Energie.
Dann hörte das Klackern auf, ihre Stimme brach, als sie von den beiden verlorenen Seelen in einem Goldfischglas sang. Panik ergriff ihn, als er ein Rascheln hörte. Nicht gehen. Bitte geh nicht. Bitte, berühre mich noch einmal. Bitte. Es hatte sich so schön angefühlt, und das wollte er ihr sagen. Es war so lange her, seit ihn das letzte Mal jemand so berührt hatte.
Ein Schluchzen drang durch den Nebel seines Bewusstseins, gefolgt von einem zittrigen Seufzer. Sie weinte. Nicht weinen. Bitte. Das Klackern setzte wieder ein, und er entspannte sich. Sie schniefte zwar noch, aber wenigstens schien sie zu bleiben.