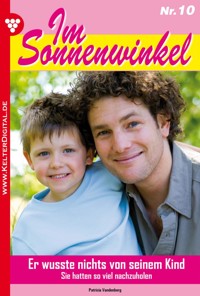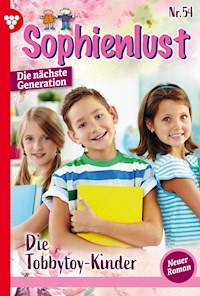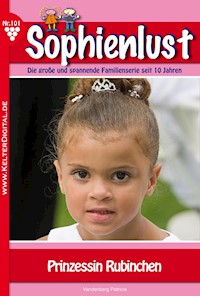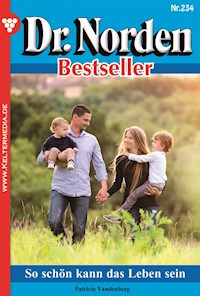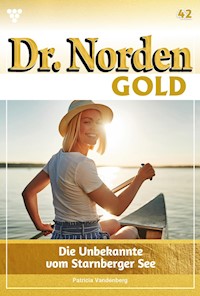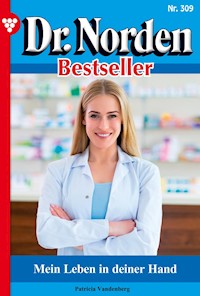Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Dr. Norden Bestseller
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Für Dr. Norden ist kein Mensch nur ein 'Fall', er sieht immer den ganzen Menschen in seinem Patienten. Er gibt nicht auf, wenn er auf schwierige Fälle stößt, bei denen kein sichtbarer Erfolg der Heilung zu erkennen ist. Immer an seiner Seite ist seine Frau Fee, selbst eine großartige Ärztin, die ihn mit feinem, häufig detektivischem Spürsinn unterstützt. Dr. Norden ist die erfolgreichste Arztromanserie Deutschlands, und das schon seit Jahrzehnten. Mehr als 1.000 Romane wurden bereits geschrieben. Die Serie von Patricia Vandenberg befindet sich inzwischen in der zweiten Autoren- und auch Arztgeneration. Bleich und zitternd saß das junge Mädchen in Dr. Nordens Sprechzimmer, während er noch ein kurzes Telefongespräch führen mußte. Dabei ließ er Christel Jakobus allerdings nicht aus den Augen. Sie war früher schon ein paarmal bei ihm gewesen, wenn sie erkältet war oder Halsschmerzen hatte. Er hatte eine besonders gute Meinung von ihr gewonnen, weil sie sich nie krank schreiben lassen wollte. Daß sie in der Konditorei Hübner weidlich ausgenutzt wurde, wußte er außerdem. Er legte den Hörer auf und fragte freundlich: »Wo fehlt es denn, Christel?« Da kullerten schon die Tränen, und ein haltloses Schluchzen schüttelte den schmalen Mädchenkörper. Endlich brachte sie es mühsam über die Lippen: »Ich krieg ein Kind, jetzt weiß ich es. Aber was soll ich nur tun, Herr Doktor, bitte, helfen Sie mir doch.« Christel Jakobus und ein Kind? Er konnte es nicht fassen. Sie war zwar ein recht hübsches Ding, aber überaus schüchtern und männerscheu, das wußte er auch. »Nun mal langsam, Kleine«, sagte er väterlich. »Warum sind Sie denn gar so ängstlich? Hat der Mann Sie verlassen?« »Ich kann's nicht sagen. Ich darf es ja nicht sagen«, flüsterte sie, »aber was der verlangt, kann ich auch nicht tun.« »Wenn ich Ihnen helfen soll, müssen Sie mir schon ein bißchen mehr erzählen, Christel. Und außerdem sollten Sie vorher mal zu Dr. Leitner gehen und feststellen lassen, ob Sie wirklich schwanger sind.« »Ich weiß es«, murmelte sie wieder. »Er hat es ja gewollt, und ich soll das Kind seiner Frau geben. Grad recht wär' ich dafür, daß ich ihnen ein Kind zur
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dr. Norden Bestseller – 149 –
Sie bereute ihre Entscheidung
Patricia Vandenberg
Bleich und zitternd saß das junge Mädchen in Dr. Nordens Sprechzimmer, während er noch ein kurzes Telefongespräch führen mußte. Dabei ließ er Christel Jakobus allerdings nicht aus den Augen. Sie war früher schon ein paarmal bei ihm gewesen, wenn sie erkältet war oder Halsschmerzen hatte. Er hatte eine besonders gute Meinung von ihr gewonnen, weil sie sich nie krank schreiben lassen wollte.
Daß sie in der Konditorei Hübner weidlich ausgenutzt wurde, wußte er außerdem. Er legte den Hörer auf und fragte freundlich: »Wo fehlt es denn, Christel?«
Da kullerten schon die Tränen, und ein haltloses Schluchzen schüttelte den schmalen Mädchenkörper. Endlich brachte sie es mühsam über die Lippen: »Ich krieg ein Kind, jetzt weiß ich es. Aber was soll ich nur tun, Herr Doktor, bitte, helfen Sie mir doch.«
Christel Jakobus und ein Kind? Er konnte es nicht fassen. Sie war zwar ein recht hübsches Ding, aber überaus schüchtern und männerscheu, das wußte er auch.
»Nun mal langsam, Kleine«, sagte er väterlich. »Warum sind Sie denn gar so ängstlich? Hat der Mann Sie verlassen?«
»Ich kann’s nicht sagen. Ich darf es ja nicht sagen«, flüsterte sie, »aber was der verlangt, kann ich auch nicht tun.«
»Wenn ich Ihnen helfen soll, müssen Sie mir schon ein bißchen mehr erzählen, Christel. Und außerdem sollten Sie vorher mal zu Dr. Leitner gehen und feststellen lassen, ob Sie wirklich schwanger sind.«
»Ich weiß es«, murmelte sie wieder. »Er hat es ja gewollt, und ich soll das Kind seiner Frau geben. Grad recht wär’ ich dafür, daß ich ihnen ein Kind zur Welt bringe, hat er gesagt, und ich hab’ mich doch gar nicht wehren können, Herr Doktor.«
Dr. Daniel Norden runzelte die Stirn. Was Christel da sagte, gefiel ihm gar nicht, denn er glaubte ihr jedes Wort. Christel hatte nicht so viel Phantasie, sich eine solche Geschichte auszudenken Sie war ein einfaches Mädchen, gewiß nicht dumm, aber man hatte ihr gar nicht die Möglichkeit gegeben, sich weiterzubilden. Ihr Vater war früh gestorben und hatte die Familie mittellos zurückgelassen. Gleich nach Volksschulabschluß hatte Christel Geld verdienen müssen.
In der Konditorei Hübner war sie seit einigen Monaten als Verkäuferin.
Christels Erklärung regte Dr. Norden sofort zum Kombinieren an. Aber er wollte aus Christels Mund hören, ob seine Ahnungen auch stimmten.
»Mir können Sie alles erzählen, Christel«, sagte er sanft. »Ein Arzt hat die Pflicht zu schweigen. Es wird niemand erfahren, was da geschehen ist, wenn Sie es selbst verschweigen wollen.«
»Ich käm’ ja doch nicht gegen ihn an. Dann würde er alles abstreiten oder wenigstens verdrehen«, weinte sie auf. »Und alle würden noch mit dem Finger auf mich zeigen. Das halt ich nicht durch.«
»Wir werden schon eine Lösung finden«, sagte er. »Es handelt sich also um Ihren Chef.«
Sie starrte ihn blicklos an und nickte. Nun, über den Konditormeister wußte Dr. Norden so einiges. Als flotter, recht ansehnlicher Bursche hatte er vor zehn Jahren die drei Jahre ältere Tochter des reichen Bäckermeisters Reberle geheiratet, sich in ein gemachtes Nest gesetzt und das auch weidlich ausgenützt. Allerdings mußte man ihm auch nachsagen, daß er sich aufs Geldverdienen gut verstand, und deshalb hatte ihm auch der alte Reberle so manches nachgesehen, was die Ehe schon mehrmals ins Gerede gebracht hatte. Gekränkt hatte es den biederen Bäckermeister aber am meisten, daß die Ehe kinderlos geblieben war. Irma Hübner hatte ein paar Fehlgeburten gehabt, und dann hatte sie so viel Kummerspeck angesetzt, daß man immer meinte, sie sei schwanger.
Nun hörte Dr. Norden aber doch eine Geschichte, die ihm sehr mißfiel und ihn sogar in Zorn geraten ließ. Christel erzählte ihm bebend ihren Leidensweg.
Oft hatte sie bis spät abends noch im Geschäft bleiben und aufräumen müssen. Vor drei Monaten, als Irma Hübner mit ihren Eltern eine Reise nach Teneriffa machte, war es dann geschehen, daß ihr Franz Hübner Gewalt angetan hatte.
Gut würde es ihr gehen, wenn sie den Mund halten würde. Man würde es so arrangieren, daß niemand etwas erfahren würde. Endlich könnte er dann seinem Schwiegervater ein Kind präsentieren, und seine Frau sei auch einverstanden. Er wollte ihr dann auch eine gute Stellung besorgen, wenn das Kind auf der Welt sei und dreitausend Mark würde sie bekommen.
»Ich kann’s nicht, ich kann’s nicht«, stammelte sie. »Sie sind doch beide so abscheulich, so geldgierig, so gemein.«
»Wollen Sie das Kind behalten, Christel?« fragte Dr. Norden.
»Ich kann es doch auch nicht ernähren«, schluchzte sie. »Aber wenn ich es weggeben muß, dann nur lieben Menschen. Und wenn Sie mir helfen könnten, Herr Doktor…«, ihre Stimme erstickte.
Er überlegte. »Ich werde Ihnen einen Vorschlag machen. Sie kündigen sofort, und dann bringe ich Sie zur Insel der Hoffnung. Dort werden Sie auch eine Beschäftigung finden bis zur Geburt, und wenn Sie das Kind dann immer noch weggeben wollen, werden wir auch liebe Eltern für das Baby finden.«
Ihre Tränen versiegten. Gläubig blickte sie ihn aus umschatteten Augen an.
»Sie sind der einzige Mensch, zu dem ich Vertrauen habe, Herr Doktor«, flüsterte sie. »Aber was soll ich denn sagen?«
»Daß Sie kein Kind bekommen und kündigen wollen. Das ist nur ein Vorschlag.«
»Aber das wird er mir doch nicht glauben«, sagte sie.
»Dann schicken Sie ihn zu mir. Ich werde ihn aufklären, wie es sich mit den Gesetzen verhält. Ich werde Sie krank schreiben. Sie können in dieser Verfassung Ihrer Arbeit unmöglich nachgehen. Das werde ich verantworten. Sollte er handgreiflich werden, schreien Sie um Hilfe. Mal sehen, wie er sich dann rechtfertigt. Haben Sie denn keinen Menschen, der Ihnen zur Seite steht, wenn Sie die Kündigung vorbringen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich kann es ja nicht mal meiner Mutter sagen.«
Knapp neunzehn Jahre war sie und so verlassen. Dr. Norden nickte ihr aufmunternd zu.
»Wir bringen das schon in Ordnung, Christel.«
»Aber ich muß doch von meinem Verdienst fast alles abgeben. Und ich muß eben verdienen.«
»Sie werden ja auch verdienen, nur nicht hier, und mit Ihrer Mutter werde ich sprechen.«
»Aber nichts von dem Kind sagen. Sie ist nicht so wie ich. Sie würde es dem Hübner dann schon geben und mehr herausschlagen.«
Schlimm war das alles, doch in diesem Fall glaubte Dr. Norden doch, helfen zu können.
»Sie sagen mir sofort Bescheid, wenn Sie gekündigt haben«, erklärte er freundlich. »Und nun Kopf hoch.«
*
Nachdem Dr. Norden seine Hausbesuche gemacht hatte, suchte er Frau Jakobus auf. Sie war eine verhärmte Frau, hart geworden durch die Armut, in der sie mit ihren Kindern zurückgeblieben war. Die kleine Wohnung in einem alten Haus, so bescheiden sie auch war, war sauber und ordentlich.
Als Zugehfrau hatte sie hart arbeiten müssen, um die Miete und den Lebensunterhalt für sich und die drei Kinder zu verdienen. Nachdem Christel dann auch beisteuern konnte, war es etwas besser geworden.
»Bei uns ist niemand krank, Herr Doktor«, sagte Frau Jakobus verwirrt, als sie dem Arzt die Tür geöffnet hatte.
»Ich wollte auch nur mal hereinschauen und etwas mit Ihnen besprechen, Frau Jakobus. Sie sehen ja wohl selbst, daß Christel überfordert ist.«
Ihre ohnehin schmalen Lippen preßten sich noch mehr zusammen. »Wir können uns nichts aussuchen, Herr Doktor. Sie verdient doch ganz gut.«
»Nun, vergleichsweise nicht«, erwiderte er. »Ich könnte ihr eine Stellung auf der Insel der Hoffnung verschaffen.«
Nun kniff sie die Augen zusammen. »Weg von hier, damit sie nichts mehr abgeben braucht?«
»So ist es nicht. Sie könnte Ihnen dann mehr abgeben als bisher. Und Sie hätten mit den beiden Kleineren etwas mehr Platz.«
»Na ja, das könnten wir schon brauchen, und so ganz recht ist es mir ja auch nicht, daß sie bei dem Hübner arbeitet. Es wird ja viel geredet über ihn. Wieviel mehr würde Christel denn abgeben können?«
»So hundertfünfzig Mark.«
»Garantiert?«
Man konnte ihr nicht verdenken, daß sie nur in Zahlen dachte. Es war ja nicht so, daß sie das Geld für sich verbrauchte. Es fehlte ja überall. Und wenn man in einem Ort lebte, wo es so viel Wohlstand gab, brauchte es auch nicht zu wundern, daß zur Resignation auch ein gewisser Neid hinzukam.
»Garantiert«, erwiderte er. »Ich habe es Christel nur angedeutet und wollte erst Ihre Meinung hören.«
»Da wird sie ja wohl gut aufgehoben sein und nicht auf die schiefe Bahn kommen«, sagte Frau Jakobus.
»Das brauchen Sie nicht zu fürchten. Und das Klima wird Christel auch guttun.«
»Sie waren immer anständig zu uns, so anständig wie keiner hier«, murmelte sie. »Wenn Sie etwas versprechen, halten Sie es auch. Mir sollst dann recht sein. Da wird sie dann wohl auch ein eigenes Zimmer bekommen.«
»Aber gewiß, Frau Jakobus.«
»Wenn der Hübner aber Schwierigkeiten macht?«
»Das kann er nicht. Christel hat immer viel länger arbeiten müssen als statthaft ist. Ich kann da schon ein Wörtchen mitreden.«
Er war zufrieden, daß Frau Jakobus keine Schwierigkeiten machte.
Christel dagegen hatte eine schwere Stunde durchzustehen. Mit Zittern und Zagen hatte sie dem Chef gesagt, daß sie kündigen wolle.
»Du hast wohl nicht alle!« fauchte er sie an. »Kannst du jetzt doch gar nicht, du dumme Gans. Denk an unser Abkommen.«
»Ich hab’s nicht gewollt«, murmelte sie. »Und ich krieg’ auch kein Kind.«
Er lief blaurot an. »Hast es abtreiben lassen? Aber dazu hast du doch kein Geld.«
Christel legte den Kopf zurück. »Wann denn? Hab’ doch jeden Tag gearbeitet. War eben ein Irrtum. Und ich bin froh. Dr. Norden hat auch gesagt, daß er mich krankschreiben muß.«
Sie war unbeholfen. Sie wußte nicht, wie sie sich ausdrücken sollte, aber der Name Dr. Norden ließ Hübner jetzt erblassen.
»Du hast dich hinter ihn gesteckt, du hinterlistiges Luder«, stieß er hervor. »Aber wenn du mich in Schwierigkeiten bringen willst, kannst du was erleben.«
»Will ich ja nicht«, sagte sie zitternd. »Ich will bloß fort.«
»Na, dann geh doch. Verschwinde. Brauchst gar nicht mehr kommen. Laß dich nur krank schreiben.«
Die Angst fiel ab von Christel. Sie atmete auf. Sie konnte gehen. Richtig begreifen konnte sie es noch nicht. Freilich waren damit für sie nicht alle Probleme aus der Welt geschafft, aber jetzt brauchte sie diesen gräßlichen Mann wenigstens nicht mehr zu sehen.
Wär sie auch ein armes Mädchen, Illusionen hatte sie doch gehabt, davon geträumt, einmal einen netten, fleißigen Mann kennenzulernen, sich ein eigenes Heim zu erarbeiten mit ihm und auch mal ein Kind zu haben. Nein, so leben wie ihre Mutter wollte sie nicht, und deshalb hatte sie ja auch lernen wollen, eine bessere Stellung zu bekommen. Wie gern wäre sie Säuglingsschwester oder Kindergärtnerin geworden, aber solch ein Weg war ihr versperrt geblieben.
Was immer sie nun auch auf der Insel der Hoffnung arbeiten sollte, schlechter als hier konnte es nicht sein.
Sie nahm sich Zeit auf dem Heimweg. Sie wußte noch nicht, daß Dr. Norden schon mit ihrer Mutter gesprochen hatte, und sie wußte erst recht nicht, wie sie sich äußern würde.
Aber ihr wurde es noch leichter ums Herz, als ihre Mutter sich gar nicht wunderte, daß sie früher heimkam.
»Dr. Norden war schon da«, platzte sie gleich heraus. »Hundertfünfzig Mark mehr kannst du abgeben, wenn du die Stellung auf der Insel bekommst«, sagte sie. »Und ein eigenes Zimmer bekommst du auch. Es freut mich für dich, Christel.«
Ja, sie zeigte ehrliche Freude, und Christel konnte nur staunen. Dann aber fragte die Mutter zögernd, was denn der Hübner gesagt hätte.
Christel zuckte die Schultern. »Er hat mich gehen lassen. Er weiß ja, daß er mich zu sehr ausgenutzt hat, und den Dr. Norden scheut er, Mutter.«
Es wurde nicht mehr viel geredet. Für Christel Jakobus begann ein neuer Lebensabschnitt. Sie konnte schon am nächsten Wochenende mit der Familie Norden zur Insel der Hoffnung fahren.
Beim Anblick der drei reizenden Kinder wurde es ihr schon weh ums Herz, wenn sie daran dachte, daß sie ihres mal weggeben wollte. Aber sie dachte auch daran, daß sie dann immer an Hübner erinnert werden und Angst haben müßte, daß er doch noch dahinter käme und ihr das Leben schwermachen würde.
Wie nett sie dann alle zu ihr waren, auch Dr. Cornelius und seine Frau Anne, und das Zimmer, das sie zugewiesen bekam, erschien ihr fürstlich, wie die Insel ihr auch als ein wahres Paradies erschien.
Anne Cornelius wußte auch schon, wie man Christel beschäftigen konnte, ohne daß ihr die Arbeit zu schwer wurde. Vorerst sollte sie im Therapiezentrum angelernt werden. Bäder einlassen und Tücher wechseln. Dann konnte sie auch bei der Essenszubereitung helfen.
»Es wird sich bald herausstellen, wozu sie sich besonders eignet«, meinte Anne zuversichtlich. »Vor allem muß sie erst mal aufgepäppelt werden. Vielleicht kann ich sie auch im Büro anlernen.«
»Und wenn sie das Kind wirklich weggeben will, wüßte ich auch jemanden«, warf Dr. Cornelius ein. »Grace Callog hat sich für September angemeldet. Sie hatte leider wieder eine Fehlgeburt.«
»Es geht wirklich sehr ungerecht zu«, meinte Fee. »Die einen wünschen sich sehnlich ein Kind und bekommen keins, und andere werden dadurch unglücklich.«
»Na, warten wir es ab«, sagte Anne. »Christel kann ihre Meinung noch ändern, da sie nun aus ihrem engen Milieu heraus ist.«
*
Für die Norden-Kinder war es immer herrlich, wenn sie zu den Großeltern fahren konnten, und seit die kleine Anneka nun auch dem Babyalter entwachsen war, geschah dies so oft, wie es die Zeit des vielbeschäftigten Arztes erlaubte.
So konnte sich Dr. Norden in diesem Sommer an Ort und Stelle überzeugen, wie gut Christel sich eingelebt hatte, wie sie förmlich aufgeblüht war und auch mit der fortschreitenden Schwangerschaft fertig wurde.
Ein paar Wochen hatte sie bei einer jungen Familie im nahen Dorf ausgeholfen, wo das dritte Kind zur Welt gekommen war, und die junge Mutter durch eine recht schwere Geburt ziemlich geschwächt war.
Anne hatte Christel gefragt, ob sie sich das zutrauen würde, und mit Freuden hatte Christel zugestimmt. So sammelte sie praktische Erfahrung in Säuglings- und Kinderpflege und zeigte sich sehr anstellig.
Alles in allem konnte man sagen, daß viel mehr in ihr steckte, als man ihr zugetraut hatte. Jetzt wurde ihr etwas zugetraut, jetzt wurde sie nicht wie ein drittklassiger Mensch behandelt, und das spornte sie immer mehr an.
Sie hatte auch ihre Hemmungen abgelegt. Sie teilte sich Anne mit, erzählte auch von ihren bösen Erfahrungen mit Franz Hübner und erklärte eines Tages auch, daß sie aus diesem Grund doch fest entschlossen sei, das Kind zur Adoption freizugeben.
»Sie haben es sich gut überlegt, Christel?« fragte Anne mütterlich.
Christel nickte. »Ich will auch nicht, daß Mutter es erfährt«, erwiderte sie. »Jetzt geht es ihr ein bissel besser, dank Ihrer Großzügigkeit, für die ich mich hoffentlich einmal erkenntlich zeigen kann.«
»Sie sind fleißig, Christel. Sie lassen sich doch nichts schenken. Von Großzügigkeit kann keine Rede sein. Sie können immer bei uns bleiben. Und selbstverständlich können Sie auch alles lernen, was für Ihre Fortbildung gut ist, wenn das Baby erst da ist.«
»Mutter würde es nie verstehen. Sie hat viel durchgemacht. Sie würde auch wissen wollen, wer der Vater ist und dann – nein, ich wage es nicht auszudenken, was dann geschehen würde. Wahrscheinlich würde sie mich sogar zwingen, ihm das Kind zu geben. Ich will, daß es zu lieben Menschen kommt, daß ihm eine Chance gegeben wird, die ich ihm nicht bieten kann. Ich habe mir alles überlegt. Ich bin hier mit so vielen klugen Leuten zusammengekommen, auch mit reichen Leuten, die sehr nett sind. Früher habe ich nie gedacht, daß die auch so nett sein könnten. Bitte, verstehen Sie mich, Frau Cornelius.«
Anne verstand Christel. Sie wollte sich des Kindes ja nicht entledigen, sie wollte verantwortungsbewußt handeln. Sie konnte die Erinnerung an ihre armselige Kindheit nicht vergessen, und sie wollte ihrem Kind eine solche ersparen. Und sie wollte auch diesen brutalen Hübner einmal ganz aus ihrem Gedächtnis streichen. Auch das verstand Anne.
Sie erinnerte sich an ihre Jugendzeit. Damals hatte eine Schulfreundin gleiches Unrecht erlebt. Sie war von einem üblen Burschen vergewaltigt worden.
Was hatte dieses arme Mädchen alles aushalten müssen! Geglaubt hatte es ihr niemand, was man ihr angetan hatte. Ihre Eltern hatten sie aus dem Hause verbannt und aufs Land geschickt. Schmach und Schande hatte man auf sie ausgeschüttet, dann hatte sie es nicht mehr ertragen und sich das Leben genommen.
Die Zeiten hatten sich zwar geändert, man war nicht mehr so engstirnig, aber wenn es ein armes Mädchen traf wie Christel, war es immer noch schlimm.
»Wenn Sie entschlossen sind, werden wir gute Adoptiveltern für Ihr Kind suchen«, sagte Anne. »Aber Sie müssen sich damit abfinden, daß Sie dann nicht erfahren werden, wer es adoptiert. Das müßten wir Ihnen auch verschweigen.«
Christel blickte zu Boden. »Wenn Sie es vermitteln, habe ich alles Vertrauen«, sagte sie leise.
»Sie dürfen sich darauf verlassen, Christel.«
Johannes Cornelius hatte schon öfter mit seiner Frau darüber gesprochen, Grace Callog für das Baby zu interessieren, und Anne wußte, daß man gar keinen besseren Platz für das Kind finden könnte. Es würde eine liebevolle Mutter bekommen, in glänzenden Verhältnissen aufwachsen, nie etwas entbehren müssen, und ein Ehepaar, das eine außerordentlich glückliche Ehe führte, zu der nur noch ein Kind fehlte.
*
Auch Hübners Ehe fehlte ein Kind, zumindest bemängelte es der alte Bäckermeister Reberle, ein ehrbarer Mann, der sich Enkel gewünscht hatte.
An seinem Schwiegersohn hatte er so viel auszusetzen, daß es ihm eines Tages leicht über die Lippen kam, ihn als einen Blindgänger zu bezeichnen.
Das wiederum brachte Hübner so in Wut, daß er kein gutes Haar an Irma ließ, und da er sich so ordinär ausdrückte, kam es zu einem Riesenkrach.
»Such ihr doch einen andern Mann«, schrie Hübner seinen Schwiegervater an. »Wirst nur keinen finden, der sie noch nimmt. Ich lasse mich scheiden. Ich höre mir das Gezeter nicht mehr an. Ich finde allemal eine andere!«