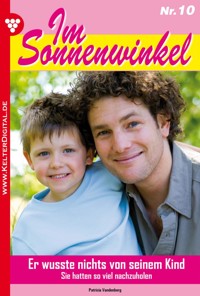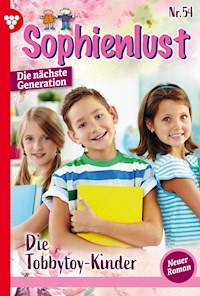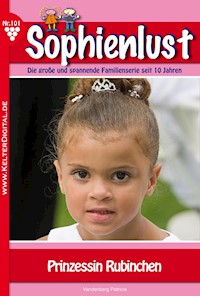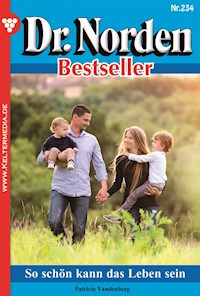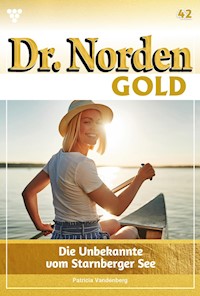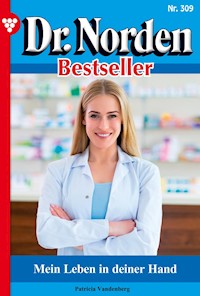Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Dr. Norden Bestseller
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Dr. Norden ist die erfolgreichste Arztromanserie Deutschlands, und das schon seit Jahrzehnten. Mehr als 1.000 Romane wurden bereits geschrieben. Deutlich über 200 Millionen Exemplare verkauft! Die Serie von Patricia Vandenberg befindet sich inzwischen in der zweiten Autoren- und auch Arztgeneration. Patricia Vandenberg ist die Begründerin von "Dr. Norden", der erfolgreichsten Arztromanserie deutscher Sprache, von "Dr. Laurin", "Sophienlust" und "Im Sonnenwinkel". Sie hat allein im Martin Kelter Verlag fast 1.300 Romane veröffentlicht, Hunderte Millionen Exemplare wurden bereits verkauft. In allen Romangenres ist sie zu Hause, ob es um Arzt, Adel, Familie oder auch Romantic Thriller geht. Ihre breitgefächerten, virtuosen Einfälle begeistern ihre Leser. Geniales Einfühlungsvermögen, der Blick in die Herzen der Menschen zeichnet Patricia Vandenberg aus. Sie kennt die Sorgen und Sehnsüchte ihrer Leser und beeindruckt immer wieder mit ihrer unnachahmlichen Erzählweise. Ohne ihre Pionierarbeit wäre der Roman nicht das geworden, was er heute ist. Der erste Sonntag im April versprach ein richtiger Frühlingstag zu werden, und nach dem wechselhaften Wetter der letzten Wochen konnte man sich über einen blauen Himmel und strahlenden Sonnenschein freuen. »Da werden wir heute aber gleich mal einen schönen Ausflug machen«, sagte Fee Norden, als das Frühstück beendet war. »Es ist aber noch recht kühl«, sagte Lenni mahnend. »Wir ziehen uns warm an«, erwiderte Fee lächelnd. »Wie ist es, Lenni, wollen Sie mitkommen?« »Mein Fuß tut immer noch weh«, erklärte Lenni. »Und warum sagen Sie das nicht?« fragte Dr. Norden vorwurfsvoll. »So schlimm ist es ja auch nicht mehr, und Sie haben genug zu tun«, meinte Lenni verlegen. Lenni war auf dem Glatteis ausgerutscht und hatte sich den Fuß verstaucht, aber geschont hatte sie sich, trotz aller Ermahnungen, nicht. Dr. Norden beharrte darauf, den Fuß zu untersuchen, bevor sie zu dem Ausflug aufbrachen, und er stellte fest, daß er wieder ganz hübsch geschwollen war. »Aber keine Ruhe geben«, meinte er kopfschüttelnd, »und obgleich ein Arzt im Haus ist, auch kein Wörtchen sagen.« »Es tut ja erst seit gestern wieder weh«, erklärte Lenni. »Mir ist eine Konservendose draufgefallen.« »Lenni, Lenni«, sagte nun auch Fee unwillig, »warum haben Sie das nicht gesagt?« »Ich kann doch nicht dauernd jammern«, murmelte Lenni. »Wir haben Sie noch nie jammern hören«, sagte Fee. »Nun wird aber Ruhe gegeben. Sie machen es sich im Sessel bequem, und der Fuß wird hochgelegt.« »Und ein Verband wird wieder angelegt«, sagte Daniel Norden. »Aber am besten wäre es wohl, wir würden Lenni festbinden, damit sie wirklich Ruhe gibt.« Aber Lenni war nun ganz froh, sich
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 140
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dr. Norden Bestseller – 174 –
An einem Sonntag im April
Patricia Vandenberg
Der erste Sonntag im April versprach ein richtiger Frühlingstag zu werden, und nach dem wechselhaften Wetter der letzten Wochen konnte man sich über einen blauen Himmel und strahlenden Sonnenschein freuen.
»Da werden wir heute aber gleich mal einen schönen Ausflug machen«, sagte Fee Norden, als das Frühstück beendet war.
»Es ist aber noch recht kühl«, sagte Lenni mahnend.
»Wir ziehen uns warm an«, erwiderte Fee lächelnd. »Wie ist es, Lenni, wollen Sie mitkommen?«
»Mein Fuß tut immer noch weh«, erklärte Lenni.
»Und warum sagen Sie das nicht?« fragte Dr. Norden vorwurfsvoll.
»So schlimm ist es ja auch nicht mehr, und Sie haben genug zu tun«, meinte Lenni verlegen.
Lenni war auf dem Glatteis ausgerutscht und hatte sich den Fuß verstaucht, aber geschont hatte sie sich, trotz aller Ermahnungen, nicht.
Dr. Norden beharrte darauf, den Fuß zu untersuchen, bevor sie zu dem Ausflug aufbrachen, und er stellte fest, daß er wieder ganz hübsch geschwollen war.
»Aber keine Ruhe geben«, meinte er kopfschüttelnd, »und obgleich ein Arzt im Haus ist, auch kein Wörtchen sagen.«
»Es tut ja erst seit gestern wieder weh«, erklärte Lenni. »Mir ist eine Konservendose draufgefallen.«
»Lenni, Lenni«, sagte nun auch Fee unwillig, »warum haben Sie das nicht gesagt?«
»Ich kann doch nicht dauernd jammern«, murmelte Lenni.
»Wir haben Sie noch nie jammern hören«, sagte Fee. »Nun wird aber Ruhe gegeben. Sie machen es sich im Sessel bequem, und der Fuß wird hochgelegt.«
»Und ein Verband wird wieder angelegt«, sagte Daniel Norden. »Aber am besten wäre es wohl, wir würden Lenni festbinden, damit sie wirklich Ruhe gibt.«
Aber Lenni war nun ganz froh, sich wieder ausruhen zu können. Von sich aus sagte sie nie etwas. Sie wurde mit Zeitschriften versorgt, der Fernsehapparat wurde in ihre Blickrichtung geschwenkt, die Kinder brachten ihr Kekse und Pralinen, und Fee füllte Kaffee in die Wärmekanne.
Anneka drückte schmeichelnd ihre Wange an Lennis Hand.
»Wir bleiben ja nicht lange«, flüsterte sie, »und dann machen wir dir ein ganz gutes Essen, gell?«
Sie alle hatten ihre Lenni lieb, aber Fee meinte auch, daß sie sich nur mal richtig Ruhe gönnen könnte, wenn die Familie aus dem Haus war. Sie machten sich nun auf den Weg. Ein paar Kilometer fuhren sie mit dem Auto, damit sie schneller zu Hause sein könnten, wenn es doch zu kühl werden würde, und nach dem miserablen Wetter der letzten Wochen wußten sie auch nicht, wie die Wege bestellt sein würden.
Im Wald waren diese, wie sie bald feststellen konnten, teilweise auch noch völlig durchweicht.
»Da werden wir aber ganz schön dreckig, Mami«, meinte Danny, doch da wurden sie abgelenkt, denn zwischen dem Gehölz erschien eine weißgekleidete Gestalt, geisterhaft wirkend, und Anneka klammerte sich auch sogleich an ihre Mami, während die Buben halb neugierig, halb ängstlich in die Richtung starrten, wo sich dieses weißgekleidete unwirkliche Geschöpf jetzt haltsuchend an dürre Tannenäste klammerte.
Daniel Norden überlegte nicht. Er eilte auf diese Gestalt zu. Es war keine Halluzination, es war ein lebendiges Wesen, ein zitterndes Mädchen, dessen Blick schreckensstarr und verstört auf Daniel gerichtet war.
Ihre Arme hoben sich, machten eine abwehrende Bewegung, sanken aber sogleich zurück, und als seine festen Hände nach ihr griffen, murmelte sie: »Es war doch nur ein Spaß, ein Spaß.«
Und dann sank sie bewußtlos zusammen.
Nun war Fee herbeigeeilt. »Mein Gott, das sieht ja wie ein Brautkleid aus«, murmelte sie.
»Sie ist erschöpft und unterkühlt«, sagte Daniel. Er zog seine Lederjacke aus und reichte sie Fee. Dann hob er das Mädchen auf, und ungeachtet des Schmutzes, der nun an ihm hing, hüllte er sie in die Jacke.
»Wir müssen schnellstens zum Wagen, Fee«, stieß er hervor. »Hoffentlich finden wir den Weg schnell zurück.«
Das bereitete Fee keine Schwierigkeiten. Danny und Felix hatten auch ein gutes Gedächtnis. Sie rannten voraus, noch verwirrt, aber als richtige Arztkinder wußten sie, daß jetzt Eile geboten war.
Das Mädchen war nicht schwer, aber der Weg war doch ziemlich lang, und Daniel war auch außer Atem, als sie den Wagen erreichten. Fee breitete schnell die vorhandenen Decken auf dem Rücksitz aus. Für die Kinder war da nun kein Platz mehr. Aber wichtig war, daß dieses Mädchen schnellstens in die Klinik gebracht wurde.
»Ich gehe mit den Kindern zum Bahnhof, da stehen immer Taxen«, sagte Fee geistesgegenwärtig. »Fahr schnell, aber nicht zu schnell, Schatz.«
Und er fuhr gleich los. Gefroren hatte es nicht, denn das Mädchen oder die junge Frau hätte dann wie Blei in seinen Armen gelegen.
Eine Braut? Das Kleid sprach dafür. »Nur ein Spaß«, hatte sie gesagt, das hatte er sich gemerkt. Ein alter Brauch war in Bayern die Brautentführung, aber solche nahmen doch stets ein fröhliches Ende.
Solche Gedanken bewegten Daniel Norden, aber auch Fee, und nun stellten die Kinder viele Fragen. Anneka meinte, daß sie Verstecken gespielt haben könnte und sich dann verlaufen hätte.
»In dem dünnen Gewand?« meinte Danny skeptisch. »Da erkältet man sich doch mächtig.«
»Es sah unheimlich aus«, sagte Felix schaudernd. »Wie ein Geist.«
»Wenn wir schon mal einen Ausflug machen«, brummte Danny. »Irgend etwas passiert doch immer.«
»Ob das ein Elflein war, Mami?« fragte Anneka. »Vielleicht ist ein böser Zauberer im Wald, vor dem es Angst hatte.« Ihre Phantasie regte sich, und dieser waren keine Grenzen gesetzt. Auch Fee dachte darüber nach, was sich da wohl zugetragen hatte, daß dieses junge Geschöpf so leicht und gar festlich gekleidet durch den kalten Wald irrte.
Es war ein ganz hübscher Marsch bis zum Bahnhof, und Fee war froh, als dort ein Taxi stand. Nun kamen sie doch schnell nach Hause, zu Lennis Überraschung, die aus einem Nickerchen emporschreckte, als die Kinder ins Haus stürmten, um ihr schleunigst von dem Erlebnis zu berichten.
»Ich fahre mal zur Behnisch-Klinik«, sagte Fee.
Die Kinder hatten nichts dagegen, denn Lenni mußte natürlich ganz genau erfahren, warum sie so schnell wieder zu Hause waren.
In der Behnisch-Klinik rätselte man auch, was da wohl geschehen sein konnte. Das Mädchen, es wurde von den Ärzten auf höchstens neunzehn Jahre geschätzt, war bewußtlos. Es wies keine ernsthaften Verletzungen auf, nur Schürf- und Kratzwunden und ein paar Blutergüsse. Es war ein zierliches, hübsches Geschöpf von südländischem Typus, langes blauschwarzes Haar klebte feucht an einem feingezeichneten Gesicht. Das weiße Spitzenkleid, das verständlicherweise verschmutzt war und viele Einrisse aufwies, war bestimmt sehr teuer gewesen. Das konnten die Ärzte beurteilen, das wußte auch Dr. Jenny Behnisch. Auch die Unterwäsche war keine Dutzendware. Die Schuhe mußte sie wohl verloren haben, die Strümpfe waren nur noch Fetzen gewesen. Außer einem goldenen Halskettchen mit einem Medaillon trug das Mädchen keinen Schmuck, keinen einzigen Ring, auch kein Armband. Eine Braut? Auch Dr. Behnisch und seine Frau hatten das überlegt, und manchmal sollte es ja schon der Fall gewesen sein, daß eine Braut, wie auch ein Bräutigam, in letzter Minute die Flucht ergriffen vor dem Ja, das bindend sein sollte.
Dr. Norden hatte indessen schon telefoniert, ob irgendwo eine Vermißtenmeldung vorliegen würde. Er bekam einen negativen Bescheid. Es wurde ihm allerdings versprochen, in der Behnisch-Klinik anzurufen, wenn eine entsprechende Nachricht eintreffen würde.
Dann kam Fee, und sie schien recht aufgeregt zu sein.
»Eben haben sie im Autoradio durchgesagt, daß ein Auto gefunden wurde, zwei Tote und ein Schwerverletzter.«
»Die üblichen Wochenendunfälle, Fee, das kennen wir doch«, sagte Daniel.
»Aber das Auto wurde an der Straße gefunden, die an jenem Wald entlangführt, wo wir das Mädchen fanden«, sagte Fee. »Es scheint ein mysteriöser Unfall gewesen zu sein, in den kein anderer Wagen verwickelt war. Vorerst werden nur etwaige Zeugen gesucht.« Sie schöpfte tief Atem. »Hat sie schon etwas gesagt?«
»Nein, sie ist noch nicht bei Bewußtsein. Und vermißt wird sie anscheinend auch noch nicht.«
»Immerhin würde eine Braut bei einer Hochzeit ganz sicher schon vermißt werden«, meinte Fee nachdenklich.
Dies war allerdings ziemlich weit von ihnen entfernt der Fall. Da war eine Hochzeitsgesellschaft in der Kirche versammelt, aber vergeblich wartete man auf die Braut und die Brauteltern. Der Bräutigam, Baron Wulf von Ecktannen, blickte nervös auf seine Armbanduhr. Verzweifelt sah er seine Schwester Martina an.
»Da muß etwas passiert sein«, murmelte er.
»Das kommt davon, wenn man schon drei Tage standesamtlich verheiratet ist, aber erst mit dem kirchlichen Segen ins Ehebett steigen will«, murmelte Martina unverblümt. »Ich werde jetzt mal anrufen. Vielleicht hat es deine Frau Verena erfahren, daß unsere erlauchte Verwandtschaft mit deiner Wahl nicht einverstanden ist.«
»Das ist doch Unsinn. Es war abgemacht, daß wir die standesamtliche Trauung mit ihrer Familie, die kirchliche mit unserer Familie feiern«, erwiderte er.
»Es kann ja auch sein, daß es ihr bewußt geworden ist, daß sie nun einen anderen Glauben annehmen muß«, sagte Martina. »Ich habe nichts gegen Verena, aber diese Art von Heiraterei hat mir von Anfang an nicht gefallen.«
»Ruf doch mal an«, bat er.
Martina ließ ihren Blick über die versammelte Gesellschaft schweifen, und ihre Mundwinkel bogen sich abwärts.
»Ich an deiner Stelle hätte auf dieses Theater verzichtet!« zischte sie.
Dann ging sie schnell hinaus, und es dauerte etwa zwanzig Minuten, bis sie zurückkehrte. Da war auch sie blaß.
Sie wechselte zuerst ein paar Worte mit dem Pfarrer, dann wandte sie sich an die versammelte Gesellschaft.
»Ihr könnt das Hochzeitsmahl einnehmen«, sagte sie eisig. »Im ›Goldenen Beutel‹ werdet ihr erwartet. Vielleicht besitzt ihr so viel Anstand zuzugeben, wer die Steudens angerufen hat, um ihnen zu sagen, daß die kirchliche Trauung wegen eines Todesfalles plötzlich abgesagt werden mußte. Verena denkt jetzt natürlich, daß Wulf etwas passiert ist.«
Der war kreidebleich geworden und zitterte am ganzen Körper.
»Wir beide fahren zu Verena«, sagte Martina zu ihm. »Laßt es euch schmecken, liebe Verwandtschaft. Es wäre ja ein Jammer, wenn das Essen umsonst zubereitet worden wäre.« Ihre Stimme triefte vor Hohn. Es war das erste Mal, daß auch sie die Beherrschung völlig verloren hatte. Und während sie mit ihrem Bruder schon unterwegs war, beschloß die übrige vierzehnköpfige Verwandtschaft, bei dem Essen zu beraten, was es mit dieser Hochzeit eigentlich auf sich hatte.
Daß ein Ecktannen eine Heirat aus Liebe schließen könnte, darauf kam niemand. Man wußte ja, daß Walter Steuden ein begüterter Großkaufmann war, aber eben doch ein Emporkömmling.
Martina von Ecktannen, achtundzwanzig Jahre und so emanzipiert, daß sie von der Verwandtschaft mit äußerster Vorsicht behandelt wurde, steuerte ihren Wagen nordwärts.
»Ich habe Andy vermißt«, sagte Wulf plötzlich.
»Denk aber bitte nicht, daß er sich so eine Gemeinheit ausgedacht hat. Er ist für jeden Spaß zu haben, aber nicht für eine so maßlose Taktlosigkeit. Und jetzt ist Schluß mit diesem Zirkus, mein lieber Wulf. Mir kann diese bucklige Verwandtschaft gestohlen bleiben. Ich bringe schon heraus, wer uns das eingebrockt hat.«
»Mir«, sagte Wulf bitter.
»Ich bin deine Schwester, also auch betroffen, und ich mag Verena.«
Nach zwanzig Minuten Fahrt hielten sie vor einer hübschen, modernen Villa, die inmitten eines gepflegten Gartens lag.
Ein untersetzter grauhaariger Mann kam ihnen entgegen.
»Verena ist völlig verzweifelt«, sagte Walter Steuden heiser und mit deutlichem Vorwurf. »Es ist für uns nicht akzeptabel, solche üblen Scherze zu treiben. Verena wird bei uns bleiben. Sie verzichtet auf die kirchliche Trauung.«
»Ich kann doch nichts dafür, Papa«, sagte Wulf erregt. »Ich bin außer mir.«
»Wir sind genauso schockiert wie ihr«, sagte Martina. »Ich möchte mit Verena sprechen.«
»Ich werde mit ihr sprechen, sie ist meine Frau«, sagte Wulf. »Sie bleibt meine Frau«, fügte er hinzu.
»Und ich werde mit Walter sprechen«, sagte Martina. »Wir müssen ja wissen, wie das geschehen konnte!«
»Da gibt es nicht viel zu sagen«, erklärte Walter Steuden kühl. »Euer Butler oder Kammerdiener, oder wie ihr ihn sonst bezeichnet, rief an und erklärte, daß die kirchliche Trauung wegen eines plötzlichen Todesfalles nicht stattfinden könne und wir weiteren Bescheid abwarten sollten. Ihr werdet euch denken können, daß das ein Schock war. Verena stand in Brautkleid und Schleier da. Nun, was mich betrifft, mir war diese Zeremonie sowieso zuwider. Bei uns ist es üblich, daß der Bräutigam die Braut abholt und daß sie gemeinsam zur Kirche fahren, und daß nur die zur Hochzeit kommen, die sich freuen.«
»Ich bin ganz deiner Memung, Walter«, sagte Martina schnell. »Aber ich hoffe, daß Wulf Verena überzeugen wird, daß er sie liebt.«
Walter Steuden trat einen Schritt auf Wulf zu. »Liebst du sie? Schwörst du es mir?« fragte er rauh.
»Ja, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe«, sagte Wulf leise, aber mit fester Stimme.
»Dann geh zu ihr«, sagte Walter Steuden.
*
Marianne Steuden ließ sich nicht blicken, aber die Tür zu Verenas Räumen war nicht verschlossen. Da Wulf auf sein Klopfen keine Antwort bekam, trat er leise ein. Verena lag auf ihrem Bett. Brautkleid und Schleier lagen hingeworfen über einem Sessel.
»Verena, Liebling«, sagte Wulf leise, »bitte…« Er kam nicht weiter, sie fuhr empor. »Du lebst, du bist da«, schluchzte sie. »Und Martina?«
Er nahm sie in seine Arme und streichelte mit seinen Lippen ihr verweintes Gesicht.
»Es ist niemandem etwas passiert, Verena. Jemand hat sich einen bitterbösen Streich erlaubt. Wir haben in der Kirche auf euch gewartet.«
»Wir wollten gerade fahren, da kam der Anruf von Gawril. Er sagte nur, daß ein tragischer Todesfall die Trauung verhindere, und ich dachte, dir wäre etwas Schreckliches passiert.«
Unter seinen Küssen beruhigte sie sich schnell. »Sie wollten also nur nicht, daß wir getraut werden«, flüsterte sie.
»Wer könnte von unserer Familie daran ein Interesse haben, Verena? Sie wissen doch, daß wir standesamtlich getraut sind, daß du meine Frau bist, und daß niemand etwas daran ändern kann.«
»Aber warum das? Warum tut man uns das an?« fragte sie bebend.
»Das frage ich mich auch. Aber wir werden es schon herausfinden. Martina hat recht gehabt. Wir hätten das anders machen sollen, aber ich habe mich der Familientradition verpflichtet gefühlt, und ich war auch überzeugt, daß alle Verwandten mich verstehen würden, wenn sie dich erst kennengelernt hätten.« Er drückte sie an sich und streichelte ihr seidiges blondes Haar. »Du sagst, Gawril hätte angerufen? Aber er ist doch bereits seit Mittwoch bei Tante Josefine. O Gott, sollte sie gestorben sein? Aber davon hätte er doch zuerst mir Mitteilung machen müssen.«
»Das ist mir jetzt ganz gleich, Wulf«, flüsterte Verena. »Ich bin froh, daß du lebst, daß du bei mir bist.«
*
»Irgendwie ist Wulf ein Träumer, Walter«, sagte Martina, »der Prinz, der seine Märchenprinzessin gefunden hat. Du darfst nicht daran zweifeln, daß er Verena liebt, und ich darf versichern, daß er keine finanziellen Interessen mit dieser Heirat verknüpfte.«
»Wir wollen einmal ganz offen reden, Martina. Ich weiß, daß ihr in Schwierigkeiten seid, ich weiß aber auch, daß man diese schnellstens beseitigen könnte. Ihr braucht die zehn Hektar nur an die Baugesellschaft zu verkaufen. Um sie selbst kaufen zu können, habe ich nicht das Geld. Es wären acht Millionen.«
»Die Hälfte gehört Tante Josefine, und ohne ihre Einwilligung können wir nicht verkaufen, Walter«, sagte Martina bedrückt. »Aber dies hat doch nichts mit der Heirat zu tun. Andere sind auch in Bedrängnis geraten durch diese enormen Zinssteigerungen.«
»Und ihr durch die Aufwendungen für das Gestüt«, sagte Walter Steuden ruhig.
»Daran ist Huschke schuld, unser lieber Cousin Johannes. Wulf hätte dir reinen Wein einschenken sollen über unsere Familienverhältnisse und Verpflichtungen, aber er sieht ja alles so sentimental. Huschke hat seinen Besitz in Schlesien verloren, wir haben alles behalten und auch die anderen alle kamen daher und nisteten sich ein, und kaum einer hat dazu beigetragen, daß das vermehrt wurde, was unser Vater uns hinterließ. Andy ausgenommen. Ich hätte schon längst reinen Tisch gemacht. Unser Vater hatte das Pech, daß er nur Schwestern hatte, und von denen ist Tante Josefine die einzige, die ihren Besitz erhalten hat. Und sie rückt nichts heraus. Sie wartet…«
Doch da wurde sie vom Läuten des Telefons unterbrochen.
Walter Steuden griff nach dem Hörer und meldete sich.
»Ja, Rosina, sie sind hier«, hörte ihn Martina sagen. Er reichte ihr den Hörer. »Sie ist sehr aufgeregt«, murmelte er.
Martina war auch aufgeregt, als das Gespräch beendet war. Alles Blut war ihr aus dem Gesicht gewichen.
»Es gibt tatsächlich einen Todesfall, nein, zwei sogar, Walter«, stammelte sie. »Tante Josefine ist gestorben, und Huschke ist heute tödlich verunglückt. Aber das Allerschlimmste für uns ist, daß Andy in seinem Wagen saß und schwer verletzt wurde.«
»Es ist wahrhaftig kein Tag für eine Hochzeit«, sagte Walter Steuden deprimiert.
*
In der Behnisch-Klinik sollten sie erst später eine Beziehung zu diesem Unglück finden. Der Autounfall, von dem Fee gesprochen hatte, spielte doch eine Rolle für die junge Unbekannte, die nun mit hohem Fieber in der Behnisch-Klinik lag. Dieser Sonntag im April sollte noch so manche Aufregung nach sich ziehen.
Vorerst erfuhr man in der Behnisch-Klinik nur, daß man in dem Unfallwagen einen weißen Satinpumps gefunden hätte, den zweiten etwa fünfzehn Meter von der Unfallstelle entfernt auf einem morastigen Weg. Der Unfall selbst sei durch ein Pferd verursacht worden, das aus der Koppel ausgebrochen und vor den Wagen gesprungen sei.