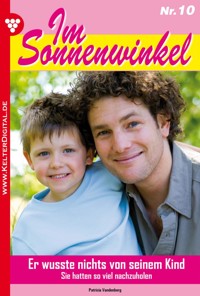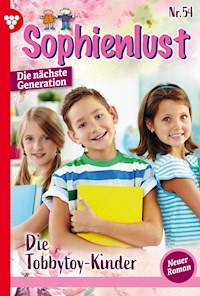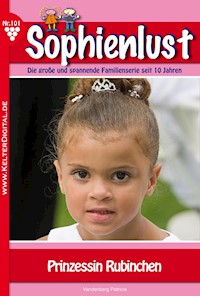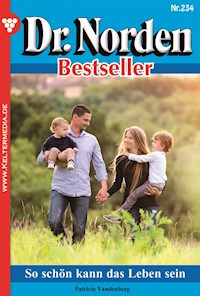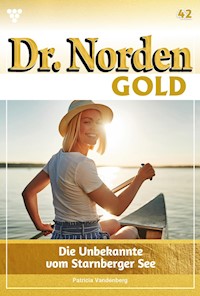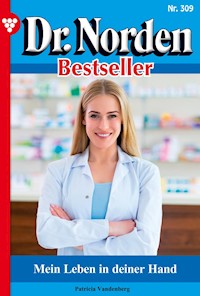Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Dr. Norden Bestseller
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Dr. Norden ist die erfolgreichste Arztromanserie Deutschlands, und das schon seit Jahrzehnten. Mehr als 1.000 Romane wurden bereits geschrieben. Deutlich über 200 Millionen Exemplare verkauft! Die Serie von Patricia Vandenberg befindet sich inzwischen in der zweiten Autoren- und auch Arztgeneration. Patricia Vandenberg ist die Begründerin von "Dr. Norden", der erfolgreichsten Arztromanserie deutscher Sprache, von "Dr. Laurin", "Sophienlust" und "Im Sonnenwinkel". Sie hat allein im Martin Kelter Verlag fast 1.300 Romane veröffentlicht, Hunderte Millionen Exemplare wurden bereits verkauft. In allen Romangenres ist sie zu Hause, ob es um Arzt, Adel, Familie oder auch Romantic Thriller geht. Ihre breitgefächerten, virtuosen Einfälle begeistern ihre Leser. Geniales Einfühlungsvermögen, der Blick in die Herzen der Menschen zeichnet Patricia Vandenberg aus. Sie kennt die Sorgen und Sehnsüchte ihrer Leser und beeindruckt immer wieder mit ihrer unnachahmlichen Erzählweise. Ohne ihre Pionierarbeit wäre der Roman nicht das geworden, was er heute ist. Es war Abend. Dr. Daniel Norden machte noch Hausbesuche, und seine Frau Fee hatte gerade den Fernseher angeschaltet, um Nachrichten zu hören, als das Telefon läutete. »Norden«, meldete sie sich. Sie vernahm ein Keuchen, dann eine heisere Männerstimme. »Ich untersage Ihnen, mein Haus noch einmal zu betreten, haben Sie verstanden? Ich werde Sie anzeigen, wenn Sie es noch einmal wagen.« Fee war konsterniert, aber sie bewahrte Ruhe. »Würden Sie bitte so freundlich sein zu sagen, wer da spricht? Ich verstehe nicht, was Sie meinen.« »Kendler, der Name sagt Ihnen hoffentlich genug. Ich habe Sie gewarnt.« Dann herrschte Schweigen. Es knackte, die Verbindung war unterbrochen. Kendler, dachte Fee, sollte das Marga Kendlers Mann gewesen sein? Und was hatte seine Drohung zu bedeuten? Sie war beunruhigt, denn sie wußte, daß ihr Mann einen Hausbesuch bei Marga Kendler machen wollte, die schon seit einiger Zeit an schweren Depressionen litt. Fee überlegte nicht lange. Sie rief bei den Kesselbachs an, denn dort würde Daniel ganz bestimmt seinen Besuch machen. Nanette Kesselbach meldete sich. Fee fragte, ob ihr Mann schon dagewesen sei. »Nein, aber ich hoffe, daß er bald kommt«, erwiderte Nanette mit bebender Stimme. »Mutti geht es sehr schlecht, Frau Norden.« »Es tut mir schrecklich leid«, erwiderte Fee bedauernd, »aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie meinem Mann sagen würden, daß er zu Hause anrufen soll. Ich muß ihm noch eine dringende Nachricht durchsagen.« »Ich werde es ihm ausrichten. Es läutet. Er scheint zu kommen. Warten Sie doch bitte einen Augenblick.« Gleich darauf meldete sich Daniel. »Was ist, Fee?« fragte er. »Ich werde hier dringend gebraucht.« Fee erzählte
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dr. Norden Bestseller – 190 –
Gebt mir noch eine Chance
Patricia Vandenberg
Es war Abend. Dr. Daniel Norden machte noch Hausbesuche, und seine Frau Fee hatte gerade den Fernseher angeschaltet, um Nachrichten zu hören, als das Telefon läutete.
»Norden«, meldete sie sich. Sie vernahm ein Keuchen, dann eine heisere Männerstimme. »Ich untersage Ihnen, mein Haus noch einmal zu betreten, haben Sie verstanden? Ich werde Sie anzeigen, wenn Sie es noch einmal wagen.«
Fee war konsterniert, aber sie bewahrte Ruhe. »Würden Sie bitte so freundlich sein zu sagen, wer da spricht? Ich verstehe nicht, was Sie meinen.«
»Kendler, der Name sagt Ihnen hoffentlich genug. Ich habe Sie gewarnt.«
Dann herrschte Schweigen. Es knackte, die Verbindung war unterbrochen.
Kendler, dachte Fee, sollte das Marga Kendlers Mann gewesen sein? Und was hatte seine Drohung zu bedeuten?
Sie war beunruhigt, denn sie wußte, daß ihr Mann einen Hausbesuch bei Marga Kendler machen wollte, die schon seit einiger Zeit an schweren Depressionen litt.
Fee überlegte nicht lange. Sie rief bei den Kesselbachs an, denn dort würde Daniel ganz bestimmt seinen Besuch machen.
Nanette Kesselbach meldete sich.
Fee fragte, ob ihr Mann schon dagewesen sei.
»Nein, aber ich hoffe, daß er bald kommt«, erwiderte Nanette mit bebender Stimme. »Mutti geht es sehr schlecht, Frau Norden.«
»Es tut mir schrecklich leid«, erwiderte Fee bedauernd, »aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie meinem Mann sagen würden, daß er zu Hause anrufen soll. Ich muß ihm noch eine dringende Nachricht durchsagen.«
»Ich werde es ihm ausrichten. Es läutet. Er scheint zu kommen. Warten Sie doch bitte einen Augenblick.«
Gleich darauf meldete sich Daniel. »Was ist, Fee?« fragte er. »Ich werde hier dringend gebraucht.«
Fee erzählte ihm hastig von dem Anruf. »Reg dich nicht auf, er wird wieder mal betrunken sein«, sagte Daniel. »Wir reden später darüber.«
»Ich bin besorgt, Daniel.«
»Brauchst du nicht. Ich habe Frau Kendler schon nachmittags in die Klinik bringen lassen.«
Als Nanette den Namen Fendler hörte, vergaß sie für einen Moment ihre eigenen Sorgen.
»Steht es so schlimm um Frau Kendler?« fragte sie. »Ich kenne sie ganz gut. Sie war meine erste Patientin.« Dr. Nanette Kesselbach war Zahnärztin, eine noch sehr junge, aber schon sehr gewissenhafte. Ihr Schicksal bewegte Dr. Norden augenblicklich noch mehr als das von Frau Kendler, die er gut aufgehoben in der Leitner-Klinik wußte und sicher von ihrem unberechenbaren Mann.
Lucy Kesselbach lag im Sterben. Dem erfahrenen Arzt tat es weh, Nanette dies sagen zu müssen, als er in ihr verzweifeltes Gesicht blickte. Hatte die junge tapfere Frau doch immer noch gehofft, daß es eine Rettung für ihre Mutter geben könnte. Mit der Diagnose Knochenkrebs, hatte sich Nanette nicht abfinden wollen, da ihre Mutter bis vor ein paar Tagen Anzeichen einer Besserung gezeigt hatte.
»Sollten wir sie nicht doch noch in die Klinik bringen, Nanette?« fragte Dr. Norden Sie schüttelte den Kopf und unterdrückte die Tränen. »Ich habe Mutti versprochen, daß sie zu Hause bleibt. Sie wollte zu Hause sterben.« Ein trockenes Schluchzen begleitete die letzten Worte.
Er nahm ihre Hände, die jetzt eiskalt waren. »Es ist so traurig, wenn man nicht mehr helfen kann, Nanette, aber nehmen Sie es als Trost, daß ihr noch schlimmere Schmerzen erspart bleiben. Sie wird sanft hinüberschlummern. Ihr Herz ist müde. Es war ein langer Leidensweg, Nanette.«
Ja, er hatte schon drei Jahre gedauert. Und Nanette hatte viel Kraft gebraucht, um diese Jahre so tapfer durchzuhalten. Sie hatte sich in dem Elternhaus ihre Praxis eingerichtet, um immer in der Nähe der Mutter zu sein. Sie mußte ja Geld verdienen. Sie hätte es leichter haben können, denn ein vermögender Kollege hatte ihr den Vorschlag gemacht, in seiner Praxis mitzuarbeiten. Dr. Peter Meißner hatte damit sogar ein ganz privates Interesse verknüpft, doch Nanette war es wichtiger gewesen, für die kranke Mutter zu sorgen.
Dr. Norden wußte das alles, und er wußte auch, daß Nanette noch eine Schwester und drei Brüder hatte, die ihr gern diese Sorge überließen.
»Sie können mich jederzeit rufen, Nanette«, sagte er, »auch in der Nacht. Ich muß jetzt noch ein paar Besuche machen. Vielleicht sollten wir doch eine Pflegerin kommen lassen.«
»Nein, ich bleibe bei Mutti«, sagte sie leise.
Ihre großen dunklen Augen in dem schmalen, ebenmäßigen Gesicht blickten ihn todtraurig an. Richtig fröhlich hatte er sie nie gesehen. Hatte sie überhaupt jemals richtig jung sein können?
»Kann Ihnen Ihre Schwester nicht helfen?« fragte er.
»Karin?« Sie schüttelte den Kopf. Ihre Mundwinkel bogen sich abwärts, aber sie sagte nichts.
»Und Ihre beiden Schwägerinnen?«
»Reden wir darüber besser nicht, es bringt nichts. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es weitergehen soll, wenn Mutti nicht mehr da ist.«
»Es gibt immer einen Weg, Nanette. Wir wohnen ja ganz nahe«, sagte er tröstend.
»Sie sind aber auch die Einzigen, auf die ich mich verlassen konnte«, erwiderte Nanette müde. »Sie haben mir so viel Zeit geopfert.«
»Das ist selbstverständlich. Es tut mir leid, daß ich Sie jetzt allein lassen muß.«
Er mußte weiter, aber seine Gedanken wanderten doch immer wieder zu Nanette. Fünf Kinder hatte Lucy Kesselbach zur Welt gebracht, ihren Mann hatte sie schon vor acht Jahren verloren, aber nur Nanette hatte sich um die damals schon kränkelnde Mutter gekümmert. Finanziell war es ihnen nicht schlechtgegangen. Vermögen war vorhanden, auch das Haus in dem großen Grundstück, das jetzt so viel wert war. Die drei Brüder hatten, wie auch Nanette, studieren können. Karin, die um fünf Jahre ältere Schwester, hatte früh geheiratet. Ihr Mann war Syndikus in einer großen Firma.
Über die Familie Kesselbach wollte Dr. Norden an diesem Abend doch nicht mehr nachdenken. Müde kam er nach Hause. Es war ein trüber, nebliger Novemberabend. Fee bereitete ihm einen Grog, der ihn durchwärmte, aber es war mehr ein inneres Frösteln gewesen.
Fee sprach dann doch über den Anruf von Kendler.
»Reg dich darüber nicht auf, Feelein«, sagte Daniel. »Der Mann hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Er ist unberechenbar. Er ist auch der Grund für Frau Kendlers Depressionen. Der absolute Tyrann, und dabei eigentlich doch ein Versager. Ich mußte sie in die Klinik bringen lassen, weil sie wieder mal eine Fehlgeburt hatte. Er hat sie geschlagen. Das wird noch ein Nachspiel haben.«
»Du solltest diese Drohung aber ernst nehmen, Daniel.«
»Ich betrete das Haus doch nicht mehr, und ich hoffe, daß Frau Kendler endlich den Mut aufbringt, die Scheidung einzureichen.«
»Warum hat sie es nicht längst getan?«
»Weil sie Angst vor ihm hat.«
»Aber sie hat doch das Geld, soviel ich weiß.«
»Und darum will er sich nicht scheiden lassen. Er will sie zermürben, systematisch kaputtmachen. Er hat freilich eine Mordswut auf mich, weil ich das nun zu verhindern suche.«
»Sag bitte nicht ›Mordswut‹, Daniel«, murmelte Fee. »Seine Stimme klang wirklich drohend.«
»Ach was, er ist ein Großmaul, Fee. Der Größte, der Beste in seiner Branche, und was ist er denn schon. Ein unbekannter Schauspieler, der sich selbst als verkanntes Genie sieht, und seine Aggressionen an einer schwachen Frau ausläßt, weil er von niemandem ernstgenommen wird.«
»Bist du da nicht zu sorglos?« fragte Fee.
»Liebes, ich bitte dich. Warum brüllt er dich an? Du hast mit Frau Kendlers Behandlung doch nichts zu tun. Es tut mir schrecklich leid, daß er dich so schockiert hat, aber ernst darfst du das nicht nehmen.«
»Dies Wort in Gottes Ohr«, sagte Fee leise.
*
In der Leitner-Klinik hatte man indessen auch Bekanntschaft mit Raimund Kendler gemacht. Dr. Hans Georg Leitner ließ sich nicht einschüchtern.
»Ihre Frau liegt auf der Intensivstation«, sagte er. »Sie hatte einen beträchtlichen Blutverlust. Von Amts wegen wurde bereits festgestellt, daß sie schwer mißhandelt wurde. Wenn Sie hier herumschreien, werde ich die Polizei rufen, Herr Kendler.«
»Das ist doch alles Mache, Blödsinn. Meine Frau ist hysterisch. Sie will kein Kind. Sie fügte sich diese Verletzungen selber zu«, stieß Kendler heiser hervor.
»Das ist unmöglich und wurde auch bereits festgestellt. Ich will mich darüber mit Ihnen nicht unterhalten. Sie werden sich jetzt entfernen, oder ich rufe, wie schon gesagt, die Polizei.«
»Sie stecken mit Norden unter einer Decke«, zischte Kendler. »Das werden Sie noch bereuen. Mit mir kann man so was nicht machen. Ich habe keinen Respekt vor den Halbgöttern in Weiß. Sie werden von meinem Anwalt hören.«
»Tun Sie, was Sie nicht lassen können«, sagte Dr. Leitner.
An sich war er keine Kämpfernatur, wenn es nicht um ein Menschenleben ging, aber in solchen Fällen konnte er hart sein, denn im Grunde ging es ja auch um ein Menschenleben, um das von Marga Kendler, einer gepeinigten Frau, die vor zehn Jahren diesen Raimund Kendler als die große Liebe ihres Lebens betrachtet hatte. Ein junges Mädchen aus einer angesehenen Familie, das mit Bitten und Trotz durchgesetzt hatte, daß die Eltern die Einwilligung zu der Heirat gaben.
Ein anderes Schicksal, als das von Nanette Kesselbach, aber dennoch hatten diese beiden jungen Frauen Sympathie füreinander empfunden, als sie sich kennenlernten, und als Nanette in dieser Nacht Wache bei ihrer Mutter hielt, dachte sie über Marga Kendler nach. Vor acht Wochen war es soweit gewesen, daß Nanette ihre Praxis eröffnen konnte. Und schon am zweiten Tag, nachdem das Messingschild an der Gartenpforte angebracht worden war, kam Marga Kendler mit heftigen Zahnschmerzen zu ihr. Sie hatte eine geschwollene Wange, aber Nanette hatte auch eine blutunterlaufene Stelle unterhalb des linken Auges festgestellt. Marga hatte erklärt, daß sie unglücklich gefallen sei und dadurch wohl auch die Zahnschmerzen, die sie schon öfter mal gespürt hätte, schlimmer geworden wären.
Nanette hatte eine Wurzelbehandlung an einem Backenzahn eingeleitet. Dreimal war Marga gekommen, dann rief sie an, daß sie krank geworden sei und vorerst nicht mehr kommen könne.
Inzwischen bekam Nanette auch andere Patienten, die bei den alteingesessenen Zahnärzten wegen Terminschwierigkeiten nicht sofort angenommen wurden. Sie hatte Glück und auch Erfolg, wenigstens in dieser Beziehung. Ihre behutsame Art machte sie vor allem bei Kindern beliebt, und das sprach sich rasch herum.
Ja, sie hatte sich über den Anfang eigentlich nicht beklagen können, wenn nicht die kranke Mutter gewesen wäre. Daß sich ihr Zustand so schnell verschlechtern würde, hatte Nanette nicht glauben wollen. Es war geradeso, als würden Lucy Kesselbachs Kräfte nachlassen, als sie merkte, daß ihre so inniggeliebte jüngste Tochter im Beruf Erfolge verzeichnen konnte.
Die Geschwister riefen zwar an, erkundigten sich nach dem Befinden der Mutter, schickten auch mal Blumen, aber blicken ließ sich niemand. Jeder war ja mit sich, dem Beruf, der Familie beschäftigt.
Es ging Nanette viel durch den Sinn in dieser langen Nacht, dieser traurigen Nacht, die jede Hoffnung von ihr nahm. Im Morgengrauen spürte sie keinen Atemzug mehr, keinen Pulsschlag. Es war sechs Uhr vorbei, als Lucy Kesselbach Abschied von dieser Welt genommen hatte, nicht mehr spürend, daß Nanette nun ganz allein in maßloser Trauer versank.
»Was soll nur werden, Mutti?« schluchzte sie. »Jetzt werden sie bestimmt Zeit haben, um ihre Rechte geltend zu machen. Ich hätte doch gern noch für dich gesorgt. Jetzt bin ich ganz allein.«
Niemand sollte erfahren, wie ihr in diesen Minuten zumute gewesen war. Sie nahm alle Kraft, all ihren Stolz zusammen.
Sie rief Dr. Norden an. Ihre Stimme bebte, als Fee sich meldete. »Meine Mutter ist für immer eingeschlafen«, sagte sie leise. »Dr. Norden hat mir gesagt, daß ich anrufen darf. Ich weiß gar nicht, wie spät, wie früh es ist.«
»Wir kommen, Nanette«, sagte Fee. »Wir sind bald da.«
Daniel hatte sich schon aufgerichtet. »Du willst mitkommen?« fragte er.
»Es ist ja Samstag. Die Kinder brauchen nicht zur Schule. Lenni ist ja auch da, aber Nanette ist ganz allein. Sie tut mir so entsetzlich leid.«
»Mir auch. Jetzt wird die liebe Familie wie Aasgeier über sie herfallen.«
»Wie kannst du das denken, Daniel?« fragte Fee bestürzt.
»Ich habe es im Gefühl. Wer hat sich denn um sie gekümmert? Aber jetzt geh es ans Erben, mein Schatz.«
»Sieh es nicht so schwarz«, flüsterte sie betroffen. Aber auch diesmal sollte Daniel Norden recht behalten.
Nanette sollte es bald zu spüren bekommen. Sie hatte ihre Geschwister benachrichtigt, und plötzlich hatte sie vor allen zu hören bekommen, warum sie denn nicht vorher von der Verschlechterung benachrichtigt worden wären. Der Einzige, der auch für sie ein mitfühlendes Wort hatte, war ihr noch unverheirateter Bruder Heinz, der in Nürnberg als Bauingenieur tätig war.
Daß die Nordens ihr über die schwersten Stunden hinweghalfen, war augenblicklich ihr einziger Trost. Die wichtigsten Formalitäten waren bereits erfüllt, als ihre Geschwister nacheinander eintrafen.
Zuerst kam Karin, die ja mit Mann und den zwei Kindern am nächsten wohnte. Sie kam jedoch allein, schon ganz in Schwarz gekleidet, und sie schluchzte auch sogleich herzzerbrechend.
»Carl ist mit den Kindern zu Hause geblieben«, sagte sie, »die Kleinen verstehen das ja noch nicht. Man kann ja auch gar nichts mehr tun, aber du wirst es auch verstehen, daß ich mich um die Kinder kümmern mußte.«
Nanette konnte nichts sagen. Sie war erschöpft von der durchwachten Nacht und im Augenblick auch völlig gleichgültig jedem Gerede gegenüber.
»Hast du dir schon Trauerkleidung besorgt?« fragte Karin.
»Wann denn und warum? Davon wird Mutti nicht mehr lebendig.« Das brachte sie dann doch über die Lippen.
»Es gehört sich doch aber«, sagte Karin verweisend. »Vorbereitet waren wir ja schließlich alle.«
»Tatsächlich? Und warum habt ihr Mutti dann nicht besucht?« fragte Nanette.
»Mein Gott, mußt du jetzt mit Anklagen kommen?«
»Es ist keine Anklage.«
»Schließlich warst du doch immer ihr Herzenskind. Und du…«, sie konnte nicht weiterreden, denn nun kamen Reinhard und Vera Kesselbach.
Sie gaben sich zurückhaltender. »Entschuldige, daß wir jetzt erst kommen«, sagte Reinhard, »aber wir mußten Andy erst zu den Großeltern bringen. Ein Trauerhaus ist ja nichts für Kinder.«
»Karin konnte ja auch schneller hier sein, da sie keine so weite Fahrt hat«, warf Vera ein. Die Begrüßung mit Karin fiel ziemlich kühl aus. Nanette hatte das Gefühl, daß man sich schon belauerte, aber ihr war sowieso alles gleichgültig an diesem Tag.
»Heinz kann erst abends hier sein«, sagte sie tonlos. »Werner muß noch etwas Geschäftliches erledigen«, warf Reinhard ein. »Wir haben vorhin noch telefoniert. Was ist noch zu erledigen?«
»Das Beerdigungsinstitut ist schon beauftragt«, erklärte Nanette. »Das Grab haben wir ja. Es muß nur für zehn Jahre vorausgezahlt werden.«
»Die werden auch immer unverschämter«, sagte Karin. »Hat Mutti denn eigentlich ein Testament gemacht?«
»Das war doch nicht nötig«, sagte Reinhard. »Vater hat sie doch nur als Vorerbin eingesetzt.«
»Müssen wir darüber jetzt reden?« fragte Nanette. »Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Versteht bitte, wenn ich ein bißchen Ruhe brauche.«
»Es wäre besser gewesen, Mutti wäre in eine Klinik gebracht worden. Vielleicht hätten sie da doch noch etwas machen können«, sagte Karin.
»Sie wollte daheim sterben. Sie wußte, daß sie sterben muß«, sagte Nanette gequält.
»Ich finde, daß es für Nanette wohl doch ein bißchen zuviel war«, warf Vera ein. »Schlaf jetzt, wir sind ja jetzt hier.«
Und jetzt werden sie überlegen, was wohl für jeden herausspringt, dachte Nanette, als sie auf ihrem Bett lag. Heiße Tränen quollen aus ihren Augen, aber sie war so müde, daß sie dann doch einschlief.
*
Obgleich das Wetter nicht gerade verlockend war, wollten die Nordens frische Luft tanken.
Der Nebel hatte sich gelichtet, doch der Himmel blieb düster. Der Weg sollte auch nur zur Leitner-Klinik führen und dann zum Gasthof »Högl«, denn Lenni war mit Loni Enderle, Dr. Nordens Sekretärin aufs Land hinaus gefahren, da Lenni sich um die Gräber ihrer Lieben kümmern wollte.
»Der November ist ein trauriger Monat«, sagte Danny plötzlich, während sie durch raschelndes buntes Laub gingen.
»Die Blätter haben aber schöne Farben«, meinte Felix.
»Aber die Bäume werden kahl, bloß die Tannen nicht«, gab Anneka auch noch ihren Kommentar dazu.
»Aber warum sind soviel traurige Feiertage im November?« fragte Danny wieder. »Allerheiligen, Allerseelen, Buß- und Bettag, Totensonntag«, zählte er auf.
»Mei, weil alles traurig ausschaut in der Natur, und weil die Leut’ sich im Dezember auf Weihnachten freuen sollen«, warf Felix ein. »Da soll dann keiner mehr traurig sein.«