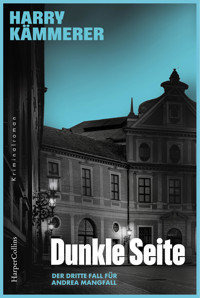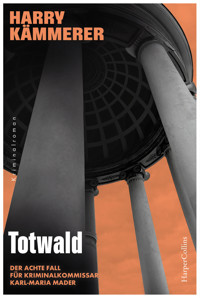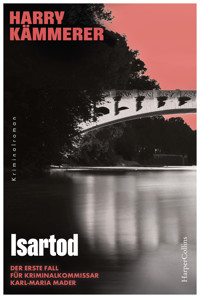15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nagel & Kimche
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jeder hat eine Leiche im Keller, sagt man. Was aber, wenn man tatsächlich glaubt, für den Tod eines Menschen mitverantwortlich zu sein? Hans, längst erwachsen und selbst Vater, erinnert sich unvermittelt an ein Ereignis seiner Kindheit: Maxi, der aufdringliche Nachbarsjunge, der Hans und seinen besten Freund Elmar immer störte, wenn sie hinter der Siedlung ihre Drachen steigen ließen, war plötzlich spurlos verschwunden. Schockiert und fasziniert zugleich verfolgten die Kinder, wie Suchtrupps der Polizei die Umgebung durchkämmten. Wie Aktenzeichen XY – nur in echt. Wie war es möglich, dass er die Sache mit Maxi vergessen hatte? – Ein stimmungsvoller Roman um Freundschaft und Verlust und um die Kraft und Unzuverlässigkeit von Erinnerung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Nagel & Kimche E-Book
Harry Kämmerer
DRACHEN FLIEGEN
Roman
für M & P
You can’t start a fire without a spark
Bruce Springsteen
Silberpfeil
Fünfzig Meter! Mindestens. Was für ein Schuss! Quer über das abgeerntete Feld. Hinterher! Barfuß. Spüre die Stoppeln kaum. Ziehe den silbernen Aluminiumpfeil aus dem harten Boden.
Höre das Schwirren. Rühre mich nicht.
Einen Meter neben mir bohrt sich der Pfeil in die Erde.
»He, Elmar, spinnst du?«
Gleißende Sonne. Ich halte die Hand vor die Augen. Ein weiterer Pfeil zischt durch die Luft. Ich springe zur Seite. Du Arsch, dir werd ich’s zeigen!
Ich renne los, Elmar auch. Ich hole ihn ein, stürze mich auf ihn. Wir raufen, keuchen, drehen uns die Arme auf den Rücken. Elmar ist stärker als ich. Ich bin gelenkiger.
Es dauert eine Weile, bis er als Sieger auf mir sitzt.
»Na, Hans, du Hosenscheißer?«
»Selber Hosenscheißer. Der Pfeil hätte mich treffen können!«
»Hätte, hätte, Fettbulette. Ich hab genau gezielt.«
»Pfff!« – Mehr fällt mir nicht ein.
Elmar rollt sich runter. Wir liegen nebeneinander auf der sommerharten Stoppelerde. Staub und Dreck auf der verschwitzten Haut, die juckt und spannt. Wir sehen hinauf in den wolkenlosen Himmel mit dem fransigen Kondensstreifen.
»Was machen wir heute noch?«, fragt Elmar.
»Reicht der Wind zum Drachenfliegen?«
»Das heißt Drachensteigen.«
»Wie Treppen steigen?«
»Sehr witzig. Drachen. Steigen. Lassen.«
»Wenn ein Drache nicht fliegt, dann weiß ich’s auch nicht.«
»Drachenfliegen heißt das, wenn du selber fliegst. Mit ’nem großen Drachen.«
»Wenn du das sagst.«
»Ist eh kaum Wind. Schwimmbad.«
»Nicht schon wieder.«
»Max-Schultze-Steig.«
»Geht klar.« Ich springe auf. »Wer zuerst beim Stromhäuschen ist!«
»Bazooka.«
»Hubba Bubba.«
Wir rennen los.
Meistens sind wir auf dem Feld hinter den Wohnblocks. Wo die verfallenen Tribünen der aufgelassenen Trabrennbahn stehen und der Aussichtsturm mit den vernagelten Türen und den eingeschlagenen Scheiben. Und der Bunkerberg, Hinterlassenschaft einer Flugzeugfabrik aus dem Zweiten Weltkrieg. Mit verkeilten Betonplatten, aus denen rostige Stahlstangen wie Knochen herausragen, mit Kratern von Granateinschlägen, zugewuchert von dichtem Buschwerk. Mit einem Wäldchen, in dem wir mit Dachdeckerhämmern und Klappspaten kleine Bäume fällen, Äste und Büsche kappen. Damit errichten wir Lager oder zerstören sie, wenn es die von der Hochhausbande sind. Mit der sind wir in permanentem Kriegszustand. Die Jungs vom Hochhaus sind älter und größer, wir sind schlauer und schneller als sie – ein ewiges Hin und Her.
Viele Unikollegen meines Vaters wohnen mit ihren Familien hier in der Siedlung. Sie ist erst ein paar Jahre alt, Wohnraum vom Reißbrett: zehn Blocks mit je drei Aufgängen und vier Stockwerken und ein Hochhaus mit 23 Stockwerken. Hier ist immer viel los, in den Höfen sind jede Menge Kinder unterwegs. Unser Block hat die Nummer 20. Wir wohnen im ersten Stock links, mittlerer Eingang. Vier Zimmer. Eins teile ich mit meinem Bruder Klaus. Der Rest: Wohnzimmer, Elternschlafzimmer und das heilige Arbeitszimmer von Papa, in dem er einmal pro Woche mit seinen Kollegen Skat spielt. Dazu gibt es Schnittchen, Bier und Schnaps.
In der Wohnung unter uns lebt Michaels Familie. Da bin ich oft. Bis Michaels Mutter an Krebs stirbt. Danach besuche ich Michael fast gar nicht mehr bei ihm zu Hause. Oder nur sehr kurz. Ich habe Angst, dass die Krebszellen in der Wohnung immer noch ihr Unwesen treiben und auf ihr nächstes Opfer lauern. Im linken Eingang im dritten Stock wohnen die Hagens. Dort essen mein Bruder und ich zu Mittag, weil Mama ihr unterbrochenes Lehramtsstudium wiederaufgenommen hat und über Mittag meistens an der Uni ist. Rechter Eingang, Erdgeschoss rechts wohnt Herr Lärmer, ein Rentner, der immer wieder im Unterhemd auf den Balkon raustritt und rumschreit, wenn wir beim Fußball oder Völkerball seine Mittagsruhe stören. Sein Nachname passt zu seiner Schreierei, nicht zu seinem Ruhebedürfnis. Angst haben wir keine vor ihm.
Elmar wohnt in der 17 auf der anderen Straßenseite. Er ist mein bester Freund. Wir gehen auf dieselbe Schule, aber leider nicht in dieselbe Klasse. Wir sind unzertrennlich und treffen uns jeden Tag nach den Hausaufgaben. Am Wochenende sowieso. Ein Haus weiter in der 19 wohnt Maxi, eine Nervensäge, die immer dabei sein will. Eine elende Labertasche, groß und dünn, sommersprossig, mit wirren rotblonden Haaren. Wir lassen Maxi fast nie mitspielen. Ein schlechtes Gewissen haben wir deswegen nicht. Maxi passt nicht zu uns. Wir wollen ja auch nicht in der Hochhausbande sein. Nein, blöder Vergleich. Die vom Hochhaus sind schließlich unsere Feinde. Wir – das sind noch Michael, Thomas von der 18 und Andi, der beste Fußballer bei uns in der Straße. Aber richtig eng bin ich nur mit Elmar.
Maxi glaubt mit uns befreundet zu sein. Aber das stimmt nicht. Selbst wenn wir dann doch mal was mit ihm machen. Einmal nehmen wir ihn sogar mit ins Freibad. Wo er uns zeigen will, dass auch er im 3,80-Meter-Becken bis zum Boden tauchen kann. Natürlich nicht Kopf voraus und ohne Sprung. Schwung holt er am Beckenrand. Er stützt sich mit den Händen auf, pumpt den Oberkörper zweimal hoch und taucht beim dritten Mal mit Karacho ab. Und schlägt sich den Unterkiefer am Beckenrand auf. Sofort färbt sich das Wasser rot. Die Sanitäter bringen ihn ins Krankenhaus. Das ist Maxi.
Irgendwann sind wir auch mal bei Maxi zu Hause, nachdem er uns ewig bequatscht hat mitzukommen, damit wir uns endlich sein Zimmer ansehen. Das ist nicht gerade sensationell, sondern schaut aus wie jedes andere Kinderzimmer. Unordentlich. Was mich aber beeindruckt, ist der Fernseher im Wohnzimmer. Der ist komplett weiß angemalt – streifig, fleckig.
»Das war ich«, erklärt Maxi stolz.
»Warum hast du das gemacht?«, frage ich fassungslos.
»Was denn?«
»Die Farbe, der Fernseher?«
»Ach so, das.«
»Und? Warum hast du ihn so angemalt?«
»Weil er mir so besser gefällt.«
»Und was haben deine Eltern gesagt?«
»Nichts.« Er lacht.
Elmar schüttelt den Kopf und konzentriert sich auf Maxis Big-Jim-Figur, die über einen Druckmechanismus am Rücken Karateschläge ausführen kann.
Als Maxis Vater nach Hause kommt, fragt er: »Habt ihr Hunger, Jungs?«
Klar, haben wir immer. Er macht uns Brote.
Beim Essen will ich wissen, ob er Maxi wegen dem Fernseher sehr geschimpft hat.
Er zuckt mit den Achseln und lacht. »Ist doch nur ein Fernseher.«
Ich staune. Nur ein Fernseher? Bei uns ist der Fernseher das kostbarste Stück im Haushalt. Für mich zumindest. Ein großes Schwarz-Weiß-Gerät von Grundig in einer Holztruhe mit Schiebetür. Die man leider absperren kann. Daktari, Mondbasis Alpha 1, Tom und Jerry – Sendungen, die mir viel bedeuten. Elmar auch. Und da sagt Maxis Papa, dass der Fernseher nicht so wichtig ist? Sehr sonderbar. Merkwürdig finde ich auch, dass Maxi beim Essen so ekelhaft schmatzt und seinen Papa das überhaupt nicht zu stören scheint.
Ich bin nicht besonders empfindlich, aber das ist mir zu viel. »Mann, muss das sein?«, beschwere ich mich.
Maxi schaut mich erstaunt an. Er hat keine Ahnung. Ich mache ihn übertrieben nach.
Maxis Vater grinst. Und verzieht sich in sein Arbeitszimmer.
»Sagen deine Eltern da nichts, wenn du beim Essen so schmatzt?«, will jetzt auch Elmar wissen.
»Aber nein«, sagt Maxi bedeutungsvoll. »Das ist autoritäre Erziehung.«
Wir sehen ihn verständnislos an.
»Das ist vor allem eklig«, sage ich.
Als wir heimgehen, meint Elmar im Hof: »So eine autoritäre Erziehung taugt nix. Fernseher vollschmieren und schmatzen, was das Zeug hält?«
»Aber sein Papa ist schon cool.«
Mein Papa ist nicht cool. Eher streng. Feste Fernsehzeiten, am Wochenende verordneter Mittagsschlaf, und am Sonntag müssen mein Bruder und ich um zehn Uhr mit ihm zum Gottesdienst in die evangelische Kirche. Mama ist nicht dabei. Sie ist katholisch und geht am Samstagabend in die Messe. Und Sonntag macht sie Mittagessen, wenn wir mit Papa in der Kirche sind. Der Gottesdienst ist für mich eine zähe Prüfung. Ich staune jedes Mal wieder, wie sehr sich Zeit dehnen lässt. Endlos. Ich bekomme von den monotonen Predigten kaum etwas mit und lasse meinen Blick den Rauputz der Wände entlangkriechen, in die Fugen der Buntglasfenster, in jeden Spalt der hellen Holzbänke.
Wenn die Ewigkeit dann doch irgendwann vorbei ist, fahren wir zum Frühschoppen. Im Sommer ist das ganz okay. Meistens sind wir beim Donaubauer, einem Ausflugslokal an der Donau. Dort ist auch der Max-Schultze-Steig, die Außengrenze unseres Reviers. Durch den Wald am steilen Hochufer winden sich enge Pfade und Steige, es gibt Höhlen, Überhänge, Felsplateaus. Da sind wir oft, liegen auf dem Bauch und sehen auf die träge Donau hinab. Und rüber zur großen Autobahnbrücke, die das Donautal zerschneidet. Oben donnert der Verkehr, fünfzig Meter tiefer glitzert braun das Wasser. Im Biergarten vom Donaubauer trinkt Papa zwei Bier, wir Kinder bekommen je ein Spezi und ein Cornetto. Klaus Nuss, ich Erdbeer. Hinterher fahren wir zum Bahnhof, wo Papa sich eine Sonntagszeitung für den Nachmittag kauft und jedem von uns ein Comic-Heft. Klaus Silberpfeil, ich Lasso. Brave Sachen im Vergleich zu Elmars Heften. Elmar liest Comics wie Superman, Batman, Hulk oder Grüne Laterne. Bei uns undenkbar. Comics mit Cowboys und Indianern sind schon ein großes Zugeständnis. Mit den Heften bekommen Klaus und ich die verordnete Mittagsruhe einigermaßen rum.
Ich bin mit Elmar auf dem Bunkerberg, und wir schauen auf das Feld hinunter. Wir kauen beide cool auf unseren Grashalmen. Elmar erzählt mir von seiner Idee mit dem unterirdischen Lager. Ein Geheimversteck nur für uns, wo wir all die Fundstücke bunkern können, die wir auf unseren Streifzügen erbeuten: Schrauben, Nägel, altes Werkzeug oder Zugschilder von den rostigen Waggons auf den Abstellgleisen jenseits des Felds. Wo uns niemand finden kann. Wir sitzen auf den sommerwarmen Betonplatten und lassen unserer Phantasie freien Lauf, träumen von einer Kommando-zentrale wie in einem James-Bond-Film, wie in Goldfinger, den wir in den Pfingstferien in den Kammerlichtspielen in einer Nachmittagsvorstellung gesehen haben. So edel wird es nicht werden, aber auch nicht ganz ohne Luxus. Ich kann einen alten Teppich aus unserem Keller bieten, Elmar einen Küchentisch und zwei Stühle. Auf unserer Proviantliste stehen: Dosenravioli, Kekse, Mineralwasser und Spezi. Wir werden uns gut eindecken, und wenn der Atomkrieg kommt, sitzen wir seelenruhig da unten und spielen bei Kerzenschein Karten, bis die Luft wieder rein ist.
Wir reden und reden. Schließlich schweigen wir und lassen die Blicke schweifen. Durch das weißgelbe Kornfeld schlängeln sich unsere Schleichwege, mitten im Feld steht der alte Turm der Rennbahnaufsicht, rechts verfallen wie vergessene Filmkulissen die Rennbahntribünen. Auf der anderen Seite vom Feld sind Bahngleise mit ausgemusterten, schmutzig grünen Waggons. Hinter dem Bunkerberg verläuft ein hoher Maschenzaun mit Stacheldraht, Begrenzung zum Fabrikgelände von Siemens mit seinen neuen, weißen Werkshallen. Vor dem Zaun ist ein fünf Meter breiter Streifen mit dichtem Buschwerk.
»Da unten graben wir das Loch für unseren Bunker«, sagt Elmar und zeigt auf den verwilderten Grünstreifen. »Zwei Meter tief. Mindestens!«
»Das wird ein Haufen Arbeit«, sage ich.
»Wir haben einen Haufen Zeit.«
Da hat er recht. Die Sommerferien beginnen gerade erst, und Papa muss arbeiten. Was ich nicht so tragisch finde, weil wir dann keine Kulturreise nach Italien oder Frankreich machen wie in den letzten Ferien. Mit stundenlangen Autofahrten, auf denen mein Bruder und ich beißenden Zigarettenqualm erdulden müssen und wir in den Städten von einer Kirche zur nächsten hasten und weiter in irgendein Museum eilen. Auf die Idee, dass so was für Kinder stinklangweilig ist, kommt mein Papa nicht, selbst wenn wir es lautstark sagen. Mama schaut sich auch gerne Kunst an, aber sie würde ebenso ans Meer fahren. Das haben wir bisher erst ein Mal gemacht, und ständig mussten wir uns von Papa anhören, wie langweilig das sei. Da könne man ja gar nichts anschauen. Ich bin ganz froh, dass wir diese Sommerferien hierbleiben. Elmar ist im August immer zu Hause, weil es da seinen Eltern in den Ferienorten überall zu voll ist. Hier ist es leer, fast alle Kinder aus der Siedlung sind schon in der ersten Ferienwoche weggefahren.
Wir beginnen mit den Aushubarbeiten und achten darauf, dass keiner von den wenigen Daheimgebliebenen etwas von unserer Aktion mitkriegt. Vor allem Maxi nicht, der ist nämlich auch noch da. Wir sehen ihn aber kaum. Vermutlich ist er wieder mit seinem Papa in der Uni und darf für ein paar Mark Stundenlohn Bücher kopieren oder den Aktenvernichter füttern. Er hat uns mal erzählt, dass er das ganz super findet, wenn das Papier in feine Streifen geschnitten wird.
Niemand stört uns, und wir graben uns in dem dichten Gebüsch vor dem Zaun mit unseren Dachdeckerhämmern und Klappspaten tief in die lehmige Erde. Mama ist stocksauer, als ich das erste Mal völlig verdreckt nach Hause komme, sagt aber schon am zweiten Tag nichts mehr, weil sie froh ist, dass ich mich selbst beschäftige, wenn wir schon nicht wegfahren. Bei Klaus ist das kein Thema, der sitzt sowieso in unserem Zimmer und lötet irgendwelche Platinen aus seinem neuen Elektronikbaukasten zusammen.
Am nächsten Sonntag beim Donaubauer hat Papa für uns eine Überraschung. »Wir fahren doch noch in den Sommerurlaub«, verkündigt er. »Zwei Wochen ans Meer!«
Das kann nicht sein, da ist was faul, denke ich. Und dann sagt er auch noch, dass wir einen Freund mitnehmen dürfen. »Elmar, wenn der Lust dazu hat.« Das ist zu viel des Guten, jetzt muss er mit der Wahrheit raus! Er eiert ein bisschen rum, dann erzählt er es uns: Sein Chef wird Rektor an der Universität Passau und hat ihm dort einen Job angeboten – ein Angebot, das er nicht ablehnen kann.
»Wir ziehen um«, sagt Papa. »Bereits zum Ferienende, wegen der Schule. In ein großes, neues Haus. Keine Wohnung mehr. Jeder von euch kriegt sein eigenes Zimmer.«
»Ich brauch kein Haus!«, platzt es aus mir heraus. »Und kein eigenes Zimmer!« Ich bin total entrüstet und muss mich zusammenreißen, um nicht heulend aufzuspringen und wegzulaufen. Ich kenne jeden Fleck hier, hier wohnt mein bester Freund. Wie stellt Papa sich das vor? Wir können doch nicht einfach von Regensburg wegziehen! Aber es ist zu spät, ich verstehe schon – da ist nichts mehr zu machen. Ich bin stocksauer. Das Cornetto kann er selber essen! Und das Lasso-Heft will ich auch nicht! Auf der Heimfahrt spreche ich kein Wort. Das Mittagessen rühre ich nicht an, obwohl es Schweinefilet mit Pilzen gibt. Meine Mama ist bedrückt. Aber was erwartet sie denn? Dass ich mich freue? Die Mittagsruhe verbringe ich mit schwarzen Gedanken.
»Ach, so schlimm ist das doch nicht«, findet Elmar, als ich ihm nachmittags am Bunkerberg alles erzähle. »Wir können uns doch an den Wochenenden besuchen. Da gibt’s bestimmt ’nen Zug. Das ist keine Weltreise. Mal kommst du, mal komm ich.«
»Die ersten Monate behalten wir die Wohnung eh noch.«
»Na also. Und dann besuchen wir uns. Das ist doch cool – so ohne Eltern unterwegs.«
»Meinst du echt?«
»Ja, logisch.«
Ja, logisch – so ist Elmar. Das mag ich am meisten an ihm. Nie sieht er Probleme.
»Und ich kann wirklich mit euch in den Urlaub fahren?«, fragt er.
»Ja, nach Bari.«
»Wo immer das ist. Hauptsache am Meer. Ich nehm die Flossen mit. Und meine neue Taucherbrille. Wann fahren wir?«
»In zwei Wochen.«
»Bis dahin ist unser Lager fertig.«
»Viel hab ich dann ja nicht mehr davon.«
»Ach, wer weiß. Vielleicht verstecken wir uns da einfach, wenn Umzug ist.«
»Und dann?«
»Jetzt nimm halt nicht immer alles so ernst, Hans. Wenn du zu Besuch kommst, dann haben wir einen Ort nur für uns.«
Ich nicke. Das leuchtet mir ein.
Das Erdloch wird immer größer und tiefer, und abends decken wir es mit Zweigen und Blättern ab, damit niemand die Baugrube vom Bunkerberg aus sehen kann.
Schließlich fährt auch Maxi weg. »In einer Woche bin ich wieder da«, verabschiedet er sich im Hof fröhlich. »Dann machen wir was zusammen, gell?«
Ich lächle und denke: Logisch, Maxi. Träum weiter! Bis du zurückkommst, sind wir fertig mit dem Lager. Und dann fahren wir weg – Elmar und ich!
Ich hole mir bei Mama den Schlüssel für den Keller, um den alten Perserteppich für unser Lager zu organisieren. Offiziell, um Leergut runter- und volle Flaschen raufzubringen. Als wir in der dritten Klasse mal aufschreiben sollten, was unsere Aufgaben im Haushalt seien, habe ich Bier holen für Papa geschrieben und damit für große Heiterkeit gesorgt. Keine Ahnung, was daran so lustig war. Ich bin gerne im Keller. Ich mag den Grusel, wenn das Minutenlicht ausgeht. Ich stelle dann den Sechserträger lautlos ab und greife mir eine leere Bierflasche, bereit, sofort zuzuschlagen, wenn der Mörder hinter dem Mauervorsprung hervorspringt. Passiert natürlich nicht. Ich starre in die Dunkelheit, zähle langsam bis zehn und drücke dann auf den orange glimmenden Lichtschalter – und der Grusel ist vorbei. Wenn ich selbst die Regie habe, dann mag ich die Dunkelheit.
Wir haben das letzte Abteil rechts hinten. In dem großen Stahlregal liegen Koffer mit alten Kleidern, Kartons, Kisten, verbeulte Töpfe, unser Schlauchboot und jede Menge anderer Kram. Ich habe mir angewöhnt, in unserem Kellerabteil immer mal wieder eine Flasche Thurn & Taxis aufzumachen. Ich mag den würzigen Geschmack des lauwarmen Biers. Kalt ist es da unten nicht, an der Kellerdecke verlaufen dicke Heizungsrohre. Und während ich das Bier im Mund hin und her schwenke und mir der Schaum in die Nase steigt, inspiziere ich all die Schätze, die in den Koffern und Kartons verborgen sind: Kleider, Bücher, Zeitschriften, Briefe, Fotos. Erinnerungen meiner Eltern an eine Zeit, wo sie noch keine Eltern waren, sich nicht einmal kannten. Ich finde auch zwei alte RCA-Singles von Elvis Presley. Auf das Etikett, wo Interpret und Komponist draufstehen, hat Mama weiße Papierstreifen mit ihrem Mädchennamen geklebt. Der Kuli ist unter dem gelblichen Tesafilm ein bisschen zerlaufen. Aber ihr Name ist astrein zu lesen. Das macht man nur mit Sachen, die einem viel bedeuten. Ob Mama als Teenager zu den Singles selbstvergessen getanzt hat? Das kann ich mir nur schwer vorstellen.
Bald ist unser Lager wohnlich eingerichtet. Der rote Perser aus unserem Keller liegt auf dem klammen Lehm. Darauf Elmars Stühle und Küchentisch. Wir sitzen dort unten, trinken Spezi und sehen hinauf in den Schleierwolkenhimmel.
»Fehlt nur noch das Dach«, meine ich zufrieden.
»Holen wir gleich«, sagt Elmar. »Wenn das Spezi leer ist.«
Auf dem angrenzenden Bahngelände steht ein halbverfal-lener Schuppen, von dem wir die Torflügel aushängen, um sie über unsere Grube zu legen und darauf etwas von der aus-gehobenen Erde zu werfen. Damit Gras über die Sache wachsen kann.
Wir transportieren die Torflügel zur Grube und stellen fest, dass das Loch für die Bretter zu groß ist. Oder die Bretter sind zu klein. Sie finden erst einen halben Meter tiefer als geplant Halt. Da muss jetzt eine Menge Erde drauf, damit oben keine auffällige Kuhle bleibt. Bald sind die Bretter von einer dicken Schicht aus Erde, Ästen und Grasbüscheln bedeckt. Das Lager ist super getarnt. Wir klettern hinein. Unten muss man sich jetzt bücken. Am Tisch sitzen kann man aber einwandfrei. Elmar leuchtet mit der Taschenlampe die Decke ab, und wir sehen, wie sich die Holzplanken bedenklich biegen.
»Das kracht gleich ein«, urteilt er. »Da müssen Stützen rein, wie in einem Bergwerk.«
Wir ziehen noch mal zum Bahngelände los und kehren mit ein paar dicken Holzpfosten zurück. Einer hat genau die richtige Länge, dass wir ihn auf die Tischplatte stellen können, um die Decke in der Mitte abzustützen. Perfekt.
Wir sitzen in unserem kühlen Erdloch, während draußen die Sommerhitze knallt. Ein scharfumrissener Lichtblock fällt durch die Einstiegsluke, die wir aus einem alten Fensterladen gebaut haben. Wir trinken jetzt die zwei Flaschen Bier, die ich aus unserem Keller abgezweigt habe. Ganz große Jungs, Männer eigent-lich schon.
»Meinst du, jemand entdeckt unser Lager, wenn wir in Italien sind?«, frage ich.
»Nein. Niemand weiß, dass es hier ist. In ein paar Tagen sieht man oben nichts mehr.«
»Und wenn doch? Was ist mit Tom, mit Andi oder der Hochhausbande?«
»Keine Gefahr, die Tarnung ist perfekt.«
»Und Maxi?«
»Der ist zu blöd, das Lager zu finden. Und wenn – er würde sich nie trauen, es kaputtzumachen.«
»Die Hochhausbande schon.«
»Wenn jemand das Lager kaputtmacht, dann wir selbst«, sagt Elmar.
»Wie meinst du das?«
»Wir bauen eine Sicherung ein. Wenn wirklich jemand einsteigen will, sorgen wir dafür, dass es einstürzt, bevor der auch nur einen Fuß reinsetzt.«
»Versteh ich nicht.«
Er deutet zur Luke. »Wir befestigen da ein Seil dran. Also innen. Mit einem Seemannsknoten. Das Seil ist mit dem Pfosten auf dem Tisch verbunden. Wenn jemand neugierig die Luke öffnet, klemmt sie wegen dem Seil. Wenn er fest an der Luke zieht, reißt er den Pfosten raus, und das ganze Teil kracht zusammen.«
»Ja, und wir?«, frage ich entgeistert. »Wie kommen wir dann selbst rein?«
»Das Seil hat etwas Spiel. Du öffnest die Luke nur einen Spalt und löst den Knoten, bevor du runtersteigst. Capito?«
Capito! Klar! Ich bin begeistert. Wenn sich einer unbefugt Einlass verschaffen will, macht es rums! Das erinnert mich an eine meiner Lieblingsszenen in Der Schatz im Silbersee. Ganz am Schluss, wenn der Typ mit dem Schatz im Schlick unter-geht. Also von der Idee her: Du greifst nach etwas, was du unbedingt haben willst, du glaubst es zu haben, und schon ver-sinkt alles in den Fluten. Ich bin verblüfft, dass Elmar so was wie mit der Seilsicherung einfach so einfällt. Darauf wäre ich nie gekommen.
Wir kaufen uns im Baumarkt zwei Meter billiges, grelloranges Kunststoffseil, binden es um den Pfosten und knoten es an den Riegel des ehemaligen Fensterladens. Dann testen wir es. Wir öffnen von innen vorsichtig die Luke. Das Seil spannt sich. Wenn jetzt jemand die Klappe aufreißt ... Wir machen das Seil noch mal ab und klettern raus. Einer muss die Luke aufhalten, während der andere das Seil mit einem Seemannsknoten an der Luke innen befestigt. Wir schließen es und wissen: Das Seil hat so viel Spiel, dass man die Luke gerade so weit öffnen kann, dass sich der Knoten lösen lässt. Und das macht man nur, wenn man Bescheid weiß. Das Beste daran ist: Man kann es nur zu zweit machen. Wir kommen uns total genial vor. Den Ort kann uns keiner nehmen!
Als wir nach Hause gehen, sehen wir das Auto von Maxis Eltern auf dem Parkplatz. Sie sind bereits aus dem Urlaub zurück. Die Woche ist wie im Flug vergangen. Ich erwarte, dass Maxi uns gleich bei den Fahrradständern abfängt und volllabert. Passiert aber nicht. Unbehelligt gehen wir über den Hof.
Alles ist für den Italienurlaub gepackt, und ein langer heißer Nachmittag liegt noch vor uns. Papa will wegen der Hitze über Nacht fahren. Unser Geheimlager interessiert uns schon nicht mehr so sehr. Schließlich ist es fertig und gut gesichert. Auf Schwimmbad haben wir auch keine Lust. Morgen baden wir ja schon im Meer. Wir holen unsere Räder und fahren zum Max-Schultze-Steig.
Plötzlich habe ich das Gefühl, dass uns jemand folgt. Ich drehe mich um und sehe ihn – Maxi!
»Schnell, Elmar«, rufe ich. »Maxi ist hinter uns her!«
Wir geben Gas, biegen beim Abenteuerspielplatz nach links ins Neubauviertel ab und kurven um die großen Blocks herum durch Spielstraßen und über Parkplätze. Maxi lässt sich nicht abschütteln. Seine rotblonden Haare wehen im Wind, er tritt mit aller Kraft in die Pedale, die Sehnen seiner dünnen, sommersprossigen Arme sind gespannt wie Drahtseile. Er strahlt übers ganze Gesicht und hält das Ganze für ein Spiel.
Irgendwann haben wir Maxi abgehängt.
Wir fahren freihändig den Radweg an der Donau entlang in Richtung Sinzinger Autobahnbrücke. Nachdem wir die Räder den steilen Weg zum Max-Schultze-Steig hochgeschoben haben, brettern wir über den schmalen Pfad bis zu dem Felsen, wo es zu unserem Lieblingsplatz abgeht, dem Plateau mit dem freien Blick auf die Donau und die mächtige Brücke. Wir verstecken die Räder im Gebüsch, und ich klettere schon zu unserem Felsen rüber. Elmar muss noch mal los, zum Donaubauer. Heute ist er dran mit Eisholen.
Ich liege auf dem Bauch und blicke in den dichtbewaldeten Hang. Sehe, wie der sanfte Wind die Blätter in Hell- und Dunkelgrün auffächert, spüre die Wärme des Felsens, höre das Rauschen der Autobahnbrücke. Ich denke an die Geschichte mit dem Selbstmörder, die in der Zeitung stand. Der ist zu Fuß auf die Brücke, bis zur Mitte, um dort über die Brüstung zu klettern und in die Donau zu springen. Er hat es nicht überlebt. Fünfzig Meter. Ich bin im Freibad schon mal vom Zehnmeterbrett gesprungen. Von dort oben sah das Becken aus, als könnte ich es problemlos verfehlen. Und der Aufprall tat echt weh. Meine Fußsohlen und die Unterseiten der Oberarme haben wie Hölle gebrannt. Und das waren nur zehn Meter.
»Bei fünfzig Metern ist das Wasser hart wie Beton«, meinte Elmar, als wir die Geschichte vom Selbstmörder wieder einmal durchkauten. »Wenn du da runterfällst, bist du tot.«
»Wie sich das wohl anfühlt?«
»Den Aufprall kriegst du nicht mehr mit.«
»Ehrlich?«
»Klar, du wirst vorher ohnmächtig.«
»Da wär ich mir nicht so sicher.«
Wir machen uns ständig Gedanken darüber, wie das ist, wenn man stirbt, was kurz vor dem entscheidenden Augenblick passiert. Läuft im Kopf ein Film ab, der das eigene Leben zeigt, rasend schnell, mit all den wichtigen Stationen im Zeitraffer, bevor es auf einen Schlag schwarz wird, das Licht ausgeht? Sieht man sich bei diesen letzten Sekunden selbst zu? Von außen? Oder steckt man mittendrin in der Sturzflut von Gedanken und Bildern, ist man Teil des Ganzen, ohne jede Distanz? Denkt man gar nichts, oder wird man einfach ohnmächtig? Macht man sich in die Hose? Was passiert da in einem drin, im Kopf, im Körper? Der Tod interessiert uns Kinder brennend.
Elmar kommt mit dem Eis zurück. Das Cornetto ist schon ganz weich. Es gab nur noch Nuss. Egal. Es schmeckt köstlich. Vanille, Sahne, Nuss – meine letzten Sommertage, bevor ich dich verlassen muss, reime ich, sage ich aber natürlich nicht laut. In mir glimmt bereits Wehmut. Es gibt plötzlich Dinge, die ich zum letzten Mal tue. Orte, an die ich vielleicht nicht mehr zurückkehre. Aber noch tut es nicht richtig weh. Ich bin nämlich auch voller Vorfreude. Morgen schon sind wir am Meer.
Aktenzeichen XY
Scirocco, heißer Wüstensand
mehr im Wasser als an Land
Kescher voller Krebse, Tang
Eis und Pizza auf die Hand
Wir toben mit Luftmatratzen durch die Wellen, tauchen Krebse und Muscheln vom Meeresboden hoch, graben uns komplett im Sand ein, Sonne und Salz brennen auf der Haut. Wir rennen durch die Bungalowsiedlung, über glühenden Asphalt, fischen 100-Lire-Stücke unter dem Eisstand hervor, bespitzeln abends die Erwachsenen, wie sie sich in der Open-Air-Disco zum Affen machen. Elmar und ich sind jetzt Blutsbrüder. Das haben wir zwischen den Dünen mit dem Taschenmesser gemacht. Ein kleiner Schnitt in die Kuppen unserer Zeigefinger, die wir dann aufeinanderpressten. Nur ein paar Tropfen Blut. Aber um die Menge geht es ja nicht.
Immer wieder tauche ich ins salzige Wasser. Bin jedes Mal aufs Neue erlöst von all den Sorgen, wie das jetzt mit dem Umzug wird, mit der neuen Stadt, dem neuen Haus, der neuen Schule. Werde ich neue Freunde finden? Einen Freund wie Elmar? Das Meer spült alle Fragen fort. Geht ein Tag spät zu Ende, kann ich den nächsten kaum erwarten. Es ist perfekt – nur wir, der Strand, das Meer und die Sonne über uns.
Die Abreise trifft mich kalt und hart. Es hat in der Nacht geregnet, der Strand ist narbig, das Meer starr wie Beton. Eigentlich wollten wir erst am Nachmittag fahren, aber der Sommer ist verschwunden, als hätte jemand das Licht ausgeknipst. Wir packen und fahren los. Im Auto ist es still. Wir sagen nichts. Ich wünsche mir so sehr, dass die Sonne noch mal rauskommt, dass wir anhalten, aussteigen, ein letztes Mal in die Wellen springen, die nackten Füße im Sand vergraben, noch ein Eis essen. Zum ersten Mal seit Tagen denke ich wieder mit Sorge an den Umzug, daran, dass wir Regensburg bald verlassen. Ich versuche mit Elmar darüber zu reden. Er steigt nicht darauf ein. Ich soll doch erst mal abwarten. Bestimmt ist das mit dem Haus ganz toll. Solche Sachen sagt er. Das will ich nicht hören. Wir schweigen fast die ganze Heimfahrt.
Ich wache auf, als Papa den Wagen in unserer Straße parkt. Schlaftrunken verabschiede ich mich von Elmar und tappe in die Wohnung hoch. Vom Balkon werfe ich einen Blick in die mondhelle Nacht. Ich will sichergehen, dass das Feld noch hinter den Häusern liegt, dass der Bunkerberg noch an seinem Platz ist. Nein, andersrum – dass ich wieder da bin. Zu Hause. Wo ich mich auskenne, wo ich hingehöre. Nicht mehr lange, denke ich traurig und gehe ins Bett. Ich bin unruhig und kann nicht einschlafen. Ich habe das Gefühl, dass etwas fehlt, dass etwas anders ist. Ich sehe noch mal aus dem Fenster. Das weite Stoppelfeld im Mondlicht, der Rennbahnturm, die Umrisse des Bunkerbergs. Irgendwas ist anders. Aber was?
Am nächsten Morgen erfahren wir es: Maxi ist verschwunden. Seit zwei Wochen schon! Die Polizei hat alles abgesucht. Vergeblich. Mama ist hysterisch. Die Teekanne fällt ihr beim Frühstück runter. Pfefferminz und tausend Scherben. Als ich Elmar treffe, weiß der es auch schon. Wir reißen blöde Witze: »Na, wo ist er denn, der kleine Maxi, putt-putt-putt?« Wir sind schrecklich ungerührt. Natürlich reden wir über den letzten Tag vor dem Urlaub, wo wir Maxi mit den Fahrrädern abgehängt hatten. Drüben in der Neubausiedlung. Nicht lange nachdem wir das unseren Eltern erzählt haben, kommt ein Polizist vorbei und nimmt unsere Aussage auf.
Am nächsten Tag schon sucht die Polizei das Neubaugebiet und die angrenzenden Felder bis zur Donau ab. Polizisten befragen die Anwohner, gehen durch Fahrrad- und Heizungskeller. Wir sind beeindruckt. Das alles passiert wegen unserer Aussage. Aber nichts, keine neuen Hinweise, auch nicht, als Maxis Bild noch mal in der Mittelbayerischen Zeitung erscheint und im Radio zur Mithilfe bei der Suche aufgefordert wird. So was kennen wir sonst nur von den schlechtgemachten Gruselfilmchen in Aktenzeichen XY ... ungelöst im Fernsehen. Aber das hier ist echt! Für uns Kinder ist das Ganze total spannend.
Wir haben kein bisschen Mitleid mit Maxi. Aber das hatten wir noch nie mit ihm. Mir fällt ein, wie Maxi beim Versteckspielen einmal den Rost eines Kellerlichtschachts herausgehoben hat, um sich darunter zu verstecken. Als wir ihn endlich entdeckten – er war der Letzte und zweifelsfrei der Sieger –, stellten wir uns zu viert auf das Gitter, taten so, als würden wir ihn nicht sehen, überlegten laut, wo er noch sein könnte. Und plötzlich mussten alle ganz dringend pinkeln. Sein Geheul ging in unserem Gelächter unter. Aber selbst so fiese Aktionen hielten Maxi nicht davon ab, sich weiterhin an uns dranzuhängen. Die Klette. Er war immer da. Jetzt ist er nicht mehr da.
Klar, wir wollen bei der Suche helfen – aber vor allem weil es ein aufregendes Spiel ist, und die Polizei unseren Hinweisen nachgeht. Aber es gibt keine Spur von Maxi und seinem Fahrrad. Wir haben wilde Phantasien. Dass jemand Maxi in einem der Wohnblocks der Neubausiedlung gefangen hält. Gerade ist Schleyer von der RAF entführt worden, und die Nachrichtensendungen bringen fast nichts anderes mehr. Wir interessieren uns sehr für Terroristen und ein Leben im Untergrund. Für Wohnungen, die unter falschem Namen angemietet werden, für Keller, Abstellkammern, in denen man Geiseln verstecken kann. Aber das ergibt alles keinen Sinn. Maxis Eltern sind weder Politiker, noch sind sie reich. Und es gibt auch keinen Erpresserbrief. Trotzdem – als eine Hundertschaft der Polizei die Donauauen durchkämmt, erinnert uns das sehr an die Fernsehnachrichten über die RAF.
Auf die Idee, dass ein Sexualverbrechen vorliegen könnte, kommen wir Kinder nicht. Solche Gedanken sind uns fremd. Unseren Eltern natürlich nicht. »Lasst euch nicht ansprechen! – Geht nicht mit fremden Leuten mit! – Du bist abends pünktlich zurück!« Die ganzen Sprüche. Und meine genervte Versicherung: »Ja, Mama. Nein, Mama ...« Mama achtet jetzt peinlichst darauf, dass ich bei Einbruch der Dunkelheit zu Hause bin. Bei Klaus muss sie das nicht. Der sitzt ja meistens in unserem Zimmer über seine Elektrobauteile gebeugt. Ich bin ständig draußen unterwegs und schaffe es nicht immer, rechtzeitig zu Hause zu sein. Mama steht dann rauchend auf dem Balkon und späht in die Dämmerung. Mir erscheint ihre Angst sehr übertrieben. Als ob plötzlich zwischen den Mülltonnen der böse Kindermörder rausspringt. Ja, vielleicht führt unser Hausmeister Bruckschlegel ein bizarres Doppelleben. Und Maxi ist nicht sein erstes Opfer. Solche Serienmörder-Geschichten stehen in einem meiner Lieblingsbücher, einem Sammelband mit Mordgeschichten aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Da gibt es auch einen Typen, der seine Opfer nach dem Erwürgen in die Badewanne legt und Säure draufgießt. Ist es Maxi so ergangen? Hat er sich zischend aufgelöst und ist durch den Ausfluss weggegurgelt? Nur sein Fahrrad kann die Polizei noch auf die richtige Fährte bringen ...
Die Polizei findet schließlich jemanden, der Maxi auch noch gesehen hat, einen Mann im Neubauviertel, der mit seiner Familie gerade erst aus dem Sommerurlaub zurückgekehrt ist und von der Suchaktion erfahren hat. Maxi ist ihm bei unserer Verfolgungsjagd mit dem Rad in die Beifahrertür gerauscht und einfach abgehauen. Der Mann hat Maxi auf dem Foto in der Zeitung erkannt. Abgehauen! Ein ganz neuer Gedanke: Vielleicht hat Maxi das gemacht, wozu wir ihn so oft aufgefordert haben? »Mensch, Maxi, jetzt hau doch endlich ab!« Hat er es wegen der zerbeulten Autotür mit der Angst bekommen? Ist er deshalb verschwunden? Aber wohin? Und warum so lange? Nein, das kann nicht sein. Wo steckt Maxi? Langsam geht uns die Phantasie aus. Natürlich überlegen wir, ob Maxi tot ist, ob er vom Radweg abgekommen und die Böschung runter in die Donau gefahren ist. Aber wenn so was passiert, dann findet man den Verunglückten doch irgendwo an der Böschung flussabwärts oder im Rechen eines Stauwehrs, oder? Wir haben keine Idee, wo Maxi sein könnte.
So sehr uns Kinder der Tod theoretisch fasziniert, so wenig kann ich damit umgehen, wenn tatsächlich etwas Schlimmes passiert. Der Krebstod von Michaels Mutter in der Wohnung unter uns war für mich noch ziemlich abstrakt, nicht greifbar, an ihrem Tod waren irgendwelche Zellen schuld, die langsam im Verborgenen wuchsen. Aber schon das hat mich so verunsichert, dass ich Michael nicht mehr zu Hause besuchen wollte. Richtig kalt hat es mich erwischt, als Elisabeth überfahren wurde. Elisabeth war die Schwester von Karla, mit der ich jeden Tag in die Schule gehe, bei deren Mutter wir unter der Woche essen, seit Mama wieder studiert. Es passierte an einem Mittwoch, an dem Mama keine Uni hatte und es zu Hause Mittagessen gab. Es war der erste richtig warme Tag in jenem Jahr. Ich hatte nur ein T-Shirt an und sah vom Balkon aus über das wogende, grüne Ährenfeld zum Bunkerberg, wo ich nachmittags mit Elmar verabredet war. In der Ferne heulten Martinshörner. Eigentlich nichts Besonderes, befindet sich jenseits des Felds doch das Krankenhaus Barmherzige Brüder. Aber die Sirenen hörten gar nicht mehr auf. Mama trat zu mir auf den Balkon und sah sorgenvoll übers Feld in Richtung Krankenhaus. »Da kommt Klaus«, sagte ich leichthin und deutete in den Hof. Mama entspannte sich jedoch nicht und lauschte weiter angestrengt. Immer noch heulten die Sirenen. Mama ging ins Arbeitszimmer, um ihre Freundin anzurufen. Karlas Mama.