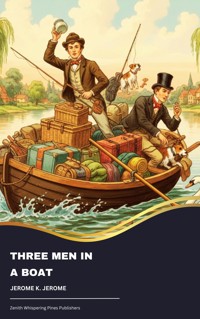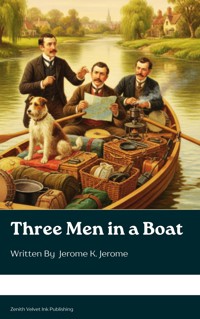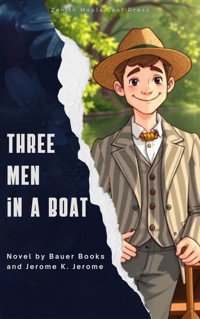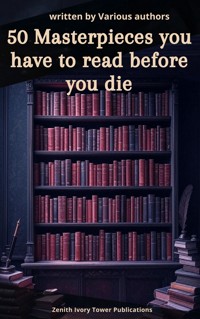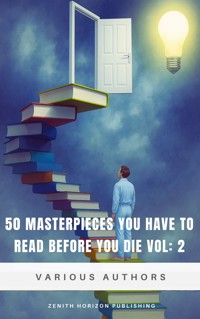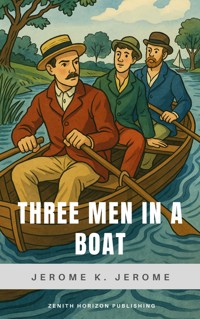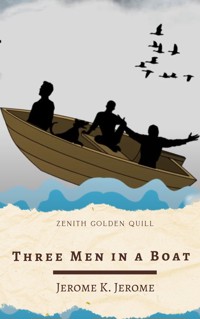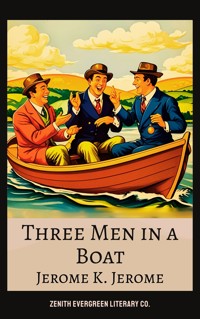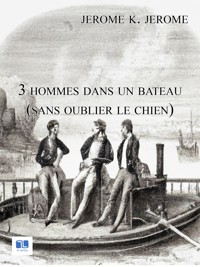0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit 55 Illustrationen von A. Frederics »Ich mag Arbeit sehr: sie fasziniert mich. Ich kann stundenlang dabeisitzen und zuschauen.« »Drei Männer im Boot (ganz zu schweigen vom Hund)« (Originaltitel: »Three Men in a Boat«), erschienen 1889, ist eine humorvolle Erzählung von Jerome K. Jerome über einen Bootsausflug auf der Themse zwischen Kingston und Oxford. Das Buch war ursprünglich als ernsthafter Reiseführer, mit Erzählungen über die Geschichte von Plätzen entlang der Strecke, geplant, doch die humoristischen Schilderungen gewannen letztlich die Oberhand. Die drei Männer basieren auf Jerome selbst und zwei seiner Freunde (George und Harris). Der Hund Montmorency ist eine reine Erfindung, hat jedoch - wie Jerome anmerkte - »viel mit mir gemeinsam«. Die Erzählung lieferte war Grundlage für den gleichnamigen deutschen Spielfilm von 1961 mit Hans-Joachim Kulenkampff, Heinz Erhardt und Walter Giller. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Jerome K. Jerome
Drei Mann in einem Boot
(ganz zu schweigen vom Hund)
Jerome K. Jerome
Drei Mann in einem Boot
(ganz zu schweigen vom Hund)
(Three men in a boat)Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]: A. Frederics 3. Auflage, ISBN 978-3-943466-64-5
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Einleitung
Wenn man den Lesern einen Schriftsteller förmlich vorstellt, so wollen sie allemal ganz genau wissen, wen sie vor sich haben; namentlich, wenn’s ein Ausländer ist. Da wäre denn zunächst zu verzeichnen, dass Jerome Klapka Jerome am 2. Mai 1859 in Walsall geboren ist, einer richtigen englischen Fabrikstadt, und zwar in einem Pfarrhause. Das ist schon sehr absonderlich für einen Humoristen. Rauchende Fabrikschlote und Frömmigkeit von Berufs wegen sind eigentlich nicht die Umgebung, die der Entwicklung von Humor förderlich sind. Ohne Zweifel hat der junge Jerome weder für das eine noch für das andere viel Neigung verspürt. Denn er begann, beizeiten seinen Beruf zu verfehlen. Kaum aus der Schule heraus, war er Angestellter in einem Geschäft. Darauf versuchte er sich als Schulmeister. Danach wurde er Schauspieler und Journalist, um dann endlich den Sprung zur Literatur zu wagen. Mit 27 Jahren veröffentlichte er sein erstes Buch, das nicht viel Beachtung fand. Das ging noch einigen anderen Büchern so. Erst sein Buch: »On the stage and off« (Auf der Bühne und außerhalb) aus dem Jahre 1888, worin er seine Bühnenerfahrungen verwertete, trug ihm einigen Erfolg ein. Ihm folgte im Jahre darauf mit steigendem Erfolg ›Idle thoughts of an idle fellow‹ (Müßige Gedanken eines müßigen Menschen) und im Jahre 1889 ›Three men in a boat‹, das der erste ›Schlager‹ war; um ein Lieblingswort aus dem Bühnen-Deutsch zu gebrauchen. In den neunziger Jahren entfaltete er zugleich eine außerordentlich rege Redaktionstätigkeit an den bekannten Blättern ›The Idler‹ und ›To-day‹. Nach dem großen Erfolg von ›Three men in a boat‹ sprudelte sein literarischer Quell mit erstaunlicher Ergiebigkeit. Buch auf Buch folgte, ohne dass eins davon den Erfolg des vorliegenden Buches zu erreichen vermochte. Viel gelesen wurde noch eine Art Seitenstück zu ›Three men in a boat‹, das den Titel führt ›Three men on a bummel‹. Jerome schildert hierin eine lustige Fahrt durch Deutschland und hat dafür das deutsche Wort ›Bummel‹ in die englische Sprache aufgenommen, um die sorglos-gemütlich genießende Art des Reisens zu kennzeichnen.
In den letzten Jahren hat sich Jerome auch der Bühne zugewandt. Auch hier ist ihm ein großer Erfolg beschieden gewesen, und zwar, seltsam genug, mit einem ernsten Stück, das den Titel ›The passing of the third floor back‹ führt; entstanden ist es im Jahre 1907. Es schildert die Wandlung und Besserung einer Anzahl von moralisch wertlosen Menschen, die ein Pensionat im dritten Stockwerk eines Hauses nach hinten heraus bewohnen. Ihre geistige Wandlung vollzieht sich durch den Einfluss eines fremden Gastes von hoher sittlicher Kraft, der zuletzt Christuszüge erhält und als Christus aufgefasst werden kann.
Die meisten Leute sind sehr erstaunt, wenn ein Humorist auch mal ein ernstes Gesicht macht. Allzu viele verbinden mit dem Begriff Humorist gern den Begriff Clown oder Spaßmacher um jeden Preis. Aber sie vergessen, dass der echte Humor doch schließlich aus dem Gemüt wächst und dass man als das Merkmal des echten Humoristen die Gabe betrachtet, unter Tränen lachen zu können. Ich erinnere daran, welche feinen, weichen und erschütternden Herzenstöne einem Reuter und einem Dickens zu Gebote standen – zwei so echte und große Humoristen, wie sie die Welt je gesehen hat. Es scheint sogar, dass der Humorist ein geradezu unwiderstehliches Verlangen hat, gelegentlich ganz ernsthaft zu sein, wie wenn er zeitweilig seiner selbst überdrüssig wäre. Immer ernsthaft zu sein ist jedenfalls leichter, als immer scherzhaft zu sein. Der immer Ernsthafte mag manchmal langweilig wirken, der immer Scherzhafte wird aber sicher oft unausstehlich werden. Das hat wohl auch Jerome gefühlt. Er hat ernsthafte Geschichten geschrieben, die mit zu dem Allerbesten in ihrer Gattung gehören, die aber nur von den Kennern geschätzt werden. Die große Masse geht an ihnen vorüber, weil Jerome nun einmal als Humorist abgestempelt ist. Das ist die Tragik des Humoristen. In diesen Schöpfungen gehören die Geschichte von »Paul Kelver« sowie die drei Geschichten »John Ingerfield«, »The Woman of the Saeter« und »Silhouettes« in dem Buche »John Ingerfield and other stories«. Jerome selber hat diese Tragik des Humoristen oft genug zu kosten bekommen und macht daher den Leser in einem Vorwort zu einem Neudruck des letztgenannten Buches eigens darauf aufmerksam, dass die drei erwähnten Geschichten nicht humoristisch seien. Er erzählt dabei, wie er einmal eine ernste Geschichte von einer Frau geschrieben habe, die von einer Riesenschlange zermalmt wurde. Am Tage nach der Veröffentlichung traf er einen Freund, der zu ihm sagte: »Reizende kleine Geschichte – die von der Frau und der Riesenschlange; aber sie ist nicht so komisch wie Ihre anderen Geschichten!« So geht’s einem Schriftsteller, der in dem Geruch steht, humoristisch zu sein. Mark Twain wollte einmal in einer Mädchenschule ein ernstes Gedicht vorlesen, musste aber damit aufhören, weil die Mädchen nicht aus dem Lachen herauskamen. Und gerade bei den unschuldigen Kindern hatte er geglaubt auf, Verständnis rechnen zu können. Ich selbst erinnere mich einer Beerdigung, wo die Leidtragenden in die peinlichste Verlegenheit gerieten, weil ein bekannter Humorist eine Grabrede hielt, die bei ihm wie das Gegenteil wirkte.
Wenn einer den Namen Jerome ausspricht, so wird er sicherlich sofort zu hören bekommen: »Ach – der Verfasser von ›Drei Mann in einem Boot‹! Kenne ich! Ganz famos!« Und wirklich – dieses Buch ist es, das Jeromes Namen zu einem Weltnamen gemacht hat. Es gehört zu den meistgelesenen Büchern der Weltliteratur. Auf den ersten Blick erscheint das nicht leicht verständlich. Ein an sich harmloseres – oder ich will sagen unschuldigeres – Buch ist nie geschrieben worden. Was ist sein Inhalt? Ja, das eben ist die größte Schwierigkeit: der Inhalt! Genau genommen hat es gar keinen. Jerome selber sowie seine Freunde George und Harris fassen eines Tages den Entschluss, ein Boot zu mieten und mit dem Hund, der auf den lachhaft pompösen Namen Montmorency hört, einen vierzehntägigen Ausflug die Themse hinauf zu machen, weil sie eine Erholung bitter nötig hatten. Sie führen den Entschluss aus und kehren nach einiger Zeit wieder nach London zurück. Das ist der ganze Inhalt! Ist etwas Dürftigeres denkbar? Aber nach dem Inhalt darf man nicht fragen. Nicht das Was, sondern das Wie ist hier die Hauptsache. Der Reiz des Buches liegt in den drolligen Abenteuern, die die drei während ihrer Fahrt erleben, und in dem Humor, mit dem diese Abenteuer geschildert werden. Man wird gelegentlich etwas an den seligen Stinde und seine Familie Buchholz erinnert oder an die Humoresken von Busch; manchmal wieder leuchtet Dickensscher oder Reuterscher Humor auf – von jener Art, die in einem leisen schalkhaften Lächeln um die Mundwinkel herum oder in einem spitzbübischen Augenzwinkern so viel auszudrücken weiß. Doch das muss jeder selber lesen. Zwischendurch ziehen sich zahllose heitere Anekdoten, von denen Jerome ein unendliches Lager besitzt. Auch Mark Twain war bekanntlich ein glänzender Anekdoten-Erzähler. Aber Jerome will zugleich belehren. Daher versäumt er nicht, wo immer sie in ihrem Boot an historischen Stätten vorüberkommen, Vorgänge von Wichtigkeit aus der englischen Geschichte in Erinnerung zu bringen – freilich immer in seiner besonderen drolligen Weise, nicht lehrhaft trocken. So ergibt sich alles in allem ein Buch von ganz eigenem Charakter: ein liebliches Sommeridyll, farbig und fesselnd und von echt englischem gemütlichen Humor verklärt.
Von Humoristen heißt es gewöhnlich, sie seien auch persönlich die angenehmsten Leute – was ernstere Schriftsteller nicht immer sind; manche von diesen nehmen sich allzu ernst. Auf Jerome trifft diese Ansicht sicherlich zu. Jeder, der ihn einmal persönlich kennengelernt hat, schildert ihn als einen »famosen Kerl« – oder wie der Engländer sagt: »a jolly good fellow«. Er wohnt in einem romantischen alten Haus in Wallingford an der Themse, mit Frau und zwei Töchtern; eine davon ist adoptiert. Es ist das denkbar glücklichste Familienleben, von jener ungezwungenen herzlichen Natürlichkeit des Verkehrs, wie sie so oft in guten amerikanischen Familien zu finden ist. Und diese Gastlichkeit! Im Sommer zumal sind oft ein halbes Dutzend Kameraden von der Feder bei ihm zu Gast und essen, trinken und dichten in seinem Hause, wie wenn es ihr eigenes wäre. Immer ist er der liebenswürdigste Mensch, dessen Augen in einem sonnigen Lächeln erstrahlen, wenn man mit ihm spricht. Seine ganze Persönlichkeit ist Gesundheit – außen und innen; außen kenntlich durch die frische Farbe des wohlwollenden, glatten Schauspielergesichts, innen durch die Fröhlichkeit und Natürlichkeit seiner Lebensanschauungen. Jerome, der Mensch, und Jerome, der Schriftsteller, sind ein harmonisches Ganzes: ein Optimist, ein heiterer Lebensbejaher ohne Schminke, ohne Pose.
Henry F. Urban
Kapitel 1
Wir waren unsrer viere – Georg William, Samuel Harris, meine Wenigkeit und Montmorency – und saßen zusammen in meiner Wohnung, rauchten Zigarren und Pfeifen, und unterhielten uns von der Verderbtheit unserer Naturen – Verderbtheit in gesundheitlicher Beziehung meine ich natürlich.
Wir fühlten uns allesamt mit Übeln behaftet, was uns entschieden in eine nervöse Aufregung versetzte. Harris sagte, er bekomme öfters solche außerordentliche Schwindelanfälle, dass er kaum mehr wisse, wo ihm der Kopf stehe; dann sagte Georg, auch er habe Schwindelanfälle, dass er kaum mehr wisse, wo ihm der Kopf stehe. Bei mir war es die Leber, die nicht in Ordnung war. Ich war sicher, dass meine Leber nicht in Ordnung wäre, da ich gerade vorher ein Zirkular1 über patentierte Leberpillen gelesen hatte, worin die verschiedenen Symptome ganz genau angegeben waren, an denen man ganz sicher erkennen konnte, ob die Leber in Ordnung sei oder nicht. Alle diese Symptome zeigten sich bei mir.
Es ist wirklich äußerst merkwürdig, dass ich niemals die Ankündigung irgendeines patentierten ärztlichen Mittels habe lesen können, ohne sofort zu der Überzeugung zu gelangen, ich leide in hohem Grade an dem besonderen Übel, wofür in dem angekündigten Mittel die Heilung angeboten wurde. Die Diagnose scheint in jedem Fall mit meinen spezifischen Empfindungen übereinzustimmen. Ich erinnere mich, dass ich eines Tages ins Britische Museum gegangen war, um dort die Behandlung eines leichten Übels – ich glaube, es war Heuschnupfen – nachzulesen. Ich holte mir das betreffende Buch herunter und las alles, was darüber zu lesen war; dann wandte ich gedankenlos und nachlässig das Blatt um und begann gleichgültig andere Krankheiten zu studieren. Ich habe vergessen, welche Krankheit mir zuerst aufstieß; ich weiß nur noch, dass es eine fürchterliche, pestartige Krankheit war; und ehe ich auch nur die Hälfte der allgemeinen Kennzeichen gelesen hatte, war ich schon überzeugt, dass ich davon befallen sei. Ich saß eine Weile völlig erstarrt vor Schrecken; dann las ich in stiller Verzweiflung die folgenden Seiten. Ich kam zum Typhus, las seine Merkmale, und nahm sofort wahr, dass ich das Nervenfieber habe, dass ich es bereits seit Monden haben müsse, ohne eine Ahnung davon gehabt zu haben. Ich war nun in der Tat neugierig, was mir wohl sonst noch fehlen möchte; so kam ich zum Veitstanz; wie ich nicht anders erwartet hatte, hatte ich den auch. Jetzt interessierte mich mein ganz eigentümlicher Fall, und ich beschloss nun, ihn bis auf den Grund zu untersuchen. So nahm ich denn die verschiedenen Krankheiten in alphabetischer Reihenfolge durch und fand, bei A anfangend, Agne (kaltes Fieber) und machte die Bemerkung, dass ich auch daran leide, und dass die Krisis in etwa 14 Tagen eintreten werde. Die Brightsche Krankheit hatte ich, zu meiner großen Erleichterung, nur in schwachem Grade, und in Betreff dieser hätte ich noch manches Jahr leben können. Cholera dagegen hatte ich schon mit ernsteren Komplikationen, und Diphtheritis war mir, wie es schien, angeboren. Gewissenhaft drang ich bis ans Ende der 26 Buchstaben, und die einzige Krankheit, von welcher ich annehmen konnte, verschont zu sein, war Kindbettfieber.
Darüber war ich nun anfangs etwas verletzt; es schien mir dies eine Vernachlässigung! Warum hatte ich nicht auch Kindbettfieber? Nach einer Weile jedoch überkamen mich weniger streitbare Gefühle! In Erwägung, dass ich doch jede andere bekannte Krankheit hatte, wurde ich weniger selbstsüchtig in Betreff des Kindbettfiebers und beschloss, darauf zu verzichten! Die Gicht auch, in ihrem bösartigsten Auftreten, hatte mich unbewusst in Beschlag genommen, und an Zymosis2 hatte ich seit meiner Knabenzeit gelitten!
Da nach Zymosis keine weiteren Krankheiten mehr angeführt waren, so schloss ich daraus, dass ich nun auch mit keiner weiteren behaftet sei.
So saß ich denn eine gute Weile und dachte nach. Ich fand, was für ein interessanter Fall ich in ärztlicher Hinsicht jedenfalls sein müsse und welch eine Akquisition ich z. B. für die Untersuchung in einer Klinik abgeben würde. Die Studenten würden nun nicht mehr nötig haben, zu ihrer Belehrung von einem Spital in das andere zu laufen, wenn sie mich hatten. Ich war ein ganzes Spital – ich ganz allein. Alles, was sie fernerhin zu tun haben würden, wäre, mich anzusehen und nachher ihr Examen zu machen.
Dann interessierte es mich, zu erfahren, wie lange ich überhaupt noch zu leben haben würde. Ich fühlte meinen Puls – zuerst konnte ich gar keinen Puls bei mir finden. Dann schien er plötzlich mit Schlagen anzufangen. Ich zog meine Uhr heraus und zählte. Er machte 147 Schläge in der Minute! Dann wollte ich den Herzschlag prüfen; ich fand mein Herz nicht! Es hatte aufgehört zu schlagen! Ich bin seither zu der Ansicht gekommen, dass ich damals doch wohl ein Herz besessen haben muss, welches schlug – aber ich kann nicht dafür einstehen. Ich befühlte meine ganze Vorderseite von dem Teil an, den man züchtig »Taille« nennt, bis zum Kopf, strich an den Seiten und außerdem ein Stück den Rücken hinauf, aber ich konnte nichts von einem Herzen weder fühlen noch hören. Dann versuchte ich, meine Zunge zu besehen, streckte sie heraus, soweit ich konnte, und machte, um schärfer zu sehen, ein Auge zu. Ich konnte nur die Spitze sehen, und das Einzige, was ich aus dieser Untersuchung mit Gewissheit schöpfte, war, dass ich das Scharlachfieber hatte.
Als gesunder, glücklicher Mann hatte ich dieses Lesezimmer betreten, als ein elender, gebrochener Patient kam ich wieder heraus.
Ich beschloss, zu meinem Arzt zu gehen. Er ist ein alter Kamerad von mir; er pflegt mir den Puls zu fühlen, die Zunge zu besehen und mit mir vom Wetter und anderen Allotrias zu sprechen, wenn ich zu ihm komme und meiner Einbildung nach krank bin, und das alles ganz umsonst.
So dachte ich denn: diesmal, Alter, will ich dir auch einen Gefallen tun und dich heimsuchen. Was ein Arzt braucht, sagte ich mir, das ist Schulung. Er soll mich haben. An mir allein wird er so viel Erfahrungen machen können wie an siebzehnhundert gewöhnlichen Patienten, die nur eine oder höchstens zwei Krankheiten haben.
So ging ich denn geradenwegs zu ihm. Als er mich sah, fragte er: »Nun, was fehlt dir diesmal?« worauf ich ihm erwiderte: »O, ich will dir deine Zeit nicht stehlen, alter Junge, mit Aufzählung all der Übel, mit denen ich behaftet bin. Das Leben ist kurz, und du könntest sterben, ehe ich mit der Aufzählung zu Ende wäre. Aber ich will dir sagen, was ich nicht habe! Das Kindbettfieber habe ich nicht! Warum ich diese Krankheit nicht bekommen habe, das kann ich dir nicht sagen – aber es ist nun einmal Tatsache, dass ich sie nicht habe, nie gehabt habe. Aber jede andere Krankheit habe ich.«
Dann erzählte ich ihm, wie ich zu der Entdeckung gelangt sei.
Da hieß er mich den Mund öffnen und sah mir in den Hals hinab; dann packte er mich beim Handgelenk und schlug mir auf die Brust, als ich es am allerwenigsten erwartete – eine recht feige, hinterlistige Art nenne ich das einem Todkranken gegenüber –, dann stieß er seinen Kopf gegen meine Rippen. Hierauf setzte er sich nieder und schrieb mir ein Rezept auf, faltete es zusammen und gab es mir. Ich steckte es in die Tasche und ging fort.
Ohne es anzusehen, ging ich damit zu dem nächsten Apotheker. Der Mann las es, dann gab er es mir zurück und sagte, er könne das nicht machen.
Ich fragte ihn: »Sind Sie Apotheker?« Er sagte darauf: »Ja, ich bin Apotheker. Wenn ich eine Restauration, verbunden mit Familienpension, hätte, so könnte ich Ihnen vielleicht dienen. Da ich nur Apotheker bin, so ist es mir unmöglich!«
Ich las nun das Rezept. Es lautete:
»1 Pfund Beefsteak mit ½ Liter Bier, alle sechs Stunden. Ein Spaziergang von 4 Stunden jeden Morgen; Schlafengehen präzis 11 Uhr jede Nacht; Und stopfe deinen Kopf nicht mit Sachen voll, die du nicht verstehst.«
Ich befolgte diese Vorschriften, und das Ergebnis war, dass ich damals vom sicheren Tod errettet wurde und bis auf den heutigen Tag am Leben bin.
Im gegenwärtigen Falle aber – um wieder auf die patentierten Leberpillen zurückzukommen – hatte ich wirklich die Symptome ohne alle Frage; das Hauptsächlichste darunter war »eine allgemeine Abneigung gegen irgendwelche Art Tätigkeit«.
Was ich in dieser Hinsicht leide, kann keine Zunge aussprechen. Von meiner frühesten Kindheit an habe ich darin ein wirkliches Martyrium ausgestanden. Während meiner Knabenjahre verließ mich das Übel kaum einen Tag. Man wusste damals nicht, dass ich an der Leber litt. Die ärztliche Wissenschaft war damals noch nicht so weit vorgeschritten wie heutzutage; daher nannte man mein Übel einfach »Faulheit«! »Verfluchter Bengel!«, pflegte man mir zu sagen, »steh’ auf und tue etwas für deinen Lebensunterhalt! Marsch, vorwärts!« – Man wusste eben nicht, dass ich krank war!
Und man gab mir keine Pillen – nein, man gab mir eins an den Kopf. Und, so seltsam dies erscheinen mag, diese Ohrfeigen kurierten mich oft wunderbar schnell, wenigstens für eine Zeit lang. Ich erinnere mich, dass damals eine einzige solche Ohrfeige eine größere Wirkung auf mein Leben ausübte – denn ich raffte mich in der Regel rasch auf, um sofort zu tun, was man von mir begehrte – als heutzutage eine ganze Schachtel voll Pillen. Man weiß ja – es geht oft so – diese altväterlichen Hausmittel sind manchmal viel wirksamer als der ganze Apothekerkram.
So saßen wir noch eine weitere halbe Stunde beisammen und beschrieben uns gegenseitig unsere Krankheiten. Ich setzte Georg und William Harris auseinander, wie mir zumute sei, wenn ich morgens aufstehe, und William Harris erzählte uns, wie es ihm beim Zubettgehen zumute sei – und Georg stand am Ofen und gab uns eine köstliche Vorstellung zum Besten, durch die uns recht anschaulich vergegenwärtigt wurde, wie er sich während der Nacht befinde.
Georg bildete sich nämlich ein, er sei auch krank; aber ich versichere, es ist absolut nichts daran.
In diesem Augenblick klopfte Frau Poppets an unsere Tür mit der Frage, ob es uns beliebe, zu Nacht zu speisen. Wir lächelten einander traurig an und erwiderten, es wäre vielleicht doch besser, wenn wir versuchten, einen Bissen hinunterzuwürgen. Harris namentlich meinte, etwas Nahrung im Magen halte manchmal die Krankheit im Schach. So brachte denn Frau Poppets das Essen herein; wir gingen zu Tisch und schnipselten uns etwas Beefsteak mit Zwiebeln und etwas Rhabarbertorte ab.
Ich muss damals wirklich recht schwach gewesen sein, denn ich erinnere mich, dass ich nach Verlauf einer halben Stunde durchaus kein Interesse mehr an dem Essen hatte, was bei mir etwas ganz Ungewöhnliches ist, und dass es mich auch nicht nach Käse verlangte.
Nachdem wir diese Pflicht erledigt, füllten wir unsere Gläser aufs Neue, zündeten die Pfeifen wieder an und versenkten uns nochmals in die Erörterung unseres Gesundheitszustandes. Was uns eigentlich fehlte, darüber war keiner von uns im Klaren, nur darüber waren wir einer Meinung, dass, wie unsere Krankheit auch heißen möge, die Ursache unfehlbar Überanstrengung sei.
»Was uns fehlt, ist Ruhe«, sagte Harris.
»Ja, Ruhe! Und vollständig veränderte Lebensweise«, meinte Georg; »die Überanstrengung unseres Gehirns hat eine allgemeine Erschlaffung des ganzen Nervensystems hervorgebracht. So wird denn ein Wechsel der Umgebung und die gänzliche Enthaltung von jeder Gedankenarbeit auch das geistige Gleichgewicht in uns wieder herstellen.«
Georg hat einen Vetter, der Medizin studiert; dadurch hat seine Ausdrucksweise etwas von hausärztlichem Stil angenommen.
Indessen stimmte ich Georg zu und beantragte demzufolge, wir sollten uns irgendwo einen verlorenen und weltverlassenen Ort aussuchen, fern von der verrückten und tollmachenden Welt, und in dessen, von einschläferndem Duft erfüllten Gefilden eine sonnige Woche lang hinträumen – an so einen halb vergessenen, von den Feen bewachten Winkel außerhalb des Bereichs der geschäftigen Menschheit – irgendein von den Klippen der Zeit hoch oben herabschauendes Adlernest, wo man nur aus weiter Ferne das schwache Anschlagen der Wogen des neunzehnten Jahrhunderts zu vernehmen bekäme.
Harris meinte, das würde kolossal dumm sein. Er sagte, er könne sich lebhaft vorstellen, was für ein langweiliges Quartier mir im Sinne liege, eines, wo jedermann um 8 Uhr abends zu Bette gehe, eines, wo man weder für Geld noch gute Worte einen Schiedsrichter für seine Boxkämpfe auftreiben könne, und wo man erst vier Stunden weit zu laufen habe, wenn man sich ein bisschen Tabak für seine Pfeife holen wolle.
»Nein«, sagte Harris, »wenn ihr Veränderung und Ruhe nötig habt, so könnt ihr nichts Besseres tun, als eine kleine Seereise machen.« Gegen die Seereise verwahrte ich mich nun aber ernstlich. Eine Seereise tut einem gut, wenn man ein paar Monate darauf verwenden kann; aber eine Reise von einer Woche, das ist etwas Heimtückisches! Da reist man am Montag mit der festen Überzeugung ab, dass man sich nun köstlich amüsieren werde. Man winkt den Jungens am Ufer noch ein fröhliches Adieu zu, zündet dann seine größte Tabakspfeife an und stolziert auf dem Deck herum, als wäre man ein Kapitän Cook, Sir Francis Drake und Christoph Kolumbus in einer Person. Am Dienstag wünscht man bereits, lieber nicht an Bord zu sein. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag möchte man am liebsten tot sein. Am Samstag endlich fühlt man sich imstande, ein wenig Fleischbrühe hinunterzuschlürfen, auf dem Deck zu sitzen und mit einem schwachen, süßen Lächeln zu antworten, wenn gutherzige Leute einen fragen, wie es jetzt gehe. Am Sonntag fängt man an, wieder auf dem Deck umherzugehen und feste Nahrung zu sich zu nehmen, und am Montag, wenn man mit Handkoffer und Regenschirm bewaffnet auf dem Hinterdeck steht, im Begriff, das Schiff zu verlassen, ist man mit dem Leben auf Deck gerade ganz ausgesöhnt.
Ich erinnere mich, wie mein Schwager einst zur Stärkung seiner Gesundheit eine kleine Seereise machte. Er nahm ein Retourbillett von London nach Liverpool. Als er in Liverpool angekommen war, hatte er nichts Eiligeres zu tun, als sein Retourbillett zu verkaufen.
Er bot es in der ganzen Stadt zu einem schändlich niedrigen Preise an – so erzählte er mir –, zuletzt wurde es für 1,50 M. von einem gelbsüchtigen Jüngling erworben, dem sein Arzt etwas Bewegung und Seeluft verordnet hatte.
»Seeluft!«, sagte mein Schwager, indem er ihm das Billett freundlich liebevoll in die Hand drückte, »O, Sie werden Ihr ganzes späteres Leben davon zehren können. – Und was Bewegung anbelangt, so werden Sie sich mehr verschaffen können, wenn Sie sich auf diesem Schiffe niedersetzen, als wenn Sie auf dem Lande Purzelbäume schlügen.«
Er selbst – mein Schwager nämlich – kam mit der Eisenbahn zurück. Er meinte, die Nordwestbahn sei gesünder für ihn.
Ein anderer Bekannter von mir machte ebenfalls eine Reise von einer Woche längs der Küste. Beim Beginn fragte ihn der Kellner, ob er für jede Mahlzeit besonders bezahlen wolle, oder ob er die Pension für die ganze Woche im Voraus zu zahlen gedenke.
Der Kellner empfahl ihm den letzteren Modus, da es auf diese Weise viel billiger komme. Er könnte ihm dann für die ganze Woche den Preis auf 45 M. herabsetzen. Zum Frühstück, sagte er, gebe es Fische nebst etwas Braten. Um ein Uhr sei das Gabelfrühstück, das aus vier Gängen bestehe. Die Hauptmahlzeit, um sechs Uhr, bestehe aus Suppe, Fisch, Zwischengang, Braten mit Zuspeise, Geflügel, Salat, süßer Speise, Käse und Dessert. Dann folge noch ein leichtes Abendessen mit Fleisch um zehn Uhr.
Mein Freund dachte, unter solchen Umständen sei es weise, auf die 45 M. Pension einzugehen. Denn er ist ein tüchtiger Esser – und so geschah’s. Als man Sheerneß passiert hatte, war es gerade zum Gabelfrühstück, aber der Hunger wollte sich nicht wie sonst einstellen, somit begnügte er sich mit einem Bissen Rindfleisch und etwas Stachelbeeren mit Schlagsahne. Während des Nachmittags bewegten ihn allerlei schwere Gedanken, und auf einmal dünkte es ihn, als ob er seit Wochen nichts als Rindfleisch gegessen hätte, und ein anderes Mal schien es ihm, er habe seit Jahren von Stachelbeeren und Schlagsahne gelebt.
Weder das Rindfleisch, noch die Stachelbeeren, noch die Schlagsahne schienen in glücklicher Eintracht in seinem Magen zu hausen; es schien eher, dass sie Händel miteinander angefangen hätten.
Um 6 Uhr wurde zum Diner angerufen. Diese Ankündigung fand keinen freudigen Widerhall in seiner Seele; aber er fand, dass er denn doch für seine 45 M. etwas haben müsse, hielt sich am Seil und Geländer und stieg hinab. Ein angenehmer Geruch von Zwiebeln und heißem Schinken strömte ihm entgegen, gemischt mit dem Duft gebratener Fische und frischer Gemüse; als er endlich unten angekommen war, kam das glatte Gesicht des Aufwärters heran, der ihn mit maliziösem Lächeln fragte: »Was darf ich Ihnen bringen, mein Herr?«
»Mich von hier fortbringen«, war die schwach gehauchte Antwort.
Man schob ihn so schnell als möglich die Treppe hinauf, brachte ihn an die Leeseite, lehnte ihn über Bord und überließ ihn dort seinem Schicksal.
Während der nächsten vier Tage führte er ein einfaches und sündloses Leben und nährte sich von dünnem Kapitänszwieback – d. h. der Zwieback war dünn, nicht der Kapitän – und Sodawasser; aber gegen Sonnabend rappelte er sich wieder zusammen und ließ sich schwachen Tee und unbestrichene Brotschnitten geben, und am Montag schluckte er mit Ach und Krach etwas Hühnerbrühe. – Am Dienstag verließ er das Schiff. Als es wieder in See stach, konnte er sich eines bedauernden Nachblickes nicht enthalten.
»Da segelt es nun fort«, sagte er, »mit einer Masse Lebensmittel an Bord, die ich nicht genossen habe und die doch von Rechts wegen mir gehören!«
Er meinte, wenn sie ihn nur noch einen Tag länger an Bord behalten hätten, so würde er es schon ausgeglichen haben.
Aus diesen Gründen wollte ich also von einer Seereise nichts wissen. Nicht meinetwegen, wie ich den Freunden auseinandersetzte. Ich bin noch nie seekrank geworden. Aber ich war besorgt um Georg. Der behauptete zwar, er könnte die Seereise herrlich vertragen; aber er möchte mir und Harris doch raten, den Gedanken daran aufzugeben, da er ganz gewiss wisse, dass wir beide seekrank würden. Harris seinerseits meinte, für ihn sei es immer ein Rätsel, wie es die Leute anfingen, seekrank zu werden; er meinte, man müsse es wirklich absichtlich tun, aus Ziererei, um sich interessant zu machen, und fügte noch hinzu, er habe oft gewünscht, einmal seekrank zu werden, sei aber nie dazu imstande gewesen.
Dann erzählte er uns allerlei Geschichten, wie er einmal über den Kanal gefahren sei, während eines so heftigen Sturmes, dass man die Passagiere in ihren Schiffsbetten habe festbinden müssen: Er und der Kapitän seien die zwei einzigen Seelen an Bord gewesen, die nicht seekrank geworden seien.
Ein andermal sei nur er und der zweite Steuermann nicht krank geworden; immer war eben er und »noch einer«, oder aber er allein nicht seekrank.
Es ist merkwürdig, aber tatsächlich wahr, dass niemals einer seekrank gewesen sein will, wenn er am Lande ist. Zur See begegnen euch Leute genug, die in der Tat sehr übel auf sind – ja ganze Bootsladungen voll sieht man da –, aber am Lande habe ich noch niemals einen getroffen, der wusste, was es heißt, seekrank zu sein. Wo sich die tausend und aber tausende von Menschen, die an Bord sofort seekrank werden – und jedes Schiff ist ganz voll von ihnen –, auf dem Lande verbergen, ist wenigstens für mich ein Geheimnis.
Wenn viele Leute einem gewissen Menschen glichen, den ich einmal auf einem Yarmouthboot sah, so könnte ich das anscheinende Rätsel leicht genug lösen. Das Schiff war, wie ich mich erinnere, eben von der Landungsbrücke bei Southend abgestoßen; da lehnte sich der Mann in einer sehr gefährlichen Weise über eine der Schiebepforten hinaus. Ich ging zu ihm hin, um ihn zu retten. »He! Kommen Sie weiter herein«, sagte ich zu ihm und ergriff ihn an der Schulter, »oder Sie fallen über Bord!«
»O mein Gott! Wenn ich doch nur hinunterfiele!« war die einzige Antwort, die ich von ihm erhielt, – und dort musste ich ihn lassen. Drei Wochen später traf ich meinen Mann in einem Kaffeehaus in Bath, wo er von seinen Reisen sprach und seinen Zuhörern in begeisterten Worten seine Vorliebe für die See ausmalte.
Auf die schüchterne Anfrage eines jungen Mannes, ob er nie seekrank werde, erwiderte er: »Nun, ich bekenne, ich war einmal, ein einziges Mal seekrank. Es war am Kap Horn, aber am anderen Morgen scheiterte dann auch unser Schiff.«
Ich unterbrach ihn: »War Ihnen denn nicht ein wenig sonderbar zumute, wissen Sie, damals, als wir die Landungsbrücke bei Southend verlassen hatten und Sie den Wunsch äußerten, irgendeine mitleidsvolle Seele möchte Sie ins Meer hinunterwerfen?«
»Southend? Landungsbrücke?« fragte er ein wenig verwirrt.
»Ja! Auf dem Wege nach Yarmouth – letzten Freitag vor drei Wochen.«
»O ja!«, erwiderte er heiter, als komme ihm nun plötzlich sein Gedächtnis zu Hilfe, »ich erinnere mich jetzt. Ich hatte an jenem Nachmittag starkes Kopfweh. Es kam von den Salzgurken her, wissen Sie! Es waren die abscheulichsten Salzgurken, die ich jemals auf einem Schiffe aß. Haben Sie auch davon genossen?«
Was mich selbst anbelangt, so habe ich ein ausgezeichnetes Mittel gegen die Seekrankheit entdeckt, nämlich Rumpfbeugungen. Man stellt sich einfach auf die Mitte des Verdecks, und sobald sich das Schiff hebt oder senkt, macht man die entsprechende Bewegung mit dem Körper, um ihn immer senkrecht über dem Wasser zu halten. Steigt das Vorderteil des Schiffes, so lehnt man sich vorwärts, bis man beinahe das Deck mit der Nase berührt; und wenn das Hinterende heraufkommt, lehnt man sich rückwärts. Das ist nun ganz gut für eine Stunde oder zwei. Aber man kann nicht eine Woche lang ohne Aufhören Rumpfbewegungen machen.
Georg sagte: »Fahren wir die Themse aufwärts!« – Wir würden dann, sagte er, frische Luft, Bewegung und Ruhe haben; der beständige Wechsel der Szene würde unsern Geist beschäftigen (so viel Harris davon besitzt, mit eingeschlossen), und die anstrengende Ruderarbeit würde uns guten Appetit und gesunden Schlaf machen.
Harris meinte, er denke nicht, dass Georg sich irgendwie noch anzustrengen brauche, um noch schläfriger, als er ohnehin schon sei, zu werden; das könnte sogar gefährlich für ihn werden. Er meinte, er könne nicht einsehen, wie Georg noch mehr schlafen möchte, da doch jeden Tag, im Sommer wie im Winter, nur 24 Stunden dafür verfügbar seien; wenn er aber noch mehr schlafen wolle, so könne er sich nur gleich zum Sterben niederlegen, dann erspare er Kost und Wohnung.
Harris gab indessen zu, dass die Flusspartie ihm bis aufs »T« passe. Ich weiß nun nicht, was ein T bedeuten soll, ausgenommen ein T (Tee) für einen halben Schilling, wobei man noch Butterbrot und Kuchen ad libitum verzehren darf, was ja ziemlich wohlfeil ist, wenn man kein Mittagessen gehabt und den mittäglichen Hunger daran stillen will: In solchem Fall weiß ich, was ein T bedeutet. Wenn ich’s auch sonst nicht weiß, so steht doch so viel fest, dass schließlich jedermann für die Flusspartie stimmte, was dem Fluss eine große Ehre sein muss.
Er passte uns anderen ebenfalls bis aufs »T«, und ich sowohl wie Harris erklärten es für eine gute Idee von Georg; wir sagten dies in einem Tone, der anzudeuten schien, wie erstaunt wir seien, dass Georg auf einmal so verständig geworden sei.
Der Einzige unter uns, der keinen Geschmack an dem Vorschlag finden konnte, war Montmorency. Er hatte nie eine Vorliebe für den Fluss gehabt, nein, niemals!
»Es ist das alles recht gut für euch Burschen«, meinte er ohne Zweifel, »euch gefällt’s wohl, aber mir nun eben nicht; da gibt’s für mich nichts zu tun, landschaftliche Reize sind mir gleichgültig, auch rauche ich nicht! Wenn ich eine Ratte erblicke, werdet ihr gewiss nicht anhalten, und wenn ich ein bisschen schlafen möchte, so macht ihr närrisches Zeug mit dem Boot und werft mich über Bord. Wenn ihr mich um meine Meinung fragt, so sage ich euch geradezu: Diese Flussfahrt ist die reine Narrheit!«
Indessen waren wir drei gegen eine Stimme, und so ging der Antrag durch.
Rundschreiben <<<
Chronische Entzündungen <<<
Kapitel 2
Wir breiteten unsere Karten aus, erörterten die Reisepläne und kamen schließlich überein, am folgenden Samstag von Kingston aus die Ruderfahrt anzutreten. Harris und ich wollten morgens mit der Bahn dahinfahren und uns bis nach Chertsey hinaufrudern, und Georg, der verhindert sein würde, vor Nachmittag die City zu verlassen,1 (denn er pflegt nämlich in einem Bankgeschäft von 10 Uhr vormittags bis 4 Uhr nachmittags zu schlafen, ausgenommen an den Samstagen, wo man ihn um 2 Uhr aufweckt und hinauswirft2 wollte mit der Bahn bis Chertsey reisen und dort mit uns zusammentreffen.
Sollten wir im Freien übernachten oder ans Land steigen und ein Wirtshaus aufsuchen? Georg und ich waren beide fürs Übernachten im Freien. Wir meinten, das hieße dann so recht: »Ein freies Leben führen wir«, das habe so etwas Wildes und Romantisches, so etwas Patriarchalisches an sich. Langsam verblasste der goldene Wolkensaum, die letzte Erinnerung an die entschwundene Sonne, und kalt und trübe starren die Wolken. Die Vögel sind wie trauernde Kinder still geworden; nur des Moorhuhns klagender Ruf und das heisere Gekrächze der Raben unterbricht die schaurige Stille, die ringsum auf den Wassern liegt, auf welche der sterbende Tag seinen letzten Schimmer hinhaucht.
Aus dem Dunkel der Uferbüsche kriecht die Geisterschar der Nacht, kriechen die grauen Schatten geräuschlos hervor und verscheuchen die letzten Nachzügler des Lichts, und leise, mit unsichtbaren Füßen, schleichen sie über das hohe Ufergras und durch das seufzende Röhricht, und die Nacht faltet von ihrem düsteren Throne aus ihre schwarzen Schwingen über die im Dunkel versinkende Welt, und Schweigen regiert in ihrem von den Sternen spärlich beleuchteten Palaste.
Dann lenken wir unser kleines Boot in irgendein trauliches Plätzchen; das Zelt wird darüber aufgerichtet und das frugale Abendessen bereitet und genossen. Nun werden die großen Pfeifen gestopft und angezündet, und gemütliches Geplauder geht hin und wieder; während in den Pausen unserer Unterhaltung der Fluss leise an unser Boot plätschert und seltsame, alte, geheimnisvolle Geschichten erzählt und den alten Wiegengesang anstimmt, den er schon vor so viel tausend Jahren gesungen und noch so viele tausend Jahre singen wird, jenen Gesang, den wir zu verstehen glauben, da wir so oft an seinem liebevollen Busen geruht und seine flüsternden Töne vernommen haben, obschon wir in Worten die Geschichten, denen wir lauschen, nicht wiederzugeben vermöchten.
Und wir sitzen hier an seinem Rande, während sich der Mond, der ihn ebenfalls liebt, herunterneigt, ihn mit schwesterlichem Kuss zu küssen und ihn mit seinen Silberarmen zärtlich zu umschlingen; und wir schauen zu und lauschen, wie er ewig singend, ewig flüsternd, hinunterfließt, um sich mit seiner Herrin, der See, zu vereinigen, – bis unsere Stimmen dann ebenfalls ersterben, die Pfeifen ausgehen, und wir – sonst nicht viel mehr als junge Alltagsmenschen – von seltsamen, traurigsüßen Gedanken uns erfüllt fühlen, die wir nicht auszusprechen wissen, noch auszusprechen wünschen, – bis wir anfangen zu lachen und uns erheben, um die Asche aus den erloschenen Pfeifen auszuklopfen und uns gegenseitig Gute Nacht zu wünschen, und eingelullt von dem leise an unser Boot leckenden Wasser und dem Rauschen der Uferbüsche, unter dem großen, weiten Sternenzelt einschlafen und träumen, die Welt sei wieder jung geworden, jung und süß und frisch, wie sie zu sein pflegte, ehe Jahrhunderte von Not und Sorgen ihr schönes Antlitz gefurcht, ehe ihrer Kinder Sünden und Torheiten ihr liebendes Herz versteinert hatten; träumen, sie sei wieder die hohe, junge Mutter, wie in jenen entschwundenen Zeiten, wo sie uns Kinder an ihrem vollen Busen nährte, ehe die Lockungen einer übertünchten Zivilisation uns aus ihren Liebesarmen weggelockt hatten, und das Gift und der Hohn einer überfeinerten Welt uns veranlasste, uns des einfachen Lebens, das wir mit ihr geführt hatten, zu schämen, und des ländlichen, traulichen, heimischen Herdes, an dem die Menschheit so viele tausend Jahre zuvor geruht hatte. –
»Wie aber, wenn es regnet?«, fragte Harris – Harris lässt sich niemals und durch nichts fortreißen. Er ist so ganz und gar nicht poetisch angehaucht, bei ihm ist keine Sehnsucht nach dem ewig Unerreichbaren; Harris weint niemals, »ohne zu wissen, warum!« – Wenn sich seine Augen mit Tränen füllen, so könnt ihr darauf schwören, dass er entweder rohe Zwiebeln gegessen oder zu viel Worcestersauce3 auf seine Hammelkeule gegossen hat.