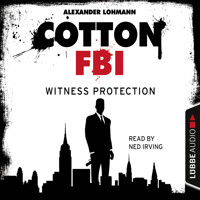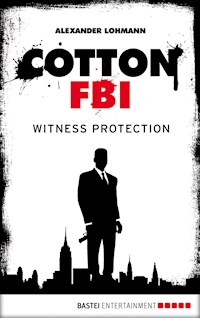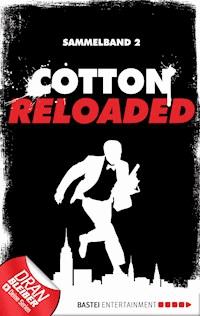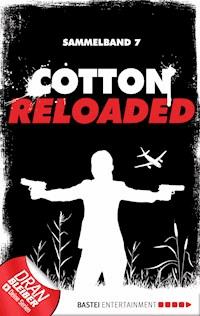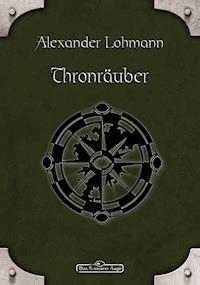
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
In Neanikis herrscht die Angst. Vor zehn Jahren verließ die Magierin Baliante ihre Heimat, jetzt, bei ihrer Rückkehr findet sie die Stadt verändert vor. Ein düsterer Dämonenturm ragt über dem Palast auf, ein Tyrann beherrscht die Stadt, die am Rande eines Aufruhrs steht. Baliante möchte sich aus all dem heraushalten und wird doch immer tiefer in die Ereignisse verstrickt: Die Rebellen von Neanikis wollen Baliantes Zauberkraft für die Befreiung des rechtmäßigen Herrschers nutzen. Keiner von ihnen ahnt allerdings, mit welcher Macht sie es wirklich zu tun bekommen werden. Der Schrecken, der Baliante einst aus Neanikis vertrieb, ist immer noch lebendig ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Biographie
Alexander Lohmann (geb. 1968 in München) arbeitete zunächst als Programmierer, entschied aber dann, dass er in der Welt der Bits und Bytes nun eigentlich genug Zeit verbracht hatte. Also wandte er sich ganz anderen Dingen zu, studierte Germanistik und Geschichte und war anschließend für eine Weile als Redakteur bei verschiedenen Zeitschriften tätig. Heute lebt und arbeitet er als freier Lektor und Literaturübersetzer in Leichlingen/Rheinland.
Seit 1988 ist er DSA- und Rollenspieler; während der 90er-Jahre war er im Fandom aktiv, z.B. als Mitherausgeber des Fanzines »Der Menhir«.
Als Geschichtenerzähler betätigt er sich allerdings schon sehr viel länger, und 2002 fanden beide Interessengebiete in seinem DSA-Roman »Die Mühle der Tränen« zusammen. Nach verschiedenen Erzählungen in Anthologien ist »Thronräuber« nun der zweite Roman von Alexander Lohmann.
Alexander Lohmann
Thronräuber
Ein Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©
Originalausgabe
Impressum
Ulisses SpieleBand 83
E-Book-Gestaltung: Nadine Hoffmann
Copyright © 2014 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems.DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN, DERE,MYRANOR, RIESLAND, THARUN und UTHURIA sind eingetragene Marken der Significant GbR.
Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt.
Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.
Print-ISBN 3-89064-512-7
Widmung
Dieses Buch möchte ich den engagierten Myranor-Fans bei ›Memoria Myriana‹ widmen ... weil sie die ›gute alte‹ Fanzinetradition zumindest im Internet auch für Myranor fortleben lassen und ihre Website durchaus eine Fundgrube ist. Und die zweite Widmung dieses Buches gilt natürlich meiner ›Junior-Gruppe‹: Volker, Birgit, Sascha, Jens und Sabine
Prolog
Unruhig stand Beldormenes am Fenster und lauschte. Aufgebrachte Stimmen drangen an sein Ohr, gedämpft durch Mauern und Entfernung. Er blickte über schlanke, glänzende Türme hinweg, die poliert und teilweise mit Marmor oder Malachit verkleidet waren. Dahinter erstreckte sich die Unterstadt von Neanikis: Beldormenes sah auf die flachen Dächer weißer, mehrflügelig angelegter Häuser hinab, und auf die erbärmlichen, schmutzig-grauen Gebäude am Stadtrand. Er lehnte sich weit über die Brüstung, aber er konnte den Ursprung des Aufruhrs nicht ausmachen. Die wütende Menschenmenge hatte sich im Schatten des inneren Walles versammelt.
»Soll ich das Volk zerstreuen lassen, Exzellenz?«, fragte eine leise Stimme unmittelbar neben seinem Ohr.
Beldormenes zuckte zusammen. Er hatte den Sprecher nicht herantreten hören. Es war General Brazanias, der Befehlshaber seiner Garde, sein treuester Helfer, sein einziger Vertrauter – sein Freund! Unerschütterlich stand der grauhaarige Krieger einen Schritt hinter seinem Herrn, dem Magnaten von Neanikis.
»Was wollen sie denn? Was soll das alles?«, fragte Beldormenes. Eine überflüssige Frage, denn auch wenn die Menge mit vielen Stimmen sprach und man keine einzelnen Worte unterscheiden konnte, so war der Tonfall doch unverkennbar. Die Menschen schrien ihre Wut heraus, riefen Beschimpfungen in Richtung der Oberstadt. Brazanias verzichtete auf eine Antwort.
»Mein Bruder im Turm hört das doch alles!«, fuhr Beldormenes fort. »Wenn er herauskommt ...«
Brazanias zuckte die Schultern. »Die Mauern des Turms sind dick. Und wir haben alles unter Kontrolle. Lasst die Reiterei ausrücken, Exzellenz, dann ist wieder Ruhe.«
Beldormenes wandte sich vom Fenster ab. Sein feistes Gesicht war gerötet. Er blickte durch den lang gezogenen, ovalen Thronsaal, auf die mit Kissen ausgelegte, erhöhte Fläche rings um den Thron unter dem Seidenbaldachin und auf die Sklavinnen, die dort warteten. Die Nordwand der Halle bestand aus buntem, durchschimmernden Op-trilith, doch dahinter zeichneten sich die wuchtigen, schwarzen Schatten des neuen Turms ab und erstickten das einfallende Licht. Beldormenes schaute in das ausdruckslose Antlitz des alten Generals. »Ach, die ganze Bürde dieser Stadt lastet nur auf mir«, jammerte er. »Mein Bruder im Turm hat seine Ruhe und ich habe nur Pflichten. Die Abgaben dienen dem Wohl des Staates – ich habe doch keine andere Wahl! Und ist es nicht mein Recht, dass ich mir vom Übrigen etwas abzweige, als kleinen Lohn für meine Mühen? Soll ich etwa alles in den Turm schicken?«
Brazanias verzog keine Miene. Er nahm einen goldenen Becher vom Bord neben dem Fenster und wog ihn nachdenklich in der Hand. »Und doch werdet Ihr Euch mäßigen müssen«, erwiderte er schließlich. »Ansonsten wird das Volk irgendwann Euren Bruder aus dem Turm holen, und er wird von Euch Rechenschaft fordern.«
Der Magnat erbleichte. »Ach du meine Güte!«
General Brazanias stellte den Becher ab. »Aber noch ist es nicht so weit. Es haben sich nur ein paar Unzufriedene vor dem Tor zur Oberstadt versammelt! Wir müssen hart durchgreifen. Das wird die Unruhestifter einschüchtern und für eine Weile sollte wieder Ruhe herrschen. Mit Eurer Erlaubnis, Exzellenz.« Beldormenes nickte.
Auf dem Weg zur Tür wandte sich der General noch einmal um: »Aber wenn das vorüber ist, müsst Ihr Euch Gedanken um die Zukunft machen. Die Stimmung im Volk ist schlecht. Ich fürchte, selbst wenn Ihr die Abgaben senkt ...
»Das kann ich nicht!«, fuhr der Magnat dazwischen.
Beruhigend hob Brazanias die Hand: »Ich weiß, Exzellenz. Daher schlage ich vor, dass Ihr die Garde verstärkt. Am Zorn des Volkes können wir vielleicht nichts ändern. Aber wir können dafür sorgen, dass es ein hilfloser Zorn bleibt!«
Die Stadt ohne Tod
Baliante schreckte hoch und blickte aufgewühlt durch ihre kleine Kammer. Sie erinnerte sich nicht, was sie so abrupt geweckt hatte – ein Albtraum, ein Geräusch von der Straße. Vielleicht gab es gar keinen Grund; sie schreckte an den meisten Tagen aus unruhigem Schlummer auf.
Noch ein wenig benommen stand sie auf. Die Luft war schwer, stickig und feucht: Baliante erwartete beinahe, den Raum mit Dunst und Nebel gefüllt zu finden. Aber die scharfen Lichtfinger, die durch die schmalen Spalten ihres Fensterladens stießen, enthüllten nur träge dahintreibende Staubflocken. Als Baliante auf das Fenster zutrat, wirbelte der Staub wild umher, leuchtete mitunter golden auf und trudelte dann in die Schatten davon.
Sie löste die Riegel an dem solide gezimmerten Laden und stieß ihn auf. Ein Schwall warmer Luft wogte in den Raum und strich über die bloße Haut an ihren Armen wie eine Berührung. Baliante strich die langen, dunklen Haare nach hinten und blinzelte in die Helligkeit. Sie brauchte einige Augenblicke, um die Straße im gleißenden Licht der Morgensonne erkennen zu können.
Baliante lebte im zweiten Geschoss, und ihre Tür ging hinaus auf das flache Dach des unteren Stockwerks. Von diesem Dach aus führte eine Treppe zur Straße hinab. Der untere Teil des Hauses war versiegelt, doch Baliantes Raum saß wie ein Würfel oben auf dem Bauwerk, ohne Verbindung zur Wohnung darunter. Es war bereits zu Lebzeiten der Besitzer untervermietet gewesen, und so war es auch nach deren Tod geblieben. Nur dass nun die Nachlassverwalter den Mietzins kassierten.
Unten auf der Straße humpelte eine hoch gewachsene und breit gebaute Gestalt entlang, die durch den gebeugten Rücken und den eingezogenen Kopf weitaus kleiner wirkte, als sie in Wirklichkeit war. Baliante seufzte. Sie kannte den Mann. »Chrys! Hallo, hier bin ich!«, rief sie herab.
Der junge Mann reckte sich, blickte suchend umher und schließlich zu dem Fenster empor, hinter dem Baliante stand. Ein Lächeln erschien auf seinem verhärmten Gesicht und er humpelte einige Schritte näher. Er mochte ungefähr zwanzig Jahre alt sein, und obwohl er von hünenhafter Statur war und die Natur ihn mit einem Übermaß Muskeln gesegnet hatte, wirkte er alles andere als gesund: hohlwangig, mit Schatten unter den Augen und entzündeten Schnitten an Füßen und Beinen. Nicht einmal die sonnengebräunte Haut konnte verbergen, dass seine Gesichtsfarbe von Tag zu Tag fahler wurde. Wie seine bunte Tunika verriet, hatte er schon mal bessere Tage erlebt, inzwischen aber war das Kleidungsstück zerschlissen und schmierig.
Chrysonias war geistig zurückgeblieben, hatte das Gemüt und den Verstand eines kleinen Kindes. Vor kurzem hatte er rasch hintereinander Vater und Mutter verloren und stand seither allein und mittellos in der Welt. Baliante sah ihn häufig durch die einsamen Straßen des Viertels streifen. Er war unfähig zu begreifen, was mit ihm geschah, unfähig, für sich zu sorgen. Auch wenn er den Körper eines Riesen hatte, so fehlte ihm doch die notwendige Stärke, um im Schmutz und Unrat der Gosse zu überleben. Jetzt stand er unter Baliantes Fenster und blickte zu der Frau hinauf: »Hallo Baliante!«
»Ich habe hier etwas für dich«, meinte sie und erwiderte das Lächeln. Dann warf sie dem Mann die Reste eines Maisfladens zu. Chrysonias hob einen langen, kräftigen und plump wirkenden Arm und fing den Brocken aus der Luft. Dann verharrte er lächelnd, die Hand mit dem Fladenrand gegen den Kopf gedrückt.
»Wohin gehst du denn?«, fragte Baliante.
Chrysonias schreckte auf. »Ich gehe so ... da hinten hin«, meinte er schließlich und gestikulierte vage die Straße entlang. Daraufhin erinnerte er sich an den Maisfladen in der Hand; er blickte darauf, roch daran. »Ja, danke!«, sagte er. Er stand noch eine Weile da, dann schlurfte er davon.
Baliante blickte ihm nach. Innerhalb weniger Schritte schrumpfte er wieder zusammen – senkte den Kopf, zog die Schultern ein, krümmte den Rücken. Ein Bild des Elends. Gelegentlich unternahm Baliante den halbherzigen Versuch, ihm zu helfen, doch sie konnte nicht die Verantwortung für den Schwachsinnigen übernehmen. Sie kam ja selbst kaum zurecht.
Scharf sog sie die Luft ein.
Chrysonias war bis zur Einmündung der nächsten Seitengasse gelangt, als dort unvermittelt ein Trupp halbwüchsiger Straßenbengel hervorstürmte und sich um den riesenhaften Verrückten scharte. Ohne große Scheu umringten sie ihn, stießen ihn an und spotteten über seine unbeholfenen Reaktionen. Chrysonias wich gegen eine Mauer zurück und ruderte mit den Armen. Er versuchte die Halbwüchsigen zu verscheuchen, bewegte sich dabei aber so langsam, als hätte er Angst, seine Angreifer zu verletzten. Die nutzten die Gelegenheit und entrissen ihm den Maisfladen.
»Danke«, rief einer der Jungen laut und übermütig. »Hast du noch mehr für uns?«
Die anderen lachten.
Chrysonias blickte hilflos umher, und Baliante trat eiligst in den Schatten ihrer Kammer zurück. Sie wollte sich nicht in diese Sache hineinziehen lassen. Und sie hatte kein Interesse daran, die Straßenjungen auf sich und ihre Wohnung aufmerksam zu machen. Ein wenig Mais und grober Spott waren den Ärger nicht wert.
Trotzdem tat es Baliante Leid um das Essen, denn eigentlich hatte sie es für ihr eigenes Frühstück zurückgelegt. Aber sie musste ohnehin auf den Markt, und sie nahm sich fest vor, eine Kleinigkeit für Chrysonias mitzubringen und ihn für den Verlust zu entschädigen.
Sie zog das dünne Nachtgewand aus und legte eine robustere Tunika an, dann sammelte sie die Sachen zusammen, die sie für ihren Weg in die Stadt brauchte. Oder die sie einfach nicht unbewacht in ihrem schlecht gesicherten Zimmer zurücklassen wollte.
Als die Geräusche von der Straße verstummt und Chrysonias und die Halbwüchsigen weitergezogen waren, trat sie nach draußen.
Der Markt von Lyrnathas war geschäftig und belebt, wirkte aber so heruntergekommen wie der Rest der Stadt. Die Auslagen waren ärmlich. Die meisten Händler hatten nur eine spärliche Auswahl anzubieten, und wenn sie mehr hatten, dann zeigten sie es nicht. Zu viel hungriges, mittelloses Volk lungerte zwischen den Ständen herum und wartete auf eine günstige Gelegenheit.
Baliante hatte ihr Halstuch über den Kopf gezogen. Sie war hoch gewachsen, aber dünn, und nun machte sie sich so klein wie möglich und versuchte unauffällig zu wirken. Einige Pardir lungerten am Rande des Platzes herum, im Schatten der festen Gebäude. Es waren armselige Vertreter ihres stolzen Volkes. Ihr Fell wirkte struppig und fahl. Die Körperform erinnerte vielleicht an aufrecht gehende Panther, doch ihnen fehlte jede Eleganz: Es waren kranke und verkrüppelte Ausgestoßene aus dem nahe gelegenen Urwald, die hier in der Stadt Zuflucht gesucht hatten; ehrlose Kreaturen selbst nach den undurchsichtigen Maßstäben ihrer eigenen Brüder. Sie boten ihre Dienste als Führer durch die weglosen Wälder an, doch im Grunde gab es nur zwei Arten von Pardir in Lyrnathas: Solche, die zu schwach waren, um im Dschungel von Nutzen zu sein – und solche, die selbst gefährlicher waren als die Gefahren, vor denen sie Schutz versprachen. Wer nicht dumm war oder völlig verzweifelt, der wandte sich lieber an die wenigen ortsansässigen Amaunir. Diese Katzenmenschen waren sehr viel zuverlässiger.
Baliante schob sich bedächtig durch den Ring aus Bettlern und armseligen Gestalten hindurch und an den Marktwächtern vorbei, die allzu zwielichtig aussehende Geschöpfe von den Ständen fern hielten. Dann bewegte sie sich in der Masse der gewöhnlichen Marktbesucher, die sich von den Bettlern am Rand meist nur durch ihre größere Beweglichkeit unterschieden. Sie trieb in einem Meer von Leibern, von Stimmen, murmelnden, allgegenwärtigen Unterhaltungen und vereinzelten anpreisenden Rufen. Kerzenzieher, Töpfer und ein Ölhändler wachten über ihre Auslagen. Bauern stellten ihre Erzeugnisse zur Schau.
Überall wurde gefeilscht, während die Langfinger nach unvorsichtigen Opfern spähten. In einem großen Bogen wich Baliante dem fauligen Hauch aus, der von einem Fischstand herüberschlug, dann drängte sie sich durch die Menge zum Standplatz der Kräuterhändlerin, die ihre beste Quelle war.
»Einen Zuckerapfel, Süße?«, sprach sie ein schäbig wirkender Kerl mit einem Bauchladen an.
Baliante duckte sich, murmelte eine unverständliche Ablehnung in entschuldigendem Tonfall und eilte weiter. Geschickt umrundete sie drei weitere Passanten und stellte damit sicher, dass der schmuddelige Naschwarenhändler mit seinem schweren Bauchladen ihr nicht folgen konnte. Sie konnte und wollte sich nicht vorstellen, wie dieser Mensch zu seinen Waren gelangt war – aber sie wusste mit Sicherheit, dass sie nichts davon essen würde.
Sie näherte sich dem Kräuterstand von der Seite, drückte sich neben das Gerüst, das die Auslage trug, und musterte die Pflanzen. Die alte Frau, die dahinter auf einem Holzblock saß, nickte ihr zu.
»Guten Morgen, Alda. Hast du vielleicht sonst noch etwas für mich?«, fragte Baliante leise. Unter einigen vorstehenden Haarsträhnen hindurch blickte sie sich misstrauisch um: Ihr Gewerbe bewegte sich am Rande der Legalität, wenn sich auch anscheinend niemand in der Stadt darum kümmerte.
Die Alte zuckte bedauernd die Achseln. »Is’ nicht, Kind. Is’ auch nicht leichter geworden, seit du die Sache bei Dromos abgelehnt hast.«
Alda vermittelte gegen Provision Interessenten an Baliante weiter. Der Sohn der Kräuterhändlerin sammelte die Ware für seine Mutter im unwegsamen Dschungel der Pardir, und er brachte viele Kräuter mit, die in mehr als einer Sphäre wirkten. So trafen sich an ihrem Stand all jene, die glaubten, übernatürliche Hilfe nötig zu haben – genau die richtigen Kunden für Baliantes Dienste!
»Was Dromos gefordert hat, war unvernünftig!«, protestierte Baliante. »Du hast mir etwas anderes gesagt! Er wollte nicht, dass ich einen Geist aus seinem Haus banne, nichts derart eindeutiges. Er wollte, dass ich über sein neues Haus einen Segen spreche und das Glück in die Räumlichkeiten banne!«
Alda zeigte ein zahnloses Lächeln. »Hört sich einfach genug an. Dromos ist ohnehin ein Glückspilz und im neuen Haus wird es ihm noch besser gehen. Ein wenig Mummenschanz und alle sind zufrieden.«
»Aber das kann ich nicht!«, rief Baliante. Erschrocken senkte sie ihre Stimme: »Du kannst mir doch nicht erzählen, dass es meinem Ruf schadet, wenn ich ehrlich zu den Leuten bin. Soll ich sie etwa betrügen?«
»Ach, Kindchen ...« Tadelnd schüttelte die alte Kräuterhändlerin den Kopf. »Musst’n Kunden einfach geben, was sie wollen, dann sind sie zufrieden. Manche wollen eben betrogen sein.«
»Aber kann ich wissen, welche Risiken Dromos eingeht, wenn er sich auf meine Künste verlässt? Ich könnte ihn mit einer Lüge ins Unglück stürzen!«
»Weißt du, hier gibt es eine Menge Händler, die haben Dromos schon so manchen Talisman angedreht. Und wenn der Talisman mal nicht so wirkt wie gehofft und der Dicke kommt und beschwert sich, dann erzählen die Händler ihm einfach, was er falsch gemacht hat und verkaufen ihm gleich noch was Neues obendrein. Du kannst doch reden, Mädchen! Musst doch keine Angst haben, dass er dich dafür zur Rechenschaft zieht.«
»Darum geht es nicht!«, meinte Baliante verzweifelt. »Selbst wenn ich ihm das Glück garantieren könnte, würde ich es nicht tun wollen. Ich übernehme damit eine Verantwortung, deren Folgen ich gar nicht absehen kann!«
Baliante sah der alten Händlerin an, dass diese ihre Bedenken nicht nachvollziehen konnte. Sie wusste nicht einmal, ob sie sich selbst so recht verstand. Aber wenn sie an den Schaden dachte, den sie direkt oder indirekt mit ihrer Magie anrichten konnte, dann umklammerte die Furcht ihr Herz wie eine eisige Klaue und wollte ihr schier den Atem rauben. Am liebsten hätte sie sich die ganze Zeit in ihrer Kammer verkrochen und überhaupt nicht mehr in das Leben anderer Menschen eingemischt. Aber sie musste von etwas leben, und sie konnte ja nichts anderes – und doch gab es Grenzen, die sie nicht überschreiten wollte.
Inzwischen blickte die alte Händlerin schon wieder an Baliante vorbei und hielt nach anderen Kunden Ausschau. Baliante wartete einen Moment unschlüssig und strich nervös ihre kittelartige Tunika glatt. Dann ging sie wieder von dem Stand fort. Manchmal hatte sie das Gefühl, dass Alda beinahe so etwas wie eine Freundin war, eine Vertraute, mit der sie über vieles reden konnte. Aber an anderen Tagen stellte sie fest, wie viel sie von der Älteren trennte und dass ihre Beziehung im Grunde rein geschäftlicher Natur war. Mit ihren Sorgen war sie jedenfalls allein.
Der Wind frischte auf. Sand und Unrat wurden vom Pflaster des Marktes emporgetragen und stiegen Baliante in die Nase. Sie schob ihr Kopftuch zurecht, bis es ihrem Gesicht einen größeren Schutz bot und das nur notdürftig zusammengebundene Haar in langen, zerzausten Strähnen in den Nacken fiel. Die Menge vor dem benachbarten Obsthändler hatte sich zerstreut. Tatsächlich war der Platz zwischen den Ständen auf einmal überraschend leer. Ein Schatten fiel auf sie ...
Mit dem Rauschen riesiger Flügel landete unvermittelt ein Ashariel vor der jungen Frau. Baliante riss die Hand vor den Mund und taumelte erschrocken zurück, aber das Vogelwesen zeigte keine Feindseligkeit.
Der hellhäutige Fremde war eine beeindruckende Erscheinung: Hoch und schlank ragte er über den anderen Besuchern des Marktes auf, und die Schwingen wölbten sich über den Platz. Baliante erkannte einige Marktordner, die ihre langen Stäbe umklammert hielten und unauffällig im Schatten der Verkaufsbuden Schutz suchten, während die Schwingen des Ashariel mit kaum gezügelter Kraft den Staub aufwirbelten. Auch am Boden wirkte der Fremde noch beeindruckend und forderte den ihm zustehenden Raum auf dem überfüllten Marktplatz ein.
Das weißhaarige Geschöpf legte den lang gezogenen Kopf schräg und blickte aus schmalen Augen in die Runde, und die anderen Besucher des Marktes schauten beiseite und wandten sich den umliegenden Ständen zu. Sie taten desinteressiert, doch am Rande des respektvollen Kreises um den Neuankömmling versammelten sich immer mehr Neugierige und begafften den seltsamen Besucher.
Die hagere Gestalt war mit bunten Stoff- und Lederbändern umwickelt, und dazwischen zeigte sich viel von der bloßen und beinahe weißen Haut des Ashariel. Baliante fragte sich, ob die Riemen zum Schmuck oder als Gürtel dienten: An einigen Stellen hingen kleine Beutel und Taschen herab, und der Vogelmensch trug einen Speer in der Hand. Aber obwohl man die spärlichen Bänder beim besten Willen nicht für Kleidung halten konnte, brauchte Baliante eine Weile, um das scheinbar geschlechtslose Wesen als Frau zu identifizieren.
In einem Moment war die Ashariel vom Himmel gestürzt, hatte durch ihr bloßes Auftreten die Menschen eingeschüchtert, den Platz für sich beansprucht, mit ihren Schwingen die Szenerie beherrscht. Im nächsten Augenblick legte sie die Flügel eng an den Körper und war nur mehr eine weitere menschenähnliche Gestalt inmitten des Markttreibens – wenn auch eine besonders große, deren Fittiche auch jetzt noch weit über den Kopf hinausragten und das Antlitz beschatteten wie ein obskurer Baldachin. Einige der Umstehenden wandten sich ab und gingen wieder ihren Geschäften nach. Andere wagten sich näher heran. Die Fremde beachtete sie nicht.
Der Blick ihrer meergrünen Augen fixierte Baliante. Sie schüttelte ihr langes weißes Haar und beugte sich vor. Baliante senkte den Kopf und hielt Schutz suchend ihre Tasche vor die Brust. Unentschlossen stand sie da und wusste nicht, ob sie weitergehen sollte oder ob dieser Auftritt irgendetwas mit ihr zu tun hatte.
Die Ashariel sprach sie an: »Wind unter den Schwingen, Menschenfrau! Ich bin Melheni.«
»Du willst etwas von mir?« Zögernd blickte Baliante auf. Ein Auftrag? Aber wie sollte diese Fremde von ihr gehört haben? Wie hatte sie unter der Menge gezielt Baliante ausfindig machen können? Baliante hatte noch niemals davon gehört, dass Ashariel in Lyrnathas gesehen worden waren.
»Wir haben ein gemeinsames Anliegen!«, verkündete die Vogelfrau mit einer seltsam weichen und leisen Stimme. Baliante wusste nicht, was sie erwartet hatte, jedenfalls nicht einen so angenehmen, fast schon träumerischen Wohlklang.
»So?«, antwortete sie nur. Sie kannte das Vogelwesen nicht. Und die Worte hörten sich wie eine Floskel an. Ein Versuch, Vertraulichkeit herzustellen – den Preis zu drücken.
»Wir haben einen gemeinsamen Feind!«
Baliante zuckte zusammen. »Ich habe keine Feinde«, murmelte sie. Abrupt wandte sie sich ab und versuchte, in der Menge unterzutauchen. Sie fühlte Bewegung hinter sich. Die Ashariel folgte ihr! Baliante hatte einmal gehört, dass Ashariel sich in ihrer Jugend einen Erzfeind erwählten und diesem mit fanatischem Eifer nachstellten. Solche Gebräuche waren ihr fremd und unheimlich. Sie zog Schultern und Arme an, kauerte sich im Gehen ein wenig zusammen. Aber die Vogelfrau griff nicht nach ihr.
»Du kannst nicht immer davonlaufen!«, rief die Fremde. Was wollte sie nur von ihr? Sie in irgendetwas hineinziehen? Ob es nun um eine solche geheimnisvolle Ashariel-Fehde ging oder nicht – Baliante verspürte nicht die ge-ringste Lust auf irgendwelche Aufträge, die mit ›Feinden‹ zu tun hatten. Sie wollte sich nicht auf Händel einlassen. Zum Glück blieb die fordernde Stimme der Ashariel hinter ihr zurück, und mit einem Blick aus den Augenwinkeln erkannte Baliante, dass die Fremde auf dem Boden nicht gut vorankam. Das Volk von Lyrnathas strömte wieder zusammen und drängte neugierig dichter an die ungewöhnliche Erscheinung heran.
Unwillkürlich musste Baliante schmunzeln. Es war anzunehmen, dass nicht nur die Neugierde den Kreis um die Fremde enger schloss: Ganz gewiss wurden viele der zwielichtigeren Gestalten hier in der Menge von den offen herabhängenden Taschen der Ashariel angelockt. Wenn die Vogelfrau nicht aufpasste, würde bald der erste Taschendieb in dem Gedränge seine Gelegenheit nutzen.
»Du bist von ihm gezeichnet!«, rief Melheni mit heller Stimme. »Ich konnte es aus der Luft sehen! Wenn du dich nicht stellst, wirst du niemals frei sein. Komm, bleib – ich kann dir helfen. Gemeinsam können wir unseren Erzfeind überwinden!«
Baliante schüttelte den Kopf. Immer noch hörte sie die Stimme der Fremden. Der Tonfall war ein anderer geworden. Klar und scharf hallte es jetzt über den Platz – schneidend! Aber von der hoch gewachsenen Gestalt war schon nichts mehr zu sehen. Baliante schwamm wie ein Fisch in der Menge, tauchte unter und fühlte sich unsichtbar, angenehm geschützt.
Ein peitschendes Geräusch, weit hinter ihr, trockenes Schlagen, ein Rauschen – die Ashariel hatte ihre Flügel ausgebreitet und schickte sich an, wieder aufzusteigen. Baliante schlüpfte unter das Vordach des nächstliegenden, aufwändigeren Standes. Ein Hutverkäufer. Die junge Zauberin lächelte – dies war nun wirklich die letzte Ware, an der sie Interesse hatte! Beiläufig nahm sie ein ausladendes Modell und studierte es, wendete es vor ihren Augen und versuchte aus dieser Deckung, die Vorgänge auf dem Markt im Blick zu behalten.
Sie sah nichts mehr von der Ashariel, aber über den Köpfen der Menge, über dem schützenden Baldachin entfernte sich schwerer Flügelschlag, zog davon, verstummte. Die Herausforderung war vorüber. Baliante blieb noch eine Weile stehen und ließ die Erklärungen und Anpreisungen der Hutmacherin über sich ergehen, ohne den Worten zuzuhören. Schließlich bedankte sie sich, legte den Hut zurück und ging zu einer der Backstuben am Rande des Platzes davon.
Ein schwacher Windhauch blies vom Fluss her, doch als er die Gasse erreichte, durch die Baliante gerade schritt, hatte er bereits jegliche Frische verloren und schaffte es gerade, den unterschwelligen, allgegenwärtigen Geruch dieses Stadtviertels wahrnehmbar zu machen: Ein Hauch von Bitterkeit, durchsetzt mit der feinen Süße von Verwesung. Die Künste der Neristu waren verblüffend, aber in den versiegelten Häusern stauten sich Hitze und Feuchtigkeit, und Fäulnis zehrte an den Fassaden, die der örtliche Brauch errichtete.
Lyrnathas wurde auch die ›Stadt ohne Tod‹ genannt, weil die Bewohner sich weigerten, die Macht des Todes anzuerkennen und keinen Unterschied zwischen den lebenden und toten Bürgern machten. Als Baliante nun aber zurück zu ihrem Zimmer ging, fühlte sie sich mehr wie in einer Stadt der Toten. Ringsum die versiegelten Häuser, deren Bewohner niemals wieder auf die Straße treten oder auch nur einen Blick aus dem Fenster werfen würden. Stille, und der allgegenwärtige Geruch nach Fäulnis und ranzigen Ölen, der umso intensiver wirkte, weil Baliante zum Schutz vor der sengenden Mittagssonne dicht an den Häusern entlangging.
Sie lebte in einem alten Stadtviertel: Kaum ein Gebäude war hier noch bewohnt, zumindest nicht nach den Maßstäben, die Baliante anlegte. Viele Türen der aus Holz und Lehm erbauten Häuser waren zugemauert worden und unterschieden sich nur noch durch Unregelmäßigkeiten im Putz von den ursprünglichen Wänden. Andere Häuser hatten noch Türen, mit Ketten verschlossen oder vernagelt. Überall klebten die blauen Siegel, die anzeigten, dass die Bewohner sich dem ewigen Schlaf hingaben.
Ein Johlen stach durch die Stille.
Baliante hielt inne und lauschte. Es klang nach spielenden Kindern, einer wilden Jagd – ein ungewöhnlicher Aufruhr in diesem entvölkerten Viertel. Vorsichtig folgte sie den verwinkelten Gassen, lauschte aufmerksam und verhielt an jeder Ecke ihren Schritt, um nicht unversehens in irgendwelche Unannehmlichkeiten zu stolpern. Zu ihrem Missfallen nahm der Lärm zu, je näher sie ihrer Straße kam.
Behutsam spähte sie um die letzte Ecke und da waren sie wieder: die Lümmel von heute Morgen. Sie quälten ihr übliches Opfer, zwei Häuser entfernt von Baliantes Heim! Die junge Frau drückte die Leinentasche mit den Einkäufen enger an den Leib und fragte sich, was wohl geschehen würde, wenn sie in diesem Augenblick auf der Bildfläche auftauchte. Würden die Halbwüchsigen sie ignorieren? Würden sie vom bedauernswerten Chrysonias ablassen? Oder würden sie sich ihr als vielversprechenderem Opfer zuwenden?
Unschlüssig stand sie an der Ecke. Noch achtete niemand auf sie, noch waren sie alle mit dem verwirrten jungen Mann beschäftigt – wenn sie noch eine Runde um den Block drehte, war es vielleicht ruhiger ...
»Wir haben es dir doch gesagt, du gehörst hier nicht hin«, sagte einer der Burschen. Er hob einen Stein vom Boden auf und warf ihn nach Chrysonias. Zum Glück lagen nur einige kleine Kiesel in der Gasse. Chrysonias riss schützend einen Arm empor und wich gegen die Hauswand zurück. Er hatte Tränen in den Augen.
»Aber meine Eltern ...«, stotterte er.
»Deine Eltern wollen dich nicht mehr sehen«, meinte der Anführer der Bande mitleidlos. »Sie haben dich vor die Tür gesetzt und hinter dir abgeschlossen. Oder was meinst du, warum du nicht mehr hineinkommst? Niemand will dich hier noch sehen.«
»Ich ... Sie wollen doch nur schlafen, hat der Blauhäutige gesagt. Sie werden wieder wach.« Unruhig fuhr er sich mit der Hand durchs Gesicht, kratzte sich, zuckte zusammen und schniefte. »Ich ...«
Er tat einen unsicheren Schritt auf den Halbwüchsigen zu, und der hatte plötzlich ein fleckiges Messer in der Hand. »He, bleib mir vom Leib, du Schwachsinniger!«
Baliante tat einen zögernden Schritt nach vorne, hielt dann aber inne. Obwohl sie aus ihrer Deckung getreten war, achtete in diesem Augenblick niemand auf sie. Chrysonias ruderte hilflos mit den kräftigen Armen durch die Luft und stotterte unverständliche Laute.
Er blickte nach links und rechts und suchte einen anderen Fluchtweg, aber von allen Seiten drangen jetzt die Mitglieder der Straßenbande auf ihn ein. Steine, Messer und Knüppel wurden sichtbar.
»Komm, mischen wir ihn richtig auf«, rief einer. »Dann weiß er endlich, woran er ist!«
Chrysonias fuhr herum, und in höchster Angst warf er sich mit der Schulter gegen das vernagelte Fenster in der hinter ihm liegenden Hauswand. Das morsche alte Holz gab nach, und ein dünner Hauch von Schmutz und Staub wolkte aus der dunklen Öffnung. Die gewalttätigen Flegel hielten den Atem an und standen wie erstarrt angesichts dieses Frevels.
Chrysonias war in Panik. Mit einem weiteren unsicheren Schlag schob er die verbliebenen Bretter aus dem Rahmen und drückte sich eilig durch die Öffnung ins Innere des Hauses.
»Ha!«, rief der Anführer der Herumtreiber. »Er ist eingebrochen! Habt ihr das gesehen, er ist eingebrochen!« Seine Stimme überschlug sich beinahe und eine blutrünstige Begeisterung klang heraus. »Hörst du, du Schwachkopf: Dafür ziehen sie dir das Fell über die Ohren!«
Baliantes Finger krallten sich in den Stoff ihrer Tasche.
»Holt die Wache! Holt die Wache!«, rief der Anführer einigen seiner Leute zu. »Wir sorgen dafür, dass er nicht abhaut.« Erwartungsvoll trat er näher an die Öffnung, aber nur einen Schritt. Dann hielt er inne und schaute sich misstrauisch um. Sein Blick fiel auf die erstarrt dastehende Baliante.
»Er ist eingebrochen«, meinte er und wies auf das zerschlagene Fenster. »Das kann man nicht durchgehen lassen!«
Es klang, als zitiere er unverstandene Worte. Baliante wusste, dass nichts, was sie antworten konnte, etwas ändern würde. Diese Kreaturen freuten sich auf das Schauspiel eines blutigen Todes, und die Obrigkeit von Lyrnathas würde ihnen dabei auch noch zu Diensten sein.
Oder besser gesagt, die Neristu: Die vierarmigen, blauhäutigen Geschöpfe mit ihren Kenntnissen der Einbalsamierung von Toten waren in Lyrnathas mächtig geworden. Sie verwalteten die Angelegenheiten der ›Schläfer‹, und dafür ließen sie sich aus dem Nachlass der Toten bezahlen oder profitierten von den zurückgebliebenen Gütern, die regelmäßige Einnahmen einbrachten. Zum Beispiel auch von dem Mietzins, den Baliante für ihr Zimmer entrichtete; für ein Zimmer, das immer noch den Verstorbenen im Haus darunter gehörte.
Eine Stadt, in der die Toten mitsamt ihres Besitzes in ihren Häusern blieben, während die meisten der Lebenden ein erbärmliches Dasein fristeten und jeden Tag aufs Neue ums Überleben kämpfen mussten – die Folgen lagen auf der Hand! Und so galt ein Einbruch als das schlimmste Verbrechen in Lyrnathas. Die Neristu verfolgten jeden solchen Fall und sorgten für die Bestrafung, und das mit größtem Eifer, mit schier unerschöpflichen Mitteln und mit der Unterstützung der Obrigkeit.
Es gab so viele Möglichkeiten, unauffällig die Toten zu berauben, und daher sollte die Grausamkeit der Strafen abschrecken. Wenn man einen Einbrecher fangen konnte, gab es kein Erbarmen. Und niemand fragte nach den Gründen einer solchen – unentschuldbaren! – Tat.
Zögernd tat Baliante ein paar weitere Schritte die Straße entlang.
»Er weiß nicht, was er tut, das wisst ihr genau«, meinte sie zu den Halbwüchsigen, obwohl ihr klar war, dass Worte hier nichts mehr ausrichten konnten.
»Das ... die Richter sollen entscheiden«, meinte der Anführer der Bande. Seine Augen flackerten und er musterte Baliante ein wenig unsicher.
Die Frau atmete tief ein. Fest drückte sie ihre Tasche gegen die Seite, um ein Zittern zu verbergen, und dann ging sie entschlossen auf die herumstehenden Burschen zu.
»Ich hole ihn jetzt raus!«, verkündete sie. Sie ging ein wenig schneller, trat fester auf, mehr um sich selbst zu überzeugen. Das kann ich nicht tun! Aber sie tat es doch, und schnell, schnell, ehe sie es sich anders überlegte! Sie konnte den harmlosen Chrysonias nicht sterben lassen.
Mit einigen wenigen Schritten war sie am Fenster und die jugendlichen Herumtreiber wichen zur Seite. Der Anführer hatte immer noch das Messer in der Hand, aber erst als Baliante an ihm vorüber war, trat er wieder vor.
»Wenn du dort hineingehst, wirst du sein Schicksal teilen!«, drohte er.
Baliante blickte in die dunklen Räumlichkeiten. Ein modriger, süßlicher Geruch schlug ihr entgegen. Im grellen Lichtstrahl, der von der Straße einfiel, sah sie Überreste des Fensterladens auf dem Boden liegen, in unregelmäßigen Trümmern, die an Flocken erinnerten, an Schwämme. Ein gräulich-dunkler Pilzbelag wucherte über die Wände. Der Geruch wurde mit jedem Augenblick unerträglicher. Von Chrysonias war nichts zu sehen.
»Chrys?«, rief sie. »Chrys, komm raus!«
»Wir lassen ihn nicht entkommen«, beharrte der Bursche hinter ihr. »Du willst ihm zur Flucht verhelfen. Vielleicht steckt ihr sogar zusammen: Die Fremde, die ihn angestiftet hat!« Ein verschlagener Unterton schlich sich in seine Stimme. »Das wird die Richter interessieren.«
Langsam drehte Baliante sich um. Sie hob eine Hand. »Verschwindet!«, sagte sie. Ihre Stimme klang fest, kalt – drohend. Die Kraft in dieser Stimme kam nicht aus ihrem Inneren. Aber irgendwann, vor langer Zeit, hatte sie diesen Tonfall einstudiert, beherrscht, und auf diese Erinnerung griff sie nun zurück.
Der Herumtreiber musterte sie mit großen Augen. Baliante senkte ein wenig die Lider, bewegte die Lippen und öffnete ihren Geist. Überraschend klar erinnerte sie sich an längst vergessen geglaubte Beschwörungen, an komplizierte Zauber, nie verwendete Matrizen ...
Nein! Das konnte sie nicht – Magie anwenden gegen diese jungen Burschen, um einem Verrückten zu helfen? Ihre Gedanken zerfaserten, drehten sich im Kreis. Sie verlor die Kontrolle. Hilflos wog sie ihre Möglichkeiten ab, konnte sich nicht entscheiden, was sie tun wollte, wie weit sie zu gehen bereit war.
Da ließ ihr Gegenüber sein Messer sinken, wich einige Schritte zurück, holte Luft und wandte sich dann doch wortlos ab, lief einige Schritte. »Kommt!«, rief er seinen verbliebenen Gefährten zu. Die hatten der Auseinandersetzung mit der fremden Zauberin ruhig zugesehen wie unbeteiligte Zuschauer, und als den Anführer der Mut verließ, da wandte sich kein anderer gegen sie. Erst an der nächsten Ecke hielten sie an, und der Anführer rief über die Schulter zurück: »Sie kriegen euch ja doch, euch beide! Wir kennen dich!«
Dann verschwand er.
Baliante atmete tief durch. Wenn die Burschen nicht nachgegeben, sondern ihre Kraft wirklich auf die Probe gestellt hätten – hätte sie dann tatsächlich gewagt, ernsthaft gegen die Halbwüchsigen vorzugehen? Schon jetzt bereute sie, was sie getan hatte.
Sie seufzte.
Doch nun musste sie weitermachen. Jetzt ging es nicht nur um Chrysonias, jetzt war sie selbst in Gefahr! Sie musste die Stadt verlassen, und wenn sie den Verrückten mitnahm, gab das ihrem Verlust zumindest einen Sinn. In gewisser Weise jedenfalls. Und was machte es schon – seit zehn Jahren war sie hier, und immer noch eine Fremde. Dieser Ort bedeutete ihr so wenig wie jeder andere.
»Chrys«, rief sie wieder in das Haus hinein. Sie sprach sanft, wie zu einem Kind. »Sie sind weg.«
»Sie sind böse!«, meinte eine weinerliche Stimme aus der Dunkelheit. Baliante zuckte zusammen. Sie entdeckte Chrysonias zusammengekauert in einer Ecke des Raumes, mit Staub und Schmier bedeckt und beinahe unsichtbar. Nur seine Augen funkelten im einfallenden Licht.
»Aber jetzt sind sie weg«, beruhigte ihn Baliante. »Aber sie kommen bald wieder. Rasch, gib mir deine Hand. Wir müssen fort von hier!«
»Ho! Schau mal, wie ich klettern kann!«
»Pst«, hauchte Baliante. »Wir müssen leise sein. Wir ... spielen verstecken.«
Sie zog Chrysonias in einen Winkel neben einigen zum Trocknen aufgestapelten Balken und lauschte, dann huschte sie über den Hof zum Hintereingang der Werkstatt. Am Türdurchgang wäre sie beinahe in den jungen Mann gelaufen, der eben nach draußen trat. Erschrocken riss er die Arme hoch und ließ einen Messstab fallen. Abwehrend stießen seine Hände auf Baliante zu, im selben Augenblick aber erkannte er die Frau auch schon, und er fasste sie am Arm.
»Verdammt noch mal, Lia!«, keuchte er. »Wo kommst du denn her?«
Auch Baliante war zusammengezuckt, legte aber hastig einen Finger auf die Lippen. »Still, nicht so laut! Wir sind auf der Flucht. Wir brauchen deine Hilfe.«
»Wir?«, fragte der braunhaarige Bursche. Misstrauisch blickte er über den Hof und die Brauen über seinen eng beieinander stehenden Augen zogen sich buschig zusammen. Schließlich entdeckte er Chrysonias, der leicht gebeugt hinter Baliante herkam, sich über das Haar strich und ein breites Lächeln zeigte.
»Schönen guten Tag, Meister Daridorius«, grüßte der hünenhafte Schwachsinnige den Bewohner des Hauses. Der Angesprochene seufzte und wandte sich wieder Baliante zu. »Was schleichst du denn mit dem Blöden hier in meine Werkstatt? Wie der aussieht! Achtet denn gar niemand mehr auf ihn?«
Baliante schüttelte den Kopf. »Nein, Dari ... das ist doch jetzt unwichtig!«, meinte sie abwehrend. »Hör zu.«
Flüsternd schilderte sie dem Tischler die Ereignisse und drückte ihn gleichzeitig tiefer in die Werkstatt. Tuschelnd und zusammengekauert standen sie im Schatten des Türsturzes, während Chrysonias im Hof stehen blieb, lächelte und schließlich ungeduldig einige Schritte zu den neben der Tür abgelegten Holzresten tat.
Daridorius schüttelte den Kopf.
»Wir müssen fliehen!«, meinte Baliante.
Der junge Tischler knetete seine Unterlippe, trat wieder einen Schritt nach draußen und musterte Chrysonias nachdenklich. Schließlich fuhr er sich nervös durch die Haare und einige Strähnen glänzten golden im einfallenden Sonnenlicht. Baliante wartete ab.
»Das ist wahr«, stimmte Daridorius zu. »Sie werden nach euch suchen. Du kannst nicht mehr nach Hause, und du kannst dich auch nicht mehr an den Toren blicken lassen. Aber wohin willst du?«
»Das ist kein Problem«, erwiderte die Frau ein wenig schroff. »Erinnere dich: Vor zehn Jahren bin ich durch den Urwald hierher gekommen. Genauso gut kann ich zu einer anderen Stadt wandern. Wir müssen nur aus Lyrnathas raus.«
»Das ist nicht schwer.« Daridorius seufzte. »Die Stadt wächst so schnell, dass es nirgendwo einen geschlossenen Mauerring gibt – und viele Stadtviertel sind menschenleer. Zumindest ist dort keine lebende Seele mehr zu finden. Aber außerhalb der Stadt ... Baliante, ich erinnere mich genau, wie du vor zehn Jahren angekommen bist: Es war ein Wunder, dass du überlebt hast!«
Lyrnathas lag in einer Biegung des Grünen Orismani und inmitten eines weit ausgedehnten Ausläufers des Pardir-Dschungels. Und für diese abgeschiedene Lage konnte die Stadt vermutlich noch dankbar sein, denn der Fluss hielt die meisten der wilden Pardir aus dem Süden fern, während der umliegende Urwald Lyrnathas von der Savanne abschirmte, die seit Jahrhunderten ein Kriegsschauplatz war.
Lyrnathas musste sich nur mit den wenigen, versprengten Sippen der Pardir herumschlagen, die den Wald nördlich des Flusses bewohnten. Diese Gegner waren zu schwach, um Lyrnathas einzunehmen – so verrottet die Stadt auch war. Aber sie waren eine stets gegenwärtige Bedrohung für jeden, der sich außerhalb des schützenden Rings aus Kundschaftern, Jägern, Holzfällersiedlungen und wehrhaften Landgütern bewegte, der die Stadt umgab. Dennoch zuckte Baliante die Achseln. Es hatte keinen Wert, darüber zu diskutieren.
Aber Daridorius tat es trotzdem: »Die Straßen zu den Nachbarstädten sind nicht sicher – dort werden sie uns suchen! Wir müssen durch den Urwald. Und der Schwachsinnige ist eine zusätzliche Last.«
»Jetzt redest du von ›wir‹«, wandte Baliante ein. »Das ist alleine mein Problem, und das von Chrysonias, wenn man so will. Ich bitte dich nur, verstecke uns bis heute Abend. Und vielleicht kannst du ein wenig Ausrüstung besorgen, und Vorräte. Hör zu, Dari, ich will dich da nicht weiter reinziehen ...«
Der Tischler wedelte mit der Hand. »Nein, nein, so geht das nicht! Du denkst doch nicht, dass ich dich alleine losziehen lasse?«
»Nun«, lenkte Baliante ein. Sie schenkte Daridorius ein dankbares Lächeln, aber gleichzeitig spürte sie einen Druck unter der Brust – Angst! Angst um ihren Freund, den einzigen wirklichen Freund, den sie in Lyrnathas hatte. Nein!, dachte sie. Tu mir das nicht an. So nahe stehen wir uns nicht. Ich will das nicht! Ich will dich da nicht reinziehen. Laut sagte sie: »Vielleicht kannst du uns helfen, durch die Stadt zu kommen. Aber im Wald kennst du dich auch nicht besser aus als ich. Und du hast viel mehr zu verlieren.«
Entschlossen fasste Daridorius sie mit beiden Händen um die Oberarme. »Hör du mir zu, Baliante. Du bist nicht verantwortlich für meine Entscheidungen. Ich will es so! Meinst du etwa, ich bin glücklicher, wenn ich dich alleine ziehen lasse? Nein, Chrysir hat unsere Leben aufgewirbelt, und ich werde mich nicht zusammenkauern und das Gesicht in den Händen verbergen, während der Sturm mir das Dach davonträgt.«
»Aber du hast ein Dach!«, wandte Baliante ein. »Ein Haus, eine Werkstatt, ein Lager ... Ich lasse nur die wenigen Möbel zurück, die du mir geschenkt hast.«
Daridorius holte tief Luft. »Außerdem kenne ich mich besser im Wald aus als du: Ich war ein Jahr bei den Holzfällern! Und dabei habe ich auch gelernt, mein Werkzeug als Waffe zu nutzen. Und wenn du in Sicherheit bist, kann ich wieder zurückkehren. Niemand sucht mich.«
»Nicht, solange du nicht mit uns gesehen wirst. Nicht, solange niemand uns erwischt!«
Daridorius unterbrach sie mit einer abwehrenden Geste. »Während der Reise teile ich euer Risiko. Und wenn mich jemand erkennt, muss ich eben mit euch fliehen.« Er grinste. »Als Tischler und Zimmermann finde ich zumindest überall eine Beschäftigung. Aber es ist ja nicht so, dass andere Städte begierig auf eine Zauberin warten, die Angst hat, zu zaubern.«
Trotz seiner Entschlossenheit war Daridorius schwer ums Herz, als sie sich am Abend zum Aufbruch versammelten. Chrysir, der Gott der Winde, hatte tatsächlich sein Leben aufgewirbelt und ihm eine hässliche, unerwartete Wendung verliehen. Daridorius fühlte sich unter Druck gesetzt, in die Enge getrieben – aber nicht von Baliante, redete er sich selbst ein. Vom Schicksal. Von den Umständen.
Er hatte einige Bündel auf leichte Holzgestelle gepackt, damit sie sich leichter tragen ließen, hauptsächlich Vorräte, aber auch Decken und einige Werkzeuge. Viel zu wenig, aber er wagte es nicht, mit prallen Rucksäcken durch die nächtliche Stadt zu wandern und eine Silhouette abzugeben, die jeden Wächter alarmieren musste.
»Gehen wir«, flüsterte er. Er flüsterte nicht aus Vorsicht, sondern weil Furcht ihm die Kehle zuschnürte. Gerade als er die Hand auf den Türriegel legte, erschütterte ein schwerer Schlag das Holz. Der Stoß hätte stark genug sein können, um die Tür einzuschlagen. Die Hauswand ächzte, der Rahmen knarrte, aber die Tür hielt. Daridorius legte Wert auf Beständigkeit und jede Holzarbeit in diesem Haus war das Werk seiner Hände.
Chrysonias zuckte zusammen und schrie erschrocken auf, Baliante riss zitternd die Hand vor den Mund und stand wie erstarrt. Aber Daridorius fühlte sich plötzlich befreit. Der Schreck spülte jede Unsicherheit davon und ließ ihn rasch und entschlossen handeln. Er schob Baliante nach hinten. »Rasch, über den Zaun«, hauchte er. »Nicht auf die Straße, auf das Nachbargrundstück. Da wohnen nur Schläfer. Wartet dort – und seid leise!« Hastig streifte er den Rucksack ab. »Wer ist da?«, rief er, um ein wenig Zeit schinden.
»Zimmermann Daridorius, du wirst verdächtigt, einem Frevlerpaar Zuflucht und Hilfe zu gewähren.«
Es war die Stimme eines Neristu, der versuchte, laut zu reden und Autorität zu vermitteln, es jedoch nur schaffte, seine tiefe und raue Stimme heiser klingen zu lassen. Aber zum Glück sprach er langsam, und das verschaffte Daridorius einige entscheidende Augenblicke. Hektisch ließ er den Blick über die vertrauten Umrisse seiner Werkbank und seiner Werkzeuge streifen. Im spärlichen Licht des Halbmondes, das durch die Hintertür einfiel, konnte er kaum etwas erkennen, doch weil er sein Haus stets in Ordnung hielt, fand er sich auch jetzt halbwegs gut zurecht.
Zielsicher griff er nach einem schweren Hammer und lief zur Hintertür. Dort lehnte eine Dechsel, die er am Nachmittag dort abgestellt hatte. Im Vorübergehen hob er das langstielige, beilartige Werkzeug auf, dann rannte er hinaus und über den Hof. Keine Spur von Baliante und dem Verrückten. Alles war still. Gut.
Vorsichtig bewegte er sich auf den rückwärtigen Zaun zu. Wie lange dauerte es wohl, bis die Wachen mit größerer Entschlossenheit versuchen würden, die Tür aufzubrechen? Wie lange, bis weitere Leute um das Haus liefen und die Seitengasse hinter seinem Grundstück erreichten?
Behutsam stieg Daridorius auf einige sorgfältig aufgestapelte Planken und näherte sich geduckt dem hohen Zaun. So konnte er unauffällig über die Kante lugen und sich einen Überblick über die Seitenstraße dahinter verschaffen. In Gedanken formulierte er einen Fluch.
Er hatte befürchtet, dass die Rückseite seines Grundstücks nicht unbewacht geblieben war. Aber der Neristu hatte gleich zwei Posten dort platziert. Zwei Gegner, das war heikel. Zum Glück waren es einfach bewaffnete Stadtwachen, die nur ihre langen Stäbe in der Hand hielten, auch wenn sie Waffengurte mit Kurzschwertern angelegt hatten. Sicher, sie suchten einen Schwachsinnigen und eine zierliche Frau – keine Gegner für einen ernsthaften Kampf. Und sie rechneten damit, dass jeder Flüchtling aus der Tischlerei mühsam über den Zaun klettern musste und ebenso auffällig wie hilflos sein würde. Sie rechneten nicht mit den Bretterstapeln, die wie ein Wehrgang hinter dem Zaun lagen.
Daridorius wog den Hammer in der Hand, holte aus und sprang hoch. Die Oberkante des Zaunes war nun auf Bauchhöhe, und er hatte einen guten Blick und freie Bahn auf sein Ziel. Mit aller Kraft schleuderte er das schwere Werkzeug auf den nächsten der Männer. Es dauerte einen Augenblick, bis die Wachen aufmerksam wurden, und noch länger, bis sie reagieren konnten. Der stählerne Hammerkopf traf früher.
Daridorius hielt den Atem an. Das Werkzeug traf den Bewaffneten wuchtig am Oberkörper. Es gab einen dumpfen Laut, als hätte Daridorius auf einen prall gefüllten Sack mit Sägespänen eingeschlagen. Der Getroffene sank in die Knie, sein Begleiter umklammerte den Stab fester und rief um Hilfe.
Daridorius fasste die Dechsel, dann schwang er sich mit der anderen Hand über den Zaun. Er versuchte auf den Füßen zu landen und den Aufprall abzufedern, doch es gelang ihm nicht ganz. Locker, dachte er. Wenn ich mir den Fuß verstauche, ist alles aus!
Er kam wieder auf die Beine, ehe der zweite Posten ihn erreichte. Der Mann wog unentschlossen seinen Stab. Die Dechsel war so schwer wie ein großes Beil, ein wenig unhandlich, aber scharf und gefährlich. Man sah dem Posten an, dass er lieber sein Kurzschwert gezogen hätte, aber jetzt war es zu spät. Allerdings konnte Daridorius sich auch nicht auf einen langen Kampf einlassen, denn die übrigen Wachen würden rasch um das Haus gelaufen kommen.
Da überwand der getroffene Posten den Schrecken, Schmerz, Betäubung – was auch immer ihn bisher still gehalten hatte – und schrie laut.
Daridorius nutzte die kurze Ablenkung und sprang vor. Er schlug mit der Dechsel zu. Wie erwartet parierte sein Gegner mit dem Stab, doch er konnte das wuchtige Tischlerwerkzeug nicht abblocken, nur ablenken. Der Wächter senkte seine Waffe ein wenig und zog sie schräg zur Seite, um den Schlag abzufangen, da riss Daridorius die Dechsel auch schon wieder hoch und schlug die Oberseite gegen das Kinn seines Kontrahenten.
Lautlos ging die Wache zu Boden.
Daridorius sprang zurück und schaute sich um. Der zweite Wächter kniete immer noch auf dem Lehmboden der Seitengasse und schrie vor Schmerzen. Keine Gefahr von dort. Daridorius war froh, dass er den Mann nicht am Kopf getroffen und getötet hatte, und er hoffte, dass auch der andere nicht ernsthaft verletzt war. Soviel zum Zurückkehren, dachte er grimmig. Trotzdem war ihm jetzt leichter zu Mute, wo er nicht nur hinter Baliante herlief, sondern selbst einen Grund zur Flucht hatte.
Er sprang zu dem schreienden Verletzten und streckte ihn mit dem Griff der Dechsel nieder. Es war besser, wenn niemand den anderen Wachen erzählen konnte, wie viele Leute hier über den Zaun geflüchtet waren.
Nach kurzem Zögern zog Daridorius dem Bewusstlosen das Kurzschwert aus dem Gürtel. Die Dechsel ließ er fallen; sie war zu schwer und würde ihn nur behindern. Endlich rannte er los, und bevor er noch an der Einmündung der nächsten Gasse angelangt war, hörte er schon die aufgeregten Stimmen der Verfolger hinter sich. Er drehte sich nicht um.
Ob die Wächter sich wohl erst um ihre verwundeten Gefährten kümmern würden? Oder auf den Neristu und weitere Anweisungen warteten, ehe sie die Verfolgung aufnahmen? In diesem Labyrinth aus engen Gassen und flachen, leicht erreichbaren Dächern brauchte Daridorius keinen großen Vorsprung. Und sobald er sich unbeobachtet fühlte, änderte er seine Richtung und lief zum einzigen Ort, wo man ihn jetzt bestimmt nicht vermuten würde: Zurück zu seinem Haus, um Baliante abzuholen, während die Wachen der Stadt ihn überall anders suchten ...
Im Dschungel der Pardir
»Chrys, komm her!«
Wie ein Kind kroch der hünenhafte Verrückte am Stra-ßenrand zwischen den Büschen umher. Sie wanderten auf einem Weg, der früher einmal ein Treidelpfad entlang des Flusses gewesen war. Inzwischen hatte der Fluss seinen Lauf an einigen Stellen geändert, und Lyrnathas hatte nicht die Mittel, um die Straße entsprechend anzupassen.
Früher war sie an den unsicheren Uferabschnitten auch befestigt gewesen, und man hatte Brücken und Stege unterhalten. Inzwischen umging der Weg den unsicheren Untergrund und verschwand kurzerhand im Urwald. Und das war Daridorius auch recht so, denn am Fluss war der Boden oft morastig, und von den Tümpeln im Überschwemmungsgebiet stiegen Mückenschwärme und anderes Getier auf und fielen über die Reisenden her. Der Dschungel war düsterer, bedrohlicher. Aber sie kamen dort rascher voran, und alles in allem auch angenehmer.
Aber nicht sicherer, dachte Daridorius.
Er ging aufmerksam vor seinen beiden Begleitern her, achtete nach vorne auf den Weg, lauschte nach hinten auf die gelegentlichen Wortwechsel zwischen Baliante und Chrysonias und dachte derweil darüber nach, wie er in diese Situation geraten war.
»Da hat sich was bewegt«, verkündete Chrysonias fröhlich. Daridorius fuhr ein Schauer über den Rücken.
»Komm trotzdem da weg«, befand Baliante.
»Komm sofort da weg!«, kommandierte Daridorius barsch. »Hier im Pardir-Dschungel bewegt sich nichts Gutes.«
Chrysonias schluchzte auf und lief zu Baliante. Daridorius zuckte zusammen.
»Sei doch nicht so grob zu ihm«, meinte Baliante. »Er versteht doch gar nichts hiervon.«
»Er sollte es schnell lernen.«
»Er kann nichts lernen, vor allem nicht schnell«, erinnerte sie ihn. »Es ist völlig überflüssig, dass du ihn anschreist.«
Daridorius versuchte ruhig zu bleiben: »Hör zu, Lia, verstehst du nicht, in was für einer Situation wir sind? Der Weg ist ohnehin schon unsicher genug und wir sind noch lange nicht entkommen.«
»Du hast diese Wachen niedergeschlagen. Wir müssten uns bestimmt keine Sorgen mehr um Verfolger machen, wenn du sie nicht so angestachelt hättest.«
Daridorius seufzte. Dieses Gespräch hatte etwas Unwirkliches an sich. Fast so, als würde er mit zwei Schwachsinnigen sprechen, oder mit zwei Kindern. »Hör zu, Lia«, sagte er schließlich einfach. »Es ist mir egal, ob Chrys etwas lernt. Aber ich kann nicht gleichzeitig auf den Dschungel und den Weg und auf ihn achten. Also sorge einfach dafür, dass er still bleibt.«
Chrys blickte ihn aus großen, weit aufgerissenen Augen an. Er klammerte sich an Baliantes Hand und schluchzte dabei leise vor sich hin. Daridorius fragte sich, was der Verrückte in ihm sah. Ein Ungeheuer? War er grausam?
Nein, wirklich grausam war das, was im Urwald lauern mochte.
»Es ist doch auch zu seiner Sicherheit. Wenn er so im Unterholz rumstöbert, wird er in diesem Wald früher oder später auf etwas Giftiges stoßen ... Was ist das?«
Daridorius horchte auf. Da war ein Geräusch gewesen, das nicht in die Umgebung passte. Aber Daridorius konnte es nicht festhalten, und jetzt war es schon wieder verklungen. Nun war es Baliante, die sich an Chrysonias’ Hand klammerte, und der Verrückte blickte sie überrascht an. Wie der beinahe zwei Schritt große Schwachsinnige es schaffte, zu der kleineren Frau aufzublicken, war Daridorius ein Rätsel.
Er fühlte einen Stich, als er Chrysonias so mit Baliante Hände halten sah. Aber das war natürlich albern. Eifersucht auf einen Zurückgebliebenen. Jetzt und hier ...
»Was ist denn los?«, fragte Baliante.
»Ich weiß nicht.«
Er lauschte. Plötzlich fühlte er sich wie erdrückt vom Dschungel. Dazu gehörte nicht viel: Das hier war vielleicht früher einmal eine gut ausgebaute Straße gewesen, doch inzwischen war es weniger als ein Weg. Wie eine grüne Flutwelle brandete das Grün gegen einen schmalen und schmaler werdenden freien Streifen an, und ebenfalls wie bei einer Flutwelle brach der Kamm und wölbte sich über sie, tauchte den Weg in lichtgesprenkeltes Zwielicht. Dann und wann schoben sich Pflastersteine aus dem weichen Grund, von Wurzeln hochgedrückt und nun so aufrecht wie Marksteine – das Letzte, was vom ursprünglich gut befestigten Treidelpfad noch übrig war.
Aber auch, wenn dieser Pfad seinem ursprünglichen Zweck nicht mehr gerecht werden konnte, so war es doch neben dem Fluss die einzige Verbindung Lyrnathas’ zur Außenwelt. Also ließ man die Straße niemals gänzlich zuwachsen. Ab und zu brachen einige angeheuerte Trupps auf, um eine Schneise frei zu halten. Diese Schneise war an einigen Stellen mehr als einen Schritt breit, an anderen nur dadurch zu erkennen, dass das Dickicht in eine Richtung nicht vollkommen undurchdringlich war.
Im Dschungel war es nie völlig still, und so hörte Daridorius eine Menge. Die Kunst war es, den Laut ausfindig zu machen, der ihn beunruhigt hatte. Da war es wieder.
»Hunde!«, rief er erschrocken aus. Dann legte er die Hand vor den Mund und sprach beinahe flüsternd weiter. »Wir müssen hier weg.«
»Vielleicht nur irgendwelche Holzfäller?«
Daridorius schüttelte den Kopf. »Zu weit weg von der Stadt. Nein, das gilt uns.«
Er fasste Baliante am Arm und zog sie mit sich. Chrysonias schaute von einem zum anderen.
»Was denn?«, fragte er und schniefte. Stolpernd fielen die drei in einen langsamen Trab. Nicht schnell genug.
Immer wieder versuchte Daridorius seine Begleiter anzutreiben, aber es war aussichtslos. Dem Schwachsinnigen fehlte es an Willensstärke, um längere Zeit konzentriert zu laufen, und Baliante an Kraft.
»Au«, rief Chrysonias. »Da war ein Stein!« Er klang empört.
»Pst«, erwiderte Daridorius und lauschte. Von den Verfolgern war kaum etwas zu hören. Da war nur dieses Bellen gewesen, ein vereinzelter Laut. Daridorius war sich sicher, dass da jemand auf ihrer Spur war – wie weit entfernt, das ließ sich nicht abschätzen. Der Weg beschrieb viele Windungen und der dichte Bewuchs dämpfte alle Geräusche. Die Schergen mochten jeden Augenblick hinter der letzten Biegung hervorbrechen. Wenn sie den Eindruck gewannen, ihrer Beute nahe zu sein, würden sie die Hunde loslassen.
»Wir müssen runter von der Straße«, befand er.
Das war leicht gesagt. So überschattet der Weg auch war, es war doch die lichteste Stelle weit und breit, und das Unterholz säumte ihn wie eine Wand aus verflochtenen Zweigen. Daridorius war froh, dass sie nicht mehr direkt am Fluss waren: Über die Windungen des Orismani hinweg hätten die Verfolger sie vielleicht schon viel früher erspäht, und womöglich hielten sie ja sogar mit Booten vom Fluss her nach ihnen Ausschau. Der Wald gab den Flüchtigen immerhin Deckung.
»Werden sie uns nicht auch abseits des Weges verfolgen?«
»Vermutlich«, bestätigte Daridorius. »Eine Weile.« Niemand drang tief in den weglosen Dschungel vor. Und es gab Stellen, die kein Mensch oder Hund betreten würde, selbst wenn sie direkt neben der Straße lagen. Und wir gehen mit dem Schwachsinnigen dorthin? Das ist Selbstmord!
»Lia! Kannst du nicht etwas machen? Ich habe dich zaubern sehen.«
»Das war in der Stadt«, gab sie zu bedenken. »Hier müsste ich ganz andere Mächte rufen. Wenn es gegen die Hunde ginge, oder gar gegen Menschen ... Es kann so viel passieren. Ich traue mich nicht.«
»Ich fürchte, wir werden ohnehin etwas machen müssen, was ich mich nicht traue.«
»Du verstehst das nicht.«
Nein. Er schüttelte den Kopf. Der Satz eines zornigen Heranwachsenden, dabei war Lia älter als er. Er wusste nicht recht, was er damit anfangen sollte. Was machte er überhaupt hier? Er war Tischler, er hätte in seiner Werkstatt bleiben sollen. »Nein. Ich verstehe nichts von Zauberei. Aber ich habe eine deutliche Vorstellung von dem, was uns im Dschungel erwarten kann.«
»Wenn es so weit ist, wenn uns keine Wahl bleibt, werde ich etwas tun«, versprach Baliante.
Er nickte. »Ich verlasse mich darauf.«
Baliante zuckte zusammen, und Daridorius fragte sich, ob er etwas Falsches gesagt hatte.
Sie liefen so langsam, dass sie sich noch immer unterhalten konnten. So ging das nicht weiter! Sie mussten hier weg.
»Geht es nicht ein wenig schneller?«
»Chrysonias ...«, setzte Baliante an und verstummte.
Daridorius hätte doppelt so schnell gehen können, und es hätte ihn weniger angestrengt als dieser unruhige, immer wieder unterbrochene Halb-Trab. Und das verschlungene Gestrüpp an den Seiten gab immer noch keinen Weg frei. Mit der Klinge einen Pfad schlagen? Das war zu laut, zu langsam, zu auffällig.
Verbissen lief er weiter.
Warum er hier war? Er wusste es genau. Er lief hinter Baliante her – im übertragenen Sinne zumindest, denn wörtlich genommen war es zur Zeit eher andersherum. Trotz ihrer Lage musste Daridorius bei dem Gedanken kurz lächeln, aber diese Regung erstarb rasch.
Seit Jahren ging es schon so, seit ihrer ersten Begegnung. Er hatte sich in dieses fremde, traurige Mädchen verliebt, er hatte den Beschützer gespielt und stets gehofft, dass sie sich irgendwann für ihn entscheiden mochte. Und es gab schöne Zeiten. Sie verstanden sich, und Daridorius hatte erlebt, was Baliante alles konnte, was für eine außergewöhnliche Frau sie war ... hätte sein können.
Nur entscheiden konnte sie sich nie. Weder für ihn, noch für sonst irgendeine Richtung in ihrem Leben. Es war, als würde sie immer im entscheidenden Augenblick zurückzucken, im Augenblick der Freude zweifeln, im Moment des süßesten Kusses erschrecken; seitwärts fliehen, wenn sie zwei Wege vorfand, die nach vorne führten.
Daridorius fragte sich oft, woher Baliante kam, was mit ihr geschehen war. Aber er hatte stets gehofft, dass er sie mit Geduld erreichen konnte; dass es half, wenn er immer da war, wenn sie jemanden brauchte.
Und wo war er jetzt?
Die Zeit für Entscheidungen verrann.
Baliante, wir könnten so glücklich miteinander sein; alles könnte so einfach sein, wenn du nur eine andere wärest!
Daridorius erschrak vor diesem Gedanken. Er hatte etwas Hoffnungsloses an sich und das hatte er noch nie zuvor zugelassen. Wenn wir diesen Dschungel verlassen – falls wir ihn wieder verlassen! – werde ich eine Entscheidung verlangen. Oder eine Entscheidung treffen.
Er seufzte. Dieser Gedanke war nicht neu. Er hatte ihn in seinem Kopf gewendet und gedrechselt wie ein Werkstück, während vieler einsamer Abende, nachdem Baliante gegangen war.
Wo blieb nur die Lücke in diesem verdammten Unter-holz? Als sie endlich kam, zuckte Daridorius erschrocken zurück.
»Dari, was hast du?«, fragte Baliante. Dann sah sie es auch.
Eine Lücke führte wie ein Tunnel nach rechts in den Urwald hinein, eine kreisrunde Röhre. Sie war länger, als Daridorius den Umfang des dichten Bodenbewuchses am Wegesrand insgesamt eingeschätzt hätte, und die Zweige, Blätter und Farne am Rand wirkten so gleichmäßig wie eine verklebte Auskleidung. Kein Licht fiel in diesen finsteren Gang, der vielleicht anderthalb Schritte durchmaß.
»Was ist das denn?«, wollte Baliante wissen.
»Keine Ahnung«, gab Daridorius zurück. Eine der Stellen, die kein Mensch oder Hund betreten würde.
Er duckte sich ein Stück in den Gang hinein und betastete die Blätter am Rand. Sie waren mit dem umliegenden Grün so fest verbunden, dass er kaum einen Finger dazwischenschieben konnte. Er spürte feste Fäden auf seiner Handfläche, zäh und einschneidend, doch als er die Hand zurückzog, war nichts davon zu sehen.
»Sollen wir da rein?«, erkundigte sich Baliante zweifelnd. Chrysonias klammerte sich an ihrer Hand fest und versuchte seine breite Gestalt hinter ihrem zierlichen Rücken zu verstecken.