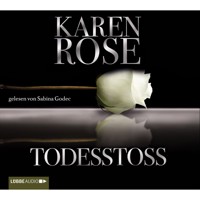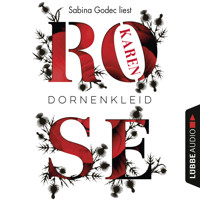14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die New-Orleans-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein toter Cop. Eine toughe Privatermittlerin. Und ein skrupelloser Mörder, der die Macht in seinen Händen hält. »Dunkelste Nacht« ist der 1. Thriller der New-Orleans-Reihe von Bestseller-Autorin Karen Rose. Der junge Star-Koch Gabe kann und will nicht glauben, dass sein Vater Rocky Selbstmord begangen haben soll. Er ist überzeugt, dass jemand den Polizisten zum Schweigen bringen wollte. Deshalb wendet er sich an den ehemaligen Partner seines Vaters: Burke Broussard hilft als Privatermittler denen in New Orleans, die sonst keine Hilfe erwarten dürfen. Die toughe Molly Sutton, Burkes Partnerin, übernimmt den Fall. Sie weiß nur zu gut, wie es ist, einen Vater unter tragischen Umständen zu verlieren. Bald finden sie und Gabe heraus, dass Rocky tatsächlich heimlich an etwas gearbeitet hat. Er hatte Kontakt zu einem jungen Mann, der Jahre zuvor, während des Hurrikans Katrina, einen Mord beobachtet hat. Doch dann war die Leiche verschwunden. Molly und Gabe ahnen nicht, über wie viel Macht der Mörder, den sie suchen, tatsächlich verfügt. Und wie weit er zu gehen bereit ist, um sein Geheimnis zu schützen … Actionreicher Thriller aus den dunkelsten Winkeln der glitzernden Südstaaten-Metropole New Orleans Die internationale Bestseller-Autorin Karen Rose steht wie keine andere für harten Thrill mit überraschenden Twists und genau der richtigen Dosis Romantik und Leidenschaft. »Dunkelste Nacht« ist ein schlafraubender Pageturner aus einer der faszinierendsten Städte der USA.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 948
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Karen Rose
Dunkelste Nacht
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Andrea Brandl
Knaur eBooks
Über dieses Buch
Der junge Star-Koch Gabe kann und will nicht glauben, dass sein Vater Rocky Selbstmord begangen haben soll. Er ist überzeugt, dass jemand den Polizisten zum Schweigen bringen wollte. Deshalb wendet er sich an den ehemaligen Partner seines Vaters: Burke Broussard hilft als Privatermittler denen in New Orleans, die sonst keine Hilfe erwarten dürfen.
Die toughe Molly Sutton, Burkes Partnerin, übernimmt den Fall. Sie weiß nur zu gut, wie es ist, einen Vater unter tragischen Umständen zu verlieren. Bald finden sie und Gabe heraus, dass Rocky tatsächlich heimlich an etwas gearbeitet hat. Er hatte Kontakt zu einem jungen Mann, der Jahre zuvor, während des Hurrikans Katrina, einen Mord beobachtet hat. Doch dann war die Leiche verschwunden. Molly und Gabe ahnen nicht, über wie viel Macht der Mörder, den sie suchen, tatsächlich verfügt. Und wie weit er zu gehen bereit ist, um sein Geheimnis zu schützen …
Actionreicher Thriller aus den dunkelsten Winkeln der glitzernden Südstaaten-Metropole New Orleans und erster Band der New-Orleans-Reihe.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
Epilog
Dank
Verzeichnis der Romane von Karen Rose und der darin auftretenden Figuren
Für meinen Liebling, Sarah. Ich bin so stolz auf dich.
Und, wie immer, für Martin – seit vierzig Jahren bist du mein allerbester Freund.
Prolog
O nein. Nein, nein, nein.« Es roch nach Tod. Der penetrante Gestank schlug Rocky Hebert entgegen, als er sich der Küchentür näherte, die seitlich ins Haus des Arztes führte. Während seiner Laufbahn hatte er so oft Verwesungsgeruch wahrgenommen, dass er ihm nicht fremd war, aber das hier war anders.
Es war … nicht wichtiger, denn alle Toten waren wichtig. Na ja, vielleicht nicht ausnahmslos alle, räumte er ein. Viele von ihnen hatten ihr Schicksal durchaus verdient. Der Doktor gehörte jedoch nicht dazu.
Es wäre von großer Bedeutung, dass der Arzt am Leben und wohlauf war.
Damit er ihm Dinge erzählte. Wichtige Dinge.
Vielleicht ist es ja gar nicht der Doktor, dachte er. Aber diese Hoffnung war vergeblich, das war ihm bewusst. Der Arzt lebte allein, und niemand kam grundlos in diese Einöde.
Vielleicht war er eines natürlichen Todes gestorben. Möglicherweise war gar nichts Schreckliches vorgefallen, sondern sie hatten einfach nur Pech gehabt, er und der Doktor.
Mit wachsender Beklommenheit betrachtete Rocky den Türknauf. Das Schloss war zerschrammt, als sei es mit Gewalt aufgestemmt worden. Er zog einen Einweghandschuh aus der Tasche und drehte den Knauf, der sich, wenig überraschend, bewegen ließ.
Das ist eine Falle. Mach kehrt und verschwinde. Aber er tat es nicht. Konnte es nicht. Er war so dicht dran, musste wissen, ob es der Arzt war oder …
Er stieß seinen angehaltenen Atem aus und sog ihn reflexartig wieder ein, als ihm der Gestank mit voller Wucht entgegenschlug. Verdammt noch mal! Seine Augen brannten, sein Magen rebellierte. Scheiße, scheiße, scheiße.
Es war der Doktor. Gewesen. Jemand hatte ihm die Kehle durchgeschnitten und …
Rocky schluckte trocken und wich einen Schritt zurück, weg von dem grauenvollen Anblick.
Die Kehle des Mannes war durchgeschnitten, sein Bauch aufgeschlitzt worden. Überall waren Blut und Gedärme und …
Rocky fuhr herum und übergab sich in die Rosensträucher vor der Küchentür. Verdammt noch mal! Er kam zu spät.
Mindestens einen Tag, den Fliegen in den offenen Wunden des Doktors nach zu urteilen.
Beide Hände auf den Knien, verharrte er vornübergebeugt über den Rosensträuchern und würgte trocken. Ich sollte die Polizei rufen. Aber nicht hier. Und schon gar nicht mit meinem normalen Handy.
Zum Glück besaß er ein Wegwerfhandy, das er während der letzten zwei Wochen benutzt hatte, um den Doktor zu drängen, zu ermutigen, anzuflehen, sich mit ihm zu treffen.
Er würde unterwegs anhalten und anrufen. Der Mann hatte etwas Besseres verdient, als auf dem Küchenboden zu verrotten.
Rocky spuckte ein letztes Mal aus und wünschte, er könnte sich einen anständigen Drink genehmigen, wünschte, er wäre nicht endlich trocken geworden.
Es gab so vieles, von dem er sich wünschte, er hätte es anders gemacht.
Mit einem leisen Stöhnen richtete er sich auf und ließ den Blick umherschweifen, um sich zu vergewissern, dass ihm nicht dasselbe Ende bevorstand wie dem armen Arzt. Doch es war niemand da. Die Stille wurde lediglich vom Quaken der Frösche in dem kleinen morastigen Kanal hinter dem Haus durchbrochen.
Allerdings gab es nicht nur Frösche dort. So dicht am Sumpf trieben sich garantiert auch Alligatoren herum.
Rocky fragte sich, weshalb der Mörder die Leiche nicht einfach ans Ufer gezerrt und ins Wasser geworfen hatte. Doch dann erstarrte er, denn er kannte die Antwort.
Ich sollte ihn finden. Die wussten, dass ich komme.
Dabei konnte er nicht einmal sagen, wer »die« waren. Seit über fünfzehn Jahren suchte er nach »denen«.
Ich war so dicht dran.
Oder?
Wahrscheinlich trieben »die« ihre Spielchen mit ihm. Katz und Maus.
Rocky zog seine Waffe. »Aber ich bin keine verdammte Maus«, brummte er und tappte unsicher in den Garten, halb in der Erwartung, dass ihn jemand erschoss, noch bevor er den rostigen Schuppen erreichte, oder von hinten angegriffen zu werden und die Klinge eines Messers an der Kehle zu spüren.
Doch nichts geschah. Er öffnete die Schuppentür und spähte hinein, wobei ihn eine Woge der Erleichterung erfasste, als er vorfand, worauf er gehofft hatte.
Bleichmittel. Rocky trug den halb vollen Kanister zu den Rosensträuchern und kippte den Inhalt über sein Erbrochenes, um jegliche DNA-Spuren zu vernichten.
Dann kehrte er zu seinem alten Ford Pick-up zurück, warf den Kanister auf die Ladefläche und setzte sich hinters Steuer. Er hatte niemanden bemerkt. Das musste nicht bedeuten, dass niemand da war, aber sein Instinkt sagte ihm, dass er längst nicht mehr leben würde, wenn es anders gewesen wäre.
Nach dreißig Minuten, auf halbem Weg nach Hause, hielt er an, nahm das Wegwerfhandy aus dem Handschuhfach und wählte den Notruf, um den Tod des Doktors zu melden, legte jedoch auf, ohne seinen Namen zu nennen.
Nach weiteren fünf Minuten ging er auf einer Brücke vom Gas, kurbelte das Fenster herunter und warf das Handy in den Fluss, wo es nie gefunden werden würde. Mehr als fünfunddreißig Jahre als Cop hatten ihn die besten Tricks und Kniffe gelehrt.
Beim Gedanken an Gabriel zögerte er. Sein Sohn würde gerade arbeiten und tun, was er am liebsten tat. Rocky war froh, dass er ihn letztes Wochenende gesehen und zum Abschied fest an sich gedrückt hatte. Froh, dass er Gabe gesagt hatte, wie sehr er ihn liebte. Denn er hatte das dumpfe Gefühl gehabt, dass es das letzte Mal gewesen war.
So ungern er die Maus in diesem Spiel sein wollte, so besaß diese Katze doch große Macht und lange, scharfe Krallen, die sie überall hineinbohren konnte. Immerhin würden sie Gabe in Ruhe lassen. Wenigstens dafür hatte er gesorgt.
Gabe wusste nichts von alldem, hatte noch nie etwas geahnt. »Ruf die Polizei, Dad!«, hatte er immer nur gesagt. Weil er immer noch der Überzeugung war, die Cops seien die Guten.
Vielleicht hätte ich ihm die Wahrheit sagen sollen. Vielleicht hätte ich ihn warnen sollen.
Vielleicht sollte ich es jetzt tun.
Nein. Es war richtig gewesen, Gabe im Unklaren zu lassen.
Aufgewühlt fuhr Rocky weiter. Kurz war er in Versuchung, einfach an seinem Haus vorbeizufahren. Jenem Heim, über dessen Schwelle er Lili als junge Braut getragen hatte und in dem ihr Sohn zu einem anständigen Mann herangewachsen war. Er war drauf und dran, den Fuß auf dem Gaspedal zu lassen. Abzuhauen.
Aber wohin? Es gab keinen Ort, wo er sich verstecken könnte.
Und was für ein Leben wäre das?
Aber Gabriel …
Seine Brust schmerzte bei der Vorstellung, seinen Sohn niemals wiederzusehen. Nicht zu Ende zu bringen, was er angefangen hatte.
Gerechtigkeit für das wahre Opfer dieses Albtraums zu erlangen.
Am Ende beschloss er, sich dem Unvermeidlichen zu stellen, denn er war kein Mann, der weglief.
Rocky bog in die Einfahrt ein und blickte zu seinem Haus, während er an den toten Arzt auf dem Küchenfußboden dachte.
Bitte, lieber Gott, mach, dass Gabe mich nicht so findet. Bitte.
Mit zitternden Händen zog er sein Handy heraus, rief die Fotos auf und betrachtete die jüngste Aufnahme: er und Gabe, letztes Wochenende, Arm in Arm in die Kamera lächelnd.
Mit der Fingerspitze zeichnete er die Gesichtszüge seines Jungen nach. Alle sagten, Gabe käme nach ihm, doch er selbst sah nur Lilis lächelnde Augen. Sie wäre stolz auf ihn. So stolz. Und sollte es zum Schlimmsten kommen, würde Rocky sie wiedersehen.
Bei dem Gedanken zog sich sein Herz zusammen. Er vermisste sie so sehr und war so unendlich müde. Damals hatte er nicht verstanden, durch welche Hölle sie mit der Chemo ging, erst als er selbst mit der Behandlung anfangen musste.
Dieser beschissene Krebs. Die Gewissheit, dass ihm die Zeit davonlief, hatte ihn gezwungen, Risiken einzugehen, die er sonst niemals eingegangen wäre. Deswegen hatte er den Arzt unter Druck gesetzt, sich mit ihm zu treffen, und nun war er tot.
Es ist alles meine Schuld. Rein verstandesmäßig wusste er, dass die Schuld natürlich beim Mörder lag – oder den Mördern, denn höchstwahrscheinlich hatte er es mit einer Hydra zu tun, und die hatte bekanntermaßen mehrere Köpfe. Doch er hatte Druck gemacht, hatte gedroht, den armen Doktor bloßzustellen. Er hatte ihm keine Wahl gelassen. Er hätte vorsichtiger sein müssen.
Es gab so vieles, das er hätte anders machen sollen.
Und wenn »die« nun hinter ihm her waren? Er hatte sich selbst ins Knie geschossen. Der Doktor war seine letzte Hoffnung gewesen. Nun würde er nie herausfinden, wer »die« waren. Weil ihm die Zeit davonlief.
Aber noch musste er weiterkämpfen. Für Gabe.
Er schloss die Foto-App und öffnete die Nachrichten. An Gabe.
Nur für alle Fälle.
Ich hoffe, du hast einen schönen Abend, mon ange, tippte er ein. Ich hab dich lieb, mein Junge.
Sollte es zum Äußersten kommen, würde Gabe es schon hinkriegen. Sein Sohn war klug. Hoffentlich klüger als ich selbst.
Rocky kramte das Ledermäppchen aus der Tasche, das er inzwischen stets bei sich trug, und kippte den Inhalt in seine Handfläche: eine Büroklammer und eine unbenutzte SIM-Karte. Er zwang sich, nicht zu zittern, als er die SIM-Karte aus seinem Handy löste und eine Rücksetzung auf die Werkseinstellungen durchführte, sodass alles Gespeicherte gelöscht wurde.
Dann legte er die neue SIM-Karte ein und schob die alte unter die Fußmatte.
Nur für alle Fälle. Sollte er die Nacht überleben, würde er die Karte holen, wieder einlegen und alles, was darauf gespeichert gewesen war, mithilfe der Cloud wiederherstellen. Sollte er morgen nicht mehr am Leben sein, würde er es denen zumindest nicht einfacher machen, wer auch immer »die« sein mochten.
Mühsam stemmte Rocky sich aus dem Wagen und zwang sich, einen Fuß vor den anderen zu setzen, bis er vor seiner Haustür stand. Er schloss die Tür auf und trat ein. Ihm blieb ein Moment, um zu registrieren, dass der Hund nicht bellte, ehe er kaltes Metall an der Schläfe spürte.
Ich hätte abhauen sollen. Aber er konnte sich nirgendwo verstecken, und eigentlich wollte er es auch nicht.
Er bedauerte nur, dass Gabe ihn nun doch finden würde.
Gabe würde um ihn trauern.
Aber dann würde er sich zusammenreißen und sein Leben wieder in die Hand nehmen. Sein Sohn war ein starker Mensch.
»Wo ist mein Hund?«, fragte Rocky leise. Sollten die seinem Hund auch nur ein Härchen gekrümmt haben …
Wortlos verpasste ihm der Eindringling einen Stoß.
Rocky taumelte vorwärts. »Wohin?«
»Ich bin in der Küche«, rief eine Stimme. »Bring ihn her.«
Rocky spürte ein Lachen in seiner Kehle aufsteigen, das als hysterisches Kichern über seine Lippen kam. Verständlich. Denn in der Küche hatten sie auch den Arzt getötet. »Klar.« Der Situation wohnte eine ganz eigene unheilvolle Poesie inne.
Rocky bewegte sich steifbeinig, wäre um ein Haar über den Schaukelstuhl gestolpert, den Lili so gern gemocht hatte. Er strich mit der Hand über das glatte Holz. Bald, mon petit chou. Bald.
Seine Augen hatten sich an die Dunkelheit gewöhnt, als er die Küche betrat. Er blieb abrupt stehen, als er den Mann auf Lilis Stuhl am anderen Ende des Tisches, gegenüber von seinem eigenen Platz, sitzen sah.
Sein hysterisches Lachen schlug in Wut um. Zwar war er dem Mann nie persönlich begegnet, trotzdem erkannte er ihn auf Anhieb.
»Runter von ihrem Stuhl«, knurrte Rocky zu seiner eigenen Überraschung. Es gab so vieles, was er sonst noch hätte sagen können … sagen müssen.
Der Mann hob lediglich seine schwarzen, von silberfarbenen Härchen durchzogenen Brauen. Er wirkte, als hätte er Geld, sah wie ein Filmstar aus.
Er schien … gelangweilt.
Am liebsten hätte Rocky ihm das Herz aus dem Leib gerissen. Als Strafe für alles, was er getan, für all die Leben, die er zerstört hatte.
Und dafür, dass er Lilis Stuhl entweiht hatte.
»Wieso sind Sie hier?«, fragte Rocky.
»Weil sich unser Tanz dem Ende neigt«, antwortete der Mann gedehnt. »Und ich musste sichergehen, dass es anständig gemacht wird. Sie hätten zuhören sollen, Rocky. Sie hätten schon vor Jahren einen Rückzieher machen sollen.«
»Habe ich doch.«
»Aber dann eben doch nicht.« Der Mann betrachtete seine Fingernägel, dann sah er Rocky an. »Setzen Sie sich.«
Der Typ hinter ihm drückte ihm die Waffe wieder gegen die Schläfe, als Rocky nicht sofort gehorchte. »Sie haben ihn gehört, Hebert. Setzen Sie sich verdammt noch mal hin.«
Dass er die Stimme des Mannes mit der Waffe erkannte, hätte ihn überraschen sollen, tat es aber nicht. Trotzig reckte er das Kinn. Er wollte sich nicht setzen, sondern wollte lieber im Stehen sterben.
Ein betrübtes Seufzen hinter ihm verriet Rocky, dass noch ein dritter Mann anwesend war. »Sie hätten es gut sein lassen sollen, Rocky. Bitte, setzen Sie sich. So ist es leichter für Sie.«
Rocky erstarrte. Auch diese Stimme erkannte er. Das konnte doch nicht sein … aber es war so. »Nein«, flüsterte er, als die Last des Verrats zu schwer wog.
Er ließ sich auf den Stuhl sinken, rief sich all das Schöne in Erinnerung, das er und Lili im Lauf der Jahre an diesem Tisch geteilt hatten – all die Geburtstage, die Feiertage, die Hochzeitstage. Ihr letztes gemeinsames Essen.
Alles, was ihn vom Ausmaß des Verrats ablenkte.
Nur vage registrierte Rocky, wie seine Waffe aus dem Holster gezogen und auf den Tisch gelegt wurde, gerade außerhalb seiner Reichweite. Der Lauf der Pistole wurde von seiner Schläfe genommen, dann hielt ihm der Mann die Nase zu und drückte seinen Kopf nach hinten.
Rocky wehrte sich, doch die Hand kniff fest zu. Ein Glas wurde gegen seine Lippen gedrückt. Rocky versuchte, die Lippen aufeinanderzupressen, damit kein Tropfen in seinen Mund sickern konnte, doch irgendwann musste er Atem schöpfen, und die scharfe Flüssigkeit brannte in seiner Mundhöhle, lief seine Kehle hinab. Bis in seinen Magen.
Drei Jahre war es her, seit er das letzte Mal Alkohol getrunken hatte, und es beschämte ihn, dass der Geschmack wie ein alter Freund war, dem man wieder begegnete.
Der Tisch begann zu schwanken, das Gesicht des Mannes auf Lilis Stuhl verschwamm.
Da muss noch etwas anderes als Schnaps in diesem Glas sein.
Nun würde Gabe denken, er hätte sein Versprechen gebrochen. Sein Versprechen, trocken zu bleiben. Das war sein letzter Gedanke. Es tut mir leid, Junge. Es tut mir so verdammt leid.
1. Kapitel
Na, sieh mal einer an, wer da mit einer Stunde Verspätung auftaucht«, bemerkte Molly Sutton gedehnt. Sie saß auf der Kante von Joys altem Schreibtisch, der zwar leicht zerschrammt sein mochte, aber prachtvolle Schnitzereien besaß und perfekt zu dem im Art-déco-Stil gehaltenen Vorzimmer von Broussard’s Private Investigations, LLC passte.
Ihr Chef, Burke Broussard, hatte eine Schwäche für schöne Dinge und liebte New Orleans. Die Miete für das am Rande des Quarters gelegene Büro mochte deutlich höher sein als das, was er in einem der Vororte würde hinblättern müssen, doch Burke war überzeugt, dass allein die Laufkundschaft die höheren Kosten wettmachte. Und ihre Kartei aus gut situierten Kunden, die »Diskrete Privatermittlungen auf höchstem Niveau« erwarten konnten, wie es der gediegene Schriftzug auf ihren Visitenkarten versprach, schien ihm recht zu geben.
Stirnrunzelnd lenkte Joy Thomas ihren elektrischen Rollstuhl mit routinierter Mühelosigkeit hinter den Schreibtisch. »Klappe. So spät bin ich gar nicht dran.«
Molly lachte. »Sonst bist du um Punkt acht hier, das weißt du genau. Davon abgesehen … redet man so mit der Frau, die einem Kaffee mitgebracht hat?« Sie hielt einen Becher aus dem Coffeeshop mit einer Zubereitung in die Höhe, wie Joy sie am liebsten mochte. »Ich habe mir schon gedacht, dass du heute Morgen ein bisschen angeschlagen sein wirst, deshalb wollte ich nicht mit leeren Händen erscheinen.«
Joy beäugte den Becher, dann nahm sie ihn mit einem widerstrebenden Nicken entgegen. »Wenn man bedenkt, dass du der Grund dafür bist, dass ich mich wie der Tod auf Latschen fühle, kann man das wohl erwarten.«
Molly konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. »Ich bin also schuld, ja?«, fragte sie und hob die Brauen. »Ich erinnere mich nicht, Ihnen die Nase zugehalten und drei Hurricanes in die Kehle geschüttet zu haben, Mrs Thomas.« Sie hob drei Finger. »Drei Hurricanes, Joy. Drei.« Sie legte den Kopf schief. »Los, wie viele Finger siehst du? Drei? Oder sechs?«
Joy zeigte ihr den Mittelfinger. »Ich sehe nur einen.«
Wieder hatte Molly Mühe, nicht laut aufzulachen. Joy war Mitte fünfzig und wirkte so … förmlich, züchtig, um nicht zu sagen matronenhaft. Sie war stets perfekt frisiert und angezogen, als wäre sie auf dem Weg zum Nachmittagstee, inklusive der obligatorischen Perlenkette um den Hals. Fehlten nur die langen Handschuhe, von denen Molly sicher war, dass sie auch davon ein Paar besaß.
Auf den ersten Blick mochte Joy überkorrekt und gebrechlich wirken, doch die Frau war die Stärke in Person. Sie war eine der ersten schwarzen Frauen gewesen, die es innerhalb des NOPD zum Detective gebracht hatten, allerdings hatte ihre Karriere ein jähes Ende gefunden, als sie in Ausübung ihrer Pflicht verwundet worden war. Danach hatte sie sich noch einmal komplett neu orientiert und ihren Abschluss als Finanz- und Wirtschaftsprüferin gemacht, um den Lebensunterhalt für sich selbst und ihre vier – inzwischen allesamt wunderbare Erwachsene – Teenagerkinder zu verdienen.
Joy war sehr viel mehr als die Büroleiterin und Buchhalterin. Sie war quasi die Mutter der Kompanie.
Molly, die ihre eigene Mutter bereits verloren hatte, ließ sich nur zu gern von Joy umsorgen.
»Ich verstehe überhaupt nicht, wieso es dir nicht dreckig geht«, brummte Joy, doch nach dem ersten Schluck Kaffee hellte sich ihre Miene auf. »Hmm. Der ist ja noch heiß.« Sie kniff die Augen zusammen. »Du kleines Miststück. Du bist auch zu spät gekommen.«
Molly grinste ungerührt. Burke war ein lockerer Chef, außerdem glich es sich wieder aus, denn wenn ein Fall anstand, leisteten sie alle jede Menge Stunden ab. »Schuldig im Sinne der Anklage.«
Joy nippte erneut an dem Kaffee und schloss die Augen. »Das ist das gute Zeug. Nicht diese verbrannte Brühe aus dem anderen Coffeeshop.«
»Nie im Leben«, erklärte Molly feierlich. »Und ich bin nicht verkatert, weil ich ja zur Fahrerin auserkoren wurde, die euch und eure jämmerlichen Hinterteile sicher nach Hause schaffen musste. Gern geschehen, meine Liebe.«
Joy schüttelte den Kopf, doch die rasche Bewegung schien ziemlich schmerzhaft zu sein. Sie fuhr ihren Computer hoch und lehnte sich mit gerunzelter Stirn in ihrem Rollstuhl zurück. »Ich verstehe immer noch nicht, wieso ausgerechnet du fahren musstest, schließlich war es dein Geburtstag. Du hättest diejenige sein sollen, die sich drei Hurricanes genehmigt.«
Achselzuckend vergrub Molly die Hände in den Hosentaschen. »Chelsea steht gerade ziemlich unter Druck und musste mal ein bisschen Dampf ablassen. Vor allem war die Gelegenheit günstig, weil sie einen Babysitter hatte. Ach ja, richte Louisa bitte ein Dankeschön aus, dass sie bei Harper geblieben ist. Das war sehr nett von ihr.«
Joys Tochter Louisa war Studentin und stand kurz vor dem Abschluss. Sie hätte genauso gut mit ihren Freundinnen losziehen können, hatte sich aber bereit erklärt, bei Mollys achtjähriger Nichte zu bleiben. Harper hatte während der vergangenen Jahre viel durchgemacht, und es gab nur wenige, denen Molly und ihre Schwester Chelsea Harper anvertrauten.
Joy lächelte stolz. »Ja, meine LouLou ist ein tolles Mädchen. Ich soll mich in ihrem Namen für das Abendessen bedanken, das ihr ihr nach Hause geschickt habt. Mit Polenta und Garnelen aus dem Choux hatte sie nicht gerechnet.«
»Nachdem sie kein Geld nehmen wollte, war es das Mindeste, was ich tun konnte.« Molly hatte ihren Geburtstag im Le Petit Choux, ihrem Lieblingsrestaurant im Quarter, gefeiert, dessen Name ein Wortspiel war. Chou war ein Kosename, während die petits choux die kleinen Windbeutel bezeichnete, für die das Restaurant neben seinem hervorragenden Essen und seinen anderen Desserts berühmt war. Und für das Sahneschnittchen von Küchenchef.
Joy grinste anzüglich. »Ein Blick auf Gabe Hebert wäre ihr lieber gewesen.«
Molly lachte, während ihre Wangen warm wurden. »LouLou ist nicht auf den Kopf gefallen.«
Sie müsste lügen, wenn sie behaupten würde, dass sie nicht ebenfalls die Augen nach dem Küchenchef und Mitbesitzer offen gehalten hatte, der seit dem Gewinn eines Fernsehpreises des Food-Network-Kanals im vergangenen Jahr zur neuen Prominenz von New Orleans zählte. Der Sieg hatte dem Restaurant einen steten Zustrom an Touristen und Einheimischen beschert, von denen mindestens die Hälfte hauptsächlich Schlange stand, um einen Blick auf Küchenchef Hebert zu erhaschen.
Gabriel Hebert, dessen Nachname in dem für die Stadt typischen französisch-amerikanischen Zungenschlag »Ay-bear« ausgesprochen wurde, war einen Meter zweiundachtzig groß und extrem gut aussehend, mit einem markanten Kiefer, einem sexy Lächeln und einem dichten Schopf dunkelroter Haare, die sich in der für die Gegend typischen feuchten Hitze lockten – allesamt Dinge, auf die Molly stand. Von seinen breiten Schultern in der Kochjacke ganz abgesehen. Und – auch wenn sie niemals offen zugeben würde, ihn angestarrt zu haben – seinem durchaus ansehnlichen Hintern in der schwarzen Hose, die seine Arbeitskluft komplettierte.
Obwohl sie kein Interesse an einer Beziehung hatte, ließ sie sich die Gelegenheit nicht entgehen, ihn bei der Arbeit anzuschmachten. Gestern Abend hatte er seinen berühmten dekadenten Schokoladenkuchen mit der einzelnen Kerze darauf sogar persönlich serviert und neben Molly gestanden, während ihre Schwester und ihre Freundinnen ihr ein Geburtstagsständchen gebracht hatten, bevor er ihr das erste Stück abgeschnitten und mit einer ausschweifenden Geste überreicht hatte.
Dasselbe hatte er die letzten drei Jahre anlässlich ihres Geburtstags getan.
So wie für alle Gäste, die ihre Geburtstage im Choux feierten.
Deshalb war es an sich nichts Besonderes, trotzdem hatten Mollys Wangen heißer geglüht als die blöde Kerze auf dem Kuchen – was ihrer Schwester logischerweise nicht entgangen war. Selbst der größte Suff schmälerte nicht die Schärfe von Chelseas Blick für solche Dinge, und natürlich hatte sie sie gnadenlos damit aufgezogen, nachdem sie die anderen zu Hause abgesetzt und endlich allein im Wagen gesessen hatten. Zum Glück neigte Chelsea unter Alkoholeinfluss zur Schläfrigkeit und hatte bereits geschnarcht, als Molly den Wagen in der Parkgarage ihres Apartmentkomplexes abgestellt hatte.
»Auf den Kopf gefallen ist meine Tochter definitiv nicht. Selbst ich finde, dass dieser Mann eine Augenweide ist«, erklärte Joy und blickte entsetzt auf ihren Computerbildschirm. »Ach du meine Güte!«
Molly beugte sich vor. »Was ist denn?«
Joy verkleinerte eilig den Ausschnitt. »Da ist ein Vertraulichkeitsvermerk drauf«, erklärte sie ernst. »Und hast du nicht eine Besprechung heute Morgen?«
Molly respektierte es, wenn eine Mail als vertraulich markiert war, und würde Joy nicht bedrängen. »Ich wünschte, es wäre so, aber nachdem ich letzte Woche meinen Fall abgeschlossen habe, wartet bloß tonnenweise Papierkram auf mich. Und niemand sollte so etwas am Montag nach seinem Geburtstag zu erledigen haben.«
»Aber du hast auch gesagt, niemand sollte am Freitag vor seinem Geburtstag Papierkram zu erledigen haben«, sagte eine trockene Männerstimme. »Oder am Donnerstag. Oder am Mittwoch.«
Molly drehte sich um und sah ihren Chef im Türrahmen stehen. Burke Broussard war Mitte vierzig und hatte sich, von ein paar silbrigen Strähnen an den Schläfen abgesehen, in den zehn Jahren, seit er bei den Marines ihr kommandierender Offizier gewesen war, kaum verändert. »Morgen, Burke. Dir habe ich auch einen Kaffee mitgebracht.« Sie hielt einen weiteren Becher hoch.
»Dem Herrn sei Dank dafür«, erklärte er mit Nachdruck. »Ich bin schon seit sechs Uhr hier.«
Molly mimte einen entsetzten Schauder. »Wieso das?« Nach ihrem letzten Einsatz beim Marine Corps hatte Molly damit aufgehört, bei Sonnenaufgang aufzustehen, wohingegen Burke immer noch eine Hassliebe mit den frühen Morgenstunden verband: Er behauptete zwar, diese Tageszeit nicht ausstehen zu können, trotzdem kam er nun sogar immer früher ins Büro. Der Mann war verrückt.
Burke war ein verflixt heller Kopf, ehrgeizig und leidenschaftlich und unbeschreiblich großzügig. Aber wenn es um den Arbeitsbeginn ging, war dem Mann schlicht nicht zu helfen.
»Komm in mein Büro«, sagte er. »Ich habe einen neuen Mandanten, den du kennenlernen solltest.«
Joys Augen weiteten sich noch mehr. Sie manövrierte ihren Rollstuhl so, dass sie zusehen konnte, wie Molly in Burkes Büro marschierte.
Und Molly verstand auf Anhieb.
Auf dem Stuhl an Burkes Konferenztisch saß kein Geringerer als Gabriel Hebert, chef extraordinaire des Choux. Er sah müde, angespannt und sehr, sehr unglücklich aus.
Sie fragte sich, ob er schon am Vorabend so unglücklich gewesen war. Er hatte müde gewirkt, ja, aber nicht so bestürzt. Natürlich könnte er auch zu den Menschen gehören, die es perfekt beherrschten, andere nur das sehen zu lassen, was sie sehen sollten.
»Molly, das ist Mr Hebert. Gabe, das ist Miss Sutton. Sie wird deinen Fall übernehmen.«
Mollys Brauen schossen hoch. Wie bitte?
Gabes Brauen hoben sich ebenfalls, ehe er sie verärgert zusammenzog. »Was? Du schiebst mich also ab?« Er sprang auf. »Was soll das, Burke?«
Die beiden Männer könnten nicht unterschiedlicher sein. Burkes olivfarbener Teint war ein Zeugnis der vielen Stunden, die er in seiner Freizeit auf dem Rennrad verbrachte, wohingegen Gabes Haut so zart gebräunt war, dass man immer noch von Blässe sprechen könnte. Und wie viele Rothaarige hatte auch er zahllose Sommersprossen auf der Nase.
Molly hatte schon immer den Drang verspürt, sie mit den Fingerspitzen nachzufahren, und sie fragte sich, wo er sonst noch welche haben mochte.
Beide Männer waren groß, wobei Burkes stämmiger Körperbau in krassem Gegensatz zu Gabes schlanker Gestalt stand. Molly genoss es, dem Küchenchef bei der Arbeit zuzusehen – seine Bewegungen erinnerten an einen choreografierten Tanz.
Lediglich ihre Akzente glichen sich. Beide hatten den gedehnten Zungenschlag, der typisch für New Orleans war und der an heiße, von Jazzklängen erfüllte Sommerabende denken ließ. Mit dem Unterschied, dass Gabes Stimme ihr einen wohligen Schauder über den Rücken jagte und Burkes nicht.
Angesichts von Gabes Wut war diese Reaktion vermutlich nicht angemessen, doch ihr Körper tat, was er wollte. Ist eben so.
Burke bedeutete Gabe, sich wieder zu setzen. »Ich bin zu nahe dran, Gabe. Dein Vater … er hat auch mir sehr viel bedeutet. Er war mein Partner. Wir waren füreinander da, immer. Was auch im Dienst passiert ist, ich konnte mich auf ihn verlassen. Er hat mich nie enttäuscht. Ich will nicht beschwören, dass ich unter diesen Voraussetzungen unvoreingenommen bleiben kann.«
Gabe setzte sich nicht. »Inwiefern unvoreingenommen?«, fragte er mit unüberhörbarer Wut.
»Im Hinblick auf die Wahrheit«, erwiderte Burke nur. »Wie auch immer sie aussehen mag. Molly ist meine rechte Hand. Sie wird dich nicht im Stich lassen. Und jetzt setz dich bitte. Solltest du jemand anderes haben wollen, nachdem du mit ihr gesprochen hast, finden wir auch dafür eine Lösung, keine Sorge. Du kannst dich auf ihre Diskretion verlassen, völlig unabhängig davon, für wen du dich letztlich entscheidest.«
Gabe atmete hörbar durch. »Okay.« Er setzte sich wieder hin und warf Molly, die immer noch reglos im Türrahmen stand, zuerst einen Blick, dann noch einen zweiten zu. »Kann es sein, dass ich Sie …« Er hielt inne. »Stimmt. Gestern Abend. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Miss Sutton.«
Burke wirkte mit einem Mal nicht allzu erfreut. »Ihr beide kennt euch?«, fragte er und sah von einem zum anderen.
»Nein«, antwortete Gabe.
»Nein«, antwortete Molly im selben Atemzug. »Ich war ein paarmal zu Gast in seinem Restaurant, das ist alles. Die Mädels haben mich gestern Abend dorthin ausgeführt. Ich habe dir etwas von dem Kuchen mitgebracht, Burke«, fügte sie lahm hinzu. »Er steht im Kühlschrank.«
»Danke, Molly.« Sichtlich erleichtert, deutete Burke auf einen der freien Stühle. »Setz dich doch zu uns. Bestimmt ist dir inzwischen klar, dass dieser Fall größte Diskretion erfordert.«
Molly nickte. »Ja. Mr Hebert, sollten Sie zu dem Schluss kommen, dass ich nicht die richtige Wahl für Sie bin, mache ich Ihnen keinen Vorwurf. Aber sollten Sie sich für mich entscheiden, werde ich mein Bestes geben.«
Resigniert ließ Gabe die Schultern sacken. »Das ist gut zu wissen, danke.« Er schluckte. »Ich muss herausfinden, wer meinen Vater getötet hat.«
Molly sah Burke an. »Ist die Polizei involviert?«
Gabe lachte bitter. »Wahrscheinlich, ja.«
Burke seufzte. »Damit meint er, dass jemand aus Polizeikreisen an der Tat beteiligt sein könnte. Oder sogar verantwortlich dafür ist.«
Molly lehnte sich zurück. Sie wünschte, Burkes Worte überraschten sie. »Also gut, dann legen Sie mal los.«
Molly Sutton war … Gabe wusste nicht recht, wie er sie beschreiben sollte. Von heiterer Gelassenheit. Unerschütterlich. Ihre Erscheinung war tadellos trotz der bereits drückenden Schwüle im Raum, dabei trug sie einen Blazer, obwohl es Ende Juli war. Du liebe Zeit. Genauso war sie auch gestern und an jedem anderen Abend im Choux gewesen.
Denn, ja, sie war ihm aufgefallen. Jedes Mal. Diese Frau hatte etwas an sich, das seinen Blick auf sich zog. Na schön, mehrere Dinge. Sie war genau sein Typ: goldblond mit dem Gesicht einer Grace Kelly und dem Körper einer Marilyn Monroe. Aber es ging um mehr als ihr Äußeres. Sie hatte eine beruhigende Ausstrahlung.
Sie war der einzige Gast gewesen, dem er gestern Abend den Geburtstagskuchen persönlich serviert hatte. Alle anderen hatte er Patty, seiner Cousine und Mitbesitzerin des Choux, aufs Auge gedrückt. Mollys Schokokuchen hatte er hingegen mit so viel Tamtam präsentiert, wie er nur konnte.
Natürlich hatte ihn Patty in der Küche damit aufgezogen, wenn auch keineswegs bösartig. Schließlich ahnte sie nicht, was er getan hatte … weshalb er innerlich so hin- und hergerissen war. Denn er hatte es ihr verheimlicht.
Dabei war es keineswegs seine Absicht gewesen, diesen Zustand ewig andauern zu lassen. Nur, bis sein Verdacht bestätigt war. Ansonsten hielte sie ihn womöglich noch für komplett paranoid und alarmierte den psychologischen Notdienst.
Leider hatte sich herausgestellt, dass er keineswegs unter Paranoia litt, sondern dass sein Verdacht richtig gewesen war.
Und jetzt erzählte er Patty nichts davon, weil er sie nicht in Gefahr bringen wollte. Denn genau die drohte ihnen allen. Und sie hatte bereits ein erstes Opfer gefordert.
Doch nun sollte er Molly Sutton mit in dieses Verderben reißen? Allein ihr reinen Wein einzuschenken, würde sie ins Fadenkreuz eines Mörders katapultieren. Seine Eltern hatten ihn zu einem Menschen erzogen, der so etwas nicht zulassen würde.
»Miss Sutton«, sagte er und rang sich ein freundliches Lächeln ab, »ich bin nicht sicher, ob Sie die Richtige für diesen Fall sind.«
Sie setzte ebenfalls ein Lächeln auf, nur lag keinerlei Freundlichkeit darin. Es war auch nicht böse. Sondern nur … vorsichtig. »Kann sein, aber vielleicht bin ich es ja doch.« Sie hatte ebenfalls einen Südstaatenakzent, nur hörte er sich nicht nach New Orleans an. Vielleicht Georgia. Oder North oder South Carolina. »Vielleicht erzählen Sie einfach, worum es geht, und wir sehen dann weiter.«
Gabe warf Burke einen Blick zu, der die Stirn gerunzelt hatte. »Was bereitet dir denn Bauchschmerzen, Gabe?«, fragte er. »Sei ganz offen, aber zuerst würde ich dir gern mehr über Molly erzählen. Sie hat unter meinem Kommando gedient und war eine der besten Marines überhaupt. Ich würde ihr jederzeit mein Leben anvertrauen und, was noch viel wichtiger ist, deines.«
Gabe schluckte gegen die Tränen an, die zu seiner Verärgerung in seinen Augen brannten. Verdammt noch mal! »Und was ist mit ihrem?«, krächzte er. »Was, wenn ich sie nicht hineinziehen will? Es könnte gefährlich werden.«
Burke setzte zu einer Erwiderung an, doch Molly schüttelte den Kopf. »Nein, Burke, es steht ihm zu, Zweifel zu haben.« Sie hob kaum merklich das Kinn und sah Gabe in die Augen. »Ich habe einen schwarzen Gürtel in drei Kampfkunstarten, Mr Hebert. Ich mag keine Scharfschützin sein, aber verteidigen kann ich mich.« Ein Muskel zuckte in ihrer Wange, was ihm verriet, wie sehr sie um Fassung rang. »Ich habe Menschen getötet, um andere zu schützen. Sollten Sie also Bedenken haben, ich könnte körperlich oder mental der Aufgabe nicht gewachsen sein oder dass Sie wegen mir in Gefahr schweben, kann ich Ihnen versichern, dass ich durchaus in der Lage bin, auf uns beide aufzupassen.«
Gabe schüttelte den Kopf. Es betrübte ihn, was sie erlebt haben oder zu tun gezwungen gewesen sein mochte, doch das spielte hier keine Rolle. Einen korrupten Polizisten zur Strecke zu bringen, war nicht dasselbe, wie einen Menschen im Kampf zu töten. Zumindest sah er es so. Aber inzwischen wusste er nicht mehr, was er glauben sollte. Ich bin doch bloß ein gewöhnlicher Koch, verdammt noch mal. »Im Krieg zu töten, ist nicht dasselbe.«
»Ich habe nicht im Krieg getötet«, erwiderte sie nur, doch hinter den knappen Worten ahnte er eine sehr viel komplexere Geschichte, die er nur zu gern erfahren würde. »Also«, fuhr sie fort und schnitt eine Grimasse, »natürlich habe ich auch das getan. Ich wollte damit sagen, dass ich sehr gut auf mich und jeden in meiner Obhut aufpassen kann.«
»Erzähl ihr von deinem Vater, Gabe«, forderte Burke ihn leise und voller Mitgefühl auf. »Wie gesagt, solltest du am Ende immer noch Bedenken haben, finde ich jemand anderes für dich. Notfalls kümmere ich mich selbst darum, wenn du darauf bestehst. Aber gib Molly wenigstens eine Chance. Bitte. Dein Vater hat mir sehr viel bedeutet, deshalb will ich, dass er meine beste Mitarbeiterin bekommt, und das ist Molly.«
Gabe seufzte erschöpft. »Na gut. In Wahrheit weiß ich noch nicht einmal genau, was Sache ist. Ich weiß nur, dass mein Vater vor sechs Wochen gestorben ist und es nach Selbstmord aussah.«
»Aber das war es nicht«, folgerte Molly.
»Nein. Zumindest kann ich es mir nicht vorstellen.« Gabe wählte seine Worte mit Bedacht. »Jedenfalls will ich es nicht glauben. Und wenn dem nicht so war, muss derjenige dafür bezahlen, der meinen Vater getötet hat.«
»Dann will ich das ebenfalls.« Molly legte den Kopf schief, sodass das durch die Buntglasfenster einfallende Licht die goldfarbenen Strähnen in ihrem blonden Haar aufleuchten ließ. »Ihr Vater war früher Burkes Partner, sprich, er war ein Cop?«
»Ja. Er hieß Robert Hebert, aber alle haben ihn Rocky genannt. Vor sechs Monaten ist er nach siebenunddreißig Jahren Dienst beim NOPD in den Ruhestand gegangen.« Gabes Stimme brach. Sein Vater war so viel mehr als ein Cop gewesen … niemand hätte sich einen besseren Dad wünschen können als ihn. »Er war gerade einmal siebenundfünfzig.«
Obwohl er ihr ansah, wie leid es ihr tat, machte sie keine Anstalten, es auszusprechen. »Und wie kommen Sie darauf, dass er ermordet wurde?«
Die Frage war nicht herablassend gemeint, denn Molly glaubte ihm schon jetzt. Zumindest glaubte sie, dass er davon überzeugt war, was für den Moment genügte.
»Mein Vater hat sich in der letzten Zeit vor seinem Tod seltsam benommen. Er war ungewöhnlich schreckhaft, und mehr als einmal habe ich mitbekommen, wie er über die Schulter gesehen oder eine Menschenmenge mit Blicken abgesucht hat, wie Cops es machen, wenn sie nach einem bestimmten Gesicht Ausschau halten.«
»Er war also auf der Hut. Oder hatte sogar Angst. Wissen Sie, warum?«
»Nein«, presste Gabe frustriert hervor. »Eines Tages, es war etwa zwei Wochen vor seinem Tod, habe ich ihn bei etwas erwischt, als er an seinem Laptop saß. Als er mich gesehen hat, wurde er kreidebleich und hat ihn ganz schnell zugeklappt.«
Sie nickte, ohne den Blick von ihm zu lösen. Ihre Augen waren blaugrün. Wobei nicht die Farbe wichtig war, sondern die messerscharfe Intelligenz, die sich darin ablesen ließ. »Und konnten Sie nach seinem Tod einen Blick auf diesen Laptop werfen?«, fragte sie.
Gabe nahm wohlwollend zur Kenntnis, dass sie davon ausging, er hätte es zumindest versucht. »Ja. Aber es war alles gelöscht. Blitzblank, wie frisch aus der Fabrik.«
Sie zog die Brauen hoch. »Tja, Scheiße«, sagte sie, wobei sie den Kraftausdruck auf drei Silben zog.
Überrascht lachte er auf. »Ja, das trifft es ziemlich gut.«
»Ihr Vater könnte alles gelöscht haben. Oder derjenige, der ihn getötet hat. Haben Sie ihn einem IT-Spezialisten zur Überprüfung gegeben?«
»Er hat ihn dabei«, schaltete sich Burke ein. »Ich gebe ihn Antoine, sobald er kommt.«
Antoine Holmes war ihr IT-Guru.
»Gut«, sagte sie. »Falls noch irgendetwas darauf sein sollte, findet Antoine es. Was ist mit seinem Handy?«
Gabe schüttelte den Kopf. »Es wurde nicht gefunden.« Er musste tief Luft holen, da sich seine Brust allein beim Gedanken an die letzte Nachricht seines Vaters zusammenzog. »Am Abend seiner Ermordung hat er mir um Viertel vor zwölf noch eine Nachricht geschickt, in der stand, dass er mich liebt.« Er schluckte trocken. »Folglich hatte er sein Handy zu dem Zeitpunkt noch bei sich.«
Mollys Seufzen klang zutiefst betrübt. »Ihr Dad hatte also vor etwas Angst, und was auch immer er auf seinen elektronischen Geräten überprüft hat, ist weg. Zumindest für uns normalsterbliche Nicht-Hacker. Doch weshalb nimmt sein Mörder das Handy mit, den Laptop aber nicht? Und es schockiert mich, ehrlich gesagt, dass die Polizei den Laptop nicht als Beweismittel sichergestellt hat.«
»Mich nicht«, warf Burke düster ein.
Gabe ebenso wenig. Wieder spürte er Wut in sich aufsteigen. »Die Cops haben eine ganze Menge nicht getan.«
»Weshalb Sie glauben, dass sie da mit drinhängen?«, folgerte sie sachlich. »Was hat der Rechtsmediziner gesagt?«
Gabes Wut schwoll zu einem Geysir an, denn die verdammten Elektronikgeräte waren am wenigstens der Grund für seine Überzeugung, dass die Cops in der Sache mit drinsteckten. »Nicht viel. Eine Autopsie hat er jedenfalls nicht durchgeführt. Oder zumindest keine gründliche.«
Mollys Augen wurden schmal. »Wieso nicht?«
»Weil ihm jemand gesagt hat, er solle nicht so genau hinsehen«, antwortete Gabe bitter. »Sagt zumindest sein Assistent, der ein anständiger Kerl zu sein scheint. Ich bin hingefahren, um mich nach den Fortschritten zu erkundigen, weil die Cops mich abgewimmelt haben.«
Molly zog ihr Handy aus der Tasche und öffnete ihre Notizen-App. »Wie heißt der Assistent?«
»Harry Peterson.« Gabe sah, wie sie den Namen eintippte. »Er wollte mir nicht sagen, welcher Cop das angeordnet hat, aber er meinte, er könne sich nicht länger im Spiegel ansehen, wenn er mir vorenthielte, dass da irgendetwas faul sei. Ehrlich gesagt, mache ich mir ein wenig Sorgen um ihn. Er ist sehr jung und wirkte verängstigt.« Gleichzeitig aber sehr entschieden, wofür Gabe größten Respekt und Dankbarkeit empfand. »Noch ist der Bericht nicht offiziell fertiggestellt. Wann immer ich bei der Gerichtsmedizin anrufe, um nachzuhaken, heißt es, man sei wegen ›Überlastung‹ noch nicht dazugekommen und melde sich zu gegebener Zeit bei mir.«
Molly sah Burke an. »Könnten wir Peterson im Auge behalten? Nur für alle Fälle? DeShawn arbeitet doch gerade in der Rechtsmedizin, stimmt’s?«
Burke nickte. »An ihn habe ich auch gedacht. Ich überprüfe das mal.«
Gabe sah zwischen den beiden hin und her. »Wer ist DeShawn?«
»DeShawn Holmes«, antwortete Burke. »Er ist der Bruder von Antoine, unserem IT-Spezialisten. DeShawn absolviert gerade sein Assistenzjahr in der Rechtsmedizin. Er ist absolut vertrauenswürdig und gut ausgebildet, sprich, sollte etwas passieren, kann er jederzeit helfen.«
Gabe runzelte die Stirn. »Inwiefern gut ausgebildet?«
»Er hat ebenfalls gedient.« Molly lächelte. »In der Armee, nicht bei den Marines, aber daraus machen wir ihm keinen Vorwurf.«
»Sein anderer Bruder ist ebenfalls Cop«, fügte Burke hinzu, »aber einer von denen, die mein Vertrauen genießen.«
Gabe zog ein finsteres Gesicht. »Aber meines nicht. Ich kenne den Mann nicht.«
Burke schien es ihm nicht übel zu nehmen. »Aber mir vertraust du?«
»Ja. Weil du nicht mehr dabei bist.« Gabe erinnerte sich noch an den Tag, als Burke den Dienst beim NOPD quittiert hatte. Sein Vater war damals am Boden zerstört gewesen, weil Burke zu den wenigen gehört hatte, deren Unterstützung er sich stets sicher gewesen war.
Burke zuckte die Achseln. »Ich bin auf dem Laufenden, wer gerade dabei ist. Antoines und DeShawns Bruder gehört zu meinen engsten Freunden. Er ist … sagen wir mal … eine überaus hilfreiche Informationsquelle, seit ich in die Privatwirtschaft gewechselt bin.«
»Was besser nicht aus diesem Büro dringen sollte«, murmelte Molly, deren Lächeln verflogen war. »Ich meine es ernst, Mr Hebert. Es könnte unseren Freund seine Stelle und vielleicht sogar das Leben kosten.«
Gabe schluckte schwer. Mr Hebert, das war sein Vater gewesen. Und der war tot. Sollte dieser Cop Burke helfen können, den Mörder seines Vaters zu finden, würde er seinen Hass auf denjenigen innerhalb des NOPD, der die Ermittlungen in seinem Fall blockiert hatte, zügeln müssen. Sein Vater war stets ein guter Cop und ein anständiger Mensch gewesen, deshalb musste Gabe daran glauben, dass auch andere so waren und Burkes Instinkt ihn nicht trog.
Sein Vater hätte seinem Partner jederzeit sein Leben anvertraut, und nun würde Gabe die Umstände seines Todes in Burkes Hände legen müssen. »Ich verstehe. Natürlich dringt kein Wort über meine Lippen. Und bitte sagen Sie doch Gabe zu mir. Mr Hebert … das war mein Dad.«
Wieder zeichnete sich Mitgefühl auf ihren Zügen ab. »Ich verstehe Sie gut, Gabe. Auch ich habe meinen Vater verloren.«
Ihr Mitleid ärgerte ihn. »Aber er wurde nicht ermordet. Bei allem Respekt, Ma’am, aber das ist wohl etwas anderes.«
Burkes Miene verriet, dass er zu weit gegangen war.
Mollys Lächeln war dünn geworden, und wieder zuckte der einzelne Muskel in ihrer Wange. »Man weiß ja, wie das mit Vermutungen so ist, Mr Hebert.«
Alles klar. Sie waren also wieder beim Nachnamen. Er war ihr auf die Füße getreten, doch sie blieb weiter professionell und höflich. Also musste er dasselbe tun. »Es tut mir leid. Ich … ich will mich gar nicht rausreden. Bitte entschuldigen Sie, Miss Sutton.«
Sie nickte knapp. »Danke. Entschuldigung angenommen. Und Sie haben recht. Jeder Fall ist anders, trotzdem verstehe ich zumindest ein Stück weit, was Sie gerade durchmachen. Mehr wollte ich damit gar nicht sagen.« Sie drückte die Schultern durch. »Aber zurück zum Geschäftlichen. Dass keine gründliche Autopsie vorgenommen wurde, ist kein gutes Zeichen, das will ich nicht verhehlen, aber es bedeutet nicht, dass wir nicht andere Quellen für unsere Ermittlungen heranziehen könnten.«
Gabe lächelte grimmig. »Ich habe nicht gesagt, dass keine Autopsie vorgenommen wurde, sondern nur, dass der Gerichtsmediziner keinen Finger gerührt hat.«
Molly runzelte die Stirn, dann schien der Groschen zu fallen, und sie lächelte. »Haben Sie eine private Autopsie durchführen lassen, Mr Hebert?«
»Worauf Sie sich verlassen können.«
2. Kapitel
Xavier Morrow überlief ein Schauder, obwohl ihm eigentlich gar nicht kalt war. Schon jetzt hatte es über dreißig Grad.
Er hatte Angst. Und er hatte keine Ahnung, warum, weshalb er sich total dämlich vorkam. Was ihn wiederum ärgerte.
Carlos stieß ihn so fest an, dass er zusammenzuckte. »Yo, X.« Sein bester Freund sah sich wiederholt um. »Wieso lässt du deinen Kopf herumwirbeln wie einen Deckenventilator?«
»Weiß ich auch nicht.« Wieder sah Xavier sich suchend um, doch ringsum saßen nur Leute beim Frühstück. So wie jeden Montag, wenn er sich mit Carlos in ihrem Lieblingsdiner in der Nähe des Campus der Rice University traf. Der Laden war während seiner College-Zeit quasi sein zweites Zuhause gewesen, und es würde ihm fehlen, nicht länger zur Belegschaft zu gehören. Aber heute Morgen war es aus irgendeinem Grund anders. »Kennst du das Gefühl, angestarrt zu werden?«
Carlos grinste. »Sobald ich eine Bar betrete.«
»So meine ich es nicht. Leider.«
Carlos’ Grinsen schlug in ein Stirnrunzeln um. »Was ist los?«
Xavier zuckte die Achseln. »Weiß auch nicht.«
»Es liegt an dem Typen, stimmt’s?«, fragte Carlos aufgebracht. »Dieser alte Sack, der dich immer mal wieder besucht.«
Xavier sah ihn verblüfft an. »Woher … ach, egal.« Wie Carlos jemals zum Lernen kam, war Xavier ein Rätsel, da er sich viel lieber und intensiver mit True-Crime-Sendungen beschäftigte. Von denen einige so brutal waren, dass Xavier davon fast genauso viele Albträume bekam wie von dem wahren Verbrechen, dessen Zeuge er vor vielen Jahren geworden war. »Nein, heute nicht. Er … er ist tot.«
Carlos riss die Augen auf. »Was? Seit wann? Wer war der Typ überhaupt?« Er beugte sich über den Tisch. »Hat er dich bedroht?«
»Nein! Natürlich nicht.« Rocky war eher so etwas wie sein Schutzengel gewesen. »Er war ein Freund von jemandem, den ich vor langer Zeit kannte.«
Was mehr oder weniger der Wahrheit entsprach, obwohl Rocky der Frau nie begegnet war, die sie zusammengeführt hatte. Diese Nacht hatte in ihnen beiden Spuren hinterlassen, wenn auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
Carlos lehnte sich zurück. »Tja, tut mir leid, dass er gestorben ist. Warst du auf seiner Beerdigung?«
Xavier schüttelte den Kopf. »Die fand in New Orleans statt. Ich … also, ich will da nicht wieder hin.« Nie wieder.
Carlos runzelte neuerlich die Stirn. »Und? Willst du es mir nicht erzählen?«
Xavier öffnete den Mund, schloss ihn jedoch sofort wieder, weil er nicht wusste, was er darauf antworten sollte.
Nein, verdammt. Das kostet uns bloß beide das Leben. Denn Carlos konnte beim besten Willen kein Geheimnis bewahren.
»Es steht mir nicht zu, die Geschichte zu erzählen«, sagte er nur. »Lass gut sein, okay?«
Carlos wurde untypisch ernst. »Wovor hast du denn solche Angst? Mir kannst du es sagen, X. Ich verrate es auch niemandem, versprochen.« Er legte sich die Hand aufs Herz und hob sie dann feierlich. »Großes Ehrenwort.«
»Das würde ich ja, wenn ich wüsste, was Sache ist, aber ich weiß es nicht. Es ist nur …« Er atmete hörbar aus. »Ich dachte heute Morgen, ich werde verfolgt, aber wann immer ich stehen geblieben bin und mich umgesehen habe, hörten die Schritte hinter mir auf.«
Bestimmt hatte er es sich nur eingebildet. Anders konnte es nicht sein. Seit Rockys Tod vor sechs Wochen war er nervös.
Es gebe keine Zufälle, hatte Rocky stets gesagt.
»Dann begleite ich dich eben«, sagte Carlos mit einem Nicken, das keinen Widerspruch zuließ.
Xavier lächelte. »Du wirst mir fehlen, Mann.«
Das stimmte. Schon seit der ersten Klasse war Carlos sein Freund – zwei schwarze Jungs in einem Meer aus weißen Gesichtern. Xaviers Teint hatte dasselbe dunkle Walnussbraun wie seine leibliche Mutter, wohingegen Carlos’ Haut in einem warmen Bronzeton schimmerte. Die beiden Jungen hatten auf Anhieb viele Gemeinsamkeiten gefunden: Videogames, die Liebe zu den Naturwissenschaften und tiefen Abscheu gegen Brokkoli.
Carlos lächelte traurig. »Du mir auch, hermano. Aber New York ist ja nicht so weit weg von Philly. Ich habe schon nachgesehen, was die Zugfahrkarte kostet.«
Bald würde Xavier nach Philadelphia gehen, um an der University of Pennsylvania Medizin zu studieren, während Carlos sein Aufbaustudium in Ingenieurswesen an der NYU in Angriff nahm. Seit ihrem sechsten Lebensjahr waren sie nie voneinander getrennt gewesen.
Das würde übel werden.
»Alle zwei Wochen«, sagte Xavier und hielt Carlos die Faust hin.
Carlos stieß mit der seinen dagegen und legte den Kopf schief. »Wie ist er denn gestorben? Der Alte, meine ich.«
Xavier musste gegen die bittere Galle anschlucken, die ihm in der Kehle aufstieg. »Er hat sich umgebracht.«
Carlos zuckte zusammen. »Ach, du Scheiße, das tut mir leid.«
»Mir auch«, murmelte Xavier. »Er war … ein Spitzentyp, und jetzt ist er tot, und ich überlege die ganze Zeit, ob ich es hätte verhindern können. Was wäre gewesen, wenn ich ihn besucht oder ihn häufiger angerufen hätte und so.«
Was beides nicht ernsthaft infrage gekommen war. Rocky hatte nicht gewollt, dass jemand die Spur zu Xavier nachverfolgen konnte. Er war verängstigt und traurig gewesen.
»Aber so darfst du nicht denken«, erwiderte Carlos, loyal wie immer. »Nach allem, was ich so lese, weihen Menschen, die ernsthaft einen Selbstmord ins Auge fassen, ihre Familien und Freunde nicht ein, weil die sonst bloß versuchen würden, sie daran zu hindern. Du bist ein guter Mensch. Hätte er gewollt, dass du mitbekommst, was er vorhat, hättest du es gemerkt.«
»Das möchte ich hoffen.« Lieber Gott, das tat er so sehr. Als Rockys Anwalt wegen der Erbschaft mit ihm in Kontakt getreten war, hatte er das Schlimmste angenommen. Dass Rocky ermordet worden wäre.
Aber Selbstmord? Damit hätte Xavier nie gerechnet.
»Wie hast du denn erfahren, dass er tot ist?«, wollte Carlos wissen.
Xavier zögerte, überlegte, ob er Carlos eine Lüge auftischen sollte. Aber sie belogen einander nie. Carlos war schlicht nicht fähig zu so etwas. Nicht, dass er es nicht manchmal wollen würde, aber er taugte schlicht nicht zum Lügner.
Xavier hingegen war ein verdammt guter Lügner, nur Carlos konnte er nicht anlügen, sondern allenfalls die Wahrheit ein wenig unterschlagen. Na gut, es war mehr als ein wenig gewesen, er hatte sie komplett unterschlagen. Aber nur, um seinen besten Freund zu schützen.
Und ihn vor Albträumen zu bewahren.
Wieder sah Xavier sich im Diner um, doch auch jetzt schien niemand Notiz von ihnen zu nehmen. »Sein Anwalt hat mich angerufen«, gestand er leise.
Carlos fielen beinahe die Augen aus dem Kopf. »Aber wieso? Hat er dir etwa Geld hinterlassen?«
»Ja, ein wenig.« Nicht so viel, wie Rocky ihm bereits zu Lebzeiten gegeben hatte, aber trotzdem … er konnte es gut gebrauchen, wenn er an die Penn Med ging. Die Wohnungen in Philly waren nicht gerade billig.
Doch nicht das Geld war das Wichtige gewesen.
Sondern der kleine Keramikengel, den Rocky ihm einen Monat vor seinem Tod gegeben hatte. Er konnte nicht mehr als zehn Dollar gekostet haben, doch Rocky hatte etwas auf die Unterseite gravieren lassen. Greif nach den Sternen, mon ange.
Es war eine Ermutigung.
Und eine Erinnerung.
Fest stand, dass Xavier den Engel niemals hergeben würde. Er hatte ihn an seinem Schlüsselring befestigt und trug ihn stets bei sich.
Er schob seinen Teller weg. Schlagartig war ihm der Appetit vergangen. »Willst du meinen Speck haben?«
Carlos grinste. »Zu Speck sage ich niemals Nein.« Seine Miene wurde ernster. Er hob sein Orangensaftglas und wartete, bis Xavier es ihm nachgetan hatte. »Al futuro.«
»Auf die Zukunft«, echote Xavier und zwang sich zu einem Lächeln. »Wir werden die Welt verändern, hermano.«
»Darauf kannst du wetten.« Carlos verputzte den Rest, der noch auf Xaviers Teller lag. »Also, was liegt heute an?«
»Ich für meinen Teil muss zu Hause Unkraut jäten. Du?«, sagte Xavier.
»Ich bin dein Schatten, Mann. Ohne mich gehst du nirgendwohin.« Carlos beugte sich vor und senkte die Stimme zu einem Flüstern. »Dank deines sechsten Sinns waren wir immer auf der sicheren Seite. Wenn du also glaubst, dass dir jemand folgt, lasse ich dich nicht allein herumspazieren.«
Wieder schluckte Xavier gerührt. »Und der Icebox-Kuchen meiner Mutter hat nicht zufällig etwas damit zu tun, hm?«, neckte er.
Carlos grinste wieder. »Ich bin multitaskingfähig und kann auf dich aufpassen und gleichzeitig euren Kühlschrank plündern. Ich glaube, heute bin ich mit dem Zahlen dran.« Er zog seine Brieftasche heraus und legte genug Bargeld für beide Mahlzeiten und ein anständiges Trinkgeld auf den Tisch. »Los, lass uns gehen. So ein Icebox-Kuchen darf nicht zu lange unbeaufsichtigt bleiben.«
Burke machte ein finsteres Gesicht. »Mit dem Wichtigsten kommst du erst jetzt um die Ecke, Gabe! Wieso hast du nicht gleich gesagt, dass du eine private Autopsie veranlasst hast?«
»Ich war nicht sicher, ob ich Miss Sutton trauen kann. Aber jetzt bin ich es.« Gabe zog den Bericht aus der Tasche und reichte ihn Molly, die ihn auseinanderfaltete, überflog und dann mit ausdrucksloser Miene an Burke weiterreichte.
Mit dieser Frau würde er jedenfalls niemals Poker spielen, befand Gabe, denn der Bericht würde jeden schockieren, ob derjenige seinen Vater nun gekannt hatte oder nicht.
Burke las den Bericht. Gabe konnte genau sagen, wann er den ersten Schock erlitt, da Burke nach Luft schnappte und ihn mit aufgerissenen Augen ansah. »Er hatte Krebs? Dein Dad hatte Krebs?«
»Ich wusste auch nichts davon.« Gabe hatte Gewissensbisse – zum einen, weil er nichts von der schweren Erkrankung seines Vaters geahnt hatte, zum anderen wegen seiner Wut, weil sein Vater ihm die Diagnose vorenthalten hatte.
»So wie ich deinen Dad kenne, wollte er nicht, dass du dir seinetwegen Sorgen machst. Vor allem nach …« Burke rutschte auf seinem Stuhl herum. »Du weißt schon. Nach dem, was mit deiner Mutter passiert ist.«
Gabe wusste Bescheid. Er und sein Vater hatten mitansehen müssen, wie die Krankheit sie vor ihren Augen hatte dahinschwinden lassen.
Und nun waren seine beiden Elternteile tot. Gabe rang sich ein Nicken ab, woraufhin Burke nach einem Moment stummen Mitgefühls die Lektüre wieder aufnahm.
Auch den zweiten Schockmoment bekam Gabe mit, denn Burke unterdrückte einen heftigen Fluch und schob Molly den Bericht über die Schreibtischplatte hinweg zu. »Das mit dem Kokain ist Schwachsinn«, stieß er aufgebracht hervor und blickte Gabe an. »Dass er Alkohol im Blut hatte, halte ich noch für nachvollziehbar, schließlich hatte er zeitweise ein Alkoholproblem, aber Drogen hat dein Vater nie konsumiert, so viel weiß ich.«
»Das stimmt.« Trotzdem hatte die Privat-Pathologin eine so hohe Menge Kokain nachweisen können, dass allein diese zum Tod geführt hätte. »Mein Vater war trockener Alkoholiker«, sagte Gabe, an Molly gewandt. »Seit drei Jahren schon. Aber Kokain hat er nie angerührt. Niemals.«
Andererseits hatte sein Vater zuvor noch nie gegen eine Krebserkrankung angekämpft, sagte eine kleine Stimme in seinem Kopf. Vielleicht kanntest du ihn ja doch nicht so gut, wie du immer dachtest.
Der Gedanke geisterte ihm ein paar Sekunden im Kopf herum, ehe er ihn verdrängte. Nein. Sein Vater hätte niemals zu Drogen gegriffen, schon gar nicht so, wie die Cops es angedeutet hatten. Alkohol, na schön. Aber harte Drogen? Auf keinen Fall.
Stirnrunzelnd blickte Molly erneut auf den Bericht. »Was ist denn das? Hier steht: Eine zweite Probe hat Spuren von Flunitrazepam ergeben.« Sie sah auf. »Rohypnol. Und zwar eine hohe Dosis. Wer auch immer ihn getötet haben mag, hat ihn vorher außer Gefecht gesetzt. Wahrscheinlich haben sie ihm das Zeug mit dem Alkohol eingeflößt, den er freiwillig oder auch nicht zu sich genommen hat.«
Gabe musste die Augen schließen, als ihn eine Woge der Wut, der Trauer und des Kummers übermannte. Sie hatten seinen Vater unter Drogen gesetzt und ihn dann erschossen.
Er zuckte zusammen, als ihn eine kühle Hand berührte. »Gabe«, hörte er Mollys leise, traurige Stimme. »Wir können auch später weitermachen.«
»Nein.« Er zwang sich, die Augen aufzuschlagen und sie anzusehen. »Es geht mir gut.«
Sie schüttelte den Kopf. In ihren Augen, die das leuchtende Blaugrün des Karibischen Ozeans aufwiesen, spiegelten sich tiefes Verständnis und unermessliche Freundlichkeit. »Nein, es geht Ihnen ganz und gar nicht gut. Trotzdem können wir weitermachen, wenn Sie das wollen.«
Seine Augen und seine Kehle brannten, und er musste schlucken, ehe er antworten konnte. »Ja, will ich.«
»Also gut.« Sie blickte wieder auf das Dokument. »Im Abschlussbericht der Gerichtsmedizin wird das Kokain verzeichnet sein«, sagte sie. »Aber nicht das Rohypnol, da gehe ich jede Wette ein. Auf diese Weise können sie weiterhin behaupten, Ihr Vater sei zum Zeitpunkt seines Todes bis unter die Hutschnur zugekokst gewesen. Dass er Alkohol im Blut hatte, untermauert ihr Argument noch, er sei rückfällig geworden, was das Kokain umso glaubhafter macht. Und angesichts der Krebserkrankung werden sie einfach behaupten, er hätte die Schmerzen wohl nicht ertragen und dafür sorgen wollen, dass sie aufhören.«
»Das ist …« Gabes Stimme brach. Er räusperte sich. »Das dachte ich auch. Dass die Cops das behaupten werden, meine ich. Nicht, dass Dad es getan hat.«
»Was ist mit dieser zweiten Probe gemeint?«, wollte Burke wissen.
»Eine Blut- und eine Urinprobe. Harry Peterson, der Assistent des Gerichtsmediziners, hat sie mir zugesteckt, ich habe sie aber erst beim Nachhausekommen in meiner Tasche entdeckt. Deshalb mache ich mir ja solche Sorgen um Harry. Er hat sich für mich aus dem Fenster gehängt. Er hätte meinen Vater gekannt, und Dad sei immer nett zu ihm gewesen, meinte er. Ich will nicht, dass Harry dafür bestraft wird, dass er mir die Proben zugeschanzt und verraten hat, dass die Autopsie manipuliert wurde.«
»Ich werde mal sehen, ob wir jemanden von uns in die Rechtsmedizin einschleusen können«, sagte Burke. »DeShawn ist ein guter Mann, aber auch er kann Peterson nicht ununterbrochen im Auge behalten.«
Molly legte den Bericht beiseite. »Hier steht das gestrige Datum. Sonntag.«
Gabe nickte. »Die Pathologin hat ihn mir gestern Abend geschickt. Ich habe ihn nach meiner Schicht gesehen. Normalerweise hätte sie bis heute damit gewartet, meinte sie, aber sie wollte mich rasch ins Bild setzen, vor allem angesichts dieser Ergebnisse. Sie hatte die Befürchtung, ich könnte ebenfalls in Gefahr sein.«
»Was durchaus möglich ist«, sagte Burke. »Deine eigene Sicherheit besprechen wir, wenn wir mit allem anderen fertig sind.«
Gabe atmete aus. Kurz war er in Versuchung, zu sagen, er brauche niemanden, der auf ihn aufpasste, aber er war nicht dumm. Wenn die Cops herausfanden, dass er auf eigene Kosten eine Autopsie hatte durchführen lassen, könnte es brenzlig werden.
»Gab es auch einen Polizeibericht?«, fragte Molly.
Burke reichte ihr die Kopie des Berichts, den Gabe inzwischen in- und auswendig kannte, bis hin zu dem schwarzen Tonerstreifen, der sich im unteren Drittel über die gesamte Seitenbreite zog.
Beim Anblick des bemerkenswert kurzen Berichts runzelte Molly die Stirn. »Hier steht, die Nachbarin hätte Ihren Vater aufgefunden.«
Gabe schluckte. »Ja, Mrs Dobson. Sie und meine Mutter waren jahrzehntelang beste Freundinnen. Mrs Dobson hat Dads Hund in ihren Blumenbeeten erwischt und nach Hause gebracht. Schon an der Küchentür hätte sie geschimpft, meinte sie.« Eine Woge der Übelkeit überkam Gabe, und er war heilfroh, dass er an diesem Morgen noch nichts gegessen hatte. »Er saß zusammengesunken am Küchentisch. Seine Waffe lag auf dem Boden, als hätte er sie fallen gelassen. Neben seinem Kopf stand eine leere Flasche Grey Goose und ein leeres Glas.« Er fuhr sich mit den Händen übers Gesicht und wünschte, er könnte das Bild dadurch aus seinen Gedanken tilgen, doch es gelang ihm nicht. Sobald er die Augen schloss, sah er seinen Vater vor sich – wie er in einer Lache aus Blut und Gehirnmasse dalag.
Gabe wünschte, er hätte das Foto nie gesehen, verfluchte den Cop, der dafür gesorgt hatte, dass er es sah.
Er verfluchte sich selbst, weil er zu beschäftigt gewesen war, als sein Vater ihn am dringendsten gebraucht hatte. Nur dass er ihn nicht angefleht hatte, sich nicht das Leben zu nehmen, bedauerte er nicht. Denn das hatte sein Dad nicht getan, das wusste Gabe ganz genau.
Wäre ich da gewesen, hätten sie ihm nichts angetan. Das hätten sie nicht gewagt.
Andererseits wäre ich jetzt vielleicht ebenfalls tot.
»Gabe? Was für eine Rasse ist der Hund?«
Gabe sah Molly an, deren Frage ihn aus der Finsternis riss, in die seine Gedanken abgetaucht waren. Geduldig wartete sie auf seine Antwort, und ihn beschlich der Verdacht, dass sie ihm die Frage mehr als einmal gestellt hatte.
»Ein Labradormischling. Ein bisschen Golden Retriever, vielleicht auch Pitbull. Eine Promenadenmischung. Shoe heißt er.«
»Wie Choux, Ihr Restaurant?«
»Nein. Wie der Schuh.«
Sie hob einen Mundwinkel. »Weil er gern Schuhe frisst?«
Die Enge in seinem Brustkorb ließ ein wenig nach, sodass er wenigstens atmen konnte. Danke, Molly. »Das auch. Mein Dad hat meine Mutter immer mon petit chou genannt. Als ich noch klein war, habe ich sie immer gefragt, warum er Schuh zu ihr sagt.« Bei der Erinnerung stiegen ihm Tränen in die Augen. »Nach ihrem Tod war Dad so schrecklich einsam, deshalb habe ich ihn überredet, sich einen Hund aus dem Tierheim zu holen. Eines Tages kam er mit diesem kleinen Burschen nach Hause, der sich vor Stress das Fell halb vom Leib gekratzt und überall wunde Stellen hatte. Da hatte er meinen Dad schon ins Herz geschlossen, und kaum war er fünf Minuten im Haus, hat er einen der Schuhe geklaut, die ich stehen gelassen hatte. Deshalb hat Dad ihn Shoe genannt, und der Name ist ihm geblieben.«