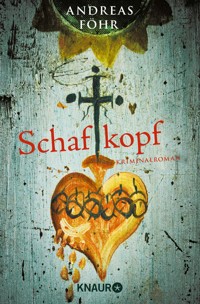12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Rachel-Eisenberg-Serie
- Sprache: Deutsch
Ein zweiter Fall für die Münchner Anwältin Rachel Eisenberg. Mit dieser Anwältin, die jeden juristischen Kniff kennt und auch nicht vor ungewöhnlichen Ermittlungsmethoden zurückschreckt, hat Spiegel-Bestseller-Autor Andreas Föhr - selbst promovierter Jurist - eine hochsympathische Frauenfigur und Ermittlerin geschaffen, die in seinem neuen Justiz-Krimi "Eifersucht" überzeugt. Judith Kellermann, die Mandantin von Anwältin Rachel Eisenberg soll ihren Lebensgefährten, Eike Sandner aus Eifersucht in die Luft gesprengt haben. Als Reste des verwendeten Sprengstoffs bei ihr gefunden werden, liefert Kellermann eine abenteuerliche Erklärung: Ein geheimnisvoller Ex-Soldat soll den Mord begangen und die Beweise manipuliert haben. Doch der Mann ist seit der Tat verschwunden. Niemand scheint ihn zu kennen. Existiert er nur in Kellermanns Phantasie? Falls nicht: Wer ist der Unbekannte und was treibt ihn an? Als gelernter Jurist gelingt Andreas Föhr, der bisher mit seiner sehr erfolgreichen Serie um das Tegernseer Ermittler-Duo Wallner & Kreuthner begeisterte, mit "Eifersucht" erneut ein hochspannender Justiz-Krimi, der dem Leser überraschende Einblicke in das Justizwesen liefert. Ein raffinierter Plot, unerwartete Wendungen und die starke Frauenfigur Rachel Eisenberg sorgen für fesselndes Lese-Vergnügen. Bestseller-Autor "Andres Föhr schreibt mit einer obsessiven Kraft, die atemlos macht" Für Sie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Andreas Föhr
Eifersucht
Ein neuer Fall für Rachel Eisenberg
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein zweiter Fall für die Münchner Anwältin Rachel Eisenberg. Mit dieser Anwältin, die jeden juristischen Kniff kennt und auch nicht vor ungewöhnlichen Ermittlungsmethoden zurückschreckt, hat Spiegel-Bestsellerautor Andreas Föhr - selbst promovierter Jurist - eine hochsympathische Frauenfigur und Ermittlerin geschaffen, die in seinem neuen Justiz-Krimi »Eifersucht« überzeugt.
Judith Kellermann, die Mandantin von Anwältin Rachel Eisenberg soll ihren Lebensgefährten, Eike Sandner, aus Eifersucht in die Luft gesprengt haben. Als Reste des verwendeten Sprengstoffs bei ihr gefunden werden, liefert Kellermann eine abenteuerliche Erklärung: Ein geheimnisvoller Ex-Soldat soll den Mord begangen und die Beweise manipuliert haben. Doch der Mann ist seit der Tat verschwunden. Niemand scheint ihn zu kennen. Existiert er nur in Kellermanns Phantasie? Falls nicht: Wer ist der Unbekannte und was treibt ihn an?
Als gelernter Jurist gelingt Andreas Föhr, der bisher mit seiner sehr erfolgreichen Serie um das Tegernseer Ermittler-Duo Wallner & Kreuthner begeisterte, mit »Eifersucht« erneut ein hochspannender Justiz-Krimi, der dem Leser überraschende Einblicke in das Justizwesen liefert. Ein raffinierter Plot, unerwartete Wendungen und die starke Frauenfigur Rachel Eisenberg sorgen für fesselndes Lese-Vergnügen.
Bestsellerautor »Andres Föhr schreibt mit einer obsessiven Kraft, die atemlos macht« Für Sie
Inhaltsübersicht
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
Danksagung
Prolog
Juni 2012
Die Flaschen und Gläser glitzerten und verschwammen ineinander. Tränen drückten von innen. Schlieren vor der Pupille. Bea bestellte noch einen Gin Tonic. Der Barkeeper goss etwas mehr Gin ein, stellte das Glas vor ihr ab und sagte: »Der Kerl ist die Tränen nicht wert.«
Kein Kerl war Tränen wert. Es war ja auch kein Kerl. Die Rolle hatte sie nicht bekommen. Es hätte ihr Durchbruch werden können – eine Nebenfigur in der vierten Staffel von Game of Thrones. Ja, es waren Dutzende Bewerberinnen gewesen. Aber sie hatte die Gewissheit gehabt, dass sie es schaffen würde. Du bekommst jede Rolle, hatte ihre Mutter gesagt, wenn du sie nur verzweifelt genug willst. Bitch!
Gott! Wie sah sie aus! Im Spiegel hinter dem Gläserregal blickte ihr eine Comicfigur mit riesenhaft großen, schwarzen Augen und verwuschelten Haaren entgegen.
Eine Viertelstunde dauerten die Sanierungsarbeiten. Als Bea von der Damentoilette zurückkam, war der Platz neben ihr am Tresen besetzt. Ein Mann. Anzugträger.
»Sitze ich auf Ihrem Platz?« Er lächelte.
»Schaue ich so, als würden Sie auf meinem Platz sitzen?«
»Ein bisschen.«
»Sie sitzen neben meinem Platz.«
Sie setzte sich neben den Mann, obwohl links und rechts mehrere Barhocker frei waren.
»Darf ich sitzen bleiben?«, fragte der Mann.
»Natürlich. Ich bin ja dazugekommen.«
»Das ist richtig. Aber nachdem das Ihr Platz ist, den Sie nur kurz verlassen haben, hätte ich fragen müssen, wenn Sie da gewesen wären. Zu kompliziert?«
»Ich bin nur eine Frau und im Moment ziemlich durch den Wind. Aber das begreife ich noch.«
»Tut mir leid. Meine Frage sollte nichts in der Richtung andeuten.«
»Welche Richtung?«
»Na, dass Sie es als Frau nicht verstehen würden oder so. Ich fand meinen eigenen Satz einfach kompliziert.«
»Was jetzt? Einfach oder kompliziert?«
Sie sah ihn ein wenig provokant an, war gespannt, wie er reagieren würde. Er lachte, ein bisschen wie ein Schulbub, den man bei etwas erwischt hatte.
»He! Das kann ja ein unterhaltsamer Abend werden.« Er reichte ihr gut gelaunt die Hand. »Ich bin Arne.« Wink an den Barkeeper. »Die nächste Runde geht auf mich.«
Die nächste Runde geht auf mich. Das gefiel ihr. Nicht: Darf ich Sie auf einen Drink einladen? Er behandelte sie wie einen Kumpel, nicht wie den nächsten One-Night-Stand. Vielleicht wollte er mit ihr ins Bett. Aber er hatte Stil genug, keine schmierigen Sätze abzusondern. Und irgendwie war er nett. Genau das, was sie jetzt brauchte, um nach dem Casting-Desaster wieder zu relaxen. Sie betrachtete ihn. Sein Gesicht war freundlich. Nicht Hollywood-Star-like, aber annehmbar. Und – lustig – ein Ohr stand ab. Nicht zwei Segelohren. Eins! Links.
Eine Stunde war vergangen. Sie hatten geredet, waren beim Du, hatten gelacht, sich aufgezogen, Spaß zusammen gehabt. Sein Schulbubenlachen gefiel ihr immer mehr, vielleicht lag’s am Gin Tonic, es war der dritte seit der Damentoilette. Einmal hatte er sie berührt – versehentlich? –, sie seine Hand spielerisch gestreichelt. Beim vierten Gin Tonic fiel ihr auf, dass Arne alkoholfreies Bier trank.
»Muss noch Auto fahren«, erklärte er und lächelte wieder wie ertappt.
Mit einem Mal war der Zauber seines Lächelns verflogen. Warum? Weil er keinen Alkohol trank? Die Geste, mit der er seinen Satz sagte, erinnerte Bea an den Regisseur beim Casting. Alles kam mit einem Schub wieder hoch, und Tränen liefen ihr übers Gesicht.
»Hab ich was Falsches gesagt?« Arnes verwirrtes Gesicht machte sie noch trauriger. Vielleicht auch mehr der Gedanke, dass sie den armen Kerl in solche Verwirrung stürzte, obwohl er sich todanständig verhielt und sie an einem schweren Tag zum Lachen gebracht hatte. Noch mehr Tränen rannen über ihr Gesicht, sie ergriff Arnes Hand und zerquetschte sie fast.
»Tut mir leid«, schluchzte sie.
Er hielt ihr ein Papiertaschentuch hin.
Der Anfall verging, Bea verschwand auf die Toilette und kam nach zehn Minuten neuerlich restauriert zurück. Sie winkte dem Barkeeper.
»Bezahlt hab ich schon«, sagte Arne.
»Oh, danke. Wie viel …?« Sie kruschte in ihrer Handtasche.
»Lass gut sein. Das ist ja das Mindeste, nachdem ich dich zum Heulen gebracht habe.«
»Ach komm.« Sie legte ihre Hand auf seinen Arm. »Du weißt, das ist nicht deine Schuld. Ich hatte einen schweren Tag heute.« Sie sah ihm in die Augen. »Danke für den schönen Abend. Ich fahr jetzt nach Hause.«
»Wo musst du denn hin?«
»Nach Obermenzing. Ich nehme ein Taxi.«
»Ich muss nach Pasing. Da liegt Obermenzing ja quasi auf dem Weg.«
Sie fuhren am nächtlichen Hauptbahnhof vorbei Richtung Westen, passierten die Hackerbrücke, die zu Oktoberfestzeiten überquoll von Besuchermassen. Am Romanplatz nahmen sie die Route nach Norden, linker Hand das Nymphenburger Schloss in Abendbeleuchtung, dann folgte die Straße für eine Weile der Mauer des Schlossparks. Bea hing ihren Gedanken an eine verpasste Weltkarriere nach und ergab sich der Hoffnung, dass noch nicht alles verloren war. Ab und an tauschten sie einen höflichen Satz. Aber auch Arne war in Gedanken versunken.
»Ich müsste noch kurz was bei einem Freund vorbeibringen. Hab’s ihm versprochen«, sagte Arne mit einem Mal. »Ist das okay? Dauert fünf Minuten.«
»Natürlich. Kein Problem.« Sie lehnte die Stirn an die kühle Scheibe und beobachtete den Mercedesstern auf der Motorhaube, der nach rechts schwenkte, als Arne von der Menzinger Straße nach Norden abbog. Plötzlich waren sie in einem Park oder Wald.
»Wo sind wir?«, fragte Bea.
»Kapuzinerhölzl.« Arne parkte den Wagen am Straßenrand und stellte den Motor ab.
Bea sah sich um, versuchte Klarheit in ihre Gin-Tonic-getrübte Wahrnehmung zu bekommen. »Hier wohnt jemand?«
»Dahinten.« Arne deutete in die Nacht. »Man muss ein Stück zu Fuß gehen. Ist aber nicht weit.«
Arne stieg aus dem Wagen.
Bea blickte verunsichert in den dunklen Wald hinein. Im letzten Jahr hatte es mehrere Morde an Frauen in München gegeben. Alle in ähnlichen Parkanlagen. Arne bückte sich in den Wagen und sah Beas ängstliches Gesicht.
»Wenn du ein komisches Gefühl hast – ich kann auch morgen bei meinem Freund vorbeischauen.«
»Nein, nein. Du hast es ihm ja versprochen. Das ist okay.« Ihre Hand zuckte in Richtung Türöffner, doch Bea zögerte.
»Pass auf …«, sagte Arne, »… du kannst entweder im Wagen warten und die Knöpfe runterdrücken. Oder du kommst mit und glaubst mir, dass ich den schwarzen Gürtel in Karate habe.«
»Hast du nicht, oder?«
»Nein. Aber das!« Arne hatte mit einem Mal einen Hammer in der Hand, dessen Edelstahlkopf im nächtlichen Licht funkelte. »Zumindest auf dem Hinweg. Den wollte ich bei meinem Freund vorbeibringen.«
Der Weg war unbeleuchtet, aber noch gab es Licht von fernen Straßenlaternen, und der Halbmond schien durch das Blätterdach. Die Luft war feucht und modrig und sommernächtlich frisch. Ein Kauz schrie.
»Mein Gott! Auch noch das Käuzchen.« Bea fröstelte und zog ihre Strickjacke vor der Brust zusammen. »Als mein Opa gestorben ist, hat auch ein Käuzchen geschrien. War echt so.«
»Jede Sekunde sterben drei Menschen auf der Erde«, sagte Arne. »Wann immer also ein Käuzchen schreit – stirbt jemand.«
»Wieso wohnt dein Freund in dieser Wildnis?«
»Da gibt es ein altes Haus, das sie irgendwann abreißen werden. Die Miete ist günstig.«
Bea versuchte, durch die Bäume hindurch etwas zu erkennen. Aber nichts war zu sehen, was ein Haus hätte sein können. Nur andere Bäume. Mit einem Mal überkam sie Panik. Sie blieb stehen.
»Was ist?«, fragte Arne.
»Ich weiß nicht.« Ihr Atem ging schwer, Kälte schlich sich unter ihre Bluse. »Ich … ich will umkehren.«
»Aber wir sind gleich da.«
»Trotzdem.« Sie schluckte. »Ich hab Angst.«
»Na ja …«
Bea hatte den Eindruck, dass Arne sie merkwürdig ansah, obwohl seine Augen in der Dunkelheit kaum zu erkennen waren. »Ich hatte dich vorhin gefragt, ob du mitkommen willst.«
»Ich weiß. Aber jetzt möchte ich zurück zum Wagen.« Sie suchte fieberhaft nach einem Ausweg aus der verzwickten Situation. Natürlich benahm sie sich wie ein Kleinkind. Aber die Angst war groß. Da vorn ging es immer tiefer in den Wald. »Wie weit ist es denn noch?«
»Eine Minute.«
Aber wo? Wo verdammt noch mal war dieses Haus? Es war nichts zu sehen davon. Sollte man es nicht sehen, wenn es nur noch eine Minute weg war? Sollte nicht Licht im Haus brennen, wenn jemand nachts Besuch erwartete? Log Arne sie an? Unsinn. Ruhig bleiben. Arne war einer von den Netten. Sie durfte nicht hysterisch werden, nur weil es dunkel war.
»Du kannst mir doch die Autoschlüssel geben.«
»Autoschlüssel?« Arne trat einen Schritt näher. Der Edelstahlkopf des Hammers blitzte kurz auf.
»Ich geh zurück zum Wagen und warte auf dich.« Ihre Stimme klang brüchig und kippelig. Opferstimme, dachte sie. Du sprichst mit einer verfluchten Opferstimme. Sie realisierte, wie groß Arne war. Jetzt, wo er vor ihr stand und auf sie heruntersah. Sie hörte ein leises Klimpern. Wo kam das her?
»Einverstanden. Geh schon mal vor.« Er hielt ihr die Wagenschlüssel hin. Sie nahm sie vorsichtig. »Aber pass ein bisschen auf. Das sind sicher fünfhundert Meter bis zum Wagen. Ist nicht die sicherste Gegend hier.« Er lächelte amüsiert.
»Hör auf mit dem Scheiß. Du machst mir Angst.«
»Das wollte ich nicht. Entschuldige.« Er sah sie bedauernd an und nickte. »Jetzt geh. Ich schau dir nach und pass auf.«
Sie drehte sich um.
»Mach dir keine Sorgen«, rief er ihr hinterher. »Hier ist niemand.«
Es war nicht weit bis zum Auto. Jedenfalls bei Tag. Bei Nacht konnte man den Wagen nur erahnen. Vor dem Wald war ein schmaler Streifen Wiese, dann, unter den Alleebäumen, die parkenden Autos. Nicht viele. Eins davon der Mercedes, dessen Schlüssel Bea umklammerte. Sie ging zügig, den Blick nach vorn gerichtet. Etwas huschte im Augenwinkel vorbei – ein Vogel, ein Blatt? Sie sah nicht hin, ging schneller, hörte ihren eigenen Atem. Sie näherte sich dem etwas helleren Streifen Wiese. Ob Arne noch ein Auge auf sie hatte? Sie hoffte es. Noch fünfzig Meter, dann ließ sie die Bäume hinter sich. Sie hörte schweren Atem. War das ihrer? Sie hielt die Luft an, hörte die Sohlen ihrer Schuhe auf dem gekiesten Waldboden knirschen – und den Atem. Er kam von hinten. Sie ging noch schneller. Wagte nicht, sich umzusehen. Es kam näher. Sie spürte es. Was immer hinter ihr atmete – es war gleich da. Sie nahm sich ein Herz, blieb stehen und drehte sich um. Er wäre fast in sie hineingerannt. Jetzt stand er vor ihr. Arne. Sie zitterte.
»Was ist? Willst du nicht zu deinem Freund?«
»Hab’s mir überlegt«, sagte er atemlos, aber bestimmt. »Ich will zu dir.«
Ehe sie reagieren konnte, hatte er seine Hand, die jetzt in einem Gummihandschuh steckte, auf ihren Mund gepresst und sie zu Boden gerissen. Während des Falls kam ihr Mund frei. Sie war so überrascht, dass sie nicht wusste, was sie schreien sollte. Dann schlug ihr Kopf auf den Kies. Blitzschnell war die Hand wieder da und nahm ihr fast die Luft, denn sie bedeckte jetzt auch die Nasenlöcher. Bea versuchte, den Kopf mit heftigen Bewegungen freizubekommen. Er ließ sie los und schlug ihr ins Gesicht, einmal, zweimal, dreimal. So kräftig, dass ihre linke Backe brannte, ihre Augenbraue war taub, an der Schläfe fühlte sie etwas heruntersickern.
»Ruhig«, sagte er. Sie hielt den Atem an, nickte mit aufgerissenen Augen. Vielleicht würde er sie am Leben lassen. Mit einer Vergewaltigung würde sie schon klarkommen. Wenn er sie nur am Leben ließ! Arne kniete auf ihrer Brust und sah auf sie herab, die Backen hingen nach unten, die Augen starr und konzentriert, immer noch der kleine Schulbub, jetzt aber nicht mehr liebenswert, jetzt das fiese Kind. Er atmete heftig durch den Mund, und genau hinter seinem Kopf schien der Mond durch das Laub eines Ahornbaums. Das abstehende Ohr leuchtete rosa. Sein Gewicht drückte ihr die Luft ab. Er nestelte hinter seinem Rücken an etwas herum, sie konnte nicht sehen, was es war, sah nur seine Knie und Schultern, sie suchte Blickkontakt, doch er starrte an ihr vorbei auf den Boden. Schließlich hob er den rechten Arm, und sein Gesicht wurde zur wütenden Fratze. Im Mondlicht glänzte der Hammerkopf …
1
Mai 2017
Sie trug Karottenjeans und weiße Segelschuhe, die Haare standen dauergewellt vom Kopf weg – Achtzigerjahre. Das Mädchen auf dem Foto war hübsch und strahlte Selbstbewusstsein aus. Der rechte Arm lag um die Hüften eines gleichaltrigen Burschen, blond mit muskulösem Hals, das Klischee eines kalifornischen Surfers. Der Griff des Mädchens wirkte fest und besitzergreifend. Das Paar stand am Grill, die junge Frau hielt mit ihrer freien Hand ein gebratenes Steak von beachtlicher Größe an einem Spieß in die Kamera und lachte. Etwas seitlich stand ein weiteres Mädchen, jünger, mit Brille, nicht hässlich, aber ohne die Ausstrahlung der anderen – die kleine Schwester. Ein Tanktop enthüllte mollige Arme. Um die Schultern hatte die Kleine den Arm des Vaters liegen, der sie liebevoll und etwas besorgt anblickte.
Jemand klopfte, und ohne eine Antwort abzuwarten, wurde die Tür geöffnet. »Willst du einen Cappuccino? Ich mach grad welchen.« Sarah steckte den Kopf herein.
Rachel Eisenberg klappte den Laptop mit dem alten Foto zu. »Hab ich ›Herein‹ gesagt?«
»Entschuldige. Ich wusste nicht, dass du Pornos guckst.«
Sarah war siebzehn, etwa so alt wie das selbstbewusste Mädchen auf dem Foto. Rachel fiel schon seit einiger Zeit auf, dass ihre Tochter dem Mädchen auf dem Foto immer ähnlicher wurde.
»Warum starrst du mich so an?« Sarah war ins Zimmer getreten.
Rachels Blick wanderte von ihrer Tochter weg zum Fenster. Der Goldregen stand in voller Blüte. »Hab ich dich angestarrt?«
Sarah sagte nichts.
»Ich hab dich nicht angestarrt. Ich war in Gedanken.«
Sarah nickte. »Wollen wir auf der Terrasse Kaffee trinken? Ist superschön draußen.«
»Das ist lieb von dir, aber ich hab zu tun.« Rachel lächelte kurz und gezwungen und drehte sich dann auf dem Bürosessel zu ihrem Schreibtisch, ohne den Laptop wieder aufzuklappen.
»Wieso sitzt du hier drin? Es ist Sonntag?«
»Ist gerade viel zu tun in der Kanzlei. Jetzt sei so lieb und lass mich arbeiten.«
»Papa sagt, ihr hättet gerade nicht so viel zu tun.«
Rachel drehte sich wieder zu Sarah. »Herrgott – geh bitte und mach die Tür zu!«
»Was ist los mit dir?«
»Nichts. Ich brauch nur meine Ruhe. Bitte!« Rachels Blick war so verzweifelt intensiv, dass Sarah einen Schritt zurückwich.
Erschrocken verließ sie das Büro ihrer Mutter und zog vorsichtig die Tür zu. Rachel sank in ihrem Stuhl zusammen und atmete durch. Es war keine gute Idee, sich hier einzusperren. Draußen war schönes Wetter. Nur passte das nicht zu Rachels Stimmung. Nein, Rausgehen war keine Option. Es klopfte wieder an die Tür.
»Komm rein!«, sagte Rachel. Sarah lugte vorsichtig durch den Türspalt. »Es tut mir leid. Ich bin heute ein bisschen gereizt. Muss am Föhn liegen.«
»Oder am Datum?« Sarah hatte die Augenbrauen hochgezogen.
Rachel erstarrte. »Was meinst du?«
Sarah zögerte. »Heute ist der 28. Mai.«
»Und?«
»Letztes Jahr warst du am 28. Mai genauso drauf.«
»Hast du das gerade in deinem Tagebuch nachgelesen?«
Sarah lächelte. Verständnisvoll. Erwachsen. »Wollen wir reden? Kaffee trinken und ein bisschen reden?«
»Hör zu, es gibt Tage, da bin ich einfach schlecht drauf, okay? Vielleicht war das letztes Jahr auch im Mai. Ist wahrscheinlich die Jahreszeit. Und wenn ich scheiße drauf bin, will ich nicht reden. Kannst du das akzeptieren und mich einfach in Ruhe lassen?«
Das Krachen der Tür hallte noch eine Weile nach.
Die Sonne brannte an diesem Maitag sommerlich auf München herab. Im Hirschgarten, dem größten der Münchner Biergärten, nur wenige Gehminuten von Rachels Haus entfernt, herrschte sonntäglicher Betrieb. Der Hauptbereich der Anlage war mit einfachen Bierbänken ausgestattet, an denen man nach unantastbarem Brauch mitgebrachte Speisen verzehren durfte, nur die Getränke musste man am Ausschank kaufen. Die meisten Gäste verköstigten sich trotzdem an den zahlreichen Verkaufsbuden mit Bratwürsten, Hendln, Schweinshaxen, Radi und anderen Spezialitäten, die üblicherweise in Biergärten angeboten wurden. Am Hirschgartenallee-Eingang direkt links lag das alte Wirtshaus, davor der von frei stehenden Markisen beschattete Servicebereich, wo einen hurtiges Personal mit bayerischem oder osteuropäischem Akzent bediente.
Rachel Eisenberg hatte nach dem Streit mit ihrer Tochter das Haus verlassen. Dass Sarah die Schuld an Rachels Reizbarkeit dem 28. Mai zuschrieb, beunruhigte sie. Hatte Sarah die Bedeutung dieses Tages tatsächlich entschlüsselt? Oder war es nur ein Schuss ins Blaue gewesen? Rachel nahm an einem freien Tisch Platz und betrachtete den sonnendurchfluteten Garten. Der Tag war klar und hell – nicht unähnlich der Erkenntnis, die sich immer unabweislicher in Rachels Kopf breitmachte: Sie würde ihr Geheimnis nicht mit ins Grab nehmen. Irgendwann musste sie es Sarah sagen. Noch bis vor Kurzem hatte sie gedacht, sie könnte es aussitzen. Hannahs Bild war über die Jahre zusehends verblasst, und in Rachel hatte die Hoffnung gekeimt, die Sache würde eines Tages hinter dem Ereignishorizont jenes schwarzen Lochs verschwinden, das ihr Gedächtnis zur Entsorgung von Schmutz und Unrat betrieb. Doch jetzt war Sarah in dem Alter, aus dem Hannahs letzte Bilder stammten, und sie wurde ihr immer ähnlicher. Sogar Gesten und Mimik waren auf geheimnisvollen Pfaden von Hannah auf Sarah übergegangen, obwohl sich beide nie gesehen hatten. Es war wie eine Erinnerungsmail des Schicksals.
Rachel fächelte sich mit einem Bierdeckel Luft zu. Wo sie hinsah, waren Teenager-Mädchen, sommerlich fröhlich, ausgelassen, selbstbewusst, verliebt, mit sommerbraunen Sonnenbrillen-Jungs. Rachel saß im Schatten, aber die Wärme drang durch die Markise hindurch. Ihr Blick fiel jetzt auf einen benachbarten Tisch. Dort saß eine Frau mit halb langen Haaren, die ebenso wie Rachel das Treiben im Biergarten betrachtete und deswegen den Kopf abgewandt hatte. Braune Arme, Spaghettiträger, dezent teure Uhr, der wenige Schmuck wirkte ebenfalls edel, aber nicht zu stylish. Attraktive Frau in den Dreißigern, vermutete Rachel und wartete darauf, dass die Frau ihr Gesicht zeigte. Langsam drehte sie ihren Kopf in Rachels Richtung, und da tauchte sie auf – die Nase der Frau. Sie war außergewöhnlich groß und fleischig, und schlagartig wusste Rachel, mit wem sie es zu tun hatte: Judith Kellermann. Rachel drehte sich schnell weg, um Blickkontakt mit der Frau zu vermeiden, denn dann würde Judith sie ansprechen, und das wollte Rachel auf keinen Fall. Nicht an einem Tag wie heute.
Rachel starrte also in eine andere Richtung und überlegte, ob sie einfach gehen sollte. Aber sie hatte schon einen Cappuccino bestellt. Vielleicht konnte sie die Bedienung bitten, den Kaffee an einen der hinteren Tische zu bringen. Als sie gerade aufstehen wollte, erschallte von hinten: »Das gibt’s doch nicht!«
Ganz kurz überlegte Rachel, ob sie nicht trotzdem aufstehen und so tun könnte, als habe sie es nicht gehört. Aber wahrscheinlich würde ihr Judith hinterherrennen. Es half nichts, Rachel drehte sich langsam um und sah Judiths Nase, die von einem lächelnden Gesicht umrahmt wurde.
»Judith! Das ist ja witzig.« Judith Kellermann war die Tochter eines bekannten Filmproduzenten und besaß selbst eine Filmfirma namens Jumpcut. Eine von den unzähligen kleineren, die es in München gab. Irgendwie schaffte es Kellermann, immer wieder mal eine Produktion an Land zu ziehen. Der Name des Vaters half sicher.
»Die Rachel Eisenberg!«, sagte Judith und kam an Rachels Tisch. »Mensch, wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen!« Sie hatte ihre dürren, braunen Hände mit den Ferrari-rot lackierten Nägeln auf Rachels Schultern gelegt und drückte fest zu. So lange, wie es mir gelungen ist, dir aus dem Weg zu gehen, hätte Rachel gerne geantwortet. Stattdessen sagte sie: »Bist du mit jemandem verabredet?«
»Nein. Ich bin einfach mal hergefahren, um unter Leute zu kommen. Und du?«
»Nur ’ne kurze Arbeitspause. Dann muss ich wieder nach Hause.«
»Was? Am Sonntag? Ach du Arme! Warte, ich hol nur schnell meinen Kaffee.« Sie stöckelte zu ihrem Tisch zurück.
Rachel nahm sich vor, das hier nicht ausarten zu lassen. Cappuccino trinken, zahlen, weg.
Judith setzte sich, die Tasse in der Hand, neben Rachel, und ihre Augen funkelten neugierig, sie verzog den halb offenen Mund zu einem Lächeln und gab Rachel mit dem Handrücken einen Klaps auf den Oberarm. »Mensch, du …!«
Um nicht weiter gehauen und angelächelt zu werden, sagte Rachel: »Und? Wie geht’s?«
»Du, das ist im Augenblick der komplette Wahnsinn. Ich sag nur 11/18 – das wird so unfassbar geil! Der Bodo Friedler macht Regie. Genial, aber der totale Choleriker. Kannst dir vorstellen, was da abgeht.«
Konnte sich Rachel offen gesagt nur sehr vage. Sie hatte mit der Filmbranche wenig zu tun, und 11/18 sagte ihr überhaupt nichts. Sascha machte Vertrags- und Urheberrecht in der Kanzlei, hatte einige Mandanten aus der Filmbranche und war deswegen immer mal wieder auf Filmpartys eingeladen. Bei der Gelegenheit hatten sie zweimal Judith Kellermann getroffen, die Rachel seither ständig irgendwelchen Müll auf Facebook und Instagram schickte und sie einlud, sich an Aktivitäten im Netz zu beteiligen. Rachel ignorierte das alles.
»11/18? Was war das noch mal?«
»Hey! Jetzt willst du mich aber hochnehmen.«
»Sascha hat mal was erwähnt.«
»Novemberrevolution 1918! Und was ist nächstes Jahr?«
»Ich hoffe, keine Revolution.«
»2018! Hundert Jahre Novemberrevolution. Das wird der ultimative HiKatZ.«
»Äh …?«
»Historischer Katastrophenzweiteiler, nie gehört?« Sie schlug lachend, diesmal mit der Handfläche, gegen Rachels Schulter. »HiKatZ! Ich find das so geil!« Sie wurde wieder ernst. »Das ist natürlich ein ganz schöner Koffer, das Teil, fünfeinhalb Millionen Budget, kannst dir vorstellen! Drehbeginn Oktober, und wir sind jetzt schon am Rotieren, aber das Ding wird richtig gut – richtig gut! Kriegst ’ne Karte für die Premiere.« Sie zog ihr Handy hervor. »Notier ich mir jetzt gleich, Rachel 11/18-Party, kommst auf die Gästeliste, vielleicht machen wir’s in Berlin, aber ich denk eher, auf dem Filmfest. Passt zwar nicht zum Sommer, aber scheißegal, die Leute werden’s lieben.«
»Und sonst? Alles in Ordnung?«, fragte Rachel, um von 11/18 wegzukommen. Die Bedienung brachte in diesem Moment den Cappuccino, Rachel dankte, bat um baldige Rechnung und schüttete Zucker in den Kaffee. Erst da merkte sie, dass Judith aufgehört hatte zu sprechen. Sie war auf einmal in sich zusammengesunken und starrte auf den Kiesboden.
»Wenn du privat meinst …« Sie kratzte mit ihrer Sandalette im Kies. »… ist grad nicht so toll.«
»Oh, das tut mir leid.«
»Kannst du ja nicht wissen.« Judith presste die Lippen zusammen, und ihr Kinn zitterte bedenklich.
»Sorry, wenn ich da in eine Wunde … das geht mich ja wirklich nichts an.« Rachel sah mit Entsetzen, wie sich die Augen ihrer Tischgenossin mit Tränen füllten. Genau das fehlte heute noch, dass die Kellermann jetzt mit der sterbenden Mutter um die Ecke kam, oder man hatte bei ihr Krebs diagnostiziert, oder irgendein anderer Schicksalsschlag hatte sie ereilt, über den sie endlich mal mit jemandem reden musste. Dieser 28. Mai, vermutlich der prächtigste Tag in den letzten zwölf Monaten, drohte zu einem veritablen Albtraum zu werden.
In dem Bemühen, Blickkontakt zu vermeiden, sah Rachel zum Eingang. Und so fielen ihr ein Mann und eine Frau auf, die gerade in den Biergarten kamen, stehen blieben und sich verdächtig unauffällig umsahen. Beide hatten Jeans und Sportschuhe an und trugen Jacken, die für das Wetter zu warm waren. Rachel vermutete, dass es sich um Polizeibeamte in Zivil handelte.
»Ich will dich damit gar nicht belasten«, sagte Judith Kellermann, wischte sich mit dem Handballen Tränen aus den Augen und wühlte anschließend in ihrer Handtasche nach einem Papiertaschentuch.
Rachel hielt ihr eins hin und sagte: »Ich glaube, da sucht dich jemand.«
Der Blick der unauffälligen Frau am Eingang war beim Umherschweifen an Judith Kellermann hängen geblieben. Sie berührte daraufhin ihren Begleiter am Arm, der jetzt ebenfalls in Kellermanns Richtung sah. Dann setzten sich die beiden ohne Hast, aber zielstrebig in Bewegung.
Judith Kellermann holte eine Brille aus der Handtasche und hielt sie sich vor die Augen, um die Näherkommenden zu erkennen.
»Kennst du die?«
»Nie gesehen.« Kellermann verstaute die Brille wieder in der Handtasche und versteifte sich, als das Paar an den Tisch trat.
»Frau Kellermann?«, sagte die Frau.
»Ja?«
»Ihre Nachbarin sagte uns, dass wir Sie hier finden.« Zwei Polizeiausweise wurden dezent präsentiert.
Kellermann starrte auf die Beamten. »Wieso rufen Sie mich nicht an? Gibt es etwas Neues in der … Sache?«
»Das würden wir gerne auf dem Revier mit Ihnen besprechen.«
Kellermann sah verunsichert zu Rachel, dann wieder zu den Polizisten. Rachel hätte gerne gewusst, was Judith Kellermann mit der Polizei zu schaffen hatte. Wenn sie am Sonntag Beamte schickten, musste es was Gravierendes sein. Andererseits, die Chancen, dass sie jetzt in Ruhe ihren Kaffee trinken konnte, standen gut. Und so versuchte Rachel, einen unbeteiligten Eindruck zu machen.
»Ich hab noch nicht gezahlt«, hörte sie Kellermann sagen.
»Ich übernehm das.« Rachel lächelte ihr zu.
»Einen Kaffee und ein Wasser. Das wär wahnsinnig nett von dir.«
»Kein Problem. Geh nur.«
Kellermann packte ihre Sachen zusammen und begab sich, von den beiden Beamten umrahmt, zum Ausgang. Kurz vor dem Eingangstor blieben sie stehen, und es kam zu einer Diskussion zwischen den dreien, in deren Verlauf die Frau ein Papier aus ihrer zu warmen Jacke zog und es Kellermann zu lesen gab. Die warf nur einen flüchtigen Blick darauf. Dann folgte eine verbale Auseinandersetzung. Da gerade eine Drei-Mann-Kapelle anfing, Dixieland zu spielen, konnte Rachel nichts verstehen. Doch Kellermann machte einen sehr erregten Eindruck, während die Polizeibeamten offenbar versuchten, sie zu beschwichtigen. Irgendwann drehte sich Kellermann zu Rachel und deutete auf sie. Die Beamten sahen in ihre Richtung, kurze Abstimmung, dann kam die Frau zu Rachels Tisch zurück. Rachel schwante nichts Gutes.
»Sie sind Frau Kellermanns Rechtsbeistand?«, fragte die Polizistin.
»Nicht dass ich wüsste.« Rachel nahm einen Schluck Cappuccino.
»Sie behauptet das aber.«
»Ich kenne Frau Kellermann nur flüchtig. Anwaltlich vertreten habe ich sie nie und habe das auch nicht vor.« Sie hielt immer noch ihre Cappuccinotasse in der Hand. »Tut mir leid.«
»Kein Problem«, sagte die Beamtin und ging zurück.
Rachel hätte sie gerne gefragt, um was es ging. Aber das hätte die Frau ihr ohnehin nicht erzählt.
Als Kellermann hörte, was die Polizistin ihr zu sagen hatte, blickte sie entsetzt in Rachels Richtung und begann so laut zu schreien, dass Rachel es trotz Dixieland verstehen konnte. »Rachel! Du musst mir helfen!«
Die Beamten sagten etwas zu Kellermann und deuteten zum Ausgang, Kellermann aber wollte zu Rachel. Sie wurde von dem Beamtenpärchen an den Armen gepackt und weggezerrt, doch Kellermann riss sich los und versuchte, in Rachels Richtung zu laufen. Die Polizisten, körperlich und schuhtechnisch überlegen, hatten sie sofort eingeholt und erneut gepackt. Kellermann wehrte sich mit Kräften, die man ihrem dürren Körper nicht zugetraut hätte. Die Biergartenbesucher wurden unruhig, sodass der Beamte seinen Dienstausweis in die Höhe hielt und laut allen Umstehenden verkündete: »Bitte gehen Sie weiter. Das ist eine Festnahme!« Noch während er es sagte, schlug ihm die wild um sich zappelnde Delinquentin die Brille von der Nase und schrie erneut nach Rachel, die jetzt im Fokus der umstehenden Biergartenbesucher stand und sich fragte, ob sie das hier einfach aussitzen könnte. Schließlich beschloss sie, dem Albtraum ein Ende zu bereiten.
Kellermann hatte sich halbwegs beruhigt, als sie Rachel kommen sah, doch sie zitterte wie Espenlaub, weinte und hatte sich ein Knie aufgeschürft. Sie sah Rachel flehend an: »Rachel, bitte! Ich brauche eine Anwältin. Muss ich irgendetwas unterschreiben?«
»Nein, Judith, ich muss bloß einverstanden sein. Aber du solltest dir besser jemand anderen suchen. Ich ruf mal Geruda an. Den kennst du ja sicher.« Sie holte ihr Handy hervor. Geruda ging mit Sicherheit auch am Sonntag ans Telefon, es sei denn, er lief gerade einen Marathon. Aber wahrscheinlich auch dann.
»Das kannst du nicht machen!« Kellermann packte Rachel am Arm. »Denk an den Eid, den du geschworen hast!«
»Judith, den schwören Ärzte.« Sie pflückte Kellermanns Hand von ihrem Arm. »Ich bin leider voll mit Mandanten. Und Geruda ist wirklich ein Topstrafverteidiger.«
»Rachel! Es geht um Leben und Tod. Ich brauche keinen Topstrafverteidiger. Ich brauche dich. Ich brauche – die Beste!«
Rachel konnte nicht verhindern, dass sie trotz aller Abneigung Kellermann für eine Millisekunde ganz sympathisch fand. Aber dann hielt die Vernunft wieder Einzug in ihr Gehirn. Kellermann war eine Ertrinkende, die alles sagen würde, damit man sie aus dem Wasser zog. Und so war es dann mehr als alle Schmeichelei die reine Neugier, die Rachel fragen ließ: »Um was geht’s denn überhaupt?«
Judith Kellermann sah Rachel aus verheulten Augen an, und ihre Stimme war brüchig, als sie sagte: »Mord …«
2
Das Zimmer war in hellen Grautönen gestrichen. Frau Kossirek und Herr Mantell hießen die vernehmenden Kommissare. Es waren nicht die beiden, die Judith Kellermann festgenommen hatten. Kriminalhauptkommissar Mantell kümmerte sich als Chef der Mordkommission in eigener Person um den Fall und hatte dafür an diesem sonnigen Sonntag sogar Frau und Kinder im Stich gelassen.
Rachel war hinter dem Polizeifahrzeug bis zum Polizeipräsidium in der Ettstraße gefahren. Auf dem Weg haderte sie mit sich, dass sie den Fall angenommen hatte. Aber einerseits war da – Sarah hatte recht gehabt – noch Luft, was die Arbeitsbelastung anging. Zum anderen hatte die Begründung des Haftbefehls ihre Neugier geweckt. Das war kein gewöhnlicher Fall. Und ein bisschen Presse würde es vielleicht auch geben. Kellermann war immerhin Filmproduzentin, wenn auch keine bekannte.
Rachel nahm ihre Brille ab, putzte sie mit dem Brillenputztuch, das sie immer bei sich führte, und setzte sie bedächtig wieder auf, um mit der Lektüre des Haftbefehls gegen Judith Kellermann fortzufahren. Sie hatte ihn im Hirschgarten nur kurz überflogen. Ein Haftbefehl war keine Anklageschrift und enthielt nur eine rudimentäre Schilderung des Tatvorwurfs sowie die wichtigsten Beweismittel. Aber das wenige, was darin stand, war erstaunlich.
»Ziemlich starker Tobak, was Sie meiner Mandantin vorwerfen.«
»Das ist Mord meistens«, erwiderte Kriminalhauptkommissarin Kossirek, die anscheinend den Bad Cop spielte. »Oder was meinen Sie genau?«
»Sie wissen, was ich meine.« Rachel schob den Haftbefehl von sich weg, als wollte sie mit diesem Unsinn nichts zu tun haben. »Frau Kellermann soll also eine Bombe aus Plastiksprengstoff gebaut haben, um einen Herrn Sandner mitsamt einer Blockhütte in die Luft zu sprengen.«
»Das interpretieren Sie vollkommen richtig, soweit es nicht ohnehin im Haftbefehl steht.« Kossirek nahm ihre eigene Kopie zur Hand und überflog sie. »Eigentlich steht das da ziemlich wörtlich drin. Was also ist Ihre Frage?«
Kommissar Mantell gefiel sich in der Rolle des Drahtziehers im Hintergrund, gab außer konzentriert-besorgter Mimik wenig preis und überließ es seiner Mitarbeiterin, sich mit Rachel zu zanken.
»Glauben Sie das allen Ernstes selbst, was Sie da von sich gegeben haben?« Rachel, die Arme vor der Brust verschränkt, deutete mit dem Kinn auf den streitgegenständlichen Haftbefehl.
»Frau Anwältin, ich weiß, dass Sie uns gerne alles Mögliche unterstellen. Aber wir haben unseren Job gemacht. Was Sie da lesen, ist das Ergebnis äußerst sorgfältiger Ermittlungen.«
»Das will ich mal hoffen. Nur, wie kommen Sie darauf, dass meine Mandantin, eine mittelständische Fernsehproduzentin, in der Lage sein soll, sich mehrere Kilogramm Sprengstoff zu beschaffen, daraus eine Bombe mit Fernzünder zu bauen und diese mit äußerster Präzision per Handy zu zünden?«
»Das hoffen wir, von Frau Kellermann selbst zu erfahren«, schaltete sich jetzt Mantells sonorer Bariton in das Gespräch ein.
»Was Sie da schreiben, ist völlig absurd.« Kellermann schüttelte den Kopf.
Rachel legte ihre Hand auf Kellermanns Arm. Sie wollte nicht, dass ihre Mandantin überhaupt irgendetwas sagte. Vor ein paar Tagen hatte Rachel in der Zeitung gelesen, dass nicht unweit des Golfplatzes von Straßlach ein Ferienhaus in die Luft geflogen war. Damals wusste die Polizei noch nicht, ob es sich um einen Unfall oder eine vorsätzliche Tat gehandelt hatte. Da war man in der Zwischenzeit offenbar weitergekommen. Sie nahm den Haftbefehl wieder zur Hand und betrachtete den nicht allzu langen Absatz mit den Beweismitteln.
»Was heißt Zeugen? Hat jemand gesehen, wie Frau Kellermann die Bombe gezündet hat? Wie sie den Sprengstoff am Tatort deponiert hat?«
»Es gibt Zeugen, die gesehen haben, wie Frau Kellermann am Tag vor der Tat zum Tatort gefahren ist. Außerdem haben wir Hinweise, dass sich Frau Kellermann auf dem schwarzen Markt Sprengstoff beschafft hat.«
»Ich nehme nicht an, dass die Person, die meiner Mandantin angeblich Sprengstoff verkauft hat, vor Gericht selbst aussagen wird.«
»Vermutlich nicht.«
»Wer wird dann aussagen? Irgendein Junkie, der gerade ein Verfahren am Hals hat und bei der Staatsanwaltschaft Punkte sammeln will? Dass er von irgendwem, den er nicht nennen kann, was gehört hat?«
»Lassen Sie das unsere Sorge sein«, sagte Mantell eher väterlich als ironisch. »Vielleicht wissen wir schon bald mehr. Die Kollegen von der Spurensicherung sind auf dem Weg zu Frau Kellermanns Haus.« Mantell zog ein weiteres Schriftstück aus einem vor ihm liegenden Aktendeckel und schob es über den Tisch. Es war der Durchsuchungsbeschluss für Judith Kellermanns Haus.
Rachel las den Beschluss konzentriert durch und sagte schließlich: »Meine Mandantin erhebt Widerspruch gegen den Durchsuchungsbeschluss.«
»Was soll das? Es wird nichts ändern.«
»Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht, und werde uns deswegen alle Optionen offenhalten.« Rachel spielte darauf an, dass von einem späteren Gericht unter Umständen ein Beweismittelverbot ausgesprochen werden konnte, falls sich die Durchsuchung als rechtswidrig herausstellte.
»Na schön. Nehmen wir es zu Protokoll.«
»Tun Sie das. Und jetzt würde ich gerne mit meiner Mandantin unter vier Augen reden.«
Rachel wurde ein Raum zur Verfügung gestellt, von dem sie hoffte, dass die Polizei hier weder Kameras noch Mikrofone aufgestellt hatte. Es war im Grunde mehr eine Zelle mit Stahltür, Tisch und zwei Stühlen.
Kellermann war aufgewühlt und zitterte, als sie ihren Kaffeebecher zum Mund führte. Rachel wartete, bis ihre Mandantin sie ansah und signalisierte, dass sie bereit war zu reden.
»Hast du eine Idee«, begann Rachel, »warum die Polizei dich beschuldigt, den Mord an Eike Sandner begangen zu haben?« Rachels Worte waren bewusst so gewählt. Sie fragte nicht, ob Kellermann es getan hatte. Wenn Kellermann die Tat zugab, konnte das Rachel in ihrer Verteidigung beeinträchtigen, denn auch als Anwältin der Beschuldigten durfte sie nicht lügen. Kellermann machte eine hilflose Geste und fand keine Worte. »Fangen wir anders an. Du kanntest das Opfer?«
»Ja, Eike war mein …« Kellermann schluckte, Erinnerungen kamen hoch. »Wir waren seit einigen Monaten zusammen.«
»Warum solltest du ihn dann umbringen?«
Kellermann zögerte, wischte sich die Tränen aus den Augen. »Er hat mich betrogen.«
Rachel ließ noch einmal Kellermanns Verhalten im Biergarten Revue passieren. Ihre überdrehte Art am Anfang, solange es um Berufliches ging. Sie hatte nicht den Eindruck einer Frau gemacht, deren Freund vor ein paar Tagen umgebracht worden war. Aber vielleicht war sie gut darin, ihre Trauer zu überspielen. Als Rachel nach ihrem Privatleben gefragt hatte, war Kellermann still geworden und hätte fast geweint. Aber worüber? Über Sandners Tod? Oder weil er sie enttäuscht hatte?
»Woher könnte die Polizei wissen, dass er dich betrogen hat?«
»Einige Tage vor der Explosion hatten wir Streit deswegen. Es war bei einer Premierenfeier. Ich bin ziemlich laut geworden, dann … habe ich ihn geohrfeigt und bin gegangen. Es dürfte jede Menge Zeugen geben.«
»Gibt es etwas, das den Mordverdacht entkräften könnte?«
»Ich habe Eike nicht umgebracht. Wir hatten Streit. Ich, ich war eifersüchtig – ja, aber deswegen … ich hab ihn geliebt!« Sie brach in Tränen aus. »Und jetzt behauptet die Polizei, ich hätte ihn in die Luft gesprengt. Ich kann das alles nicht glauben.«
Rachel reichte Kellermann ein Papiertaschentuch. Und gleich darauf ein zweites. Die Tränen flossen reichlich, und Kellermann musste sich schnäuzen.
»Was ist mit dieser Hütte?«
»Eike hat dort gewohnt.«
»Sagten die nicht, es war ein Ferienhaus?«
»Er wohnte eigentlich in Köln, kam aber häufig nach München. Dafür hatte er die Hütte gemietet.«
»Das ist vermutlich nicht billig. Ein Ferienhaus in Straßlach …«
»Eike konnte es sich leisten. Er hatte eine Firma, und die Geschäfte liefen gut.«
»Warst du öfter in der Hütte?«
»Nein. Eigentlich nie. Er ist immer zu mir nach Harlaching gekommen. Nur wenn ich keine Zeit hatte oder er abends mal weg war, hat er die Hütte benutzt. Ich hatte aber einen Schlüssel – falls mal was ist.«
»Das heißt, du warst nie in der Hütte in Straßlach?«
Kellermann zögerte, Rachel gab ihr noch ein Taschentuch, um die restlichen Tränen fortzuwischen. Kellermanns Blick wie auch ihre Gefühlslage hatten sich verändert, und sie machte einen konzentrierten Eindruck. »Doch«, sagte sie, zog die Nase hoch und sah an Rachel vorbei zur Stahltür, die Augen verengten sich. »Doch, ich war da.«
»Wie oft?«
»Einmal. Am Tag vor der Explosion.« Sie starrte Rachel an. Die Augen und die wulstige Nase waren vom Weinen gerötet.
»Was wolltest du in der Hütte?«
»Ich war mir sicher, er betrügt mich. Aber er hat alles abgestritten. Ich wollte Beweise. Irgendwas finden: E-Mails, Kalendereinträge, einen Slip im Badezimmer, Parfüm – was weiß ich. Ja, ich war außer mir. Ich bin also nach Straßlach gefahren, hab den Wagen ein paar Hundert Meter vorher im Wald abgestellt und bin den Rest zu Fuß gegangen. Ich wusste, dass Eike zu dieser Zeit nicht da war.«
»Warum hast du den Wagen abgestellt?«
»Ich dachte, wenn jemand vorbeikommt und mich sieht, dann sieht er eben nur mich und nicht den Wagen. Autos sind leichter zu identifizieren. Haben Nummernschilder, Farben, Marken.«
»Anscheinend hat dich trotzdem jemand gesehen.«
»Keine Ahnung. Da draußen kennt mich eigentlich niemand. Aber ich bin kein Profieinbrecher. Wahrscheinlich hab ich mich einfach zu dumm angestellt.«
»Warst du im Haus?«
»Ja.« Kellermann stand auf, ging im Raum umher, streifte mit den Fingern am Putz entlang, blieb vor der Stahltür stehen und betastete die Nieten an den Metallbändern mit den Fingerkuppen. »Eike hatte mir, wie gesagt, einen Schlüssel gegeben. Für Notfälle. Oder wenn er in Köln war und etwas aus der Hütte gebraucht hätte. Er ist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass ich den Schlüssel sonst nicht benutze.«
»Auch nach der Szene, die du ihm gemacht hast?«
Kellermann zuckte mit den Schultern.
»Hast du was gefunden?«
Kellermanns Kinnmuskulatur kam in Bewegung, ihr Blick verhärtete sich. »Das Bett war gemacht. Aber das Kopfkissen roch nach einem Duft, den Eike nicht benutzte. Irgendwie mit nuttiger Note. Im Ablauf der Duschwanne waren lange schwarze Haare. Die Frau, mit der ich Eike gesehen hatte, war schwarzhaarig.«
Rachel hätte noch viele Fragen gehabt, etwa: Wo hatte Kellermann Sandner mit der schwarzhaarigen Frau gesehen, und wie war es dazu gekommen. Aber das konnte sie später klären. Die Zeit drängte, und anderes war wichtiger. »Wie könnte die Polizei darauf kommen, dass du dir Sprengstoff besorgen wolltest?« Auch hier verzichtete Rachel auf die Frage, ob Kellermann das tatsächlich gemacht hatte.
Kellermann kehrte an den Tisch zurück, nahm wieder Platz und biss sich auf die Unterlippe. Sie sah Rachel an und wollte etwas sagen. Doch es klopfte an der Tür. Kommissarin Kossirek steckte den Kopf herein.
»Tut mir leid, dass ich Ihr Mandantengespräch unterbreche …« Ihr Gesichtsausdruck sagte Rachel etwas anderes. »Aber wir wären so weit. Wenn Sie also bei der Hausdurchsuchung dabei sein wollen, dann sollten Sie jetzt mitkommen.«
Rachel wollte definitiv bei der Hausdurchsuchung dabei sein. Es ergab in dem Fall vermutlich nicht viel Sinn. Aber sie wollte auf keinen Fall den Eindruck erwecken, sie würde der Polizei freie Hand lassen.
Kellermann stand auf, aber Rachel hielt sie mit einer Handbewegung zurück und rief »Eine Minute noch!« in Richtung Kossirek. Die zog die Tür wieder zu.
»Ich weiß, das ist alles sehr belastend für dich, und ich versuche, es dir so leicht zu machen, wie es in einer solchen Situation eben geht. Trotzdem müssen wir über die finanzielle Seite unserer Zusammenarbeit reden.«
»Natürlich. Was bekommst du? Willst du nach Stunden abrechnen?«
»Das mache ich üblicherweise. Allerdings müsste ich einen Vorschuss verlangen.«
»Der wie hoch wäre?«
»Fünfzigtausend.«
Kellermann starrte Rachel ins Gesicht.
»Ist das ein Problem?«
»Ein Problem?« Sie lachte dünn. »Ja.«
»Dann haben wir beide ein Problem.«
Kellermann zog die Stirn in Falten.
»Es klingt nach viel. Klar. Aber das könnte ein kompliziertes und langes Verfahren werden, und Mandanten, die inhaftiert sind – verzeih mir meine Offenheit –, haben in der Regel gewisse Probleme mit der Honorarbeschaffung.«
Kellermann fuhr sich mit den Händen übers Gesicht. »Um ehrlich zu sein, habe ich das Geld nicht. Wir sind für den Dreh von 11/18 wahnsinnig in Vorleistung gegangen. Da steckt mein ganzes Kapital drin. Und wenn die Banken erfahren, dass ich verhaftet bin, bekomme ich keinen Cent mehr.«
»Und wie lösen wir das Problem? Kannst du deinen Vater nicht bitten?«
Kellermann atmete tief ein und schüttelte mit zusammengepressten Lippen den Kopf. »Das will ich nicht. Nicht meinen Vater.«
Rachel notierte im Kopf, dass es da anscheinend Verwerfungen gab. »Was ist mit deinem Bruder?«
Kellermann nickte. »Ich geb dir seine Telefonnummer. Meinst du, ich kann ihn anrufen und ihm Bescheid sagen?«
»Ja. Das wird gehen«, sagte Rachel und holte eine vorgedruckte Vollmachtserklärung aus ihrer Aktentasche, um sie von Kellermann unterschreiben zu lassen.
3
Judith Kellermanns Haus befand sich in Harlaching, einem Ortsteil von München, der direkt an Grünwald grenzte. Wenn man durch Grünwald nach Süden fuhr, kam man in Straßlach heraus. Zwischen ihrem Haus und dem Tatort lagen also nur wenige Kilometer.
Judith Kellermann hatte das Recht, bei der Durchsuchung ihres Hauses zugegen zu sein. Ebenso ihre Verteidigerin. Die Ermittlungsbeamten suchten weitere Spuren, die Kellermann mit der Tat in Verbindung brachten. Insbesondere hatte es die Polizei auf ein Mobiltelefon abgesehen, von dem aus die Bombe gezündet worden war. Das Handy, das Kellermann bei ihrer Festnahme dabeihatte, war bereits beschlagnahmt worden. Was die vorläufige Untersuchung des Handys durch die Spezialisten bislang ergeben hatte, wurde Rachel nicht mitgeteilt. Der Umstand, dass Kommissar Mantell die Spurensicherer anwies, nach weiteren Handys Ausschau zu halten, ließ sie freilich vermuten, dass die Untersuchung des bislang sichergestellten Geräts nicht zur Zufriedenheit der Ermittler ausgefallen war.
Rachel schaute den Beamten bei der Durchsuchung auf die Finger. Ab und zu kam sie nach draußen auf die Terrasse, wo Judith Kellermann eine Zigarette nach der anderen rauchte. Eine ungestörte Unterhaltung war hier nicht möglich, denn Kellermann wurde von einer Polizeibeamtin bewacht.
In weiße Overalls gekleidete Beamte der Spurensicherung schwirrten umher, trugen gelegentlich Gegenstände aus dem Haus und verstauten sie in Einsatzfahrzeugen. Es sah ein bisschen aus, als wären Marsmännchen über das Anwesen von Judith Kellermann hergefallen. Auch ein Team mit zwei Spürhunden traf ein und machte sich erst im Garten, dann im Haus zu schaffen. Rachel war nicht ganz klar, was die Hunde suchten. Irgendwann kam Kommissarin Kossirek mit einer durchsichtigen Plastiktüte auf die Terrasse. Die Tüte enthielt ein billiges Handy.
»Gehört das Ihnen?«
Kellermann wollte etwas sagen, aber Rachel fiel ihr ins Wort.
»Sie werden das sicher selbst herausfinden, Frau Kossirek. Wenn keine Fingerabdrücke von Frau Kellermann drauf sind, hat es wohl jemand im Haus vergessen.«
»Sehr witzig. Vielleicht sagen Sie uns einfach den PIN-Code. Das würde uns eine Menge Arbeit ersparen. Bei dem anderen Handy waren Sie ja auch nicht so zugeknöpft.«
»Schauen Sie, Frau Kossirek, wir sind nicht da, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Dennoch rate ich meinen Mandanten, so kooperativ wie möglich zu sein. Man muss sich das Leben ja nicht unnötig schwer machen. Allerdings käme in diesem Fall die Herausgabe der PIN-Nummer einem Eingeständnis meiner Mandantin gleich. Deswegen müssen wir leider offenlassen, ob es sich um Frau Kellermanns Handy handelt.« Rachel bemühte sich um ein breites Lächeln.
»Werd’s mir merken«, sagte Kossirek und stöckelte auf ihren für einen Außeneinsatz recht hochhackigen Pumps zurück ins Haus.
»Dein Zweithandy?«, flüsterte Rachel, da Kellermanns Bewacherin sich gerade ein paar Schritte entfernt hatte.
»Ist etwas kompliziert.« Kellermann sog mit verzweifelter Inbrunst an ihrer Zigarette, warf sie auf den Terrassenboden und trat sie aus.
Im Haus wurde es unruhig. Ein Hund bellte, Stimmen von Beamten riefen einander zu, man habe etwas entdeckt. Rachel sah Kellermann an, die zuckte mit den Schultern. Es dauerte einige Zeit, bis sich die Unruhe gelegt hatte. Schließlich wurden die beiden Hunde wieder aus dem Haus geführt. Sie hatten offenbar ihre Arbeit getan. Kommissar Mantell, der die Aktion leitete, stand jetzt mit Sabine Wittmann, der zuständigen Staatsanwältin, deren Anwesenheit Rachel bis jetzt noch nicht bemerkt hatte, zusammen. Sie redeten mit ernster Miene, und man konnte den Eindruck gewinnen, die Arbeiten gingen gut voran.
»Hallo, Frau Wittmann!« Rachel gesellte sich zu den beiden. Sie kannte Wittmann aus etlichen früheren Verfahren. Ihr persönliches Verhältnis war kompliziert und verkrampft. Wittmann hatte Rachel vor zwei Jahren das Leben gerettet, als jemand vor einem Gerichtssaal mit einem Messer auf sie losgehen wollte. Seitdem bemühte sich Rachel um einen respektvollen und halbwegs freundlichen Umgangston. Allerdings liefen gelegentlich Dinge an Wittmann vorbei. Dann nämlich, wenn Rachel mit Oberstaatsanwalt Schwind, Wittmanns Vorgesetztem, auf dem kurzen Dienstweg kommunizierte. Schwind versuchte zwar, Wittmann nichts von diesen Kontakten merken zu lassen, schon um sie nicht bloßzustellen. Aber Wittmann war nicht dumm und ahnte es meist, wenn hinter ihrem Rücken gedealt wurde.
»Hab schon gehört«, sagte Wittmann. »Wir arbeiten wieder zusammen am gleichen Fall, wie mein Chef sagen würde.« Das sagte Schwind öfter – mehr im Scherz natürlich. Aber es gab Wittmann trotzdem jedes Mal einen Stich, weil insofern ein Körnchen Wahrheit daran war, als sie nie ganz sicher war, mit wem ihr Chef eigentlich zusammenarbeitete.
»Sieht so aus. Aber Sie sind ja noch am Ermitteln. Vielleicht kommt es gar nicht zum Prozess.« Rachel sah Kommissar Mantell lächelnd an. »Oder haben Ihre Hunde irgendetwas von Bedeutung gefunden?«
»Wird sich herausstellen.« Mantell wirkte entspannt und zufrieden. »Es dürfte sich um Spuren von Semtex handeln, soweit wir das schon sagen können. Der Hundeführer schließt es daraus, dass es der Hund so schnell gefunden hat. Das Zeug wird nämlich mit Markierungsstoffen versetzt, um es den Hunden zu erleichtern. Semtex ist ein …«
»… gängiger Sprengstoff. Ich weiß.« Rachel sah zu ihrer Mandantin, die fünfzehn Meter entfernt stand und sich gerade eine neue Zigarette angezündet hatte.
Es war halb vier, als Rachel in die Kanzlei kam. Die Büroräume waren verwaist. Bei Eisenberg & Partner wurde Wert darauf gelegt, dass keiner am Wochenende arbeitete. Rachel bewilligte sich heute eine Ausnahme. Sie wollte nicht zu Hause auf Sarah treffen. Die hätte sie vermutlich mit Fragen zu ihrem Verhalten vorhin gelöchert.
Rachel diktierte ein Gedächtnisprotokoll der bisherigen Ereignisse sowie einen Antrag auf Akteneinsicht, dann rief sie Jonas Kellermann an, den Bruder von Judith. Er war Geschäftsführer der Filmfirma seines Vaters, und Rachel hatte ihn einige Male bei Film- und Fernsehempfängen getroffen. Sie überlegte, ob sie per Du waren, hielt es aber für unwahrscheinlich. Jonas Kellermann war ein nüchterner Kaufmann, der nicht die Visionen seines glamourösen, inzwischen fünfundsiebzigjährigen Vaters Bernd hatte, sondern den Laden ordentlich verwaltete und fürs Kreative Leute hatte, die er bezahlte.
Jonas Kellermann war gerade von seiner Schwester angerufen worden und zusammen mit seinem Vater auf dem Weg, sie zu besuchen. Er bot an, in die Kanzlei zu kommen.
Zwanzig Minuten später saßen Rachel, Jonas und Bernd Kellermann in Rachels Büro. Beide Kellermanns erschienen in Freizeitkleidung. Während Jonas Lacoste-Polo, Jeans und Loafers trug, hatte sein Vater einen legeren Sommeranzug aus Leinen mit weißem Hemd an. Jonas war trotz des schönen Wetters blass im Gesicht, Bernd braun gebrannt, er schien sich viel auf Golf- und Tennisplätzen aufzuhalten.
»Das kann doch nur ein absurdes Missverständnis sein«, sagte Jonas und sah Zustimmung erhoffend zu seinem Vater.
»Mich würde es nicht wundern, wenn sie einen dieser Mistkerle mal in die Luft gesprengt hätte.« Bernd Kellermann hob die Hände. »Womit ich nicht sagen will, dass sie es wirklich getan hat.«
Rachel wandte sich etwas verwundert an Jonas. Der fühlte sich bemüßigt, die Worte seines Vaters zu erläutern.
»Wissen Sie, meine Schwester ist kein Engel und sehr emotional. Sie ist sogar mal mit einem Messer auf einen Polizisten losgegangen. Trotzdem glaube ich nicht, dass sie das getan hat. Hätte sie den Kerl umbringen wollen, dann nicht mit etwas so Kompliziertem wie einer Bombe. Das muss man sorgfältig planen. Dafür ist sie viel zu chaotisch.«
»Vielleicht können wir Ihre Einschätzung von Judiths Persönlichkeitsstruktur vor Gericht verwenden. Aber ich glaube nicht, dass es die Staatsanwaltschaft zum Umdenken veranlasst. Zumal in Judiths Haus Spuren von Sprengstoff gefunden wurden.«
»Tatsächlich!«, raunte der alte Kellermann mit einem Anflug von Bewunderung. »Hätte ich ihr nicht zugetraut.«
»Für die Polizei scheint die Sache klar zu sein. Das heißt, Ihre Schwester braucht anwaltliche Hilfe. Ich weiß nicht, warum sie ausgerechnet mich will. Aber ich konnte es ihr nicht ausreden.«
»Sie wird ihre Gründe haben«, sagte Jonas. »Wie viel bekommen Sie?«
»Fünfhundert die Stunde. Fünfzigtausend Anzahlung. Sollten die Ermittlungen nächste Woche eingestellt werden, bekommen Sie natürlich eine Erstattung. Aber damit würde ich mal nicht rechnen.«
Bernd Kellermann zog nickend die Mundwinkel nach unten. »Ein recht ordentliches Stundenhonorar.«
»Es ist das, was alle Mandanten mir bezahlen. Aber es kommen möglicherweise noch andere Kosten auf Sie zu.«
»Gerichtskosten?«
»Die auch – wenn wir verlieren. Aber das ist Portokasse. Nein, ich meine etwas anderes, die Polizei glaubt, sie hat den Fall geklärt. Die werden nicht mehr in andere Richtungen ermitteln. Das müssten wir dann selbst tun.«
»Wer ist wir?« Jonas Kellermann blickte zusehends säuerlich drein.
»Ein Privatdetektiv, den wir engagieren. Da fallen etwa hundert Euro die Stunde plus Spesen an.«
»Das kann ja ein Vermögen kosten. Ich bin nicht Bill Gates.«
»Sie ist deine Schwester! Hör auf rumzugeizen«, fauchte ihn sein Vater an und wandte sich an Rachel. »Ich übernehme das. Er ist so ein Pfennigfuchser.«
Rachel war einen Moment lang unschlüssig, ob sie es sagen sollte, aber letztlich musste sie es tun. »Ich hatte, um ehrlich zu sein, den Eindruck, dass Judith Sie lieber nicht um diesen Gefallen bitten möchte.«
Wieder nickte Kellermann mit heruntergezogenen Mundwinkeln und gerunzelter Stirn. »Verstehe. Natürlich. Kann ich ihr nicht verdenken.«
»Ich gebe nur weiter, was sie mir sagte. Was da zwischen Ihnen ist, geht mich natürlich nichts an.«
Bernd Kellermann zuckte mit den Schultern. »Sie nimmt es mir übel, dass ich Jonas zu meinem Nachfolger gemacht habe.« Er sah zu seinem Sohn. »Also, was ist jetzt?«
»Es kann doch nicht sein, dass ich ihr jedes Mal wieder den Arsch retten muss. Sie ist erwachsen.«
»Ich meine, wie Sie beide das dann intern verrechnen, ist ja Ihre Sache«, versuchte Rachel zu vermitteln.
»Ja, klar. Wir kriegen das schon hin«, sagte Bernd Kellermann. »Muss er eine Vereinbarung unterschreiben?«
»Sie haben sie morgen im Briefkasten.«
»Na gut.« Jonas Kellermann verschränkte die Arme vor der Brust. »Aber ich hätte gerne wöchentliche Berichte. Auch was bei den Recherchen herauskommt. Damit ich weiß, wofür ich mein Geld ausgebe.«
»Da haben wir allerdings ein Problem.«
»Wie bitte?«
»Sie zahlen zwar, aber unsere Mandantin ist Judith Kellermann. Was wir recherchieren, unterliegt der Schweigepflicht. Sie können sich natürlich von Ihrer Schwester erzählen lassen, wie der Stand der Dinge ist.«
»Ist ja reizend.« Er sah mit fassungsloser Miene zu seinem Vater, der schwieg und schien eher amüsiert.
»Tut mir leid. Aber Sie übernehmen nur die Schulden Ihrer Schwester.«
»Ist wie gesagt nichts Neues. Schicken Sie mir die Vereinbarung.«
Als die Kellermanns gegangen waren, bemerkte Rachel eine WhatsApp auf ihrem Handy. Sascha bat sie, ihn anzurufen. Rachel und Sascha waren immer noch verheiratet, lebten aber seit Jahren getrennt. Die Anwaltskanzlei betrieben sie weiterhin gemeinsam. Rachel war für Strafrecht, Sascha für Zivilrecht zuständig. Trennungsgrund war eine Rechtsreferendarin gewesen, mit der Sascha Rachel betrogen hatte, oder genauer gesagt war es der Anlass zur Trennung gewesen. Ihre Ehe hatte schon länger geschwächelt. Mittlerweile hatte sich die Affäre mit der Referendarin, inzwischen fertige Juristin, erledigt, und Sascha, der keine Probleme hatte, Frauen kennenzulernen, führte ein lockeres Singleleben und schlug sich oft die Nächte um die Ohren. Rachel hatte seit zwei Jahren eine Beziehung zu einem Anwaltskollegen namens Reza Haim, alleinerziehender Vater eines Sohnes in Sarahs Alter. Sie gingen öfter zusammen essen, ins Theater, auf die Berge der bayerischen Voralpen und manchmal auch ins Bett. Aber bislang war nichts Festes aus den beiden geworden. Das lag mehr an Rachel als an Reza, der persische Wurzeln hatte, was Sascha, der einer jüdischen Familie aus Russland entstammte, die eine oder andere Spitze entlockte.
»Wie war dein Tag?«, eröffnete Sascha das Telefonat.
Rachel erzählte ihm von Judith Kellermann.
»Judith Kellermann? Die hat echt ihren Freund …?«
»Das wissen wir noch nicht. Aber sie wurde verhaftet, und ich war zufällig dabei. Deshalb hab ich jetzt das Mandat an der Hacke.«
»Kann sie zahlen?«
»Der Bruder übernimmt die Gebühren.«
»Sehr gut. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ich bin in der Branche ja ganz gut vernetzt.«
»Werde ich wahrscheinlich sogar machen.«
»Ja, gut. Sag mal …« Sascha machte eine Pause, als müsste er nach den richtigen Worten suchen.
»Ja?«
»Sarah hat gefragt, ob ich heute Abend zum Essen komme. Sie kocht. Weißt du davon?«
»Offen gestanden – nein. Als ich das Haus verlassen habe, hatten wir gerade Krach. Und seitdem haben wir nicht mehr gesprochen. Aber du kannst gerne kommen.«
»Kein Mullah-Abend heute?«
»Du bist wieder ausgeladen.« Rachels Stimme wurde bedrohlich scharf, noch auf der scherzhaften Seite, aber das konnte kippen.
»Sorry. War ’n dummer Scherz. Wie nennt er mich eigentlich?«
»Wir reden nicht über dich.«
»Ah ja!« Sascha klang gut gelaunt, und Rachel ärgerte es, dass er sich so wichtig nahm – und dass er recht hatte. Natürlich redeten sie über ihn. »Zwanzig Uhr?«
Seit Längerem saß die Familie wieder zusammen beim Abendessen. Es war nicht so, dass sie nach der Trennung von Rachel und Sascha – genauer gesagt hatte Rachel Sascha vor die Tür gesetzt – gar nichts mehr zu dritt machten. Es gab Segelausflüge auf dem Starnberger See und öfter auch ein gemeinsames Essen. Das fand aber meistens mittags statt. Sarah hatte an diesem Abend Spaghetti aglio e olio con scampi gemacht und beim Knoblauch ordentlich zugelangt.
»Köstlich«, lobte Sascha, hielt sich aber bei der zweiten Portion zurück.
»Mama – ihm schmeckt’s nicht!« Sarah deutete fassungslos auf den Verweigerer. »Da essen wir endlich mal wieder zusammen zu Abend und dann …«
»Nein, nein, Mäuschen, es schmeckt ganz wunderbar. Es ist nur …«
»Was?!«
»Es ist sehr viel Knoblauch dran. Ich hab morgen einen Termin mit einem Rabbiner aus Frankfurt und möchte nicht, dass er bei der Besprechung ohnmächtig wird.«
»Sag ihm, dass deine Tochter megaköstliche Spaghetti mit Scampi gekocht hat und du keinen Ärger wolltest.«
»Das werde ich ihm besser nicht sagen.«
»Sind Spaghetti nicht koscher?«
»Spaghetti schon. Scampi nicht.«
»Aber nicht, weil sie aus dem Meer kommen, oder? Was ist mit Gefillte Fisch?«
»Fische sind koscher, wenn sie Schuppen und Flossen haben. Alles andere aus dem Meer ist treif. Hast du das nicht für deine Bat Mitzwa gelernt?«
Sarah verdrehte die Augen. »Kann sich doch keiner merken. Ich weiß nur, dass Israel den besten Kaviar der Welt herstellt, die Orthodoxen ihn aber nicht essen dürfen. Wieso eigentlich? Stör ist doch Fisch.«
»Ja, aber er hat keine Schuppen, sondern einen Panzer. Die Ansichten zu Kaviar sind allerdings geteilt, weil junge Störe angeblich durchaus Schuppen haben. Deswegen sagen die meisten Rabbiner in den USA, Kaviar wär in Ordnung.«
»Steckt da irgendeine Logik dahinter?«
»Nein. Das ist Religion. Religion besteht darin, dass dir irgendjemand vorschreibt, was du tun und vor allem was du nicht tun sollst. Katholiken dürfen sich nicht scheiden lassen, Juden keine Scampi essen. Ob das Sinn macht, ist völlig egal. Eigentlich ist’s dann Religion, wenn’s keinen Sinn macht, denn für Dinge, die Sinn machen, brauchst du keine Religion. Die weiß man ja von selber.«
Sarah hielt kurz beim Kauen inne, nickte nachdenklich und sagte: »Cool. So hab ich das noch gar nicht gesehen.«
»Onkel Shimon hat übrigens mal wieder vorsichtig angefragt, wie es mit deiner Konvertierung zum Judentum vorangeht.«
Sarah hatte vor zwei Jahren auf ihren Wunsch hin eine Bat Mitzwa gefeiert, was die Erlangung der religiösen Mündigkeit im Judentum bedeutet. Allerdings war der Ritus von einer Reformrabbinerin vollzogen worden und hatte mehr den Charakter einer privaten Familienfeier gehabt. In Sarahs Pass stand als Religion immer noch evangelisch-lutherisch, denn nur Sascha war Jude. Die Zugehörigkeit zum Judentum hing aber von der Mutter ab. Rachel war evangelisch. Sarah interessierte sich zwar für das Judentum. Immerhin war eine Hälfte der Familie jüdisch. Aber es war nur ein Interesse unter vielen, die ein siebzehnjähriger Teenager hat.
»Ja, ich überleg noch.« Sie spießte einen Scampo auf und betrachtete ihn, als wollte sie seine religiöse Unreinheit ergründen. »Einiges spricht dafür, anderes dagegen.«
»Dafür spricht, dass dich Gott dann besonders liebt«, sagte Sascha. »Dagegen, dass die meisten Menschen dich dann hassen. Also lass dir Zeit mit der Entscheidung.« Er schob seinen Teller zu Sarah. »Gib mir noch eine Portion. Ich kauf mir morgen früh am Gemüsestand einen Bund Petersilie. Das soll helfen.«
Als sie beim Espresso saßen, sah Sarah ihre Eltern ernst an und sagte: »Ich würde gerne was besprechen. Es hat mit heute Morgen zu tun.«
Sarah und Rachel hatten über ihren Streit nicht mehr gesprochen, sondern seit Rachels Heimkehr so getan, als wäre nichts passiert. Das hatte Rachel schon stutzig gemacht, denn Sarah war niemand, der Differenzen totschwieg. Da waren sie sich sehr ähnlich. Nur dass Rachel in dem Fall ausnahmsweise kein Interesse an Klärung hatte.
»Es tut mir leid«, sagte Rachel. »Ich bin ein bisschen mit den Nerven runter. Ich wollte dich nicht so anmachen.«
»Du bist sicher, dass es nichts anderes ist?«
Rachel sah misstrauisch zwischen Sarah und Sascha hin und her. »Was wird das hier?«
Sascha hob beschwichtigend die Hände. »Ich hab keine Ahnung, worum es geht. Ich kann euch auch allein lassen.«
»Nein. Bleib bitte.« Sarah spielte nervös mit ihrem Espressolöffel. »Das geht uns als Familie an. Es geht um – Offenheit. Vertrauen. Solche Sachen.«
Rachel sagte nichts, wartete, was noch kommen würde.
»Ich glaube, du verheimlichst uns etwas.«
»Selbst wenn«, sagte Rachel. »Jeder hat ein Recht auf Geheimnisse.«
»Wenn du sie geheim hältst und sie andere nichts angehen – okay.«
»Es ist eine Sache, die nur mich was angeht. Und dass ich mal schlechte Laune habe, wirst du aushalten müssen. Als pubertierender Teenager hast du wenig Berechtigung, dich da zu beschweren.«
»Ich rede nicht von schlechter Laune.«
»Sondern?«
»Dass dein Geheimnis unsere Familie betrifft. Und es gibt Leute, die finden, dass ich davon wissen sollte.«
Sascha war jetzt hellhörig geworden. »Von was redest du? Und was für Leute?«
»Keine Ahnung. Da musst du meine Mutter fragen.« Sarah stand auf, holte ihr Handy aus dem Flur, kam wieder zurück und rief WhatsApp auf. »Das hab ich gestern bekommen.« Sie schob das Smartphone zu Rachel.
Sie las die ziemlich lange Nachricht und verzog keine Miene. Als sie fertig war, gab sie das Handy Sascha und wandte sich an ihre Tochter.
»Wer hat dir das geschickt?«
»Die Telefonnummer kenn ich nicht. Dir kommt sie nicht bekannt vor?«
Rachel schüttelte den Kopf.
Inzwischen hatte Sascha die WhatsApp-Nachricht gelesen und gab das Smartphone an Sarah zurück.
»Worum um Himmels willen geht’s da?«
Sarah zuckte mit den Schultern und wies mit der Hand auf ihre Mutter.
4
Der Text der WhatsApp-Nachricht lautete: