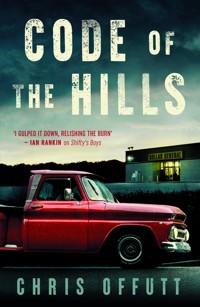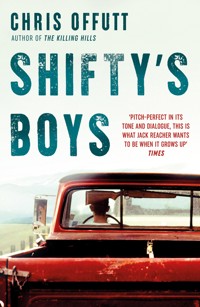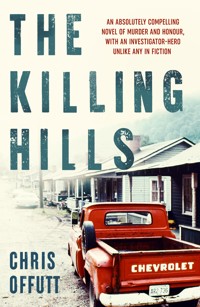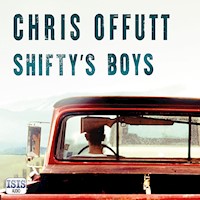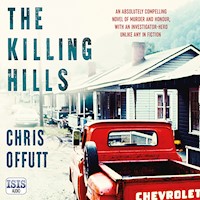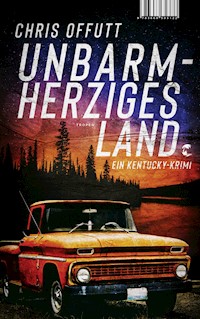13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tropen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Leiche in der Stadt. Eine Mauer des Schweigens in den Bergen. Und eine Spur, die weit über die Grenzen Kentuckys hinausreicht. In seinem neuen Krimi um den wortkargen Army-Ermittler Mick Hardin lässt Chris Offutt ein weiteres Mal den rauen amerikanischen Süden aufleben – mit all seinen Schattenseiten. Mick Hardin, Ermittler für das CID der US-Army, ist zurück in den Kentucky Hills. Er wurde bei einem Sprengstoffangriff verletzt, außerdem soll er die Scheidungspapiere seiner Frau unterzeichnen. Danach will er so schnell wie möglich wieder verschwinden. Doch dann wird in der Stadt eine Leiche gefunden. Der Tote ist Barney Kissick – der stadtbekannte Drogendealer. Für die Polizei liegt der Fall klar auf der Hand: Einer von Barneys Drogendeals ist schiefgelaufen. Seine Mutter bezweifelt das und bittet Mick um Hilfe. Er beginnt sich umzuhören, dabei hat er seiner Schwester, die kurz vor ihrer Wiederwahl als Sheriff steht, eigentlich versprochen, sich rauszuhalten. Als er tief in der rauen Hügellandschaft auf eine dreckige Spur stößt, steht plötzlich nicht mehr nur die Karriere seiner Schwester, sondern sein eigenes Leben auf dem Spiel. »Ein weiterer exzellenter Mick-Hardin-Thriller. Tolle Charaktere, geballte Spannung. Ein weiterer Volltreffer von Offutt.« Kirkus Reviews »Country Noir vom Feinsten: knallharte Action und toughe, aber kluge Protagonisten, die gezwungenermaßen selbst zu Mördern werden, um den Kreislauf der Gewalt zu stoppen.« Booklist »Fans des zeitgenössischen Kleinstadtkrimis fiebern dem nächsten Offutt entgegen.« Publishers Weekly »Offutt weiß, was gespielt wird, er versteht es, und das ist eine gute Voraussetzung für einen Plot, in dem der erfahrene Ermittler Mick für den Fall wie für seine private Misere eine unkonventionelle Lösung findet.« Peter Körte, FAZ
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Chris Offutt
Ein dreckiges Geschäft
Ein Kentucky-Krimi
Aus dem Englischen von Anke Caroline Burger
Tropen
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Tropen
www.tropen.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Shifty’s Boys«
im Verlag Grove Press, ein Imprint von Grove Atlantic, New York
© 2022 by Chris Offutt
Für die deutsche Ausgabe
© 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: © Zero-Media.net, München
Fotos: © gettyimages/The Image Bank/Ron Watts (Explosion) und FinePic®, München (Truck)
Gesetzt von Dörlemann Satz GmbH & Co. KG
Gedruckt und gebunden von CPI Clausen & Bosse GmbH
Übersetzungslektorat: Cathérine Fischer
ISBN 978-3-608-50186-5
E-Book ISBN 978-3-608-11999-2
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Danksagungen
Danksagungen der Übersetzerin
Für Sam Offutt
Die Hügel verändern sich nicht.
Cesare Pavese
Kapitel 1
Wenn er erwachsen war, wollte er Rennfahrer werden. Das hatte Albin im Alter von acht Jahren beschlossen. Beim Bau von Modellautos hatte er verschiedene Bausätze zu ganz eigenen Hot Rods kombiniert, sie in Weiß und Grün bemalt und die Nummer Elf daraufgepinselt. In seiner Fantasie gewann er als jüngster Champion den Brickyard 400 und konnte sich von dem Preisgeld zu jeder Mahlzeit ein Eis kaufen. Dass er mit zweiundzwanzig Taxifahrer in seinem Heimatort Rocksalt, Kentucky, sein würde, hätte er sich im Traum nicht vorstellen können.
Der Großteil des Jobs bestand darin, im Auto zu sitzen und darauf zu warten, dass ihn die Taxizentrale anrief. In der restlichen Zeit fuhr er immer wieder dieselben Straßen ab, auf denen er in den vergangenen vier Jahren tausendmal unterwegs gewesen war – Asphalt, Lehm und Schotter. Die Karte der Gegend war in seinem Kopf eingebrannt. Er brauchte nur einen geistigen Blick darauf zu werfen, schon wusste er die beste Route. Ein paar Stammgäste hatte er: Männer, die stark alkoholisiert aus einer der beiden Bars im Ort kamen. Die meisten anderen Fahrgäste wollten zum Arzt oder mussten aus dem Krankenhaus heimgebracht werden. Sein Einkommen hing von diesen Kranken ab, und er war immer ein wenig enttäuscht, wenn sie wieder gesund wurden, was kein gutes Licht auf seinen Charakter warf, das war ihm klar.
Die vergangenen sechs Arbeitsstunden hatte er vergeblich auf einen Anruf gewartet. Er tuckerte über den kleinen Collegecampus, was abends komplett sinnlos war, aber er langweilte sich und musste endlich etwas verdienen. Die Main Street war wie leer gefegt. Er fuhr am neuen Gefängnis vorbei, ebenfalls reine Zeitverschwendung, weil nach Einbruch der Dunkelheit niemand mehr freigelassen wurde. In den Bars ging der Betrieb gerade erst los, und es würde noch Stunden dauern, bis die Besoffenen nach Hause wollten. Er rief in der Zentrale an, nur um ganz sicherzugehen, dass sein Handy auch wirklich funktionierte, wo man ihn aber nur dafür zusammenstauchte, dass er die Leitung blockierte.
In Rocksalt gab es nur wenige Stellen, an denen sich gut auf Fahrgäste warten ließ. Am besten eignete sich der Parkplatz einer Apotheke in der Ortsmitte, aber Albin war schon zweimal von Pillbillys überfallen worden, die ihr gesamtes Geld für verschreibungspflichtige Opiate ausgegeben hatten und mehr brauchten. Wurde langsam Zeit, sich ein ruhiges Plätzchen zu suchen, zweimal an seinem Joint zu ziehen und ein bisschen vom Rennfahrerdasein zu träumen. Es bräuchte nichts weiter als einen wichtigen Promoter, der aus irgendeinem Grund zu ihm ins Taxi stieg – der würde Albins Können am Lenkrad sofort erkennen.
Seinen ersten Gokart hatte Albin bei Western Auto gekauft, einem Laden, der schon vor etlichen Jahren dichtgemacht hatte. Besonders gut hatte Albin gefallen, dass man Western Auto auch durch den Hintereingang betreten und von dort mehrere Stufen hinunter zur Verkaufsfläche gehen konnte. Nirgendwo sonst im ganzen County gab es einen so großen Verkaufsraum, und als Teenager war er aus dem Staunen gar nicht mehr herausgekommen.
Jetzt war der geteerte Parkplatz hinter dem Laden voller Schlaglöcher, manche Krater waren so tief, dass es in den Stoßdämpfern krachte. Überall lagen Fast-Food-Tüten und leere Colaflaschen herum. Bedächtig steuerte Albin seinen Lieblingsplatz direkt vor der früheren Glastür an, die seit Langem mit Sperrholz vernagelt war. Dort warf das Vordach einen Schatten, unter dem man nicht in sein Taxi blicken konnte. In einer Ecke lag etwas seltsam Geformtes auf dem holprigen Boden, und Albin schaltete das Fernlicht ein. Jemand lag an dem kaputten Zaun und schlief, jemand, der sicher nach Hause gebracht werden musste.
Albin stieg aus, etwas, was Taxifahrer nur ungern tun, und näherte sich dem auf dem Rücken liegenden Mann. Ein Arm lag verdreht unter ihm, der andere schien sich Hilfe suchend am Boden nach Albin auszustrecken. Seine Kleidung war übersät mit dunklen Flecken. Albin hielt sie für Schlamm, bis er näher kam und sie als getrocknetes Blut erkannte. Er stolperte zu seinem Auto und alarmierte den Notruf. Er war froh, dass er noch nicht an seinem halben Joint gezogen hatte, und versteckte ihn in der USB-Ladebuchse am Armaturenbrett, bevor die Polizei eintraf.
Kapitel 2
Mick Hardin wachte auf. Er hatte geträumt, er läge in seinem Kinderbett und könne sich nicht bewegen. Seine Lider waren schwer, und er fragte sich, ob er gestorben war, und jemand hatte ihm Pennys auf die Augen gelegt. Die Münzen sollten dafür sorgen, dass die Augen zublieben; außerdem hatte man so eine Bezahlung für den Fährmann dabei, der die Toten über den Unterweltfluss Styx brachte. Mick lag wach da und dachte an den Sprengstoffanschlag, der ihn drei Wochen lang ins Armee-Lazarett befördert hatte. Aus dem Krankenhaus entlassen, war ihm befohlen worden, sein Bein mit Physio wieder fit zu machen, eine langwierige und schmerzhafte Angelegenheit. Vom Bett hatte er sich zum Rollstuhl hochgearbeitet, dann ging er drei Monate lang an Krücken. Schließlich war er auf einen Stock umgestiegen, mit dem er sich aber nur ungern in der Öffentlichkeit sehen ließ.
Sein Vorgesetzter, Colonel Whitaker, schenkte ihm einen beschrifteten Veteranen-Krückstock. Das leichte Stück aus Aluminium war schwarz und trug die Aufschrift: »KEIN FUSS DEM FEIND«. Die Buchstaben waren vertikal darauf gedruckt, und von oben sah es so aus, als stände da »KEIN FASS DEM FEIND«. Wenn er mit dem Stock ging, musste Mick an das Regenfass neben der alten Hütte seines Großvaters mitten im Wald denken, in dem das Wasser so kalt war, dass es beim Untertauchen an den Zähnen wehtat. Mick machte bei allen Reha-Maßnahmen mit, bis er wieder selbstständig im Stützpunkt herumhumpeln konnte, dann bat er, sich zu Hause auskurieren zu dürfen. Seine Frau könne ihn versorgen und zum nächstgelegenen Veteranenkrankenhaus im achtzig Meilen entfernten Lexington fahren. Der Colonel willigte ein, unter der Bedingung, dass Mick sein Handy eingeschaltet ließ und auf alle Anrufe reagierte. Mick hatte zugestimmt und war nach Hause geflogen.
Jetzt öffnete er die Augen. Er lag im Haus seiner Mutter, nicht in der Hütte, in der er seine Jugend verbracht hatte. Er war müde, seine Glieder waren bleischwer – eine Folge der starken Schmerzmittel. Er hatte sich von Fentanyl direkt nach dem Sprengstoffanschlag zu Morphin und seit der Entlassung zu Percocet hochgearbeitet. Das schluckte er immer noch, auch wenn die momentanen Schmerzen solche schweren Geschütze eigentlich nicht mehr erforderlich machten.
Er hatte Colonel Whitaker angelogen. Mick hatte keine Frau, die ihn versorgen könnte. Sie hatten sich vor einem Jahr getrennt. Die Scheidungspapiere lagen, zusammen mit seinem abgeschalteten Handy, ohne Unterschrift in Micks Koffer. Er wartete auf einen Grund, die Papiere zu unterschreiben und sich von sechzehn Ehejahren loszusagen. Trotz der Umstände passte es ihm nicht. Genauso wenig wie die Tatsache, dass er im Gästezimmer seines Elternhauses schlafen musste. Micks Schwester Linda hatte es nach dem Tod ihrer Mutter geerbt. Linda war viel beschäftigter Sheriff im County und selten zu Hause, da sie sich gerade mitten im Wahlkampf um ihre Wiederwahl befand.
Der Wecker auf dem Nachttisch zeigte halb elf, und Mick wusste, dass Linda schon relativ bald zum Mittagessen da sein würde. Ihm blieb noch genug Zeit, um seine täglichen zwei Meilen zu gehen und sich hinterher mit einer Percocet zu belohnen. Er trat aus dem flachen Ranchhaus am Ende der Lyons Avenue und ging zügigen Schrittes los. Auf mehreren Nachbargrundstücken leuchteten die gelben Forsythienbüsche in der Frühlingssonne. Obenauf zeigten sich schon erste grüne Blattspitzen. Auch die Narzissen blühten. Am Hang oberhalb der Straße sah Mick Kanadischen Judasbaum und Hartriegel rosa schimmern. Kentuckys Hügel und Berge waren zu jeder Jahreszeit wunderschön, aber nie so wie im Frühling, wenn das Land so viel Hoffnung versprühte. Die Schönheit war überwältigend. In Micks Leben war eine Menge schiefgegangen, und hier war er nun, lebte unter dem Dach seiner Mutter und leckte sich die Wunden, versorgt von seiner wenig mütterlichen Schwester. Kurz musste er über die Absurdität der ganzen Situation schmunzeln.
Eine Nachbarsfrau winkte ihm aus dem Blumenbeet zu. Hinter einem anderen Haus kamen zwei Hunde hervorgetrottet, die Mick so begeistert begrüßten, dass ihr ganzes Hinterteil wedelte. Mick mochte sein Tempo nicht verlangsamen und kraulte sie im Vorbeigehen. Sein Bein tat weh, aber kräftig auszuschreiten, fühlte sich trotzdem gut an. Er war fast vollständig genesen. Täglicher Sport war die letzte Phase der Reha, damit die Muskeln wieder aufgebaut wurden, die sich beim wochenlangen Herumliegen in trostlosen Krankenhausbetten zurückgebildet hatten. Auf der anderen Straßenseite war Miller unterwegs, der Postbote, den Mick noch aus der Schule kannte. Er hatte einen der wenigen Behördenjobs im Ort ergattert, obwohl sich über vierhundert Leute auf die Stelle beworben hatten. Wie Miller das geschafft hatte, war immer noch allen ein Rätsel.
Insgeheim verfluchte Mick sich für das schlechte Timing – jetzt würde er mit jedem an der Straße, der zum Briefkasten ging, um nach der Post zu schauen, ein Schwätzchen halten müssen. Und tatsächlich: Old Man Boyle beobachtete von seinem Briefkasten aus, wie Mick näher kam. Er trug eine Hose mit Bügelfalte, braune Lederschuhe und ein bis oben zugeknöpftes Hemd, als habe er sich extra für den Gang vor die Tür schick gemacht. Bull Boyle hatte selbst in Vietnam gedient und einen seiner Söhne im Irakkrieg verloren. Er empfand eine gewisse Sympathie für Mick, durchsetzt mit einer Menge Bitterkeit darüber, dass Mick mehr oder minder intakt aus dem Krieg zurückgekommen war. Hinter beiden Ohren trug Boyle große, halbmondförmige, hautfarbene Hörgeräte. Mick erkannte sie als die scheußlichen Uraltmodelle, die kostenlos an Kriegsveteranen ausgegeben wurden.
»Wie läuft die Maschine?«, fragte Boyle und zeigte auf Micks Bein.
Mick verlangsamte respektvoll den Schritt.
»Jeden Tag besser«, antwortete er. »Und, was Gutes in der Post?«
»Und ob. Ich habe zweitausend Dollar gewonnen. Muss nur zum Chevy-Händler gehen und sie mir abholen. Dafür kriege ich ein schönes Verkaufsgespräch und ein Paar Kopfhörer. Was soll ich damit machen, bitte schön? Damit sehe ich doch aus wie ein wandelnder Elektroladen.«
Mick musste lächeln.
»Wie geht’s deiner Schwester?«, fragte Boyle.
»Gut, ständig will sie was von mir. Ich mache meinen Spaziergang nur, damit sie mich eine Stunde lang nicht nerven kann.«
»Sie ist ein guter Gesetzeshüter, so als Frau«, sagte Boyle. »Ich wähle sie.«
»Linda meint, es könnte knapp werden.«
»Der andere Bursche taugt nichts. Er hält sich für einen echten Windhund, und das würde er auch noch tun, wenn er ein Holzbein hätte.« Er warf einen entschuldigenden Blick auf Micks Bein. »Das war jetzt nicht persönlich gemeint.«
»Schon klar, Mr. Boyle. Ich muss dann mal weiter, sonst wird’s noch steif, das Bein.«
»Brav«, erwiderte er. »Bis bald mal wieder.«
Mick legte einen Zahn zu und lauschte dem schwach hörbaren Pop in seinem Knie und dem eingebildeten Knirschen in der Hüfte. Luftlinie war es nur eine Viertelmeile vom Haus seiner Schwester bis zur ersten Querstraße, aber die Lyons Avenue folgte einem gewundenen, aus den Bergen kommenden Bachlauf, deswegen hatte er eine ganze Meile zurückzulegen. Zweimal wechselte er auf die andere Straßenseite, um Bekannten auszuweichen.
Vater Hardin war jung gestorben, und Linda war bei ihrer Mutter geblieben. Mick hatte vom achten Lebensjahr an bei seinem Großvater und Urgroßvater gelebt, mitten im Wald, zwölf Meilen vom Ort entfernt. In der Kleinstadt hatte er sich noch nie zu Hause gefühlt. Er hatte nichts gegen Rocksalt im Besonderen, es ging einfach um Menschenansammlungen im Allgemeinen. Im Ort brauchte man eine gewisse Umgänglichkeit, eine kleinstadttaugliche Fassade, die ihm abging. Hier sagte man das eine, meinte aber etwas ganz anderes. Die Leute konnten mit seiner offenen Art nicht umgehen. Ihm war die Direktheit der Landbevölkerung und Armeeangehörigen lieber.
Die Lyons Avenue endete an der Second Street, ein Name, über dessen Einfallslosigkeit sich Mick immer wieder amüsieren konnte. In einer Großstadt waren solche Bezeichnungen vielleicht sinnvoll, weil es viele Querstraßen gab, aber ganz Rocksalt hatte nur drei Kreuzungen: Main Street, First Street und Second Street. Mick machte kehrt und lief zurück zum Haus seiner Schwester. Zwei Autos fuhren vorbei, und er winkte, ohne hinzugucken. An Rücken und Beinen floss ihm der Schweiß herunter. Er bekam genug Luft, sodass er sein Tempo auf Eilmarsch steigern konnte, Blick strikt geradeaus, Wachsamkeit an den Blickfeldrändern. Das Haus tauchte vor ihm auf, und er verfiel in einen Laufschritt, zählte den Rhythmus im Kopf mit, hundertachtzig Schritte pro Minute, bis er an der Einfahrt ankam.
Hechelnd wie ein Hund ließ er sich gegen die Außenwand fallen und trank aus dem Gartenschlauch. Mick war sehr zufrieden mit seinem Fortschritt – er fühlte sich fast stark genug, um zum Dienst zurückzukehren. Die Frau, mit der er sechzehn Jahre lang verheiratet gewesen war, lebte mit einem anderen Mann und dem gemeinsamen Kind im Nachbarort. Im besten Licht betrachtet, war es nichts weiter als der Kollateralschaden einer langjährigen Stationierung in Übersee. Weniger positiv betrachtet, hatte er als Ehemann versagt.
Kapitel 3
Sheriff Linda Hardin fuhr mit dem Dienstwagen nach Hause, um zusammen mit ihrem Bruder Mittag zu essen. Sie liebte die Lyons Avenue, in der sie aufgewachsen war. In dieser Straße hatte sie das Fahrradfahren gelernt, war in der Adventszeit von Tür zu Tür gegangen, um Kerzen für ihre Schule zu verkaufen, hier hatte sie sich mit einer Freundin getroffen und heimlich geraucht. Linda kannte sämtliche Nachbarn, von denen keiner vorhergesagt hätte, dass sie der erste weibliche Sheriff in der Geschichte des Countys werden würde. Sie fuhr gern schnell, aber in ihrer eigenen Straße drosselte sie immer das Tempo, damit jeder den großen SUV mit dem offiziellen Abzeichen auf den Türen und dem Blaulichtbalken auf dem Dach ausgiebig bewundern konnte.
An diesem Morgen war zwar viel los gewesen, aber nichts dabei herausgekommen – ein herrenloses Auto, das auf einer Lehmpiste bei Big Brushy stand, nicht zu entziffernde Graffiti auf einer Scheune und vier wilde Hunde, die eine Kuh jagten. Am Nachmittag hatte Linda einen Gerichtstermin. Kein schlechtes Leben für eine alleinstehende Frau, verbunden mit einem guten Einkommen. Das Einzige, was ihre Laune etwas trübte, war ihr Bruder, der sich von der Sprengstoffverwundung in Afghanistan körperlich erholt zu haben schien, aber immer noch Schmerzmittel schluckte und kaum aus dem Haus ging. Seine Anwesenheit war überall zu spüren, er füllte jeden Raum mit seiner verwundeten Seele. Sie liebte ihn, er war ihr Bruder, aber sie lebte lieber allein.
Als sie in die Einfahrt fuhr, sah sie, dass Mick an der hölzernen Hauswand lehnte und sich den Wasserschlauch über den Kopf hielt. Das Wasser bildete einen Kegel um sein Gesicht wie ein Schleier. Es war seine erste Dusche seit vielen Tagen.
»Hey, Mick«, sagte sie. »Schön, dass du dich mal ordentlich wäschst.«
Er nickte, sodass der Wasserschleier schwankte wie ein Duschvorhang. Als Linda ins Haus trat, um ihm ein Handtuch zu holen, verzog sie das Gesicht: Alle lagen noch genauso sauber und ordentlich gefaltet da wie vor einer Woche. Sie brachte das Handtuch nach draußen.
»Nicht, dass du mir das ganze Haus nass tropfst«, sagte sie.
Mick stellte den Wasserhahn ab.
»Was ich dich mal fragen wollte«, sagte sie. »Warum duschst du eigentlich nicht? Wegen deinem Bein?«
»Nein«, antwortete er.
»Das geht mir echt total auf den Senkel.«
»Hättest du mir das mal gesagt, als du noch mehr als einen Senkel hattest.«
Sie schmunzelte.
»Also?«
»Bei der Armee habe ich jeden Tag geduscht, manchmal sogar zweimal am Tag. Zum Teil wegen dem vielen Staub in der Wüste. Aber hauptsächlich, weil man nie wissen konnte, wann man wieder Gelegenheit dazu haben würde.«
»Schon klar, und?«
»Bei dir gibt es immer fließend Wasser. Wenn ich weiß, dass ich jederzeit duschen kann, brauche ich’s nicht unbedingt zu tun.«
»Diese Logik geht auf keine Kuhhaut, großer Bruder.«
»Verständlich«, sagte er. »Irgendwie kommt mir momentan gar nichts logisch vor.«
»Das liegt wahrscheinlich an den Pillen, die du dir dauernd reinpfeifst. Warum schluckst du die Dinger eigentlich noch?«
»Weil ich hier bei dir rumhänge, statt bei meiner Frau zu wohnen. Besser als Whiskey zu saufen.«
»Vielleicht kehrst du besser zurück.«
»Zum Whiskey?«
»Nein, nach Deutschland zu deinem Stützpunkt. Zu dem Leben, wie du es dir eingerichtet hast.«
»Noch nicht«, erwiderte er.
Er ging davon und rubbelte sich dabei den Kopf trocken. Linda sah ihm hinterher. Sie machte sich Sorgen um ihn, aber er war ein erwachsener Mann, und ihre Karriere war momentan wichtiger. Vor einigen Jahren war Linda Dispatcherin beim Sheriff geworden. Sie war selbst erstaunt darüber gewesen, dass es ihr Spaß machte, Teil einer größeren Sache zu sein und für das Wohl des Countys zu arbeiten. Als sein Deputy wegen eines Skandals um sexuelle Belästigung zurücktreten musste, hatte man Linda die Stelle angeboten. Die Politiker hofften, mit der Ernennung des ersten weiblichen Deputys etwas gegen die negativen Schlagzeilen auszurichten. Widerstrebend sagte Linda zu, hauptsächlich, weil es mit einer Gehaltserhöhung verbunden war. Dann starb der Sheriff ganz überraschend, und Linda übernahm seine Stelle. Nicht der dienstälteste Deputy – ein fauler Nichtsnutz, der nebenbei noch auf der Müllkippe arbeitete und es dort unglaublicherweise geschafft hatte, drei Müllautos zu Schrott zu fahren. Eine beeindruckende Leistung. Er gab seine Stelle auf, Linda ernannte Johnny Boy Tolliver zu ihrem Deputy und brachte sich das Sheriffshandwerk selbst bei.
Eigentlich hatte sie nicht vorgehabt, jetzt bei der Wahl um das Amt des Sheriffs anzutreten. Geplant war, den Posten zu bekleiden, bis Neuwahlen ausgeschrieben wurden, und den Sieger darum zu bitten, als Dispatcherin weiterarbeiten zu dürfen. Aber dann bewarb sich ein ausgemachter Idiot und Frauenfeind um die Stelle. Ihn von dem Amt fernzuhalten, wurde zu Lindas neuem Ziel im Leben. Gewann er die Wahl, würden sich nur all die Betonköpfe bestätigt fühlen, die dagegen waren, dass eine Frau Autorität ausübte.
Außerdem machte sie ihre Sache gut. Ihre Familiengeschichte kannte eigentlich jeder – der Vater ein Säufer, die Mutter hatte das Haus nicht verlassen, der Bruder ein schwieriger Typ mit Eheproblemen. In Eldridge County galt sie als vertrauenswürdig, weil all diese Dinge über sie bekannt waren. Linda war davon überzeugt, dass sie die Wahl gewinnen konnte, wenn ihr Bruder nirgendwo für Schwierigkeiten sorgte. Nach außen wirkte er ruhig und berechnend, aber sie wusste, dass er manchmal auch völlig impulsiv handelte. Bei ihm wusste man nie, was als Nächstes kam. Vielleicht sollte sie eine Razzia bei einem Dealer durchführen, das Zeug beschlagnahmen und so dafür sorgen, dass Mick ausreichend Opiate zur Verfügung hatte. Solange er betäubt war, bestand kein Risiko, dass er ihr bei der Wahl in die Parade fahren würde. Im Notfall könnte sie ihn wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln einbuchten und zurück zur Army verfrachten lassen. In sich hinein grinsend betrat sie das Haus.
Mick hatte für sie beide etwas zu essen auf den Tisch gestellt – mit Pute und Käse belegte Sandwiches, Kartoffelchips, dazu Limonade. Eine leicht angespannte Stimmung lag in der Luft. Er aß schweigend, als ob er in der Truppenküche sitzen würde – Arme schützend vor den Teller gebreitet, Augen aufs Essen gerichtet. Linda durchforstete ihr Gehirn nach einem unverfänglichen Thema, um die Stimmung etwas aufzulockern, was schwierig war, da so viele wichtige Themen tabu waren – seine Frau, seine Verwundung, die Schmerzmittel und jetzt sogar sein verdammtes Duschverhalten.
»Ach, ich muss dir was erzählen«, sagte sie. »Neuigkeiten aus dem Ort.«
Er nickte kauend.
»Vor zwei Tagen hatten wir eine Leiche.«
»Ach, nur eine?«
»Genau, du Witzbold, einen Toten. Jedenfalls kennst du ihn.«
Sie wartete darauf, dass er Interesse an der Welt jenseits seines Tellerrands zeigte. Stattdessen sah er sie nur abwartend an.
»Es war Fuckin’ Barney«, sagte sie.
»Dealt der immer noch Heroin?«
»Seit zwei Tagen nicht mehr«, antwortete sie.
Sein schnelles Grinsen war, als würde die Sonne urplötzlich hinter einer schwarzen Wolke hervorblitzen und dann wieder verschwinden. Linda freute sich über ihren Triumph.
»Und, wen hast du im Auge?«, wollte er wissen.
»Niemanden. Fällt in den Zuständigkeitsbereich der Polizei. Barney Kissick lag hinter dem Western Auto. Mit drei Schüssen getötet.«
»Ich dachte, der Laden hätte dichtgemacht.«
»Hat er auch«, antwortete sie. »Es ging nicht um den Laden.«
»Und worum dann?«
»Drogen«, sagte sie. »Ist doch immer das Gleiche. Kannst du den Abwasch übernehmen? Das wäre nett. Und stell dich verdammt nochmal unter die Brause. Ich muss los, ich hab eine Verhandlung.«
Sie erhob sich von dem uralten Küchentisch, richtete ihren Dienstgürtel und ging. Mick fragte sich, welche Laus ihr über die Leber gelaufen sein mochte. Als guter Soldat befolgte er ihren Befehl, dann schluckte er ein Percocet und legte sich aufs Sofa. Eine Tablette blieb ihm noch. Er konnte sie bis morgen aufsparen oder gleich nehmen. Er nahm sie gleich. Morgen würde er das bereuen, wenn der Drang nach einer weiteren Pille heftig sein würde, aber es gab eh schon so viel zu bereuen. Zu bereuende Dinge türmten sich um ihn herum auf wie Brennholz. Lange war er nicht mehr krankgeschrieben. Bis dahin musste er von den Medikamenten weg sein. Ohne Tabletten würde die Zeit noch zäher vergehen.
Und dann fingen die Opiate an zu wirken – bei Weitem nicht so stark, wie er das gern hätte, aber stark genug, damit jedes Zeitgefühl verschwand. Es war schön, die Sonne zu beobachten, wie sie zum Fenster hereinschien.
Kapitel 4
Vier Tage später fühlte Mick sich schon neunzig Prozent besser. Seit er das Percocet nicht mehr nahm, hatte sich die Benommenheit gelichtet. Die ab und an hochkommenden Gelüste, nicht so sehr nach Opiaten oder Whiskey, sondern nach Flucht allgemein, hatte er niedergekämpft. Mick wusste, dass er sich glücklich schätzen konnte – er trank gern Alkohol, jetzt wusste er auch, dass ihm Betäubungsmittel zusagten, aber er hatte keinen Hang zu Suchtverhalten. Er konnte sich einfach von der Sucht verabschieden, als würde er einen Schalter umlegen. Die ersten paar Tage waren allerdings schlimm. Noch schlimmer war es zu wissen, dass man den Schalter auch jederzeit wieder in die andere Richtung kippen konnte.
Sein Todfeind war die Langeweile, deswegen legte er jetzt zwei, immer länger werdende Märsche pro Tag ein, erst drei, dann fünf, schließlich sechs Meilen. Das Bein tat nur nachts weh. Er räumte auf und duschte jeden Tag, was die Laune seiner Schwester verbesserte. Von den Hardin-Angehörigen lebte sonst niemand mehr. Beide hatten keine Kinder. Es gab nur seine Schwester und ihn, da konnte man auch genauso gut miteinander zurechtkommen. Mick beschloss, es mit Fernsehgucken zu probieren, aber auf jedem Kanal liefen Sendungen mit viel Sex, Zombies, Serienmördern oder depressiven Polizisten. Die Komödien waren nicht lustig. Er fand eine Doku über Atlantis, einen Ort, den es möglicherweise mal gegeben hatte, aber niemand wusste, wo, mit vielen Aufnahmen vom offenen Meer. Wie konnte man so was als Dokumentarfilm bezeichnen?
Jemand klopfte an der Vordertür, was seltsam war, da die meisten Leute zur Seitentür durch die Küche ins Haus kamen. Mick stellte den Fernseher aus und öffnete die Tür. Vor ihm stand Mason Kissick. Sie musterten einander wie Männer, die vom Land kamen, sich mit der Situation und der Stadt unwohl fühlten und erst einmal abwarteten, wie der andere reagierte. Mason senkte das Kinn zum Gruß.
»Mick«, sagte er.
»Mason.«
Damit war die Begrüßung ausgestanden, und eine weitere Minute verging, in der Mick sich fragte, was der Bruder von Fuckin’ Barney wohl von ihm wollte. Mason stand nur da, wie ein Baum, dem kein Sturm der Welt etwas anhaben konnte.
»Hab gehört, du wärst angeschossen worden, bei denen da drüben«, sagte Mason.
»Nee, bin in die Luft gejagt worden. Ein USBV.«
»Scheiße. Ich hab auch einen USB-Stick daheim. Wusste gar nicht, dass die explodieren können. Hat das wehgetan?«
»Ein USBV ist eine selbst gebaute Bombe, Mason. Worum geht’s?«
»Mommy schickt mich. Sie will mit dir reden.«
»Dann bring sie her.«
»Sie kommt nicht in den Ort. Sie hat mich geschickt, ich soll dich holen kommen.«
»Als deine Mutter und ich das letzte Mal miteinander geredet haben, sind wir nicht gerade im Guten auseinandergegangen.«
»Sie hat gesagt, ich soll dir ausrichten, das ist Schnee von gestern.«
»Was will sie von mir, Mason?«
Er schüttelte den Kopf. »Darf ich nicht sagen. Sie will’s dir selbst erklären.«
Mick überlegte. Bisher war er noch nicht weiter als bis zur Apotheke oder zum Krankenhaus gekommen. Einmal war er zu seinem früheren Haus gefahren, das jetzt leer stand, seit seine Frau ausgezogen war. Er hatte ein paar Klamotten geholt. Das hatte ihn derart deprimiert, dass er sich schwor, nie wieder zum Haus zurückzukehren. Ein Ausflug ans andere Ende des Countys würde ihm guttun.
Mason navigierte seinen Taurus mit äußerster Vorsicht. Offenbar hatte er keine Übung darin, in der Stadt Auto zu fahren. Jedem Stoppschild näherte er sich schleichend, mit mehrmaligem, angedeutetem Halten und dann einem langen Stopp direkt vor dem Schild. Wenn er sich restlos versichert hatte, dass eine Weiterfahrt gefahrlos möglich war, machte er einen plötzlichen Satz auf die Kreuzung, wo er noch einmal schnell auf die Bremse trat, als wolle er einem in letzter Sekunde entgegenkommenden Fahrzeug, das er womöglich übersehen haben könnte, ausweichen. Mick starrte aus dem Fenster. Er hatte bei der Army schon schlimmere Fahrer erlebt. Die mit großem Abstand schlechtesten waren die irakischen Zivilisten.
Das helle Grün des Frühlings hatte sich über das Land gelegt. Jede frische Blattknospe strebte der Sonne entgegen. Mit den in Blüte stehenden Bäumen sprühten die Berge nur so vor Energie, den zarten Blättern der Ahornbäume, den neugeborenen Tieren – Rehkitze, Kaninchenjunge und naive kleine Schlangen. Das Licht war sanft, der Himmel pastellgetönt. Es war ein gutes Gefühl, mal rauszukommen, in Bewegung zu sein, ein Ziel zu haben, auch wenn es nur Masons Mutter war. Bei der letzten Begegnung mit Mrs. Kissick waren sie beide bewaffnet gewesen. Sie war eine harte Frau.
Mason bog von der Asphaltstraße ab auf die ungeteerte Zufahrt, die zum Haus seiner Mutter führte.
»Was ich noch sagen wollte«, sagte Mick. »Tut mir leid wegen deinem Bruder.«
»Danke«, antwortete Mason. »Nur, dass du Bescheid weißt. Mommy will, dass wir ihn nicht mehr Fuckin’ Barney nennen. Er heißt jetzt Barney. Nur noch Barney.«
Mick nickte. In den Bergen war der Tod eine Macht, die für Respekt sorgte. Er musste an eine Frau denken, die jemanden geheiratet hatte, den ihre Eltern zu Lebzeiten verabscheuten. Aber als der junge Mann starb, setzten sie ihn im Familiengrab bei.
Mason fuhr auf die Wiese vor dem Haus und parkte neben den drei Holzstufen hoch zur Veranda, die sich an der gesamten Vorderseite des Hauses entlangzog. In das enge Tal kam weniger Licht als im Ort, und an der Hauseiche zeigten sich noch kaum Knospen. Das Gras wuchs nur spärlich. Die beiden Männer gingen die Treppe hoch ins Haus.
Shifty Kissick saß in einem Liegesessel, dessen Klappmechanismus mit Panzerband repariert war. Auf den Armlehnen lagen Spitzendeckchen. Neben Shifty stand ein niedriger Tisch, darauf ein Aschenbecher, eine Tasse Kaffee und eine kurze Pistole ohne Hahn, damit man nicht in den Kleidern hängen blieb. Mick kannte Mrs. Kissick als witzig, manchmal auch bedrohlich, aber so wie jetzt hatte er sie noch nie gesehen – vor Trauer verhärmt, Augen glühend wie ein Hochofen. Er wartete darauf, dass sie etwas sagte. Stattdessen zeigte sie auf einen Stuhl.
»Mason«, sagte sie, »hol dem Mann einen Kaffee.«
»Mein Beileid, Mrs. Kissick«, sagte Mick.
Sie erwiderte nichts. Mittlerweile hatte sie die Plattitüde scheinbar so oft gehört, dass sie an ihr abglitt wie Schmalz. Zwei von ihren fünf Kindern waren ihr weggestorben, zwei Söhne, einen hatte sie vor vielen Jahren bei einem Verkehrsunfall verloren, und jetzt Barney. Mason kam mit einem dampfenden schwarzen Kaffee zurück, auf der Tasse eine lächelnde Kuh. Respektvoll hielt Mick die Tasse so, dass das Kuhgrinsen verdeckt war. Im ordentlich aufgeräumten Wohnzimmer standen ein Sofa, zwei Sessel, ein Großbildfernseher mit Gaming-Konsole, an der Wand hing ein nach Zahlen gemaltes Abendmahl im Filigranrahmen. An einer anderen Wand war ein verblasstes Farbfoto von Shifty mit ihrem verstorbenen Mann zu sehen. Beide wirkten glücklich. Mick nippte an dem bitteren Kaffee.
»Dienst du noch?«, fragte Shifty.
»Jawohl, Ma’am. Ich habe Heimaturlaub, bis mein Bein wieder in Ordnung ist.«
»Und wie lang noch?«
»Kommt drauf an, was der Doc sagt. Aber lange dauert’s nicht mehr, eine Woche oder so.«
Sie nickte, und ihm wurde klar, dass sie das alles schon wusste. Wahrscheinlich wusste sie auch über seine Frau und ihr uneheliches Kind Bescheid. Er fragte sich, ob sie auch über das Percocet Bescheid wusste. Er saß still da und wartete ab. In den Bergen war es nicht üblich, oberflächliche Nettigkeiten auszutauschen. Shifty hatte ihn kommen lassen. Er war da. Jetzt war sie dran, das anzusprechen, weswegen sie nach ihm gerufen hatte.
»Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen«, sagte sie.
Das überraschte ihn. Einer ihrer Jungs war ausgefallen, aber Mick hatte nicht vor, anstelle von Fuckin’ Barney ins Drogengeschäft einzusteigen. Er warf Mason einen schnellen Blick zu, ihrem jüngsten Sohn, der für jede Handlung genaue Anweisungen zu benötigen schien. Vielleicht brauchte sie jemanden, der auf ihrem Land mit anpackte. Da könnte er sich körperlich verausgaben, Mason würde ihn herumfahren.
»Wobei brauchen Sie Hilfe, Mrs. Kissick?«
»Ich will wissen, wer Barney getötet hat.«
»Da müssen Sie mit der Polizei reden.«
»Hab ich längst gemacht«, erwiderte sie. »Ich habe mir den Mund fusselig geredet. Interessiert hat es die einen feuchten Kehricht.«
Ihre Pupillen wurden vor Wut ganz klein. Mrs. Kissick starrte ihm mit dem rechten Auge ins rechte Auge, ein deutliches Zeichen von Aggression. Mick betrachtete seine Kaffeetasse.
»Und was hat die Polizei zu Ihnen gesagt?«, fragte er.
»Ich soll sie in Ruhe lassen.«
»Und wenn Sie einen Anwalt einschalten? Der weiß bestimmt, wie man richtig mit der Polizei redet.«
»Geht nicht«, sagte sie.
»Sie können nicht oder wollen nicht?«
»Beides. Geht halt nicht.«
»Klingt verzwickt.«
»Ist es auch«, erwiderte sie. »Barney war immer schwierig, sogar jetzt noch, dabei ist er tot. Ich zahl dir auch gutes Geld dafür.«
Mick lehnte sich zurück, setzte sich entspannter hin und blickte mit dem linken Auge in ihr rechtes, damit sie sich ein bisschen abregte. Er sprach so, dass seine Stimme tief und beruhigend klang.
»Ich kann nicht ja sagen, Mrs. Kissick«, sagte er, »bis ich nicht mehr über die Sache weiß.«
»Zum Beispiel?«
»Was die Polizisten gesagt haben. Warum die Beamten Ihnen nicht glauben. Wer Ihrer Meinung nach Barney ermordet hat.«
Bleischwer hing ihr Schweigen in der Luft. Shifty sah im Zimmer umher wie ein wildes Tier, das in die Ecke gedrängt worden war. Sie war Ende fünfzig, aber ihr langes Haar war noch dunkel. Nur an den Schläfen hatte sie zwei graue Strähnen, die sich am Hinterkopf vereinigten. Als Shifty sich vorbeugte, war Mick darauf gefasst, dass sie sich auf ihn stürzen würde. Stattdessen sprang sie gelenkig wie ein Kind auf die Füße.
»Draußen«, sagte sie. »Mason, du bleibst hier.«
Mick folgte ihr hinaus auf die Veranda. Sie setzten sich auf Holzstühle mit Blick auf die Straße und Masons roten Taurus. Sie zündete sich eine Zigarette an und schlug die Jeans hoch, um in den Aufschlag zu aschen.
»Kippe?«, fragte sie.
»Nee, hab aufgehört. Fehlt mir aber ganz schön.«
»Glimmstängel taugen nichts«, sagte sie, »aber manchmal braucht man sie trotzdem. Ein bisschen wie Barney.«
»Was hat die Polizei gesagt?«
»Ein Drogendeal, bei dem was schiefgegangen ist.«
»Vielleicht stimmt das ja.«
»Nix da. Nicht im Ort. Dafür war er viel zu schlau. Seine Geschäfte hat er immer auf dem Land abgewickelt.«
»Wie sieht es mit einer Freundin aus? Der Mann der Freundin. Der Ex von irgendjemandem?«
»Eine feste Freundin hat er nicht gehabt. Er wollte sich auf nichts Kompliziertes einlassen, hat er gesagt. Ein paar Bekannte hatte er, bei denen er regelmäßig vorbeigeschaut hat. Immer dieselben. Er war kein Frauenheld, wie so gewisse andere.«
Ganz langsam stieg ihr die Röte vom Hals nach oben ins Gesicht. Das Thema körperliche Intimität war ihr sichtlich unangenehm.
»Und darüber hat er mit Ihnen geredet?«, fragte Mick.
»Einmal. Da hatte er einen über den Durst getrunken und dann noch Kraut geraucht. Er wollte sich bei mir entschuldigen, dass er nicht für Enkelkinder gesorgt hat. Ich habe ihm gesagt, macht nichts, deine Schwester hat ja vier Kinder. Aber Schuldgefühle hatte er trotzdem. Mein Großer ist mit einer Mexikanerin zusammen, in Kalifornien. Die haben auch keine Kinder. Mason hatte vor fünf oder sechs Jahren mal eine Freundin, das ging aber keinen Monat gut. Barney war überzeugt, er müsste den Namen Kissick weitervererben. Er wollte mir verklickern, warum er Junggeselle ist.«
»Und wie hat er es genau gesagt?«
»Mein Mann ist früh verstorben, das war schwierig für unsere Familie. So was wollte Barney seiner Frau und seinen Kindern nicht antun. Er wollte schnell Geld verdienen und dann raus aus dem Business. Sein Hobby war Wrestling, was die da bei WWE zeigen. Hat oft davon geredet, dass er gerne Wettkämpfe organisieren würde. Gekonnt hätte er das auf jeden Fall. Er hatte eine Menge Grips.«
Sie sprach nicht weiter. Sie drückte die Zigarette an einer der grauen Verandalatten aus und steckte sich die nächste an. Eine Wanderdrossel mit etwas leuchtend grünem Moos im Schnabel landete auf einem modrigen Holzstoß im Garten. Sie saß auf der dicken Rinde eines Stücks Hickory, machte einige ruckartige Kopfbewegungen, ob sie auch nicht beobachtet wurde, und schlüpfte in den Raum zwischen zwei Holzscheiten.
»Die bauen sich jedes Jahr ein neues Nest«, sagte Mick.
»Weiß ich doch. Ich hab schon gesehn, wie sie die Jungen von andern Vögeln gefüttert haben. Großzügig, die Vögel.«
»Ich find’s schön, dass sie das ganze Jahr über singen.«
Mehrere Minuten lang betrachteten beide den Holzstoß. Eine Wolke zog vor der Sonne vorbei und dimmte das Licht wie ein Gazeschleier. Mick genoss es, mit Mrs. Kissick dazusitzen. Sie blies den Rauch in die Luft, wo er von einer Brise erfasst wurde.
»Und«, sagte sie. »Machst du’s?«
»Sie trauern, Mrs. Kissick, das weiß ich. Aber ich verstehe einfach nicht, warum Sie die Sache nicht der Polizei überlassen wollen.«
»Die denken doch eh nur, Barney war ein Dealer und hat seine gerechte Strafe gekriegt.«
»Ganz sicher?«
»Und ob. Vor zehn Jahren war meine Tochter mal mit einem Jungen aus dem Rocksalt Police Department zusammen. Und von dem weiß ich, dass der Fall noch nicht abgeschlossen ist, aber nach dem Mörder suchen tun sie auch nicht.«
»Und wie heißt der Polizist?«
»Vergiss es.« Sie schüttelte den Kopf. »Aus mir kriegst du nichts raus.«
»Und Barney?«
Sie riss den Kopf zu Mick herum und bedachte ihn mit einem Blick, der alles in seinem Weg schwarz versengt hätte. Das Sonnenlicht blitzte in ihren Augen wie Funken auf einem Feuerstein. Ihre Stimme klang rau.
»Wir Kissicks verpfeifen keinen.«
Mick saß ruhig da, bis ihr Zorn verflogen war. Sie zerdrückte ihre Kippe und steckte die nächste an.
»Wenn Sie wollen, dass ich Ihnen helfe, muss ich solche Fragen stellen«, sagte Mick.
Sie atmete tief ein und wieder aus und zog lang an der Zigarette.
»Das heißt, du machst es?«
»Warum ich?«
»Ich trau den Gesetzeshütern nicht.«
»Ich bin Gesetzeshüter bei der Army, Ma’am. Strafverfolgung beim Militär.«
»Ich seh hier kein Militär.«
»Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Warum ich?«, fragte er.
»Dir traue ich, wenigstens halbwegs«, sagte sie leise.
»Warum?«
»Weil es dir egal ist.«
Mick ließ sich das durch den Kopf gehen. Sie hatte recht – ihm waren ihr Sohn und die Gesetzeshüter egal. Wurde in den Bergen von Kentucky jemand ermordet, zog das unweigerlich weitere Morde nach sich. Ihm war nur eins wichtig: dass möglichst viele Menschen weiterleben konnten.
»Machen wir’s doch so«, sagte er. »Ich hör mich mal ein bisschen um. Wenn ich das Gefühl kriege, irgendwo ist was faul, dann stochere ich weiter in der Sache herum. Aber wenn nicht, dann bin ich raus. Und dann will ich nicht, dass Sie sauer auf mich sind. Verstehen Sie?«
»Ja, schon klar. Ich bin eine trauernde Mutter, verdammt noch mal, kein hirnverbrannter Idiot.«
»Und was glauben Sie, wer war es?«
»Ich hab keine Ahnung.« Ihre Stimme klang auf einmal verzweifelt. »Darüber grübel ich von morgens bis abends nach.«
Mick erhob sich und nickte ihr zum Abschied zu. »Danke für den Kaffee. Kann Mason mich heimbringen?«
Sie rief nach ihrem Sohn und zeigte auf das Auto. Bedächtig fuhr Mason die Lehmpiste hinunter bis zur Hauptstraße in den Ort. Jenseits des Straßengrabens leuchteten die hellgrünen Ahornblätter, die Eichen und Hickorys trieben noch aus.
»Und was meinst du, wer Barney umgebracht hat?«, fragte Mick.
»Was hat Mommy gesagt?«
»Sie weiß es nicht.«
»Ich weiß es auch nicht.«