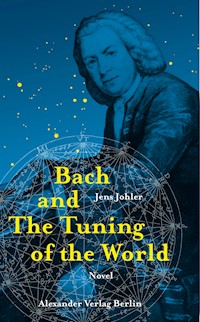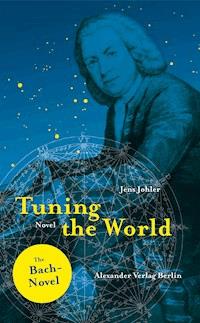Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kennen Sie das hässliche Geräusch, das entsteht, wenn man in einem ungünstigen Augenblick an wenig passender Stelle auf eine Wasserschildkröte tritt? Oder die quälende Angst, bei einem geselligen Abendessen ausgerechnet neben den langweiligsten Leuten sitzen zu müssen? "Ein Essen bei Viktoria" ist ein Reigen von sieben Erzählungen, die alle miteinander verknüpft sind. Sie handeln von Liebe, Einsamkeit und dem Gefühl, dass alle Anderen immer besser wissen, wo es langgeht. Die Originalausgabe erschien 1993 im Luchterhand Literaturverlag. DIE ZEIT schrieb: "Ein Essen bei Viktoria erfreut durch wahre Leichtigkeit, durch normal-verrückte Charaktere und durch eine Sprache, die so lebhaft ist wie die gesprochene und doch so ausgebufft wie die geschliffene, die geschriebene." Der "Tagesspiegel": "Johlers Erzählungen sind blankgeputzte Kabinettstücke, fein ziseliert und durchwoben mit einer unaufdringlichen Ironie, die auch noch die genüsslichste Boshaftigkeit in ein mildes Licht taucht und im übrigen für Komik sorgt."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nach Amerika!
Es war eine Nichtigkeit, die dazu führte, dass ich mich mit Erasmus überwarf. Es ging um einen Dollar.
Wie ist es möglich, fragte ich mich damals, dass zwei Freunde wie wir, und noch dazu auf einer solchen Reise, einer Amerikareise, sich wegen eines Dollars in die Haare kriegen? Inzwischen glaube ich zu wissen, woran es lag. Ich glaube, es lag daran, dass wir keine Freunde waren. Erasmus hatte das immer behauptet, ich hatte ihm nur nicht geglaubt. Aber hatte er es selbst geglaubt? Und wenn ja, wieso ist er mit mir nach Amerika gefahren? Schon als er mir die Reise vorschlug, hätte ich wissen müssen, dass es schiefgehen würde. Es musste schiefgehen. Wenn man so über die Menschen redet wie Erasmus, dann muss man ihnen aus dem Wege gehen und darf mit ihnen nicht verreisen. Man dürfte nicht einmal mit ihnen essen gehen.
Wir gingen häufig miteinander essen. Es gab niemanden, mit dem ich das so gern tat wie mit Erasmus. Nicht, weil wir beide Gourmets wären, ich bin kein Gourmet. Ich esse, was auf den Tisch kommt. Es gibt zwar Speisen, die ich aus irgendeinem Grunde nicht mag, aber die kommen auch nicht auf den Tisch, weil ich sie nicht bestelle. Austern, Schnecken, Kutteln oder Hirn bestelle ich nicht, so sehr auch andere davon schwärmen mögen. Auch zu Kaviar habe ich nie einen Zugang finden können. Ich weiß nicht, was Erasmus von Kaviar hält, ich habe ihn nie gefragt, aber ein Gourmet ist er auch nicht. Ihm schmeckt nämlich alles. Was für ein Vergnügen, mit ihm zu essen! Sein immer guter Appetit steckt einen an, er futtert drauflos wie ein Weltmeister und strahlt dabei eine Lebensfreude aus, um die man ihn beneidet. Er plaudert und lacht und freut sich, so dass es eine wahre Lust ist, ihm zuzuschauen und mitzumachen, selbst wenn man gerade mittendrin ist in der schönsten Schlankheitskur. Er ist ein hinreißender, ein mitreißender Esser. Und dabei ist er ganz und gar nicht dick! Kein Falstaff, kein Hitchcock, kein Orson Welles. Einsachtzig groß, athletischer Oberkörper, schmale Hüften, wenig Fett –, nicht einmal um die Taille, wo es für Männer unseres Alters doch eigentlich Vorschrift ist. Erasmus ist ein wenig jünger als ich, wirkt aber älter. Das liegt daran, dass er mehr arbeitet und dazu neigt, den Menschen Ratschläge zu geben, und zwar in Form von Theorien, obwohl er, wie er sagt, nicht daran glaubt, dass dadurch irgend jemand zur Vernunft zu bringen wäre. Nein, sagte er auch an dem Abend, an dem wir unsere Reise nach Amerika beschlossen, er mache sich nichts vor. Er wisse, wie die Menschen sind. Sie seien weder klug noch vernünftig, weder einsichtig noch beherrscht, sondern gingen chronisch in die Irre. Sie täten alles, um den Abgrund, in den sie früher oder später alle miteinander hineinspringen würden, so groß und tief und weit zu machen, dass sie auch wirklich alle hineinpassten, alle sechs Milliarden. Die Menschen hätten nichts als Dummheiten im Kopf, und nichtmal danach würden sie sich richten, sie richteten sich überhaupt nicht nach dem Kopf, deswegen sei es vollkommen zwecklos, ihnen Ratschläge zu geben. Im übrigen wisse er selbst nicht, wo es langgehe, aber darauf komme es auch gar nicht an. Kein Wissen dieser Welt werde die Menschen zur Vernunft bringen, weder zur Vernunft noch zur Tugend. Überhaupt nichts könne sie dazu bringen. Die Menschen seien falsch codiert.
Darüber musste ich lachen. Ich hatte eine Schwäche für die kategorische Art, in der Erasmus den Untergang der Menschheit prophezeite. Wahrscheinlich war ich seiner Ansicht, nur hätte ich es nie gewagt, das auszusprechen, ohne nicht doch noch ein wenig Hoffnung zu verbreiten. Umso komischer aber war es in meinen Augen, dass Erasmus seine Hoffnungslosigkeit so kategorisch verkünden und es sich dabei auch noch schmecken lassen konnte. Nur fragt es sich, ob es vernünftig ist, mit einem Menschen, der so denkt, fünf Wochen zu verreisen, besonders wenn man selbst so denkt. Da hilft auch nicht die sogenannte Metadiskussion.
Die Metadiskussion ist ohnehin ein ausgemachter Schwindel. Man denkt, man habe das Ei des Kolumbus gefunden, und in Wirklichkeit ist es ein Windei, eine Scheinlösung. Das einzig Gute an der Metadiskussion ist, dass sie Spaß macht. Ja, das macht sie. Sie nennt das Elend beim Namen und lässt einem die Illusion, man stünde darüber. Man unterhält sich über die Misere und glaubt, weil man sich noch darüber unterhalten kann, sei man mit einem Bein schon draußen. Man sagt, die Menschen seien falsch codiert, es gebe keine Freundschaft, die besten Freunde seien oft schlimmsten Feinde undsoweiter, und dabei lässt man es sich schmecken und denkt nicht daran, aufzustehen und seiner Wege zu gehen, was man doch eigentlich tun müsste. Man verständigt sich darüber, dass man sich nicht verständigen kann, und denkt, man habe sich verstanden.
In einer solchen Stimmung, bei einem solchen Essen haben wir – das ist jetzt ein paar Jahre her – die Reise nach Amerika beschlossen, einig darüber, dass es keine Freundschaft gebe, einig darüber, dass der Mensch ein Ungeheuer sei, einig darüber, dass wir in die Staaten wollten. Nach Amerika!
Mit Erasmus zu reisen ist ein ähnliches Vergnügen, wie mit ihm zu essen. Mit demselben Appetit wie hier die Speisen verschlingt er dort die Sehenswürdigkeiten. Selbst mich riss er mit. Ich bin im Grunde nicht besonders neugierig. Wenn ich auf etwas Neues stoße, weiß ich meist nicht wohin damit. Es erschlägt mich. Ich weiß nicht, warum ich, wenn ich in New York bin, alle Sehenswürdigkeiten anstarren soll, das Empire State Building und das Guggenheim Museum, die Bronx und Brooklyn, Lower Eastside und Greenwich Village. Ich laufe mit blöden Augen durch die Gegend und sage aha, das ist dies, und aha, das ist das. Vor meinem Blick wird alles grau, selbst die Eichhörnchen im Central Park. Ich könnte die ganze Zeit im Park auf einer Bank sitzen. Der Schwarze im braunen Anzug, der sich neben mich setzt und fragt, ob ich die New York Times schon ausgelesen habe, ist mir näher als das ganze Empire State Building. Aber das ist nur Bequemlichkeit, in diesem Punkte gebe ich Erasmus recht. Man muss sich schon bewegen, wenn man was erleben will. Man kann sich nicht auf eine Bank setzen und darauf warten, dass das Leben zu einem kommt. Erasmus würde es keine fünf Minuten auf dieser Bank aushalten, er wüsste gar nicht, was er da sollte. Und den Schwarzen würde er für einen Straßenräuber halten, das ist sicher.
Wir waren nämlich nicht in der Bronx, und natürlich auch nicht in Harlem. Ich wollte hin, Erasmus war dagegen. Da hätten wir nichts zu suchen, sagte er. Es würde ihn zwar interessieren, wie ihn alles interessiere, aber sein Leben setze er dafür nicht aufs Spiel. Vor Harlem habe man ihn gewarnt. Die Schwarzen in Harlem warteten nur darauf, dass die Touristen zu ihnen kämen, um ihr Elend anzugaffen. Auf allen Straßen und in allen Hauseingängen lungerten sie herum und wetzten ihre Messer, um sie dem Touristen in den Rücken zu stoßen. Das sei ein einseitiges Vergnügen, sagte Erasmus, deswegen gehe er nicht hin. Nach Brooklyn ja, nach Harlem nicht. Lieber nochmal ins Guggenheim Museum, moderne Kunst sei ungefährlicher.
Ich weiß nicht, warum ich so versessen darauf war, nach Harlem zu gehen. Mit Engels- oder, wie Erasmus fand, mit Teufelszungen redete ich auf ihn ein. Ich würde ihn beschützen, sagte ich. Ich hätte Vertrauen zu den Schwarzen und sie zu mir. Mir würden sie nichts tun, mir würden sie ansehen, dass ich ihr Freund sei. Meine Freunde wären auch ihre Freunde. Kein Schwarzer würde ihm das Messer in den Rücken stoßen, solange ich noch bei ihm wäre. Im übrigen könne ich Karate, schwarzer Gürtel, zehnter Dan. Es half nichts. Erasmus war nicht nach Harlem zu bewegen, weder mit Engels- noch mit Teufelszungen. Statt dessen Freiheitsstatue, die gerade renoviert wurde, so dass wir nicht hinaufkonnten. Ich habe von alledem nicht viel behalten. Was mir geblieben ist, sind die Eichhörnchen im Central Park und der Schwarze mit der New York Times. Der Blick vom Empire State Building ist mir genausowenig zum Erlebnis geworden wie das Schlangestehen vor der Picasso-Ausstellung. Ganz schwach erinnere ich mich noch an Brooklyn. Es gab dort einen guten Cappucino. Aber Harlem hätte ich spannender gefunden.
Das sei übrigens, sagte Erasmus in einer Metadiskussion, nur eine Provokation gewesen. Ich hätte gewusst, dass er so vernünftig sein würde, Harlem zu meiden, und daher hätte ich den Mutigen gespielt und so getan, als hätte ich keine Angst. Auch ich hätte Angst vor Harlem und den herumlungernden Schwarzen, nur bräuchte ich das nicht mehr zuzugeben, weil er sich zu seiner Angst bekenne. Auf seine Kosten spielte ich den Mutigen. Wieso ich den ausgerechnet nach Harlem gewollt hätte und sonst nirgendwohin, während er überall hingewollt hätte, nur nicht nach Harlem?
Später in Montana, im Yellowstone Park, waren es dann nicht die Schwarzen, sondern die Bären. Vor ihnen wurde überall gewarnt. Schon beim Eingang des Parks eine riesige Warntafel: Immer im Auto bleiben! Niemals aussteigen! Honigtöpfe zu Hause lassen! Im Hotel: Warntafeln auch hier, Flugblätter mit Instruktionen für den Notfall, bear-bells im Schaufenster des Kiosk. Wir übernachteten im Lake Hotel, sehr schön gelegen, prächtiger Holzbau, leider schlecht beheizt, es war schon etwas kalt.
Die bear-bells waren kleine Glöckchen mit Lederbändchen, die man sich um die Fußgelenke binden sollte, damit sie den etwas schreckhaften Bären rechtzeitig das Nahen des Wanderers ankündigten. Die Bären greifen den Menschen nämlich, so stand es auf dem Flugblatt, normalerweise nur an, wenn sie vor Schreck in Panik geraten. Das erste also, was Erasmus tat, als wir ins Lake Hotel kamen, war bear-bells kaufen. Ich weiß nicht wozu. Wir sind während der ganzen Woche kaum aus unserem Auto ausgestiegen. Wir fuhren immer nur die Landstraße auf und ab, ich saß am Steuer, ließ mir von Erasmus sagen, was für ein miserabler Autofahrer ich sei, und hörte mir mit Fassung seine Jubelschreie über eine weit entfernt grasende Büffelherde oder über einen einsamen Coyoten an, der am Straßenrand darauf lauerte, dass wir eine Maus totfuhren. Manchmal sahen wir auch – das war dann ein Höhepunkt! – Elche, die man in dieser Gegend Moose nannte. So eine Moose-Familie bescherte uns übrigens eine weitere Metadiskussion.
Wir hatten das Auto am Straßenrand geparkt und waren ausgestiegen. Erasmus hatte beobachtet, wie einige Amerikaner sich an die Elch-Gemeinschaft heranschlichen, offenbar in der Absicht, sie zu fotografieren. Wir schlichen mutig hinterher, bis auf hundert Meter an die Moose-Familie heran. Dann blieben die Amerikaner stehen, Erasmus ebenso. Es sei keine Frage, sagte Erasmus später, dass der Amerikaner besser wisse als der Deutsche, wie nahe man an einen Moose herangehen dürfe. Der Amerikaner kenne seinen Moose, der Deutsche nicht. Wir hätten den Amerikanern viel voraus, worum sie uns beneideten, unsere Kultur, unsere Geschichte, den Schwarzwald, Heidelberg. Aber was den oder das Moose betreffe, da sei der Amerikaner uns noch überlegen. Oder ob mir in Heidelberg schon mal ein Moose begegnet sei?
Ich war nämlich weitergegangen. Ich wagte mich auf fünfzig oder sogar dreißig Meter an das erste Moose heran. Es war ein Junges. In einiger Entfernung käute Mutter Moose. Noch weiter hinten, im seichten Wasser eines Flusses, stand in Gedanken Vater Moose. Alle drei waren in einer sehr philosophischen Stimmung und kümmerten sich wenig darum, dass man sie anstarrte und fotografierte, als hätte man noch nie im Leben einen Moose gesehen. Es war eine harmonische Szene, ein Bild des Friedens. Nur einer fiel aus dem Rahmen: Erasmus. Er löste sich unter – wie er mir nachher sagte – Aufbringung seines ganzen Mutes aus dem Schutz der Amerikaner, kam näher an mich heran, gestikulierte wild mit Armen und Beinen und stieß in gewissen Abständen Laute aus, die in meinen Ohren wie »He« oder »Pssst« klangen. Die Moose-Familie fühlte sich dadurch in ihrer Ruhe gestört und trottete davon. Ich aber musste mir die schlimmsten Vorwürfe anhören. Ich sei ein Todeskandidat, sagte Erasmus, ein Selbstmörder, der nicht davor zurückschrecke, auch andere in seinen Abgrund mit hineinzureißen. Er müsse mich um seiner eigenen Sicherheit willen vor mir selber schützen. Schon wieder hätte ich ihn provozieren wollen, genauso wie vor einer Woche in New York.
Das Verteufelte an der Metadiskussion ist, dass man dazu neigt, die Unverträglichkeit von der Objektebene auf die Metaebene hinüberzuschmuggeln. Wir aßen im Restaurant des Lake Hotels. Es gab, das weiß ich noch genau, eine köstliche Lachsforelle. Das Essen machte uns bereit für Friedensverhandlungen, der kalifornische Chablis half kräftig mit, aber es wollte nicht gelingen. Erasmus räumte zwar ein, dass er ein wenig überängstlich sei, bestand aber darauf, dass seine Überängstlichkeit nur eine Reaktion auf meinen fast schon kriminellen Übermut gewesen sei. Ich provozierte seine Überängstlichkeit durch meinen Übermut.
»Nein«, sagte ich, »du provozierst meinen Übermut durch deine Überängstlichkeit.«
»Du verwechselst Ursache und Wirkung«, sagte er.
»Nein«, sagte ich, »ich rücke sie nur zurecht.«
Und so weiter bis zum Dessert. Nicht das Streben nach Erkenntnis beherrschte unsere Metadiskussion, sondern die blanke Rechthaberei.
»Halt«, sagte ich schließlich, »ich mache nicht mehr mit.«
»Was soll das heißen, du machst nicht mehr mit?«
»Du willst mir mal wieder den Schwarzen Peter zuschieben.«
»Wir spielen hier nicht Schwarzer Peter, wir führen eine Metadiskussion.«
»Dann schlage ich vor, wir führen eine Meta-Metadiskussion.«
Es war mein Vorschlag. Später versuchte Erasmus, ihn für sich zu reklamieren, aber ich lasse mir nicht mein letztes Hemd rauben. Die Meta-Metadiskussion hatte nämlich Erfolg. Wir kamen zu der richtigen Erkenntnis, dass wir in unserer Metadiskussion deswegen den Streit nicht beenden konnten, weil wir noch am kausalen Denken festgehalten hatten. So waren wir dazu verdammt gewesen, Erasmus' Überängstlichkeit auf meinen Übermut zurückzuführen, oder aber meinen Übermut auf Erasmus' Überängstlichkeit. Ein Drittes gab es nicht, wenn man so dachte. Ein anderes, moderneres Denken dagegen würde hier statt Ursache und Wirkung Interdependenzen sehen, einen Regelkreis vielleicht, ein halbgeschlossenes System oder wie immer man so etwas nenne wollte, in jedem Falle sah die Sache dann schon anderes aus: Überängstlichkeit des einen und Übermut des anderen bedingten einander, schaukelten sich wechselseitig hoch oder herunter, Schuld hatte selbstverständlich keiner, jeder sollte sich an seine eigene Nase fassen, und was vielleicht noch möglich schien, war Vorsicht bei der Wahl der Situationen, in die wir uns hinein begaben, darüber sollte man mal nachdenken. Mein Vorschlag, das schwerfällige »Über« aus unserer Sprache zu verbannen und künftig statt von Überängstlichkeit und Übermut nur noch von Angst und Mut zu reden, wurde aus irgendeinem Grunde abgelehnt. Und damit gingen wir schlafen.
In der Nacht fing es an zu schneien. Wir konnten am nächsten Morgen gerade noch ins Auto steigen und zum Flughafen nach Bozeman fahren, sonst hätten wir im Yellowstone Park überwintert. In Kalifornien schien die Sonne. Wir mieteten uns südlich von Los Angeles, direkt am Pazifik, ein Apartment. Zwei Zimmer, große Terrasse, Fernseher, Kühlschrank, Spüle, Herd – alles. Ich besitze noch heute Fotos, auf denen wir beide zu sehen sind: in der Abendsonne sitzend, Zigarette in der einen, das Glas Whiskey in der anderen Hand. Erasmus mit weißer Hose und blau-weiß kariertem Hemd, ich mit weißer Hose und schwarzem Hemd. So saßen wir da. Es ist auf den Bildern deutlich zu erkennen, dass wir das Wohlleben preisen. Aber die Unverträglichkeit war stärker.
Es sind Kleinigkeiten. Immer sind es Kleinigkeiten. Eigentlich nicht der Rede wert. Man schämt sich, dass man nicht die Größe hat, darüber hinwegzusehen. Aber es ist wie verhext, die Kleinigkeiten setzen sich durch. Wenn ich an Kalifornien denke, an Laguna Beach, dann sollte ich eigentlich an Dinge denken, die wirklich von Bedeutung sind, an Disneyland, an Hollywood, an die Besichtigung der Universal Studios. Wir haben eine Guided Tour gemacht, wir haben uns alles angesehen, was die Studios zu bieten hatten, Stuntmen, dressierte Tiere, den Killer-Hai, Frankensteins Schloss, mexikanische Straßen, durch die man künstliche Sturzbäche schickte, und natürlich die Studios selbst mit ihren Tricks und Betrügereien, ohne die der Film nicht auskommt. Das war schon beeindruckend. Im Grunde aber ist es an mir abgeprallt. Wenn ich das alles nicht gesehen hätte, würde ich mich auch nicht ärmer fühlen. Viel mehr beeindruckt haben mich die Kleinigkeiten.
Ich finde, ein Dollar ist eine Kleinigkeit. Ein Schwarzer in Haiti mit einem Dollar Tageslohn mag das ein bisschen anders sehen, ich bin kein Schwarzer in Haiti. Man sagt zwar, beim Geld höre die Freundschaft auf, aber dass die Freundschaft schon bei einem Dollar aufhören sollte, das hätte ich mir doch nicht träumen lassen; nicht, als wir in der Pizzeria in der Eisenacher Straße unsere Reise nach Amerika beschlossen.
Es ist auf solchen Reisen immer die Frage, wie halten wir es mit dem Gelde? Getrennte Kassen? Gemeinsame Kasse? Irgendeine Mischform? Wir hatten uns für die Mischform entschieden, das halte ich auch heute noch für sehr vernünftig. Die großen Beträge für Hotelrechnungen, Leihwagen oder Flugtickets bezahlten wir getrennt, die kleineren für Eintrittskarten, Popcorn, Kaffee, Eis oder Benzinrechnungen bezahlte mal der eine, mal der andere, wie es gerade kam. Das würde sich schon ausgleichen, dachten wir, wenn heute der eine zuviel gezahlt hat, zahlt morgen der andere zuviel, am Ende wird es sich ausgeglichen haben, dafür sorgt das Gesetz der großen Zahl. Man muß diesem Gesetz natürlich Vertrauen schenken, sonst kann man die Mischform vergessen. Wozu eine solche Regelung treffen, wenn man es doch nicht lassen kann, alles und jedes nachzurechnen?
Das aber ist Erasmus' Art, obwohl er propagiert, man solle fünfe gerade sein lassen. Er rechnet nach, wo immer eine Rechnung auftaucht. Die Mundwinkel buchhalterisch heruntergezogen überprüft er, selbst wenn ich bezahle, im Restaurant die Rechnung. Er sei zu oft betrogen worden, sagt er. Die Kellner legten es darauf an. Es liege vielleicht sogar ein bisschen an ihm selbst, er habe etwas an sich, das sie zum Betrug herausfordere. Aber gerade deshalb rechne er nach, damit sie nicht glaubten, mit ihm könnten sie es machen. Die Kellner verachteten den Gast, den sie übervorteilen könnten, und das könne er nicht auf sich sitzen lassen. Das Geld könne er verschmerzen, die Verachtung der Kellner nicht. Er sei kein Knickerarsch, er wolle aber respektiert werden. »Sie stecken alle unter einer Decke«, sagt er, »Sie haben sich alle miteinander verschworen. Wo du auch hinkommst, dieselben Tricks, dieselben Gesten, dieselben Blicke, dieselben Gaunereien. Es ist ein internationale Verschwörung, es ist eine Verschwörung des internationalen Weltkellnertums!«
Und dann lacht er! Haha! Er denkt, es sei komisch, was er da sagt, es sei ironisch übertrieben. Das ist es oder wäre es auch, wenn da nicht auch noch etwas anderes wäre: Erasmus' Finger auf der Rechnung, Posten für Posten herunterkletternd bis zur Summe unter dem Stich. Was soll da noch die Ironie? Man kann nicht ironisch nachrechnen. Entweder man rechnet, oder man rechnet nicht. Erasmus rechnet. Er entdeckt einen Fehler. Er winkt den Kellner herbei und sagt mit gedämpfter Stimme – nicht übertrieben anklagend, aber auch nicht übertrieben freundlich –, er glaube, an der Rechnung sei etwas nicht in Ordnung.
»Nicht, mein Herr?«
»Nein, sehen Sie hier: Das haben wir nicht bestellt.«
»Die Portion Pommes frites extra, mein Herr.«
»Das hier?«
»Ja, mein Herr.«
Die Rechnung stimmt. Erasmus hat sich blamiert. Aber er merkt es nicht, er ist zufrieden. Er hat nachgerechnet. Kein noch so schönes Apartment mit Sonnenterrasse und Blick auf den Pazifik wird ihn davon abhalten. Er musste es dann sogar dahin treiben, dass er mich verdächtigte, obwohl ich ja gar kein Kellner bin. Er musste mir die Absicht unterstellen, ich wolle ihn betrügen oder übervorteilen. Er musste mich beleidigen.
Am Abend unserer Abreise aus Laguna Beach warf er mir vor, ich nutzte ihn aus. Ich gäbe mir den Anschein eines großzügigen Menschen, sagte er, eines Menschen, der eher zuviel bezahle als zuwenig, in Wirklichkeit aber drehte und wendete ich alles so, dass es zu meinem Vorteil sei. Ich bezahlte das Eis, und er die Benzinrechnung. Ich den Kaffee, und er die Eintrittskarten für die Universalstudios. Ich die Limonade, und er die Hamburger mit Pommes frites. Undsoweiter. Nichts davon stimmte, alles war an den Haaren herbeigezogen, selbst sein eigene, heimlich notierte Rechnung sprach dagegen. Am Ende dieser kaum noch so zu nennenden Metadiskussion begann er nämlich, mir anhand seines Notizbuches vorzurechnen, was an diesem Tage ich und was er bezahlt hatte. Ich war zu aufgeregt und zu empört, um meinerseits das Rechenwerk zu überprüfen. Mag sein, es stimmte. Mag sein, er hatte etwas vergessen. Es war mir egal. Auf jeden Fall war das Ergebnis seiner Rechnung, dass er an diesem Tage einen Dollar fünfzig zuviel bezahlt hatte. Einen Dollar fünfzig! Natürlich rechnete er diese Summe auf fünf Wochen hoch, behauptete, der Fehlbetrag zu seinen Ungunsten sei an anderen Tagen noch höher, von Ausgleich und Gesetz der großen Zahl könne bei meinem das Zücken meines Portemonnaies geschickt verzögernden Gebaren nicht die Rede sein, er zahle drauf, ich sahnte ab, und so weiter. Es war absurd. Ich hatte das Gefühl, es mit einem Verrückten zu tun zu haben. Rette sich, wer kann!
Am nächsten Tage trennten wir uns. Ich fuhr allein nach San Francisco, nach Las Vegas, nach New Orleans und dann von dort nach Houston, wo wir unseren Rückflug antraten. Im Flugzeug, während wir vom Plastikteller Sandwiches aßen, kam es zur letzten Metadiskussion. Wir einigten uns darauf, dass die Affäre äußerst lächerlich gewesen sei. Erasmus, bester Laune, gestand, er habe bei der Aufrechnung auch noch gemogelt. Die Differenz sei nicht ein Dollar fünfzig gewesen, sondern nur ein Dollar.
Inverness
Es kam mir länger vor, aber ich war tatsächlich erst zwei Stunden wieder in Berlin. Und schon betrunken.
Ich hatte meine letzten drei, vier Zigaretten geraucht und ebensoviele Gläser Sherry geleert. Danach überfiel mich der Heißhunger auf Spiegeleier. Vermutlich, weil ich schon zum Frühstück Spiegeleier gegessen hatte, bacon and eggs. Wenn ich morgens Spiegeleier esse, komme ich den ganzen Tag nicht davon los. Das ist wie mit dem Alkohol. Oder den Zigaretten. Ich rannte in die Küche, stellte den Herd an, wartete darauf, dass die Butter in der Pfanne schmolz, gab drei Eier hinein, legte zwei Scheiben Käse darauf, tat den Deckel auf die Pfanne und betete, dass das Zeug da drinnen endlich gar würde.
Im Kühlschrank war noch eine Flasche Sekt. Ich öffnete sie, füllte mir ein Glas ab, verschloss die Flasche wieder und stellte sie zurück. Dummerweise waren die Zigaretten alle. Jetzt hätte ich gern noch eine geraucht. Eine jetzt und eine nach dem Essen. Schade. Zum Automaten gehen kam nicht mehr in Frage. Ich wollte mit dem Rauchen aufhören. Unbedingt. Mit dem Rauchen, mit dem Saufen, mit dem Essen. Nur vorher noch die Spiegeleier.
Ich ließ die Eier auf den Teller gleiten, kramte Messer und Gabel aus der Schublade, rannte zurück ins Wohnzimmer und aß den Teller leer. Dazu trank ich den Sekt. Danach legte ich mich ins Bett. Mein Bauch war voll, meine Brust schmerzte, mein Kopf war benebelt –, da half nur noch das Bett. Ich hätte nicht lesen können, erst recht nicht schreiben, auch nicht mit irgendjemand reden, noch nicht einmal ins Kino gehen. Fernsehen vielleicht, fernsehen geht immer. Mein Fernseher war kaputt.
Ich lag im Bett und dämmerte vor mich hin. Wie spät war es? Halb sechs. Zu früh, um sich ins Bett zu legen. Zu früh zum Betrunkensein. Zu spät, um mit dem Tag noch etwas anzufangen.
Ich dachte an Andrea. Ich war nicht betrunken genug, um nicht an sie denken zu müssen, und nicht nüchtern genug, um mich auf etwas anderes konzentrieren zu können. Ich war ihr ausgeliefert. Es ist in Ordnung, dachte ich, es ist in Ordnung. Die Sache lief nicht mehr, schon lange nicht, sie ist im Grunde nie gelaufen, nicht einmal in den ersten Wochen. Es war Lüge, alles Lüge. Sei froh, dass es zuende ist, sei froh!
Ich war nicht froh. Ich dachte an den neuen Lover. Wahrscheinlich war er jünger als ich, lebensbejahend, sportlich, attraktiv, und was man sich als Frau so wünschen kann von einem Mann. Für einen resignierten, selbstzerstörerischen, jede gute Laune verderbenden Anfangvierziger hätte sie mich nicht verlassen müssen. Da hätte sie auch bei mir bleiben können.
Wahrscheinlich schläft sie jetzt mit ihm, dachte ich. Na und? So toll war es nicht. Sie sagte, es sei toll, ich sagte, es sei toll, und in Wirklichkeit habe ich gedacht, wie komme ich bloß hier raus. Ich habe mich immer nur nach einer anderen gesehnt. Oder nach dem Alleinsein.
Du wolltest allein sein, sagte ich zu mir, jetzt bist du es, was willst du mehr? Sie ist mit ihrem Lover glücklich, und du bist wieder ein freier Mann. Ist doch in Ordnung.
Aber je mehr ich dachte, es ist in Ordnung, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass es irgendetwas anderes war, eine Gemeinheit, eine Bosheit, eine Hinterhältigkeit. Ich wollte sie lossein und meine Ruhe haben, jetzt bin ich sie los und habe doch nicht meine Ruhe. Ich saufe, ich rauche, ich fresse, ich lasse mich gehen. Und alles nur, weil sie den neuen Lover hat.
Du bist ein Kind, sagte ich dann wieder zu mir, du bist ein alter Mann, aber ein Kind. Du bist mit ihr nicht glücklich, aber du willst auch nicht, dass sie mit einem anderen glücklich ist, das ist kindisch. Du bist nie richtig erwachsen geworden! Du kannst dich mit deinem verkniffenen Gesicht und der dahintersteckenden Kinderseele nirgendwo mehr blicken lassen. Du hast verloren, endgültig verloren.
Es gelang mir, mich im Bett aufzusetzen und erst das rotgemusterte und dann auch noch das grüngemusterte Kissen zwischen mich und die Wand zu schieben. Meine Nase war verstopft. Ich holte vom Fußboden ein Plastikfläschchen mit Nasenspray herauf und sprühte in jedes Nasenloch zwei Spritzer. Die Nase wurde freier. Meine Weinerlichkeit nahm ab.
Nein, dachte ich, ich habe nicht verloren. Morgen beginnt ein neues Leben. Heute ist nichts mehr zu machen, aber morgen. Ichhabe ein Recht zu leiden. Ich wollte, dass sie mich in Ruhe lässt, aber sie hat mich nicht in Ruhe gelassen, sie hat mich in Panik versetzt. Sie hat gewartet, bis sie mich in Panik versetzen konnte, sonst hätte sie mich schon eher verlassen, schon bevor sie ihren neuen Lover hatte. Aber so sind die Frauen, sie müssen unbedingt so lange warten, bis der neue Lover da ist, vorher verlassen sie dich nicht.
Noch Ende Februar hatte Andrea mir geschrieben, dass sie sich riesig darauf freue, mich in London zu sehen. Anfang März war sie auch noch herzlich und in Vorfreude. Und dann, am Tag vor meinem Abflug, auf einmal dieser Eilbrief: »Ich möchte Dich bei Deinem Londonaufenthalt nicht sehen, den Grund dafür wirst du erraten können.« War das in Ordnung? Ich hatte mich auf sie eingestellt, ich hatte alles arrangiert, den Flug, das Hotel, das Doppelzimmer, alles. Es fehlt nicht viel, und ich hätte sogar schon die Mütze gekauft, die Mütze für Mrs Kingdom.
Mrs Kingdom war ihre Wirtin. Sechzig Jahre, Witwe, zwei Töchter, ein bisschen schwerhörig. Das Zimmer, schrieb Andrea, sei so richtig gemütlich und nett, das Reihenhaus so typisch englisch, und das Frühstück so richtig lecker, mit cerials und allem. Manchmal koche Mrs Kingdom sogar für sie, obwohl sie ja nur bed and breakfast habe und nicht bed and dinner , aber trotzdem. Sie habe sich sogar schon überlegt, ob sie nicht ganz dableiben solle, nicht nur die sechs Wochen für den Englischkurs, sondern für immer! Bei Mrs Kingdom fühle sie sich so richtig wie zu Hause. Und eines Abends hatte sie mich angerufen und gesagt, ich müsse unbedingt noch eine solche Mütze besorgen, wie ich sie ihr vor ihrer Abreise geschenkt hatte, Mrs Kingdom sei nämlich ganz verrückt nach dieser Mütze.
Es war eine Mütze aus der Volksrepublik China. Außen braunes Leder, innen Kaninchenfell, an der Seite Ohrenklappen mit Bändern, die man unterm Kinn zusammenbinden konnte. Ich hatte sie Anfang der 70er Jahre in einem Laden gekauft, in dem es rotchinesische Hochglanzillustrierte, Jacken im Mao-Look und diese Mützen gab. Getragen hatte ich sie nie, sie war zu klein. Andrea passte sie hervorragend. Sie war in London, während sie Stunden um Stunden durch die Straßen lief und sich alles anschaute, die Häuser und die Menschen, die Busse und die Taxis, alles ganz toll, immer wieder auf diese Mütze angesprochen worden, das hatte sie schon in ihrem ersten Brief geschrieben. Ganz London stand gewissermaßen Kopf nach dieser Mütze. Und Mrs Kingdom wollte auch so eine.
Ich hätte sie auch gekauft, ich hatte nur den Laden nicht mehr finden können. Zum Glück. Sonst läge die Mütze jetzt bei mir herum. Das mit der Mütze war nochmal gutgegangen, das mit dem Flug und mit dem Doppelzimmer weniger. Wozu für eine ganze Woche ein Doppelzimmer reservieren und sogar im voraus bezahlen, wenn man am Ende doch allein ist und nicht länger als drei Tage bleiben will? Das war doch Unsinn! Drei Tage musste ich sowieso nach London, weil ich zusammen mit Viktoria eine alte Dame für den Rundfunk interviewen wollte. Den Rest der Woche hatte ich mit Andrea verbringen wollen, damit sie noch einmal mit mir zusammen durch die Straßen laufen und alles anschauen konnte, die Häuser und die Menschen, die Busse und die Taxis, alles ganz toll – und dann kam auf einmal dieser Eilbrief.
In meiner ersten Panik hatte ich Maria angerufen. Aber noch während bei ihr das Telefon klingelte, fragte ich mich, ob ich nicht wieder auflegen sollte. Sollte ich mich nicht lieber hinsetzen und warten, bis es vorbei war? Aber nein, sagte ich mir dann, du kannst nicht dein ganzes Leben lang immer nur warten, bis es vorbei ist, irgendetwas musst du tun. Wenn Maria nicht da ist, umso besser.
Maria war da. Ich sagte, ich hätte mich mit einer jungen Dame in London treffen wollen, und die junge Dame habe mich versetzt. Maria lachte.
»Nun ist das Doppelzimmer frei«, sagte ich, »bzw. das zweite Bett im Doppelzimmer, willst du mich nicht besuchen? Von Sonntag bis Donnerstag, auf meine Kosten, Flug und alles?«
»Das ist ja ein verlockendes Angebot«, sagte sie.
»Dann nimm es doch an«, sagte ich.
»Von wann bis wann, sagtest du?«
»Von Sonntag bis Donnerstag.«
»Ich werd's mir überlegen.«
»Ich muss es aber heute wissen«, sagte ich, »ich fliege ja schon morgen.«
»Gut«, sagte Maria, »ich rufe dich in einer halben Stunde wieder an.«
Danach war ich beruhigt. Die Panik hatte sich gelegt. Ich machte mich daran, den Koffer zu packen, vor allem das Aufnahmegerät, das Mikrophon und die Kassetten für das Interview, und als ich mich im Innersten befragte, ob es mir lieber wäre, wenn Maria ja sagte oder nein, da musste ich mir ehrlich sagen, dass es mir egal wäre.
Nach einer halben Stunde rief Maria wieder an und sagte, sie habe es sich überlegt, es sei wirklich ein äußerst verlockendes Angebot, und es täte ihr schrecklich leid, dass sie es nicht annehmen könne. Aber sie müsse noch einen Artikel für die Neue Zürcher Zeitung schreiben, und ich wisse ja, wie langsam sie arbeite.
»Ist gut«, sagte ich, »es war ja nur ein Angebot.«
»Ja«, sagte Maria, »und was für ein verlockendes!«
Am nächsten Morgen holten Viktoria, ihr Sohn Max und Winfried mich mit dem Taxi ab, und wir fuhren zum Flughafen. Winfried war Max' Kindermädchen oder, wie Viktoria richtig sagte, sein »Kindermann«.
Erst in London dachte ich wieder an Andrea. Sie hatte mir geschrieben, es sei warm und frühlingshaft. Es war kalt und regnerisch.
Im Hotel gab es eine Überraschung. Man hatte kein Zimmer für uns. Irgendein Computer hatte irgendetwas durcheinandergebracht. Das sagte man uns natürlich nicht sofort, sondern erst, nachdem man uns solange hingehalten hatte, bis wir kampfunfähig waren. Max verspielte währenddessen ein Vermögen an einem dieser elektronischen Geräte, mit denen man Flugzeuge abschießen kann, Winfried maulte, weil er unbedingt sofort die Stadt sehen wollte, Viktoria regte sich mehrere Male auf, ab, und wieder auf –, nur ich blieb ruhig. Ich hatte es nicht eilig. Je länger ich hier im Hotel saß und nicht wusste, was nun werden würde, desto geringer war die Gefahr, Andrea und ihrem Lover über den Weg zu laufen. Sie hockten jetzt wahrscheinlich in der Tate Gallery vor einem Turner oder Constable, und ich konnte vorbeikommen und mir ihr Glück anschauen. Aber darauf konnten sie lange warten, ich würde doch nicht kommen, weder in die Tate Gallery noch in die National Gallery. Die Kunst war mir für dieses Mal verleidet. Ich hätte nicht einmal an Cézanne meine Freude gehabt, mit Andrea und ihrem Lover davor.
Nach ungefähr drei Stunden kam der Manager des Hotels, drückte uns ein Begleitschreiben für ein anderes Hotel derselben Kategorie sowie zwei einzelne Pfundnoten für das Taxi in die Hand und wünschte uns alle Gute. Das Taxi fuhr ein paar Straßen weiter zu dem anderen Hotel, der Fahrer war mit den zwei Pfund zufrieden, und nur die Sache mit derselben Kategorie erwies sich als Schwindel. Aber inzwischen waren wir so müde, dass es auch das Obdachlosenasyl getan hätte. Wir schleppten die Koffer in unsere Zimmer und trafen uns eine halbe Stunde später im Foyer. Viktoria und Winfried wollten in die Stadt, Max musste wohl oder übel mit, und auch ich schloss mich ihnen zögernd an. Zwar fürchtete ich, unterwegs Andrea mit ihrem Lover zu begegnen, aber ich hatte auch keine Lust, allein in meinem Doppelzimmer auf dem viel zu großen Bett zu liegen und die Decke anzustarren.
Wir fuhren mit dem Taxi zum Trafalgar Square, und gleich nachdem wir ausgestiegen waren, sah ich sie: Andrea! Mit Lover! Eng umschlungen! Direkt neben einem der großen Löwen, die die Säule mit dem Admiral bewachen! Geistesgegenwärtig versteckte ich mich hinter dem breiten Rücken des Kindermannes. Mein Herz klopfte, meine Knie schlotterten, mein Atem stockte. Es war demütigend. Ich hatte es vorausgesehen, es hatte so kommen müssen, ich kannte die Zufälle, man konnte sich hundertprozentig auf sie verlassen. Ich hätte im Hotelzimmer bleiben sollen, soviel war sicher. Ich fühlte mich wie ausgestoßen, wie einer, der auf dieser Welt nichts mehr zu suchen hat, weder in London noch in Berlin noch sonstwo, und vor allem nicht auf dem Trafalgar Square. Und das, obwohl London meine Stadt war! Ich hatte sie für mich erobert, vor Jahrzehnten schon. Andrea war nicht die erste, die hier einen Englischkurs mit bed and breakfast besuchte, ich hatte das vor fünfundzwanzig Jahren schon gemacht, da lag Andrea noch so gut wie in den Windeln!
Das Gefühl der Demütigung wurde nicht geringer, als ich erkennen musste, dass Andrea nicht Andrea und ihr Lover höchstwahrscheinlich auch nicht ihr Lover war. Ich hatte mich blamiert.
Wir bogen in den Strand ein und kauften im Adelphi Karten für das Musical Me and My Girl. Nur noch zwei Stunden, dann würden Viktoria und ich im Theater sitzen, und wenn Andrea nicht noch unvermutet dort auftauchte, dann war der Tag gerettet.
Im Covent Garden, beim Cappucino, erzählte ich Viktoria von dem Eilbrief. Ich hatte es eigentlich nicht verraten wollen, aber die Begegnung mit Andrea hatte mich weich gemacht, obwohl es nicht Andrea gewesen war. Viktoria konnte mit der Geschichte wenig anfangen. Sie ließ sich den Text des Eilbriefes dreimal wiederholen, schüttelte verständnislos den Kopf und sagte schließlich: »Wieso glaubst du, dass sie einen Lover hat?«
»Was denn sonst?« sagte ich.
»Keine Ahnung.«
»Und der Brief?«
»Ich weiß nicht«, sagte sie, »ich finde ihn kryptisch.«
Kryptisch! Das war es! Der Brief war kryptisch! »Warum ich Dich bei Deinem Londonaufenthalt nicht sehen will, wirst du sicherlich erraten können.« Kryptisch. Viktorias Fähigkeit, zur rechten Zeit das rechte Wort zu finden, war meine Rettung.
Das Wort befreite mich von dem Verdacht, dass es die Abfuhr gewesen war, die mich geärgert hatte, und der Brief bloß Nebensache. Nun aber, wo Viktoria das erlösende Wort gefunden hatte, war dieser Verdacht mit einem Mal verflogen. Der Brief war kryptisch, und das Kryptische daran war ärgerlich. Einen neuen Lover haben, ist eine Sache, einen kryptischen Eilbrief schreiben, eine andere.
Das Wort erleichterte mich so, dass ich nicht einmal mehr darauf bestand, mit dem Taxi ins Hotel zu fahren. Auf Winfrieds Wunsch fuhren wir mit der berühmten Londoner tube. Das brachte noch einmal das Risiko mit sich, Andrea und ihrem Lover zu begegnen, aber diesmal ging alles gut.
Der nächste Tag war so gut wie verplant. Nachmittags das Interview, abends nochmal Theater, morgens meinen Rückflug buchen. Ich hatte ja immer noch das Ticket für die ganze Woche, von Freitag bis Donnerstag, aber was sollte ich noch hier, wenn Viktoria, Max und Winfried am Sonntag wieder abgeflogen waren? Mich vor Andrea verstecken? Das konnte ich in Berlin besser.
Viktoria und Winfried wollten vormittags Bahnhöfe besichtigen, Charing Cross, St.Pancrass, Viktoria Station und Paddington. Max wollte unbedingt auch noch ins London Dungeon, ein Wachsfigurenhorrorkabinett. Viktoria war davon nicht angetan, Winfried auch nicht, aber Max setzte es durch.