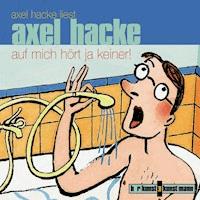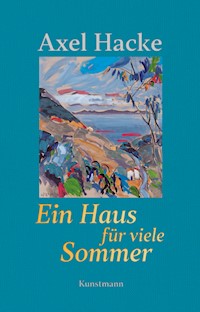
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Haus im Süden, woanders sein und doch bei sich, das ist ein Traum, den viele träumen. Wer aber dann wirklich so ein Haus hat, hat andere Träume, Träume von … ja, vielleicht von Ferien? Axel Hacke erzählt in Ein Haus für viele Sommer von der Magie eines Ortes, an dem man eigentlich nicht sein müsste, aber doch unbedingt sein will. In seinen Geschichten geht es um die Menschen auf einer Insel, um die Landschaft dort, um Schlangen, Gottesanbeterinnen, Fakirtauben, Ziegen, Oliven und um einen Mann, der aus dem Ehebett heraus ein Wildschwein erschießt. Um Gedichte, die an Straßenecken hängen, und um die Geheimnisse eines alten Turms, den Torre, der für die, die ihn besitzen und in den Ferien bewohnen, Herausforderungen bereithält, mit denen sie nicht gerechnet hatten. In diesen Geschichten spürt man die Sommerhitze, den Sand unter den Füßen, die leichte Brise auf dem Meer. Der Blick wandert über den Olivenhain, er richtet sich auf den schönsten Sonnenuntergang der Welt und auf so seltsame Fragen wie die, was man eigentlich genau tut, wenn man nichts tut. Was sich entwickeln kann, wenn man einen Urlaubsort nicht nur als Urlaubsort sieht, den man betritt und wieder verlässt – als Erholungskulisse also –, sondern wenn man diesen Ort ernst nimmt und zu verstehen versucht, das macht die Magie dieses Buchs aus, das in den Lesern noch lange nachwirkt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Ein Haus im Süden, woanders sein und doch bei sich, das ist ein Traum, den viele träumen. Wer aber dann wirklich so ein Haus hat, hat andere Träume, Träume von … ja, vielleicht von Ferien?
Axel Hacke erzählt in Ein Haus für viele Sommer von der Magie eines Ortes, an dem man eigentlich nicht sein müsste, aber doch unbedingt sein will. In seinen Geschichten geht es um die Menschen auf einer Insel, um die Landschaft dort, um Schlangen, Gottesanbeterinnen, Fakirtauben, Ziegen, Oliven und um einen Mann, der aus dem Ehebett heraus ein Wildschwein erschießt. Um Gedichte, die an Straßenecken hängen, und um die Geheimnisse eines alten Turms, den Torre, der für die, die ihn besitzen und in den Ferien bewohnen, Herausforderungen bereithält, mit denen sie nicht gerechnet hatten.
In diesen Geschichten spürt man die Sommerhitze, den Sand unter den Füßen, die leichte Brise auf dem Meer. Der Blick wandert über den Olivenhain, er richtet sich auf den schönsten Sonnenuntergang der Welt und auf so seltsame Fragen wie die, was man eigentlich genau tut, wenn man nichts tut.
Was sich entwickeln kann, wenn man einen Urlaubsort nicht nur als Urlaubsort sieht, den man betritt und wieder verlässt – als Erholungskulisse also –, sondern wenn man diesen Ort ernst nimmt und zu verstehen versucht, das macht die Magie dieses Buchs aus, das in den Lesern noch lange nachwirkt.
Über den Autor
Axel Hacke lebt als Schriftsteller und Kolumnist des Süddeutsche Zeitung Magazins in München. Er gehört zu den bekanntesten Autoren Deutschlands, seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Zuletzt erschienen Wozu wir da sind. Walter Wemuts Handreichungen für ein gelungenes Leben (Kunstmann 2019) und Im Bann des Eichelhechts (Kunstmann 2021). Mehr unter www.axelhacke.de
Axel Hacke
Ein Hausfür vieleSommer
Verlag Antje Kunstmann
Für Ursula
HUNDERT METER ENTFERNT von unserem Turm, von dem ich berichten werde, in einer kleinen Seitengasse des Dorfes, haben wir eine Cantina, in der wir Fahrräder aufbewahren, auch eine Vespa, dann zum Beispiel Fliesen, die wir vielleicht noch mal brauchen werden. Solche Sachen. Die Waschmaschine steht ebenfalls dort, und die Cantina ist sogar so groß, dass der alte Fiat 500 dort Platz hat, von dem ich auch noch erzählen möchte, später.
Also, es ist praktisch eine Garage, allerdings eine uralte. Wie viele Häuser im Dorf ist auch das Gebäude, zu dem die Cantina gehört, teils in die Felsen gerammt, teils klebt es auf ihnen. Der Raum hat ein Holztor, das so schmal ist, dass nur eine einzige Art von Auto hindurchpasst (eben ein alter Fiat 500), und zwei glaslose Fenster, weit oben an den hohen Wänden.
Dorthin bringe ich die leeren Koffer, wenn wir sie ausgepackt haben und für eine ganze Weile nicht mehr brauchen.
Wir haben die Cantina vor vielen Jahren von Matilde gekauft, einer alten Frau aus dem Dorf. Ihr Mann hatte in den Jahren vor seinem Tod hier fast jeden seiner Tage verbracht, hatte Fischernetze geflickt, seinen Bootsmotor repariert und die Trauben von einigen Weinstöcken gekeltert, die er draußen vor dem Dorf besaß. Aber die meiste Zeit hatte er wohl einfach nur drinnen gesessen, sich mit Freunden unterhalten oder eben, nun, was soll man sagen …? Er hat drinnen gesessen, wie viele alte Männer hier das in solchen Räumen tun, auch Antonio zum Beispiel, der sich früher im Winter um unsere Vespa kümmerte, die Zündkerzen reinigte, kleine Reparaturen machte. Damals hat er auch unseren Bootsmotor gewartet, ihn zum Beispiel in Süßwasser laufen lassen, was man jeden Winter machen muss, damit er nicht kaputtgeht. Das tut Antonio heute nicht mehr. Er ist zu alt.
Aber in seiner Cantina sitzt er immer noch. Seit dreißig Jahren verbringt er seine Tage dort. Was er da genau tut, weiß ich nicht. Es ist einfach eine Gewohnheit, und eine Zeit lang träumte ich davon, es auch mir zur Gewohnheit werden zu lassen, morgens bisweilen einen Stuhl in die Cantina zu stellen und darauf sitzend den Tag zu verbringen, zwischendurch eine Mutter an meinem Fahrrad nachzuziehen, das Ende des Schleudergangs der Waschmaschine abzuwarten, den Raum auszufegen oder den Schlauch neu aufzurollen, mit dem ich bisweilen den kleinen Platz vor der Cantina abspritze, um ihn zu säubern.
Die Zeit verstreichen zu lassen …
Nirgendwo anders habe ich so ein deutliches Gefühl für das Verstreichen der Zeit gehabt wie hier im Dorf oder oben auf dem Ripidello, dem Hügel einige Kilometer außerhalb des Dorfes, wo du auf einer uralten Mauer sitzen kannst und zusiehst, wie ein Wind die Olivenblätter leise bewegt und wie die Zeit zusammen mit dem Wind durch die Bäume streicht und dabei langsam verstreicht. Oder wie eben in der Cantina, wo ich manchmal herumsitze, bevor ich den Raum ausfege oder ein paar Strandhandtücher wasche, während es draußen, in der Nachmittagszeit, vollkommen ruhig ist, weil die Zeit tatsächlich für Augenblicke ganz still steht, bevor sie weiterstreicht.
Matilde hatte den Raum nach dem Tod ihres Mannes noch einige Jahre lang behalten, ohne ihn wirklich zu benutzen, wohl zur Erinnerung an den Verstorbenen und aus Respekt vor ihm. Aber dann wollte sich die Tochter mit ihrer jungen Familie ein Haus bauen, sie brauchte Geld. So konnten wir zum Notar gehen.
In der Nähe unserer Cantina lebt, in einer kleinen Wohnung auf dem Weg dorthin, ein Mann namens Pietro. Oft, wenn ich das Tor aufschließe, höre ich ihn in meinem Rücken rufen, weil er gerade vorbeigeht.
Axellll, ciao, come stai? Wie geht es dir?
So ist es auch jetzt. Pietro ist oft der erste Dorfbewohner, mit dem ich rede, kaum bin ich da.
Axellll, ciao, come stai?
Er ruft es laut und immer im Ton höchster Freude und größter Überraschung, als seien wir alte Freunde und hätten uns seit vielen Jahren nicht gesehen. Dabei begegnen wir uns jeden zweiten Tag, kennen uns aber erst, seit wir die Cantina haben, ein paar Jahre lang also.
Pietroooo!, rufe ich, als hätte ich nicht im Geringsten mit ihm gerechnet. (Dabei wusste ich genau, dass er mich gleich rufen würde).
Tutto bene?, frage ich. Alles klar bei dir?
Anfangs ist mir Pietro auf die Nerven gegangen. Wenn ich zur Cantina gehe, habe ich es nämlich meistens eilig. Ich will etwas holen, die Waschmaschine anwerfen, Wäsche aufhängen oder mit der Vespa wegfahren. Pietro aber hat immer etwas zu erzählen, und er erzählt es auch, mit großer Intensität und Inbrunst, mit gepressten Konsonanten, gedehnten Vokalen und viel Zeit. Als wir uns das erste Mal sahen und er gleich auf mich einredete, das Gesicht dicht vor meinem, wollte ich ihn rasch wieder loswerden. Ich hielt ihn für ein wenig verrückt.
Was soll’s?, denke ich heute, das ist ja Unsinn. In dieser Cantina hat ein alter Mann so viel Zeit verbracht, dass in allen Ecken noch etwas von ihr herumliegt, von der Zeit, meine ich. Dieser Raum ist ein Lager für alte, unverbrauchte Zeit. Und von dieser alten, unverbrauchten Zeit verbrauche ich jetzt ein Viertelstündchen mit Pietro. Wenn dir dieser kleine, überaus freundliche Mann auf die Nerven geht, dann stimmt was mit deinen Nerven nicht, denke ich.
Hast du gesehen, wie schön ich meine Treppe repariert habe?, fragt er.
Tatsächlich, großartig, sage ich.
Diese Treppe hatte vorher nur ein paar hässliche grobe Betonstufen, die nach oben führten. Die hat er mit rotbraunen Cotto-Fliesen belegt, ein Geländer aus Holz gibt es auch. Auf der ersten Stufe steht eine kleine Peperoncino-Pflanze. Pietro pflückt drei der kleinen roten Früchte und gibt sie mir.
Wie nett!, sage ich, danke, die nehmen wir heute Abend für die Spaghetti, wir machen sie con aglio, olio e peperoncino.
Esatto! So machst du es!
Er schreit es. Jubelt es geradezu heraus.
Esattoooo!
Es ist eines der Wörter, die er am häufigsten benutzt. Oft erfüllt es mich mit einem kindischen Stolz, wenn er wieder dieses Esattoooo! schreit, weil es nämlich bedeutet, dass ich etwas richtig gemacht habe, irgendetwas.
Ich kann zum Beispiel erwähnen, dass Turin die Hauptstadt des Piemont ist.
Esattoooo!
Oder dass man, wenn man in die Hauptstadt will, unten an der Kreuzung am besten links abbiegt.
Esattoooo!
Dass die Straßenfeger sich mal ein bisschen mehr um unsere kleine Gasse hier kümmern könnten.
Esattoooo!
In jedem Gespräch kommt Pietro mir, wie schon erwähnt, sehr nahe. Meistens rückt er sein Gesicht so dicht vor meines, dass ich unwillkürlich zurückweiche. Es kann sein, dass wir ein Gespräch vor meiner Cantina beginnen und es zwanzig Meter weiter die Gasse hinunter beenden. Würde ich nicht unsere Unterhaltungen immer irgendwann etwas brüsk beenden, weil ich trotz des Cantina-Zeitvorrates noch etwas anderes zu tun habe, als mit Pietro zu reden, würde er, glaube ich, immer weiter und weiter reden. Ja, ich denke, er würde mich, den Zurückweichenden, irgendwann rückwärts durchs komplette Dorf gequatscht haben, bis ich am Strand stünde, mit dem Rücken zum Meer, in das mich Pietro dann auch noch hineinredete.
Erst spät habe ich kapiert, warum das so ist.
Pietro sieht nämlich schlecht, sehr schlecht.
Er habe eine Makuladegeneration, hat er mir eines Tages erzählt. Die Makula ist die Stelle der Netzhaut, an der man am schärfsten sieht. Was der Mensch direkt anschaut, wird auf der Makula abgebildet. Alles andere sieht er außerhalb der Makula, sozusagen an der Peripherie der Netzhaut. Deshalb kann Pietro sich gut durchs Dorf bewegen. Aber wenn er mich direkt anblickt, sieht er mich schlecht.
Es sei denn, sein Gesicht wäre zwanzig Zentimeter vor meinem.
Ausführlich erklärt er mir, dass es eine feuchte und eine trockene Variante der Makuladegeneration gebe; er leide unter der trockenen. Vor drei Jahren habe er den Führerschein zurückgegeben, lesen könne er auch nichts mehr.
Nur dreihundert Leute haben das in Italien, sagt er, und es gibt bloß drei Professoren dafür, in Mailand, Rom und Neapel.
Er sagt es nicht klagend. Eher scheint er begeistert zu sein, dass er zu einer so kleinen Minderheit gehört und von solchen Koryphäen behandelt wird.
Allerdings ist die Makuladegeneration die häufigste Augenerkrankung der westlichen Welt, und die trockene Art kommt viel öfter vor als die feuchte. Das sage ich Pietro aber nicht, er hat da vielleicht was falsch verstanden, aber wie soll ich ihm das erklären und warum überhaupt? Ich habe es sowieso erst daheim nachschlagen müssen. Ohnehin ist es bei meinem miserablen Italienisch ein Problem, dass ich mir vieles von dem, was er sagt, erst zu Hause zusammenbuchstabiere, und dass ich, weil Pietro auch noch sehr schnell redet, irgendwann ohnehin den Faden verliere, nur noch nicke und capisco murmele, ich verstehe, capisco, capisco.
Also kann der Fehler genauso gut bei mir liegen, ich habe ja fast nichts verstanden, nur noch, dass Pietro aus bescheidensten Verhältnissen stammt und oft Hunger litt, richtigen Hunger.
Fame!, ruft er, als habe er gerade jetzt auch Hunger, und drückt sich mit den Händen in der Magengegend. Fame!, Axellll, quella fame! Il dolore della fame! Dieser Hunger. Der Schmerz des Hungers.
Er schaut mich mit einem verzehrenden Blick an, als wüte just jetzt dieser entsetzliche Hunger in seinen Eingeweiden.
Dabei geht es ihm ganz gut heute, das glaube ich jedenfalls. Er war Gärtner, jetzt ist er in Rente, lebt allein. Seine Tochter arbeitet in einem Restaurant in der Hauptstadt, dort wohnt sie auch. Den Winter verbringt er immer in Australien, wo der Sohn lebt, in Sydney. Manchmal erzählt er auch von Brisbane, wo er gewesen sei. Oder von Neuseeland. Überall habe er Freunde, ruft er, so viele Freunde. Nur im Dorf sehe ich ihn nie mit den anderen. Immer ist er allein vor seinem kleinen Haus und allein auf seinen Wegen.
Gib mir doch deine Handynummer, sagte er einmal, als wir uns gerade kennengelernt hatten, falls mal was ist mit deiner Cantina, dann rufe ich in Deutschland an, oder du rufst mich an, dann kann ich dir helfen. Und ich gebe dir meine.
So machten wir es.
Eines Tages im tiefen Winter stand ich dann am Fenster eines kleinen Hotels in den Bergen, es war Silvester, ich schaute ins Schneegestöber und dachte an die bevorstehende Party, zu der wir gehen wollten und zu der ich keine Lust hatte.
Da klingelte mein Handy.
Axellll, jubelte eine Stimme. Come stai?
… Pietro?
Esattoooo!
Es wird doch nichts passiert sein, dachte ich, in meiner Cantina. Es wird doch nicht alles abgebrannt sein, eingestürzt oder geplündert, jetzt, mitten im Winter.
Ma dove sei, Pietro? Wo bist du?
A Sydney!
Er rief mich aus Australien an, vom anderen Ende der Welt, es war nicht zu fassen. Er hatte meine Nummer in seinem Telefon entdeckt und vielleicht gedacht: Wozu habe ich seine Nummer, wenn ich sie nie wähle? Also hatte er sie eben gewählt.
Wir wünschten uns ein gutes neues Jahr. Schwupp, war er wieder weg.
Und ich, ins Schneegestöber blickend, freute mich auf das Jahr, und auf den Frühling auf der Insel freute ich mich auch.
So ist das geblieben. Seit Jahren ruft mich an jedem Silvestertag Pietro aus Sydney an, und wir sagen uns, dass wir es kaum erwarten können, uns wieder im Dorf auf der Insel zu sehen.
DIE INSEL IST NICHT GROSS, aber sie hat alles, was eine Insel braucht.
Es gibt eine Hauptstadt mit einer Festung und einem alten Hafen für die Fischer, die Segler und ein paar Jachten, auch existiert ein beschaulicher Flughafen, der sich so nahe an den Bergen befindet, dass man beim Anflug in einer der kleinen Maschinen (für große reicht der Platz zum Landen nicht) die Ziegen zählen kann, die zwischen den Felsen herumsteigen. Es gibt nur ein paar lange Sandstrände, aber viele kleinere und größere Buchten, von denen kaum eine der anderen ähnlich ist. Hinter diesen Buchten steigen steil die Hügel und Berge an. Der höchste ist so hoch, dass mir bei meinem einzigen Aufstieg vor langer Zeit schwindlig wurde auf seinem Gipfel. Ich blickte von oben auf die Flugzeuge, die im Wind wackelnd und leise brummend nacheinander die Landebahn des Flughafens ansteuerten.
Es gibt wilde Wälder und felsige Küsten, die schräg aus dem Meer emporsteigen und in deren Felswänden – vom Anblick her geschichteten Torten ähnlich – das aus dem Erdinneren vor langer Zeit nach oben gepresste Gestein blau, grün, rot, mattschwarz und blassgelb enthalten ist. Es gibt Geröllfelder, in denen sich hier und da die Macchia festkrallt. Dann wieder sind da von Gestrüpp wie mit grünem Pelz überzogene Landzungen, aber auch Gegenden, in denen die Insel den Eindruck eines großen Gartens macht, bewachsen von Weinstöcken, Olivenbäumen, langen Reihen von Tomatenstöcken und flachen Sträuchern, an denen Peperoni hängen.
Neben der Hauptstadt existiert eine Reihe weiterer Orte. Jeder unterscheidet sich von den anderen grundsätzlich. Da sind zwei oder drei Dörfer an den Hängen der Berge, die noch immer, selbst im Hochsommer, so abgeschieden sind wie vor fünfzig Jahren. Auf ihren Plätzen dösen Katzen, und steigt man bergauf durch die Gassen, sieht man viele leere Häuser. Nur wenige Kilometer weiter unten am Meer liegt ein Dorf voller Blumen, Palmen und Oleanderbüschen, und all das hinter einem endlos scheinenden hellen Sandstrand in einer weitläufigen Bucht. Dahinter wiederum befindet sich eine Promenade mit Geschäften für das, was man am Strand benötigt, Bikinis, Schäufelchen, Eis, Sonnenhüte.
Auf der anderen Seite der Insel, dem Festland zugewandt, hat ein Städtchen nie ganz die Anmutung eines Platzes verloren, der bestimmt ist durch Fähren, die ankommen, und durch Frachtschiffe, die das Erz abtransportieren, das vor langer Zeit auf der Insel gewonnen wurde. Doch heute fahren die Fähren, von Ausnahmen abgesehen, vom Festland aus nur noch in die Hauptstadt, und der Erzabbau wurde vor mehr als fünfzig Jahren eingestellt. Der Ort hingegen vermittelt einem das Gefühl, das alles sei nicht geschehen oder als habe jedenfalls diese Gemeinde einfach nicht gemerkt, dass es geschehen sei.
Ein anderer Hafenort hat versucht, sich die Atmosphäre eines Fischerdorfes zu bewahren. Fischer gibt es dort nur noch wenige. So ist dieser Ort einfach ein hübsches ehemaliges Fischerdorf voller Lokale und Läden.
Obwohl wir die Insel seit Jahrzehnten jedes Jahr mehrere Male besuchen, haben wir manche Dörfer nie gesehen und werden sie vielleicht auch nie sehen. Denn die Straßen dorthin ziehen sich durch Aberdutzende von Kurven, und da man ihnen folgen muss, ist es eben weit, sehr weit, zu weit.
Die Insel ist eine Welt für sich. Das gilt natürlich für jede Insel, ja, es macht eine Insel überhaupt erst aus, eine eigene Welt zu sein, anders als alles, was sich auf dem Festland befindet: in continente, wie die Leute auf der Insel sagen, auf dem Kontinent.
Mitten im Dorf hat mein Schwiegervater vor einem halben Jahrhundert einen alten Turm gekauft und ihn im Lauf der folgenden Jahre selbst renoviert, eines der ältesten Häuser des Ortes, la torre. Interessanterweise ist der Turm im Italienischen weiblich, die Türmin. Aber wir kämen nie auf den Gedanken, das Wort Turm für ihn oder sie überhaupt in Erwägung zu ziehen, der Torre war für uns immer der Torre, nicht der Turm und auch nicht die Torre, sondern eben, wie gesagt, der Torre. Es gibt kein passenderes Wort für ihn: massiv, mit meterdicken, an keiner Stelle jemals exakt geraden, sondern überall leicht unebenen Wänden, die sich im Laufe der Jahrhunderte gewissermaßen in Falten gelegt haben und in denen sich unlösbare Rätsel verbergen.
Jahrhundertelang war der Turm das höchste Gebäude am höchsten Platz gewesen, nein, nicht ganz: Der Kirchturm war natürlich höher und ist es bis heute. Vom Dach des Torre aus aber – so erzählen wir es in der Familie seit Jahrzehnten, ohne zu wissen, ob es eigentlich stimmt – spähte ein Wächter einerseits aufs Meer hinaus, von wo Piratenüberfälle drohten, und andererseits auch ins Inselinnere, wo der eine oder andere Eroberer mit seinen Leuten des Weges kam. Man sieht von hier oben das Meer auf allen Seiten, beobachtet die Sonne beim Auf- und Untergehen, sieht die zehn Kilometer entfernte Inselhauptstadt und die Straße, die dorthin führt. Man würde noch viel mehr sehen, hätte nicht mancher Nachbar sein Haus ein wenig aufgestockt.
Zum Mythos des Dorfes gehört eine gewisse Unleidlichkeit seiner Bewohner, die sich ganz zu Recht angewöhnt hatten, den Rest der Welt als Bedrohung anzusehen. Denn über Jahrtausende sind Dörfer wie dieses, nah am Meer gelegen, überfallen, überfallen und noch mal überfallen worden, von Karthagern und Etruskern, Römern und Goten, Vandalen, Sarazenen, Türken, Genuesen, Spaniern, Pisanern, Franzosen, Deutschen – und vor allem von Piraten, immer wieder von Piraten. Das alte Dorf liegt nicht zufällig so abweisend auf dem Felsen, und nicht ohne Grund überragte der Torre alle Häuser. So waren die Leute hier berüchtigt für ihre Feindseligkeit und Gewalttätigkeit, mit der sie sich der Übergriffe anderer zu erwehren wussten. Man sagt, es sei nicht so lange her, dass es hier die Blutrache gab. Und dass Carabinieri sich einst nur sonntags und zu dritt in den Ort wagten, das sagt man auch. Das Dorf war widerspenstig und zäh und hatte gelernt, sich nur selbst zu vertrauen.
Kein Geschichtsbuch und kein Reiseführer vergisst zu erwähnen, dass man hier in der Antike – an einem damals als unwirtlich geltenden Ort fern der Zivilisation – als Steuerschuldner oder sogar Straftäter seine Freiheit bekam, wenn man versprach zu bleiben und nicht dorthin zurückzukommen, wo man die Steuern nicht bezahlt oder sonst gegen das Gesetz verstoßen hatte. Es fehlt auch nirgends die Geschichte der Steuereintreiber, die mit Steinen und Prügeln den Hügel hinuntergescheucht wurden, als sie es wagten, von den Einwohnern Geld zu verlangen. Der kleine Kaiser, der die Insel neun Monate lang beherrschte, weil er hierher verbannt worden war, hatte die Büttel geschickt. In seiner Langeweile überzog er sein winziges Imperium mit einem Netz von neuen Straßen, dafür brauchte er Geld. Seine Wut über den Widerstand – auch diese Geschichte kennt jedes Büchlein – wurde gründlich besänftigt durch eine Schöne des Dorfes. Man hält ihren Namen in Ehren bis heute, denn sie bewahrte den Ort vor der Zerstörung.
Eine halbe Ewigkeit lang lebte das Dorf vor allem vom Erz, das hier schon von den Etruskern abgebaut worden war. Über Jahrtausende wurde in der Mine geschuftet, erst Anfang der Achtzigerjahre wurde sie geschlossen. Vom Dorf aus ging man zu Fuß zur Arbeit ins Bergwerk oder stieg später in den Minenbus. Er hielt auf der Piazza, direkt vor dem Parteibüro der Sozialisten. Auch das hat die Menschen über Generationen geformt: Sie haben (oder hatten jedenfalls, als das notwendig war) die Sturheit, den fatalistischen Mut, die Verwegenheit, den solidarischen Zusammenhalt, den Stolz und den nüchternen Realitätssinn von Bergleuten. Noch heute sieht man übrigens an manchen Stränden antike Schlackehaufen, denn gleich unten am Wasser wurde das Gestein verarbeitet.
Der Hügel, auf dem sich der Torre und das ganze Dorf befinden, bestehe, so heißt es, zu erheblichen Teilen aus Metall. Das bewirke, so wiederum der Mythos, dass man hier auf Dauer verrückt werde: der Magnetismus mache das mit den Menschen, auch die Blitze der ungezählten und fürchterlichen Gewitter, die zu gewissen Zeiten jedes Jahr über das Meer heranziehen wie Heere wütender Götter und die den Boden, so heißt es, mit ihrer gewaltigen Energie immer neu auflüden.
Es gibt tatsächlich Tage, an denen man das Gefühl hat, man selbst würde von einem solchen Wahnsinn, nein, nein, nicht geschüttelt, sondern eher gelähmt: jene Tage nämlich, an denen ein heißer Sahara-Wind übers Meer gestrichen kommt, der sich über dem Wasser mit Feuchtigkeit aufgeladen hat und nun das Dorf mit seinem Dampf brüht. Tage sind das, an denen jede Bewegung zur Mühsal wird, während das Gehirn zu einem trägen Brei geworden zu sein scheint.
Scirocco heißt der Wind, denn alle Winde haben hier einen Namen. Unten an einem der Strände kenne ich einen Schirmvermieter namens Simone, der jedes Mal, wenn er mich sieht, ruft:
Che vento abbiamo oggi? Welchen Wind haben wir heute?
Ich rufe dann einen der Namen der Winde: Tramontana, Maestrale, Greco, Levante, Mezzogiorno, Libeccio, Ponente oder eben Scirocco, und wenn ich richtig geantwortet habe, lobt Simone mich mit einem Bravo, und ich miete einen Schirm und zwei Liegen. War meine Antwort falsch, erfahre ich von ihm den richtigen Windnamen und miete dann ebenfalls einen Schirm und zwei Liegen.
Sei stanco?, bist du müde?, habe ich am Nachmittag eines dieser Tage, an denen schon seit einer Woche die Scirocco-Luft das Dorf belagerte, Mimmo gefragt, den Kellner jener ganz bestimmten Bar auf der Piazza, die es schon sehr, sehr lange gibt und in der wir viel Lebenszeit verbracht haben, weil wir eigentlich nur diese Bar besuchen, fast nie eine andere. Sein Hemd war ein feuchter Lappen, und entgegen seiner Gewohnheit bediente er mich stumm.
Stanco sei das falsche Wort, antwortete er, sono lesso, ich bin gekocht.
Als mein Schwiegervater in den Sechzigerjahren zum ersten Mal ins Dorf kam, war es also ein anderer Ort als heute. Es gab kaum irgendeine Art von Tourismus. Viele Häuser im Zentrum verfielen damals, ihre Türen waren offen, man konnte einfach hineingehen, davon werde ich noch erzählen. Die Autos der Fremden – aber das ist nun wirklich lange her – wurden umständlich mit einem Kran aus den Fähren herausgehoben.
Einige von den Leuten, die den Ort für sich entdeckten, kamen des Tauchens wegen; es waren ja noch Amphoren am Meeresboden zu finden und andere Überbleibsel in antiker Zeit gesunkener Schiffe. Andere versuchten hier den Ausstieg aus einem alten Leben, sie probierten den Öko-Landbau, Maler kamen, denen das Insellicht gefiel, Architekten, Regisseure, Schauspieler, keineswegs nur Deutsche, auch sehr viele Italiener. Manche von ihnen kauften die alten Häuser, renovierten sie, machten darin Ferien, vermieteten sie, um so das Geld für ihren eigenen Urlaub zu verdienen. Der eine oder andere mit etwas mehr Geld baute ein Haus unten am Meer, auf preiswerten Grundstücken, unter Pinien und mit berückenden Ausblicken.
Die Dorfbewohner blieben. Manche kamen auch zurück. Sie waren vor der Armut nach Australien geflohen, nun hatten sie wieder die Möglichkeit, in der Heimat zu leben. Es kann passieren, dass man einen bagnino, einen Bademeister, am Strand gesprächsweise nach seinem Geburtsort fragt und Melbourne als Antwort erhält. Es kamen auch Sarden, die ihre Insel ihrerseits verlassen mussten, weil es dort nichts zu verdienen gab, wovon man hätte leben können. Hier fanden sie Arbeit. Viele wurden Maurer, weil viel gebaut wurde. Aber erst einmal waren sie den Dorfbewohnern ähnlich fremd, wie die Deutschen es waren. Sie gehörten zu einer der vielen Schichten, die sich in Jahrzehnten und Jahrhunderten über das alte Dorf gelegt haben und noch legen werden, Schichten, die zumindest an ihren Rändern miteinander verschmolzen, aber immer noch erkennbar sind und erkennbar bleiben, wenn man genau hinschaut.
Fünfundzwanzig Jahre später verließ mein Schwiegervater den Ort und überließ uns den Torre. Er zog sich in ein entlegenes Haus in den toskanischen Steineichenwäldern auf dem Festland zurück.
Aber meine Frau, die ihre halbe Kindheit hier verbracht hat, blieb. Ich kam dazu. So blieben wir gemeinsam. Unsere Kinder haben als Ferienort praktisch nichts anderes kennengelernt. In manchen Jahren sind wir drei Mal pro Jahr hier gewesen, Ostern, Pfingsten, im Sommer. Einmal haben wir ausgerechnet, dass meine Frau insgesamt schon sechs komplette Jahre hier verbracht hat, ich natürlich etwas weniger, und dass sie in dieser Zeit fast neunzig Tage ohne Pause in der ganz bestimmten Bar auf der Piazza saß, neunzig Mal 24 Stunden, das sind …
Ach, egal.
ICH SITZE IN DER KÜCHE des Torre und trinke ein Glas Wein.
Wir sind gerade angekommen, haben die Fenster weit geöffnet, die Koffer ausgepackt, die Betten bezogen, ein paar Kleinigkeiten eingekauft. Ich bin müde, und doch habe ich seltsamerweise nun das Gefühl, gerade langsam wach zu werden. Das ist ein Zustand, den es nur an diesem Küchentisch gibt und nur an diesem ersten Tag, nach der langen Fahrt, die mir oft wie ein Schlaf und ein Traum vorgekommen ist, aus dem ich erst im Dorf langsam erwache, als sei ich daheim ins Bett gegangen und hier aufgestanden.
Ich habe mich gestern in Deutschland zu spät hingelegt, wie immer vor der Abfahrt, habe mich gewälzt, habe geschwitzt, nach dem Wecker getastet, der um zwei Uhr früh klingeln würde. Einmal bin ich aus dem Schlaf hochgeschreckt, weil mein linker Arm komplett taub war. Ich schrie um Hilfe, schlug mit dem Arm aufs Bett, bewegte ihn hektisch, um das Gefühl zurückzuerlangen. Meine Frau beruhigte mich. Schätzungsweise um halb eins fiel ich in tiefen Schlaf.
Ich träumte von einem Mann auf einem altertümlichen Motorrad. Seine langen Haare wehten im Wind. Einen Helm trug er nicht, dafür einen langen Mantel, dessen Gürtel-Enden frei hingen und im Fahrtwind hin und her flogen. Er fuhr vor mir auf einer Landstraße und …
Der Wecker klingelte.
Die großen Ferien hatten begonnen.
Ob wir nicht erst um fünf Uhr fahren könnten, hatte ich abends gefragt, denn zwischen Mitternacht und vier Uhr schliefe ich am allerbesten, und wenn ich dann um vier Uhr aufstünde, sei ich halbwegs ausgeruht. So argumentierte ich, wie ich schon oft argumentiert hatte.
Aber die Antwort meiner Frau hatte wie vor allen großen Ferien in den vergangenen Jahrzehnten gelautet: Welchen Sinn das haben solle? Dann führen wir zwei Stunden später, aber dafür stünden wir am Gardasee oder bei Florenz vier Stunden im Stau. Und was werde man dann von den zwei Stunden mehr Schlaf gehabt haben? Man stehe ausgeruht auf der Autobahn herum. Außerdem kämen wir, wenn wir früh starteten, bereits in der Mittagszeit im Dorf an, der einzigen Zeit, in der man mit dem Auto in die Fußgängerzone hineinfahren darf. Wir könnten das Auto direkt vor dem Haus ausladen. Nicht diese Kofferschlepperei durch den halben Ort.
Das ist wahr. Nur während der Mittagsruhe darf man als Anwohner für zwei oder drei Stunden mit dem Auto in den Ort hineinfahren. Erwischt man bei der Anreise diese kleine Pause im Dorfleben nicht, muss man am Rand des Ortes an einer Straßenecke anhalten, die Koffer ausladen, dann zunächst einmal das Auto parken und daraufhin das Gepäck, das ein Beifahrer derweil zu bewachen hat, zum Haus schleppen: eine Strapaze, denn jeder Weg führt bergauf und das – im Sommer jedenfalls – in brütender Hitze, vielleicht aber auch, im Frühjahr, in strömendem Regen. Und der Torre ist nun mal der Torre. Alles muss über steile Treppen getragen werden. Am Ende ist, was man am Leib hat, schweißgetränkt oder eben regennass.
Ein einziges Mal habe ich vor der Abreise ausgeschlafen. Um zehn Uhr morgens stiegen wir ausgeruht ins Auto. Zum Abendessen wollten wir bei Freunden in der Toskana sein und dort einen Tag verbringen.
Kurz nach Südtirol mussten wir die Geschwindigkeit drosseln, weil der Verkehr immer dichter wurde. Bei Affi standen wir. Von hier aus ging es nur noch ruckelnd voran durch die auf den Autoblechen und dem Straßenasphalt tanzende heiße Sommerluft. Man wäre zu Fuß schneller in der Toskana gewesen als mit dem Auto. Tatsächlich hatte meine Frau das auch versucht und war mit erstarrten Gesichtszügen einige Schritte neben dem Auto hergegangen, während ich zunächst dumpf brütend am Lenkrad saß und dann durch das offene Seitenfenster gefleht hatte, sie möge wieder einsteigen, wir würden auch bestimmt nie wieder erst um zehn Uhr losfahren.
Wir fanden in Mantua ein bescheidenes Hotelzimmer und verzehrten, weil alle Restaurants bis auf den letzten Platz ausgebucht waren, einige frittierte Kartoffelbällchen aus den Aluschalen einer Rosticceria. Unsere Freunde aßen allein ein wenig von dem mit Feigenzweigen gespickten Schweinebraten, den sie vorbereitet hatten.
Beim nächsten Mal starteten wir wieder unausgeschlafen, so wie in der vergangenen Nacht, nach der ich nun hier sitze, vor meinem Glas.
Das Auto habe ich am Abend zuvor beladen. In all diesen vielen Jahren und auf all diesen vielen Reisen an dasselbe Ziel haben wir auf eine zauberische Art die Fähigkeit entwickelt, exakt so viele Gegenstände mitzunehmen wie in unser Auto passen, nicht einen einzigen mehr.
Aber auch keinen weniger.
Am Abend vor der Abfahrt habe ich all dies, so will es die Tradition, in die Tiefgarage unter unserem Haus geschafft: die Koffer und Taschen, Beutel und Kleidersäcke, das neue Tischlein, das meine Frau für unsere Wohnung ausgesucht hat, die Taubenabwehrgitter für die Fensterbänke, die hübschen Kissen für das Sofa im Wohnzimmer, den ausgestopften Papagei, den ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe und der an der Wand zum Treppenhaus hängen soll, den elektrischen Ofen für die kühlen Tage im Herbst, den Gartenschlauch, den Freunde nicht mehr benötigen, die ihr Haus samt Garten verkauft haben, um in eine Wohnung zu ziehen. Auf dem Ripidello, von dem ich später auch noch erzählen werde, wird er seinen Zweck erfüllen.
All diese Dinge habe ich hinter dem in die Garagenmitte gefahrenen Wagen aufgebaut, habe die Kofferraumklappe geöffnet und den Laderaum betrachtet wie ein Elfmeterschütze das Tor mit dem darin lauernden Torhüter. Ich vermaß mit meinen Blicken die Volumina sowohl der Gegenstände als auch des Innenraums, straffte meinen Körper und sortierte meine Fingerspitzen wie ein Pianist vor dem ersten Griff in die Tasten, ließ die Hüften leicht schwingen und platzierte daraufhin alles auf den jeweils richtigen Platz im Wagen Wartende genau dort, wo es eben hingehörte – bis auch der letzte Kubikzentimeter und das allerletzte Luftloch gefüllt waren und ich, der Beladekünstler, die Autoklappe mit leichtem Druck auf die von mir bewusst oben platzierte weiche und nachgiebige Tasche schließen konnte.
Dann parkte ich den Wagen wieder. Und ging schlafen.
Morgens um drei standen wir vor dem Auto. Meine Frau hatte noch eine Tasche mit allem dabei, was man so unterwegs benötigt. Mir war ein Paar Schuhe eingefallen, das ich im Urlaub benötigen würde. Und dann war da die Gitarre …
Der ausgestopfte Papagei musste also in der Stadt bleiben. Ich flüsterte ihm die Frage ins Ohr, ob er eventuell allein den Luftweg nehmen könne.
Allein den Luftweg!, wiederholte er krächzend.
Wir fuhren los.
Ich hatte lange kalt geduscht. Hatte zwei Espressi getrunken. Ich war für einige Stunden tatsächlich hellwach.
Dieser Zustand hielt von München aus bis über den Brenner hinaus an. In der Nähe von Bozen spürte ich ein Nachlassen meiner Kräfte, bei Trento war ich tatsächlich müde, bei Verona verlor ich die Kontrolle über meine Augenlider. Es war immer so. Schon wenn ich zum ersten Mal das Wort Verona auf einem Autobahnschild sehe, bemerke ich an mir stets ein Erschlaffen. Kurz vor Verona selbst musste ich meine Frau bitten, das Lenkrad zu übernehmen.
Ist es ein Wunder, dass die erste kommerziell erfolgreiche Schlaftablette der Geschichte Veronal hieß? Bei mir reicht die Erwähnung von Verona ohne l, um mich schläfrig zu machen, ich komme nie bis zu diesem l, weil ich schon vorher einnicke. Wo andere nachts Schäfchen zählen, wenn sie nicht schlafen können, murmele ich fünfzig Mal Verona vor mich hin wie ein Mantra. Beim einundfünfzigsten Mal schlafe ich.
Ob ich Verona je in wachem Zustand erlebt habe? Ja, einmal haben wir Verona besichtigt, es war schön. An mehr kann ich mich nicht erinnern.
Und früher bin ich manchmal allein mit den Kindern in den Urlaub gefahren, weil meine Frau noch zu arbeiten hatte. Sie kam eine Woche später nach. Da fuhr ich abends um zehn Uhr los, die ganze Nacht durch, um morgens gegen sechs eine der ersten Fähren zu nehmen. Die Kinder schliefen hinten. Es gab noch keine iPads und keine Filme, um sie ruhig zu halten, also unternahm ich eben diese Nachtfahrt.
Es war ein Irrsinn, allein am Steuer die ganze Nacht. Wie konnte ich so verrückt sein!? Warum war ich so irre?! Warum hat man mich nicht bestraft, inhaftiert, warum nicht zur Rechenschaft gezogen für meine Verantwortungslosigkeit?
Ich glaube, selbst auf diesen Reisen bin ich dämmernd an Verona vorbeigefahren, um dann bei Nogarole Rocca oder auch erst bei Mantua panisch emporzuschrecken, nachdem das Auto viele Kilometer lang offenbar auf Autopilot gefahren war und mich nun plötzlich durch seltsame Bewegungen weckte, weil es ohne Kontrolle über die leere Straße schlingerte, der reine Wahnsinn, wie gesagt.
Meine Frau fuhr heute Morgen bis Bologna. Dann übernahm ich wieder.
Was seine Gründe hatte.
Auf der Strecke nach Florenz, kurz bevor es in den Apennin geht, gibt es eine Stelle, an der man sich entscheiden muss, ob man die sogenannte Panoramica nehmen will, die alte Autobahn also mit den Blicken und vielen Kurven, oder die neuere, die Direttissima, die geradewegs durch die Berge und durch viele frisch gebohrte Tunnel führt. Diese beiden Varianten gibt es noch nicht sooo lange, und als sie ganz neu waren, fuhr einmal meine Frau, während ich schlief. Sie sah die nagelneuen Schilder, auf denen Panoramica oder Direttissima angekündigt waren, sah aber die Wörter nicht, sondern erkannte nur die Tatsache, dass man sich hier für links oder rechts entscheiden musste.
Wo soll ich fahren?, rief sie. Wo? Wo?
Direttissima, murmelte ich, halb im Schlaf.
Was?
Direttissima!, wiederholte ich schläfrig, immer noch mit geschlossenen Augen.
Was? Was soll ich machen? Wo?
Ich öffnete die Augen und sah, dass sie direkt auf das die Autobahn teilende Leitplankendreieck zusteuerte. Sie fuhr also geradeaus, nahm quasi die Direttissima auf dieses Dreieck zu, das wie ein scharfer Keil unser Auto in zwei Hälften geteilt hätte, von denen eine auf der Panoramica weitergefahren wäre, die andere auf der Direttissima.
Wo soll ich fahren? Rechts oder links?
Rechts!!!
Und so geschah es. Sie riss das Lenkrad nach rechts. Hinter uns hupte ein Alfa Romeo