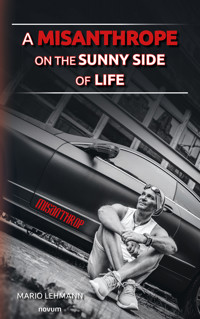15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum pro Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Leben hält so einige Abenteuer parat und leider muss auch Autor Mario Lehmann einsehen, dass man im Nachhinein zumeist schlauer ist. So nimmt er uns mit auf eine Reise durch seine Lebensabschnitte und zeigt auf, wie es ihm ergangen ist und wie ihn das zu dem Menschen, der er heute ist, gemacht hat. Nach der Kindheit und der Ausbildungszeit in der DDR kam er nach der Wende zur Erkenntnis dass das Gras im Westen nur grüner ist, wenn du weißt, wie du die beste Wiese erbeutest. Und als er das gelernt hatte, fingen auch einige Frauen in seinem Leben an, verrückt zu spielen. Nur gut, dass das Leben oft mehr zu bieten hat als qualvolle Zweisamkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2024 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99146-532-4
ISBN e-book: 978-3-99146-533-1
Lektorat: Laura Oberdorfer, Veronika Lukashevich
Umschlagfoto: Jennifer Becker Photography
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Innenabbildungen: Mario Lehmann
www.novumverlag.com
PROLOG: Aus dem Hotel der Erkenntnis
Die Zimmertür fällt hinter mir ins Schloss, abgebremst durch den weichen, dunkelblauen Teppich. Das gibt einen satten Ton, gefolgt von dem Klacken der Tür. Die Welt bleibt draußen. Die Ostseeinsel ist mir nur Kulisse, das Meer vor dem Fenster Hintergrund, damit ich endlich denken kann. Erst vor Kurzem habe ich die Scheidungspapiere unterschrieben, was mir, ehrlich gesagt, nicht sonderlich schwerfiel. Mein Herz hing schon lange nicht mehr an Claudia. Nun habe ich also eine Ex-Frau. Sie will das Wochenende nutzen, um ihren Krempel zusammenzupacken und aus unserer Wohnung auszuziehen. Da muss ich nicht mittendrin stehen, das Chaos brauche ich nicht. Eher Abstand. Von allem. Die letzten Monate haben mich echt mitgenommen. Meiner Tochter kommt meine Abwesenheit ganz gelegen. Sie verbringt die Tage bei einer Freundin.
Ich bin allein mit mir selbst. Isoliert, schalldicht. Fern von allem anderen. Ruckartig ziehe ich den Fernsehstecker aus der Dose, schalte mein Telefon aus und setze mich aufs Bett. Ein fremdes Bett, in dem schon sonst wer gelegen hat. Bequem ist es trotzdem. Ich sehe mich um, konzentriere mich auf die Einzelheiten des Zimmers: Ein gepolsterter Stuhl an einem kleinen Schreibtisch, auf dem kunterbunte Infozettel liegen. Eine Flasche Wasser mit zwei Gläsern. Wofür eigentlich? Ich habe schließlich ein Einzelzimmer gebucht. Ein Sessel mit Leselampe. Daneben ein Kleiderschrank. Als ich hineinsehe, klacken die Bügel aneinander. An einem baumelt eine weiße Tüte für den Wäscheservice. Wie praktisch würde ich länger bleiben. Ich werde meine Klamotten wohl nicht auspacken. Hab schon immer aus dem Koffer gelebt, wenn ich unterwegs war. Das Bad, zweckmäßig. Nur flüchtig schaue ich mir ins Gesicht. Sehe aus wie immer, nur älter, geschaffter. Kein Wunder, die letzte Zeit war echt kein Spaziergang. Nach neun Jahren habe ich mich scheiden lassen. Wahrscheinlich hätten Claudia und ich damals gar nicht heiraten sollen. Das Bett, links ein Kissen, rechts ein Kissen. Auch für zwei gedacht.
Die Luft riecht nach Salz. Das Wasser kann nicht weit entfernt sein. Als ich aus dem Fenster schaue, das Meer suche, höre ich Möwengeschrei. Klingt wie Urlaub.
Da stehe ich nun. Jetzt heißt es warten und die Gedanken fließen lassen. Dafür bin ich schließlich hier. Habe ein Hotelzimmer gebucht für drei Nächte.
Niemand weiß, wo ich bin. Ich will die Abgeschiedenheit für mich nutzen, meine Gedanken spielen lassen, ein bisschen Ordnung schaffen. Ohne irgendwelche Ablenkung. Wer weiß, was alles hochkommt. Sicher nicht nur gute Erinnerungen. Aber wenn ich mich darauf einlasse, werde ich mich hinterher wieder etwas freier fühlen. Und vielleicht sogar glücklich.
Ich setze mich in den Sessel, atme durch. Meine Finger trommeln nacheinander auf die Armlehne. Erst langsam, dann immer schneller. Eins-zwei-drei-vier. Eins-zwei-drei-vier. Es gibt nichts zu tun, rein gar nichts. Keine Musik oder Stimmen, die mich ablenken können. Kein Buch zu lesen. So was wie Panik steigt in mir hoch: Was soll ich drei Tage lang tun, womit mich beschäftigen? Hätte ich doch zu Hause bleiben sollen? Macht das hier überhaupt einen Sinn?
Ich werde mir nachher was zu essen aufs Zimmer bestellen, muss irgendwas konsumieren zur Ablenkung. Einmal alles, bitte.
Ich habe einen Plan, und so kommt Stille über mich. Die Abgeschiedenheit lässt mich die Einsamkeit fühlen. Für mich nicht leicht zu ertragen, auch wenn ich mir das hier selbst ausgesucht habe. Wer bin ich eigentlich, ohne dass mir andere das sagen? Auf wen soll ich mich beziehen? Wem zuwenden? Und von wem abgrenzen, wenn da niemand ist außer mir selbst? Solche Betrachtungen können einen echt in den Wahnsinn treiben. Völlige Stille birgt die Gefahr, dass man Stimmen hört, die gar nicht da sind. Es rauscht in meinem Kopf. Erinnerungsblitze zucken. Meine Gedanken werden immer lauter. Kaum zu überhören.
Irgendwie bin ich immer enttäuscht worden: Meine Mutter hat mich im Stich gelassen, meine Frau hat mich gelangweilt, meine Kollegen wollten mich hintergehen, die Typen vom Klub haben mich rausgeschmissen.
Ich hatte schon viele Messer im Rücken. Und ich habe sie alle wieder rausgezogen.
Vaterlos
Andere haben Väter, die mit ihnen auf Bäume klettern oder Fußball spielen. Die ihnen bei den Hausaufgaben helfen und was zum Geburtstag schenken. Ich nicht. Mein Vater war nicht besonders freundlich, schon gar nicht väterlich. Er trennte sich von meiner Mutter, als ich acht war und meine Schwester Elke fünf. Danach habe ich ihn nie wiedergesehen, nie hat er nach mir gefragt. Auch zu meinen Großeltern, Onkeln und Tanten hatte ich keinen Kontakt mehr. Es gab ohnehin keine persönliche Bindung zwischen uns. Nur bei einer späteren Familienfeier tauchte sein Bruder einmal auf, ohne eingeladen zu sein. Meine Mutter erzählte nie von ihm, als sei er aus ihrem Gedächtnis gefallen, als habe es die Ehe zwischen den beiden nie gegeben. Nur Elke und ich waren ein sichtbares Überbleibsel aus dieser Zeit.
Ich vergaß, wie mein Vater aussah, ob er blond war oder Locken hatte, ob er groß war oder dick. Fotos gibt es keine von ihm. Ich würde ihn heute nicht mal auf der Straße wiedererkennen.
Mein Vater ist ein Arschloch, von dem ich nie etwas erwartet habe. Vielleicht lebt er schon gar nicht mehr. Mir wär’s egal. Er hat absolut keine Rolle in meinem Leben gespielt. Wie es ihm ergangen ist in all den Jahren interessiert mich nicht. Er hat sich schließlich auch nie für mich interessiert.
An meine Kindheit kann ich mich kaum erinnern. Was macht man wohl, wenn man vier ist? Man geht in den Kindergarten. Man sitzt im Sandkasten. Man schiebt Spielautos hin und her. Man ärgert seine kleine Schwester. Und wenn man acht ist und Sohn einer alleinerziehenden Mutter, die alle elterlichen Entscheidungen allein treffen muss?
Meine Mutter arbeitete als Sachbearbeiterin bei der Wasserwirtschaft Leipzig, später dann bei der NDPD, der National-Demokratischen Partei Deutschlands. Sie saß im Büro, ging morgens aus dem Haus und kam abends zum Abendbrot zurück. Alles ging seinen normalen Gang. Das Miteinander war recht harmonisch, alles war sauber und ordentlich, Elke und ich funktionierten. Wir Kinder beschäftigten uns, packten morgens unsere Brotdosen, gingen in Kindergarten, Schule und Hort. Mittwochs war Pioniernachmittag. Meist holte ich meine Schwester vom Kindergarten ab und ging mit ihr nach Hause, wo wir uns selbst was kochten. Zum Geburtstag gab’s eine Torte, und Elke und meine Mutter sangen »Weil heute dein Geburtstag ist«.
Nach der vierten Klasse zogen wir von Leipzig nach Leipzig-Grünau, von der Innenstadt ins Neubaugebiet. Das eröffnete mir neue Möglichkeiten, neue Spielplätze, eine neue Schule. Ich ging nun in die POS »Adolf Hennecke«, benannt nach dem tüchtigen Bergmann und ruhmreichen »Held der Arbeit«, dessen Porträt im Foyer hing und uns Schüler tagtäglich begrüßte. Meine Noten waren nicht herausragend, aber ich kam so durch. Hin und wieder musste meine Mutter zur Klassenlehrerin, weil ich irgendwas ausgefressen hatte. Aber wirkliche Konsequenzen folgten nicht. Nachmittags spielte ich Fußball mit meinen Kumpels, so wie das eben alle Jungs machen. Der Verein gehörte zur BSG Chemie Leipzig, und wir kickten in der Bezirksliga. Eine feste Position hatte ich nicht, sondern wurde immer dort eingesetzt, wo Not am Mann war. Ich war ziemlich wendig und spielte gut.
Manchmal war ich mit einem Schulkumpel in unserem Wohngebiet unterwegs. Er wohnte im selben Aufgang wie wir. Wir quatschten, fuhren mit dem Fahrrad durch die Gegend oder trieben uns auf Baustellen rum. Wir kletterten in Rohbauten, spazierten durch unfertige Küchen und Bäder und knackten die Schlösser von Bauwagen. Hin und wieder nahmen wir eine Kaffeekasse mit, steckten Zigaretten ein oder klauten die Schlüssel der Maschinen und Geräte. Draußen schmissen wir sie in die trüben Pfützen und freuten uns diebisch bei der Vorstellung, dass die Bauarbeiter sie umsonst suchen würden. Mein Kumpel und ich waren ziemlich schräg drauf. Zu Hause hörten wir gemeinsam Musik, alles querbeet. Meist Kassetten, die wir beim Radiohören mitgeschnitten hatten. Vorne fehlte immer was vom Lied und hinten quatschte der Moderator rein.
Ich verbrachte eine ganz normale Kindheit. Wie Hunderttausende von DDR-Kindern.
Der Junge und das Fahrrad
Meine Mutter hatte zu dieser Zeit kein gutes Händchen bei der Auswahl ihrer Partner. Wahrscheinlich trieb sie der Wunsch, nicht allein zu sein. Andere Dinge verlor sie dadurch aus dem Blick. Bald schon lernte sie im Büro der NDPD Manfred kennen. Sie wollte uns nicht alleine lassen, deshalb brachte sie ihn mit zu uns nach Hause. Elke und ich verschwanden dann ins Kinderzimmer, um nicht mit ihm zusammen sein zu müssen. Er saß bei uns auf der Couch und benahm sich wie ein Despot.
Dieser Mensch war nicht besser als mein Vater. Er verbrachte wenig Zeit mit uns Kindern, wir und unsere Belange interessierten ihn nicht sonderlich. Meine Mutter behandelte er ziemlich schlecht, kritisierte sie ständig und wies sie zurecht. Manchmal wurde er handgreiflich.Und sie nahm es hin. Zwar äußerte sie ihre Meinung, vertrat sie aber nicht. Diskussionen ging sie aus dem Weg.
Als ich zwölf war, fuhren wir in den Ferien nach Bad Schmiedeberg. Elke blieb bei unserer Oma. Meine Mutter wollte als Familie Urlaub machen: Vater, Mutter, Sohn. Ein schönes Bild, das jedoch nicht wirklich zu uns passte. Die beiden waren ein Paar, ich machte eher mein eigenes Ding.
Über den FDGB hatte meine Mutter einen kleinen Bungalow zugewiesen bekommen, der etwas außerhalb der Kleinstadt im Wald stand. Rundherum gab es weitere Hütten, in denen Leute von der NDPD Urlaub machten. Mit denen kamen wir allerdings kaum in Kontakt. Viel war in Bad Schmiedeberg nicht los. Wir liefen durch die Dübener Heide, gingen baden, saßen auf der Terrasse. Meine Mutter ließ mir ziemlich freie Hand. Ich langweilte mich und sehnte die Heimreise herbei.
Eines Abends fuhr ich mit dem Fahrrad, das ich mir beim Vermieter geliehen hatte, ins Kino. Ich war spät dran, stellte das Rad hastig vor dem Gebäude ab und vergaß dabei völlig, es irgendwo anzuschließen. Nach dem Film war es weg. Ich lief um das Gebäude herum. Nichts. »Wie blöd«, dachte ich, »lässt sich aber nicht mehr ändern.« Außerdem war es ja nicht mein eigenes Rad. Ich trottete also zu Fuß zurück. Das war ganz schön weit. Langsam wurde es dunkel. Glücklicherweise fand ich den richtigen Weg.
»Kommt der Herr auch schon?«, ranzte Manfred mich an, als ich die Bungalowtür öffnete. Er saß mit einer Flasche Bier auf dem Sofa.
»Ich musste laufen«, gab ich zur Antwort.
»Wieso das denn? Wo ist das Fahrrad?«
»Hat jemand vorm Kino geklaut. Als ich wieder rauskam, war es nicht mehr da.«
»Hast du Idiot das Teil nicht angeschlossen?«
»Nee, hab ich vergessen. Ist doch nicht so schlimm, dass das Klapperding weg ist«, brachte ich hervor.
Manfreds Gesicht wurde immer röter, er sprang auf und flippte total aus. Meine Mutter aber stand apathisch daneben, rührte sich nicht und machte keinen Mucks. Ich hätte verstanden, wenn sie sich Sorgen um mich gemacht hätten, schließlich war ich stundenlang weg gewesen in einer fremden Stadt. Ihm ging es aber nicht um mich, sondern nur um das gestohlene Fahrrad.
Unentwegt schrie er mich an. Ich hoffte die ganze Zeit, meine Mutter würde einschreiten, mich, ihren Sohn, verteidigen, mich beschützen. Aber das tat sie nicht. Ich versuchte mich zu rechtfertigen, kam aber nicht gegen Manfred an. Er steigerte sich in seinen Wutausbruch hinein, rückte mir immer weiter auf die Pelle, bis er direkt vor mir stand. Die Fäuste geballt, war er kurz davor, mir ins Gesicht zu schlagen. Ich stand in die Ecke gedrängt, blieb stumm, blickte ihm aber grimmig entgegen. Die Luft zwischen uns war geladen. Ich würde mich auf keinen Fall von diesem Typen verprügeln lassen, so viel war klar. Und er schien zu spüren, dass ich mich gegen ihn wehren würde. Ein Zwölfjähriger gegen einen Erwachsenen – zwei Köpfe kleiner und fünfzig Kilo leichter. Wir starrten uns an. Und er ließ von mir ab.
Als wir zurück in Leipzig waren, versuchte Manfred weiterhin, der Herr im Hause zu sein. Meine Mutter verlor kein Sterbenswörtchen über seinen Ausraster nach der Fahrradgeschichte. Sie tat so, als sei nichts passiert, statt sich mit mir hinzusetzen und über die Situation zu reden. Sich zu entschuldigen vielleicht. Insgeheim gab sie Manfred durch ihr Schweigen recht.
Das Zusammenleben wurde immer beengender. Ich versuchte, möglichst nicht da zu sein, wenn Manfred zu uns nach Hause kam. Oder ich verzog mich in mein Zimmer und machte mein eigenes Ding. Ich ging oft zum Fußball, inzwischen spielte ich bei der BSG Lokomotive Ost Leipzig. Bis mir ein Gegenspieler gegen das Schienbein trat, sich mein Knie verdrehte und ich mehrere Wochen ausfiel. Die Reha dauerte ewig. Danach hörte ich mit dem Fußballspielen auf, da war ich sechzehn Jahre alt.
In der Schule kam ich gerade so durch. Aber nicht, weil ich blöd war, sondern weil ich keine Lust hatte, mich anzustrengen. Mir reichte es, die Prüfungen zu bestehen, ich musste keine Eins haben. Die neunte Klasse wählte ich ab, ging lieber kicken und baden. Wegen meiner wiederholten Abwesenheit bekam ich einen Tadel, blieb aber nicht sitzen. Auch für die Abschlussprüfungen der zehnten Klasse lernte ich kaum. Zugegeben, ich war faul. Aber ich kam damit durch.
Start ins Leben
Mein Magen knurrt. Bin heute schon lange unterwegs, das Frühstück liegt Stunden zurück. Ich wuchte mich aus dem Sessel hoch, suche die Menükarte, die irgendwo zwischen den Broschüren auf dem Tisch liegen muss. Salat, Würzfleisch, Salamipizza. Ich rufe die Rezeption an, eine Männerstimme nimmt meine Bestellung entgegen.
Schon ewig habe ich nicht mehr an meinen Vater gedacht, eigentlich meine ganze Jugend über nicht. Hatte wohl Besseres zu tun, als jemandem hinterher zu trauern, der es gar nicht verdient hat. Jemandem, der es vorgezogen hat, seine beiden Kinder zurückzulassen und ein neues Leben anzufangen. Als gäbe es Elke und mich gar nicht. Später hat er wohl versucht, Kontakt zu meiner Schwester aufzunehmen. Ob sie sich tatsächlich getroffen haben, interessiert mich nicht.
Sicher, mein Vater hat eine Leerstelle hinterlassen, ein Loch, in das ich vielleicht gefallen wäre, hätte ich über ihn nachgedacht. Ich war enttäuscht, weil er uns verlassen hat. Das war wohl der Grund dafür, dass ich selbst niemandem mehr wirklich vertrauen konnte. Und meine Mutter hat noch reingehauen in die gleiche Kerbe.
Sie war zwar da, aber stand trotzdem nicht zu mir. Als ihr Typ auf mich losging, hätte sie mir beistehen, sich vor mich stellen müssen. Was konnte ich denn dafür, dass mir das Fahrrad geklaut worden war? Stattdessen aber blieb sie stumm, hatte Schiss, den Mund aufzumachen und am Ende ohne Mann dazustehen. Dafür mit einem Sohn, der sich bei seiner Mutter sicher fühlte. Aber es war ihr egal, wie ich mich fühlte.Sie ließ ihren Typen schalten und walten, wie es ihm passte.
In dem Moment, als mich Manfred in die Ecke gedrängt hat, wurde ich auch von meiner Mutter verlassen. Und ich begann, mich emotional von ihr abzunabeln. Fortan zog ich mein eigenes Ding durch. Sie war noch lange mit ihm zusammen, weit über die Wende hinaus. Sie zogen zusammen weg. Ihr Leben mit ihm bestand nur aus Kompromissen, von ihrer Seite natürlich. Was er sagte, galt. Vor ein paar Jahren starb Manfred und meine Mutter zog nach Delitzsch.
Meine Familie war also kein geschützter Ort, an dem ich mich geborgen fühlte. Die Kälte, die stattdessen herrschte, hat mich früh selbstständig werden lassen. Ich lernte damals, dass ich mich nur auf mich selbst verlassen kann. Dass ich ständig auf der Hut sein muss, damit mich niemand verletzt. Am Ende ist die eigene Familiensituation nur ein Zustand der Vergangenheit, der sich nicht verändern lässt. Jeder spielt eine Rolle, bis er geht und alles hinter sich lässt.
Die Verbindung zu meiner Kindheit ist gekappt. Mit zwölf hat sich alles verändert mit einem Schlag. Es kommt mir so vor, als sei der kleine Mario jemand ganz anderes als ich. Einer, der traurig ist. Kritisch. Einsam.
Ich hatte einen schweren Start ins Leben, das ist mir heute klar. Vielleicht habe ich deshalb auch das Lieben erst später gelernt, weil ich erst mal misstraue. Der andere muss mir erst beweisen, dass er mein Vertrauen auch verdient. Die Enttäuschung kommt sowieso. Sicher habe ich oft eine gewisse Nähe zu einem anderen vermisst. Eine Nähe, die meine innere Einsamkeit vertreiben konnte. Kommt meine Geschäftigkeit vielleicht daher, dass ich die emotionale Lücke irgendwie füllen musste? Meine Zeit vertreiben musste, um nicht zu merken, was fehlt?
Es klopft. Die Zimmertür zieht schwer über die plüschige Auslegeware, als ich öffnen will. Ich brauche erstaunlich viel Kraft, um sie zu bewegen. Der junge Mann vom Restaurant reicht mir ein Tablett, auf dem Geschirr aufgereiht ist. Suppe, Nudeln, Vanillepudding. Die Kosten lasse ich aufs Zimmer schreiben. Inzwischen habe ich echt Hunger.
Die Tür klappt zu und knallt unterwegs gegen mein Knie. Nicht die erste Tür, die sich rächt.
Der Neid der Nelke
Mit dem Gesellenbrief als Isoliertechniker in der Tasche trat ich 1988in den Leipziger Szeneklub Nelke ein. Der befand sich in einem Flachbau mitten in meinem Wohngebiet. Schon vorher war ich oft dort gewesen. Axel, einer der Chefs, hatte mich angesprochen, ob ich nicht beim Klubrat mitmachen wolle. Klar wollte ich! So wuchs ich in die Leipziger Szene hinein.
Axel und Kai waren von der FDJ als vollberufliche Leiter des Klubs eingesetzt worden, um Jugendarbeit zu leisten, und dementsprechend dem System verpflichtet. Sie erstellten Programme und reichten sie bei der FDJ-Kreisleitung ein, damit sie sie abnickten. Bei manchen Veranstaltungen standen Gutachter rum und hatten ein Auge auf die Jugendlichen und die Musik. Da gab es die offizielle 60/40-Regelung, was die gespielte Ost- und Westmusik betraf, woran sich allerdings so gut wie keiner hielt. Kai als DJ legte auf, was er bekommen konnte. Seltener echte Platten, weil es schwer war, an die ranzukommen, eher Kassetten, selbst mitgeschnitten bei DT64, dem Radiosender, den wir alle hörten.
Für mich ging es vor allem um gute Musik, als ich bei der Nelke einstieg. Nicht einfach so runtergedudelt, sondern von Profis aufgelegt und abgemischt. Außerdem machte ich das eine oder andere Geschäft, baute zum Beispiel Alukoffer für die Tontechnik oder installierte Waschbecken und Klos. Das Material dazu kam aus dem VEB, bei dem ich tagsüber arbeitete.
Die DJs hatten einiges an Technik zu verstauen und zu transportieren, aber richtige Vorrichtungen dafür gab es nicht. So tüftelte ich über die passende Verkleidung eines Autoanhängers, baute verschiedene, abschließbare Transportboxen für Lichtanlage, Rekorder und all das teure Zeug. So was gab es nicht auf dem Markt und die DJs rissen es mir förmlich aus den Händen. Ich machte mir einen Namen in der Szene, weil ich auch Sonderwünsche umsetzte, und verdiente mir eine goldene Nase mit den Anfertigungen. Materialkosten hatte ich so gut wie keine.
Hauptsächlich stand ich freitags und samstags an der Tür neben meiner Arbeit im Betrieb. Die Position brachte mir viel Macht und Einfluss, auch wenn ich neben Ralf zu den Jüngsten gehörte. Unsere Gruppe bestand aus zehn Mann, die für Ordnung und Sicherheit sorgen sollten, ganz normale Jungs, die unter der Woche wie ich ihrer regulären Arbeit nachgingen. Mit dem Einlass wechselten wir uns ab. Stand ich an der Tür, war der Klub voll. Ich hatte irgendwie ein Händchen dafür, die richtigen Leute reinzulassen.
Ich achtete auf ein ausgewogenes Männer- und Frauenverhältnis, hauptsächlich aber kam es mir darauf an, dass es im Laden lustig zuging. Durch die DJs frequentierte uns ein tanzbegeistertes Publikum, Schüler aus der POS, junge Leute aus den Betrieben und den Wohnheimen, Mädels aus der Ballettschule, alle höchstens dreißig. Manche kamen extra aus Berlin oder Potsdam angereist, um bei uns zu feiern, und alle mussten an mir vorbei. Ich knüpfte ziemlich viele Kontakte, kannte die Leute.
Die Ballettmädels ließ ich besonders gern rein, sie sahen gut aus und konnten sich bewegen. Die Berlinerinnen brachten mir Platten aus der Hauptstadt mit, die es bei uns nicht gab. Ich kaufte sie ihnen für hundert Mark ab und verhökerte sie für vierhundert an Kai. Die erste LP von Heaven17 in Leipzig ging so durch meine Hände.
An der Tür machte ich klare Ansagen, war dabei aber nie beleidigend oder böse. Normalerweise lief es vor und in der Nelke recht friedlich ab. Die Leute machten kein Theater, schließlich wollten sie rein in den Klub und abfeiern. Entscheidend war für mich, dass das Bild stimmte: Wer gut aussah und die richtigen Klamotten anhatte, kam rein. Und die Leute mussten tanzen. Wer nur rumstand und trank, quatschte die Mädels blöd an und machte über kurz oder lang Ärger.
Zu dieser Zeit war Gewalt nichts Ungewöhnliches, sie war Teil des Alltags in der Leipziger Szene. Immer wieder hörte man von Schlägereien, wenn sich ein Streit hochgeschaukelt hatte oder rivalisierende Gruppen aneinandergeraten waren. Ich ahnte, dass es mir auch irgendwann passieren würde, und ich nahm mir vor, im Ernstfall schneller zu sein als mein Gegner. Mir aus Höflichkeit eine zu fangen, kam für mich gar nicht infrage. Ob ich dabei im Recht oder im Unrecht war, war mir, ehrlich gesagt, scheißegal.
An einem Samstagwar es im Laden mal wieder rammelvoll. Es passte definitiv keiner mehr rein. Und trotzdem versuchten drei Jungs, mich an der Tür vollzuquatschen.
»Tut mir leid, Jungs, ist nichts Persönliches«, stellte ich mich ihnen entgegen, »aber ihr passt echt nicht mehr rein.«
«Wir warten auf dich, bis du hier fertig bist«, spielte sich einer auf, bevor die drei den Platz räumten. Solche Drohungen hörte ich ständig und gab nichts darauf. Der Abend lief weiter, ohne dass ich mir über die Sache Gedanken machte.